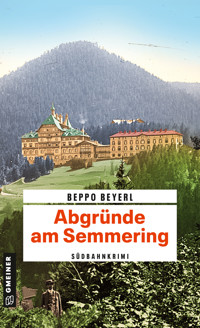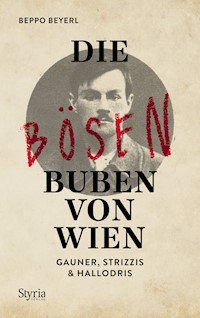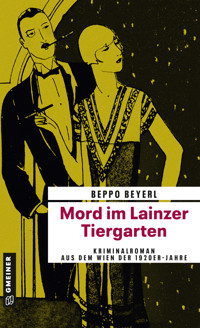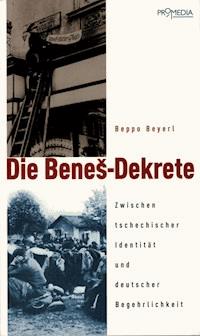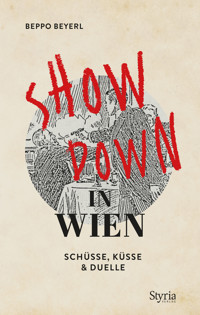
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wiener »Wickl« – also Streitereien, Raufereien – und Duelle, Attentate und Liebeleien: Treffen sich zwei im alten Wien, dann geht häufig etwas schief. Das Wiener Urgestein Beppo Beyerl hat wieder in die Geschichtsbücher geschaut: Er erzählt pointiert und abwechslungsreich von überraschenden, unheilvollen Begegnungen in der Donaumetropole, von charmanten Gaunern und windigen Hallodris, dem hohen Adel und motivierten Attentätern, eifrigen Liebhabern und all den Wiener Strizzis und Mädls, die zur rechten Zeit am rechten – oder auch am falschen – Ort waren. Bleibt nur noch die Frage: Wie geht das alles aus?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BEPPO BEYERL
SHOW DOWN
IN
WIEN
SCHÜSSE, KÜSSE & DUELLE
INHALT
KEIN WICKL FÄLLT VOM HIMMEL
STAPS WILL KEINE GNADE
Napoleon Bonaparte verhört Friedrich Staps am 12. Oktober 1809
REINE LIEBE UND EWIGE TREUE
Ferdinand Raimund feiert mit Toni Wagner am 10. September 1821 private Hochzeit
SAUFEN SCHÜTZT VOR VIREN NICHT
Die Cholera tötet Ferdinand Sauter am 30. Oktober 1854
DUELL IN DER MILITÄRREITSCHULE
Prinz Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha schlägt sich mit Geza Graf von Mattachich-Keglevich am 18. Februar 1898
ZUM LETZTEN GEBURTSTAG GEHT’S AUF DEN ZENTRAL-FRIEDHOF
Oskar Marmorek begeht am 6. April 1909 Suizid am Grab von Vater Josef Marmorek
D’WELT STEHT AUF KEIN FALL MEHR LANG
Der Halleysche Komet schockt die Wienerstadt am 19. Mai 1910
DER VOLKSTRIBUN MUSS STERBEN
Paul Kunschak erschießt Franz Schuhmeier am 11. Februar 1913
EINE WAFFE FÜR DEN HOCHVERRÄTER
Major Maximilian Ronge legt Oberst Alfred Redl am 24. Mai 1913 die Pistole auf den Tisch
SECHS KUGELN FÜR PRINZ LEO
Kamilla Rybiczka rechnet am 17. Oktober 1915 mit ihrem Liebhaber Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha ab
ATTENTAT IM MEISSL & SCHADN
Dr. Friedrich Adler ermordet den Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh am 21. Oktober 1916
„EINEN JUDEN ERSCHRECKEN!“
Josef Kreil wirft am 12. Juni 1933 eine Bombe in den Juwelierladen von Norbert Futterweit
DER PAPIERENE ÜBERDRIBBELT SICH SELBST
Matthias Sindelar geht mit Camilla Castagnola am 23. Jänner 1939 aufs Zimmer
DIE WATSCHEN DER KLEINEN LADY
Käthe Dorsch ohrfeigt Hans Weigel am 13. April 1956
SERVAS, WANDA! ES WÄR HALT WIEDER SO WEIT
Polizist Karl Zuwach verhaftet die „Wilde Wanda“ Kuchwalek
AUSGEWÄHLTE LITERATUR
BILDNACHWEIS
DER AUTOR
Impressum
KEIN WICKLFÄLLT VOM HIMMEL
Wenn sich zwei Menschen treffen, so passiert das allgemein in angenehmer Grundstimmung. Die Begegnung ist meist ein Geschehen des Friedens und der Verständigung, getragen von Neugier, aber auch von Respekt. Wer würde nicht die anregende Gesellschaft, das Gespräch mit einem sympathischen Gegenüber schätzen? Und wer möchte schon lange alleine bleiben? Immer allein sein Glaserl und sein Schnapserl trinken?
Ein vielleicht ursprünglich gut gemeintes Treffen kann aber auch fürchterlich schiefgehen. Es kann innerhalb kürzester Zeit umschlagen und zu einem regelrechten Showdown führen, zu einem ausgemachten „Wickl“, wie die Wiener sagen, der sich gehörig gewaschen hat. Oder man kommt ohnehin mit fixem Mordgedanken zum Rendezvous, mit geladener Pistole oder wie Damon den Dolch im Gewande.
Von solchen Wickln in der Wiener Geschichte möchte ich erzählen. Von Begegnungen, die kein gutes, sondern ein blutiges Ende nahmen, in denen die Waffe locker saß. Von Mord und Totschlag. Von ungeheuerlichen Untaten. Oder zumindest von Ohrfeigen, die nicht nur die Wange erschütterten. Mir geht es dabei nicht um böse und verdammungswürdige Täter, die ihre armen unschuldigen Opfer mehr oder weniger zufällig treffen – und dennoch nicht vor der Tat zurückschrecken. Meine Helden und Heldinnen sind ein anderes Kaliber: Sie sind zum einen Attentäter. Menschen, die über eine gefestigte, wenn auch mitunter äußerst fragwürdige Weltanschauung verfügen, die gekoppelt ist mit einer messianischen Grundhaltung: Durch das schlimme Attentat, so ihre Überzeugung, werde alles besser werden.
Es sind aber auch andere Motive, die Menschen zum Griff nach der Waffe treiben, ja, zwingen. Da geht es etwa um Ehre und Selbstachtung, die klassische Konstellation für eine brenzlige Begegnung, die wir Duell nennen – beide Teilnehmer des Treffens beabsichtigen, den jeweils anderen durch eine Gewalttat in die Hölle zu schicken. Dieser Wunsch nach dem finalen Schuss, dem finalen Stich, der Erlösung bringen soll, kann sich letztlich auch gegen den Menschen selbst richten – das Drama des Suizids, die Selbsttötung, spielte in unserer Wienerstadt leider schon immer eine gewichtige Rolle.
Und ganz blöd wird die Geschichte auch, wenn die beiden Protagonisten einander ohne böse Absicht treffen, in Liebe oder Freundschaft verbunden sind, aber über ihren Köpfen oder in ihren Seelen schon das Verhängnis schwebt, das dann wie ein Automatismus über sie niederbricht. Und nachher will keiner schuld gewesen sein.
Nicht immer sind es reale Personen, die Schicksal spielen. Wir können auch mit so etwas Heimtückisch-Unsichtbarem wie Viren – denken wir nur an die jüngste Vergangenheit – oder mit so etwas Fernem und doch bedrohlich Scheinendem wie herumfliegenden Kometen eine wenig segensreiche, verhängnisvolle Bekanntschaft machen. Und dann schlägt’s ein. Oder auch nicht. Der oft filmreife Showdown bildet dabei die Essenz der jeweiligen Geschichte. Ich möchte selbstverständlich auch die jeweilige Vorgeschichte und – sofern es eine gibt – kurz auch die Nachgeschichte erzählen. Weil kein Wickl und kein Showdown fallen einfach so vom Himmel. Und jemanden so richtig am Wickl zu haben, kann eine ganz schön verflixte Geschichte sein.
Ich schreibe ausschließlich über Geschehnisse nach 1800, die ich chronologisch ordne. Also beginne ich mit dem versuchten Attentat auf Napoleon, den Kaiser der Franzosen, am 12. Oktober 1809 vor dem Schloss Schönbrunn. Was mit dem Attentäter dann passierte, nun, das können Sie gleich am Anfang des Buches lesen.
Auf viele Leserinnen und Leser und wenige Nachahmerinnen und Nachahmer hofft
Beppo Beyerl
Wien, im Sommer 2024
STAPS WILL KEINE GNADE
NAPOLEON BONAPARTE VERHÖRT FRIEDRICH STAPS AM 12. OKTOBER 1809
Der 12. Oktober 1809 war in Wien, so schien es, ein ganz normaler Tag, alles ging offenbar seinen gewohnten Gang. Laut Anhang zur Wiener Zeitung waren in Währing Nr. 54 verschiedene Quartiere, mit oder ohne Parkettböden, halbjährig zu vermieten, wer eine Wohnung mit Pferdestall sammt Schupfen, Heu- und Haberboden suchte, konnte eine solche in der Alleegasse 59 (heute: Argentinierstraße) auf der Wieden finden. Das Stift Klosterneuburg musste aus Platzmangel eine Vielzahl von Akten vernichten, sofern sie von den betreffenden Partheyen nicht behoben wurden. Und ich lese, dass das Schottenstift am Donnerstag, dem 19. Oktober, um 3 Uhr Nachmittag beim „Weißen Schwan“ in der Zieglergasse einige Hundert Eimer Gebirgswein der Jahrgänge 1802, 1806 und 1807 den Meistbietenden licitando verkaufen wollte. Was damals als „Gebirgswein“ galt, stand nicht in der Wiener Zeitung, die Weine, so das geschäftstüchtige Schottenstift, würden jedoch keiner weiteren Anempfehlung bedürfen.
Und doch hat sich an besagtem 12. Oktober 1809 in Wien etwas Sensationelles ereignet – darüber durfte jedoch nicht berichtet werden, weil top secret. Auf Napoleon, den umjubelten Kaiser der Franzosen, wurde vor dem Schloss Schönbrunn ein Attentat verübt. Und der Kaiser der Franzosen hat daraufhin den Attentäter selbst verhört. Wie gesagt, das alles drang nicht an die Öffentlichkeit.
Bei der Schilderung von Attentaten soll man nicht hetzen, sonst entsteht ein Pallawatsch. Also fange ich mit dem Vormittag des 12. Oktober an. Napoleon ließ vor dem Schloss Schönbrunn, seinem standesgemäßen Quartier in Wien, eine Siegesparade abhalten. Dies war nichts Außergewöhnliches, der Emporkömmling Napoleon liebte es, vor dem Schloss der Habsburgerkaiser mit Paraden seiner Truppen zu imponieren und Macht und Stärke zu demonstrieren. Anlass für den Aufmarsch am 12. Oktober war die Schlacht bei Wagram (5. und 6. Juli 1809) – der mit hohen Verlusten bezahlte Sieg der Grande Armée über die Österreicher unter Erzherzog Carl hatte letztlich für klare Verhältnisse gesorgt und zum Waffenstillstand geführt.
Am Tag des Spektakels eilten viele Wiener nach Schönbrunn hinaus, um sich den Anblick der paradierenden französischen Truppen zu gönnen. Sieg oder Niederlage, das spielte offenbar keine Rolle mehr. Gegen Mittag dann endlich der Höhepunkt: Der Empereur, gefolgt von seinen Marschällen, stieg die Freitreppe des Schlosses hinunter und näherte sich sodann dem rechten Flügel der Infanterie.
Ein junger Mann, offenbar mit einem Brief in der Hand, will die gaffende Menge durchbrechen.
Fotos vom folgenden Zwischenfall gibt es nicht, auch auf YouTube findet sich keine diesbezügliche Doku, also hilft nur eine schriftliche Darstellung: Ein junger Mann, offenbar mit einem Brief in der Hand, will die gaffende Menge durchbrechen. Ein französischer Offizier hält ihn auf, diesem erklärt der Jüngling, er wolle dem Kaiser der Franzosen eine Bittschrift überreichen. Der misstrauische Offizier hält den vermeintlichen Bittsteller am Mantel zurück und lässt nach dem Aide-de-camp des Kaisers rufen, es ist dies General Jean Rapp. In der Zwischenzeit öffnen herbeigeeilte Offiziere den Brief – und erblicken ein bedrohlich großes Küchenmesser. Der Jüngling gibt dazu keine Erklärungen ab, wahrscheinlich stellen sich Sprachprobleme ein, da der Jüngling nicht Französisch spricht. General Rapp lässt ihn sofort verhaften und in die Kanzlei von General Anne Jean Marie René Savary bringen, der für die Sicherheit Napoleons zuständig ist. Dort verhört ihn der zweisprachig aufgewachsene Adjutant des Kaisers.
Französische Offiziere hindern Friedrich Staps daran, zu Napoleon vorzudringen. Zeichnung von unbekannter Hand, 19. Jahrhundert.Jean Rapp, geboren 1771 in Colmar im Elsass, hatte nach seinem Eintritt in die Grande Armée dank persönlicher Tapferkeit und Gewandtheit sowie seiner Mehrsprachigkeit eine steile Karriere hingelegt. Bereits 1805 – mit 34 Jahren! In Wien wurde man in diesem Alter höchstens kaiserlicher Klinkenputzer! – wurde er zum General befördert; schon seit 1800 war er Bonapartes Adjutant (Aide-de-camp). 1809 erhob ihn der Korse in den Grafenstand. Jean Comte de Rapp starb übrigens 1821, also mit 50 Jahren, in Rheinweiler eines „friedlichen Todes“: an Magenkrebs.
Und diesem General Rapp sagte der junge Mann, dass er beabsichtige, den Kaiser der Franzosen zu ermorden, zu töten, zu erdolchen. General Rapp erstattete seinem kaiserlichen Chef sofort Bericht, ob er die Lage wirklich als gefährlich einschätzte, wissen wir nicht. Napoleon war ziemlich konsterniert, er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein dahergelaufener, nichtsnutziger Bursch ihn, den sieggewohnten und unbesiegbaren Kaiser der Franzosen, umbringen wollte. In einem Brief, den er am Abend an seinen in Paris weilenden Polizeiminister Joseph Fouché schrieb, gab er dieser Überraschung Ausdruck: „Ein junger Mann von 17 Jahren, Sohn eines protestantischen Pastors, hat versucht, sich bei der heutigen Parade mir zu nähern. Er wurde von Offizieren arretiert, und als man Bestürzung bei diesem klein gebauten Mann bemerkt hat, hat dies Verdacht geweckt. Man hat ihn durchsucht und einen Dolch gefunden. Ich ließ den Nichtsnutz kommen, und er schien mir ziemlich ungebildet.“
Tatsächlich verhörte Napoleon „seinen“ Attentäter noch am selben Tag. Der Kaiser, wohl irritiert von der Entschlossenheit des seltsamen Jünglings, wollte sich selbst ein Bild von den Motiven machen, die ihn antrieben.
Jetzt ist es auch an der Zeit, den Namen des verhinderten Attentäters zu nennen: Der junge Mann hieß Friedrich Staps (auch Stapß oder Stapss), war 17 Jahre alt und kam aus Naumburg in Sachsen – das Königreich Sachsen war zu diesem Zeitpunkt mit Napoleon offiziell verbündet, sächsische Truppen hatten auf französischer Seite bei Wagram gekämpft. General Rapp fungierte bei dem Verhör, das im Kabinett des Kaisers stattfand, als Dolmetscher.
Hier möchte ich noch anfügen, dass der Kaiser, als er noch kein Kaiser war, sondern während der Französischen Revolution Karriere in der Armee machte und zum General und später zum Ersten Konsul aufstieg, bei manchen Gegnern der absoluten Regime in Europa als Hoffnungsträger galt. Als Beispiel möchte ich auf Ludwig van Beethoven verweisen, der ursprünglich Napoleon seine 3. Symphonie, also die „Eroica“, gewidmet hat. Etwa ab 1805 erkannten aber die republikanischen Gegner der absoluten Regime, dass dieser korsische Emporkömmling die alten Monarchien nicht bekämpfen, sondern bloß imitieren wollte. Wichtig wurde für ihn die Kaiserkrone, die er sich selbst aufsetzte, um mit diesem Statussymbol im Kreis der europäischen Dynastien gewaltig auftrumpfen zu können. Immerhin konnte er stolz auf die fortschrittlichste Gesetzgebung in Europa verweisen, den Code civil, der sich aus den Ideen und Proklamationen der Aufklärung ableitete. Gleichzeitig aber verfügte Napoleon – und das ist die andere Seite der Medaille – die weitere Anwendung des monströsen Code Noir, der die Sklaverei in den französischen Kolonien rechtfertigte und regelte.
Der Kaiser, wohl irritiert von der Entschlossenheit des seltsamen Jünglings, wollte sich selbst ein Bild von den Motiven machen, die ihn antrieben.
Zurück zum Verhör. Die wichtigste Quelle dafür ist das 1829/30 auch in deutscher Sprache erschienene zehnbändige Werk Memoiren des Staatsministers von Bourrienne über Napoleon, das Directorium, das Consulat, das Kaiserreich und die Restauration von Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769–1834), dem ehemaligen Privatsekretär des Korsen. Monsieur Bourrienne, der einst zusammen mit Napoleon die Kadettenschule in Brienne-le-Château besucht hatte, bezog seine Informationen direkt von Jean Rapp; Staps nennt er den „Fanatiker von Schönbrunn“. Im Großen und Ganzen lässt sich so die Abfolge von Fragen und Antworten recht gut zusammenfassen.
Der Korse – ganz Souverän und auf einem Stuhl sitzend – dürfte äußerst neugierig gewesen sein, vielleicht auch überrascht und leicht verunsichert: Wieso kam ein dahergelaufener Jüngling auf die verrückte Idee, ihn, den Kaiser der Franzosen und in absehbarer Zeit den Beherrscher von ganz Europa, mir nix dir nix umzubringen?
Ihm gegenüber stand Friedrich Staps, trotzig, wütend, unbeherrscht, wahrscheinlich hätte er am liebsten sein Gegenüber angespuckt. Aus Sicherheitsgründen hatte man dem jungen Mann die Hände am Rücken zusammengebunden; zum Augenzeugen wurde neben Dolmetscher Jean Rapp auch Außenminister Jean-Baptiste Nompère Champagny, der aus der Stadt eingetroffen war, um mit Napoleon die Friedensbestimmungen für die Österreicher zu besprechen.
Napoleon begann das Gespräch mit der Frage: Woher sind Sie? – Antwort: Aus Naumburg. Frage: Was er mit diesem Messer machen wollte? Antwort: Ihn töten. Frage: Wer hat Sie zu diesem Verbrechen angestiftet? Ob er krank oder wahnsinnig sei? – Antwort: Niemand. Es ist meine Überzeugung, dass ich, indem ich Sie töte, meinem Vaterland und Europa einen großen Dienst erweisen würde.
Napoleons erste Vermutung war, dass er es mit einem Verrückten, einem Narren, zu tun habe, so ließ er nach seinem Leibarzt Jean-Nicolas Corvisart rufen. Dieser fühlte den Puls des verhinderten Attentäters, konnte jedoch keine körperliche Beeinträchtigung und in der Eile auch keine psychische Erkrankung feststellen. Seine wenig überraschende Schnelldiagnose: „Der Herr befindet sich wohl.“ So ein Pech.
Fortsetzung des Verhörs. Nun überraschte Napoleon mit einer Geste, die man als Zeichen eines lässigen Grandseigneurs, aber auch als Zeichen eines absoluten Imperators deuten kann: „Ich will Ihnen das Leben schenken, wenn Sie Reue empfinden und Verzeihung erbitten.“
Der Kaiser sitzt, der verhinderte Attentäter steht, wo ist der Dolmetscher? Holzstich, 19. Jahrhundert.Auf dieses Angebot ging Friedrich Staps nicht ein. Er bekundete nur, dass es ihm leid täte, dass sein Vorhaben misslungen war. Napoleon: „Wenn ich Sie begnadige, würden Sie mir dankbar sein?“ – So manches deutet darauf hin, dass der Kaiser Wege suchte, das Unvermeidliche zu verhindern, dass er auf gut Wienerisch seinem Attentäter eine „Rutsche“ legen wollte, um ein Todesurteil zu vermeiden.
Sein Vorhaben misslang. Denn der 17-Jährige wiederholte nur hartnäckig, dass er den Kaiser der Franzosen töten würde und dass er tatsächlich nichts anderes im Sinn hätte. Napoleons Geduld war damit erschöpft, er verließ das Kabinett, wahrscheinlich war er ein bisschen enttäuscht, da er immer noch nicht genau wusste, warum dieser seltsame Jüngling so erpicht darauf war, ihn umzubringen. Und Staps musste sich damit abfinden, dass er die Tat, mit der er unsterblich werden wollte, nicht geschafft hatte und nun der Tod auf ihn wartete.
Das Verhör hatte etwas mehr als eine halbe Stunde gedauert, jetzt nahm das Unvermeidliche seinen Lauf. Ein Kriegsgericht verurteilte den jungen Sachsen zum Tode. Allerdings durfte im Urteil das Wort „Mord“ oder „Mordversuch“ nicht vorkommen, Napoleon, dem siegreichen Feldherrn vieler Schlachten, grauste gehörig vor dem Wort assassinat. So wurde Friedrich Staps wegen Spionage verurteilt. Zudem erteilte Napoleon den Befehl, das Attentat in keinem Dokument zu erwähnen, darüber nicht zu berichten, es in einen Mantel des Schweigens zu hüllen. Hatte er doch Angst vor Wiederholungstätern? Und sollte gegen seinen Befehl dennoch ein Gerücht über das versuchte Attentat durchsickern, so müsse der Jüngling als völlig verrückt bezeichnet werden. Im Geheimen ermittelten die Franzosen jedoch weiter: Charles Schulmeister, der Commissaire de la Police militaire im besetzten Wien, erhielt von Savary den Auftrag, weiter Nachforschungen über Staps anzustellen – angeblich fand Schulmeister heraus, dass eine Spur des Attentäters ins Hauptquartier von Kaiser Franz im ungarischen Totis (heute Tata) führte. Hatte Friedrich Staps doch nicht die ganze Wahrheit erzählt? Gab es Mitwisser, die sich nun wohlweislich in Schweigen hüllten?
Barbara Wolflingseder berichtet in ihrem Buch Dunkle Geschichten aus dem Alten Wien über die folgenden Verhöre, die von Brigadegeneral Jean-Baptiste Lauer durchgeführt wurden. Lauer wies stets auf die Errungenschaften des korsischen Schlachtenlenkers hin: Er habe den französischen Bürgerkrieg beendet, er habe allen Religionen die Freiheit des Kultes gewährt, er wolle in der Unruhe in Europa die Ordnung sichern, und nur der König von Preußen und der Kaiser Franz seien für die Kriege verantwortlich. Worauf der politisch nicht ganz sattelfeste Jüngling seine Verwirrungen und Verirrungen höchstwahrscheinlich mit Tränen in den Augen gestand. Aber alles zu spät: Das Todesurteil war bereits fixiert und konnte nicht mehr revidiert werden.
Gab es Mitwisser, die sich nun wohlweislich in Schweigen hüllten?
Am 16. Oktober 1809 – also vier Tage nach dem Vorfall, Napoleon hatte Wien bereits verlassen – wurde das Urteil vollstreckt. Um sieben Uhr führten Gendarmen Friedrich Staps zur Hinrichtung. Sie fand jedoch nicht in den Anlagen des Schlosses Schönbrunn statt, sondern auf der anderen Seite des Wienflusses, im großen Garten des Arnsteinschen Gartenpalais in Fünfhaus. Möglicherweise war Friedrich Staps in den letzten Tagen bereits in der dortigen Obstkammer arretiert. Gründe für die Wahl dieses Ortes sind nicht bekannt. Später – ab 1860 – wurde anstelle des Sommersitzes der Bankiersfamilie Arnstein der kolossale Vergnügungspalast „Schwenders Colosseum“ errichtet. Der heutige Henriettenplatz ist ein letzter Rest des Schlossgartens, in dem Friedrich Staps zu Tode gebracht wurde. Er musste vor einer ausgehobenen Grube niederknien, Soldaten eines württembergischen Infanterieregiments bildeten das Erschießungskommando. Erst die zweite Salve sollte den Jüngling tödlich treffen. Wie General Jean Rapp in seinen Memoiren berichtet, soll er noch gerufen haben: „Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tod seinem Tyrannen!“ Dann verscharrte man den Leichnam in der Grube. Der Leichnam wurde allerdings bei späteren Nachforschungen und Erkundigungen nie gefunden – sofern solche überhaupt ernsthaft unternommen wurden. Friedrich Staps galt offiziell als „verschollen“.
»Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tod seinem Tyrannen!«
Die Bestrebungen seines Vaters, des Pastors Friedrich Gottlob Staps, etwas über das Schicksal seines Sohnes zu erfahren, blieben erfolglos, nicht zuletzt im Hinblick auf neu zu regelnde Erbangelegenheiten suchte der Pastor vergeblich nach Klarheit. Die Behörden konnten keinen Totenschein vorlegen, da in Wien offiziell niemand von der Erschießung seines Sohnes oder von der Auffindung von dessen Leiche Bescheid wusste. Erst im Jahre 1831, 22 Jahre nach der Hinrichtung, gelang es dem Oberlandesgericht in Naumburg, dem Vater einen Bescheid betreffend den Tod des Sohnes zu übermitteln.
Zur Geschichte der beiden ungleichen Kontrahenten. Die Absichten und imperialen Pläne Napoleons will ich als bekannt vorausschicken. Am 12. Mai ließ er Wien beschießen, am 13. Mai erfolgte die kampflose Kapitulation der Donaumetropole. Ab dem 23. Mai residierte der Kaiser der Franzosen im Schloss Schönbrunn. Nach der Unterzeichnung des „Friedens von Schönbrunn“ am 14. Oktober verließ er tags darauf die österreichische Kaiserstadt in Richtung Paris. Einige der im Schloss befindlichen wertvollen Kunstgegenstände nahm er insgeheim in seinem Reisegepäck mit. Und angeblich befahl Napoleon auch, das riesige Küchenmesser des Friedrich Staps einzupacken und nach Paris zu transferieren. Ein Detail, das vermuten lässt, dass der Jüngling doch Eindruck auf ihn gemacht hatte. Das bestätigt auch Bourrienne in seinen Memoiren: „Der unglückliche Staps kommt nicht aus meinem Geiste“, soll der Korse zu Jean Rapp noch Tage später geäußert haben. Und überreichte seinem Aide-de-camp zum Andenken das Messer des jungen Sachsen, es war, wie Bourrienne schreibt, „nichts weiter als ein großes, sehr gewöhnliches Küchenmesser“. Rostet das Messer vielleicht noch in irgendeinem Archiv vor sich hin?
Und wer war dieser Friedrich Staps? Er wurde am 14. März 1792 in Naumburg geboren; Naumburg hat heute knapp unter 40.000 Einwohner und liegt zwischen Jena und Leipzig in Sachsen-Anhalt. Der junge Friedrich wurde durch sein kirchliches Umfeld geprägt – sein Vater war Pfarrer in der St.-Othmar-Gemeinde, auch seine Mutter stammte aus einer Pfarrersfamilie. In seiner Jugend galt er als schüchtern, fromm und träumerisch. Stets trug er das Bild einer jungen Frau bei sich, die er als seine Geliebte bezeichnete. Nach der Schlacht bei Jena am 14. Oktober 1806 wurde in der St.-Othmar-Kirche ein Lazarett eingerichtet. Belastete der Anblick der Sterbenden und Verwundeten den frommen Jüngling?
1806 übersiedelte Friedrich Staps nach Erfurt, wo er bei der Firma Rothstein, Lentin & Co. eine kaufmännische Lehre antrat. Doch nun sollte sich seine Einstellung wandeln. Vage Andeutungen finden wir in seinen Briefen an die Eltern. In seiner religiös-träumerischen Art glaubte er, dass Gott ihn dazu erkoren hätte, den verhassten Tyrannen zu töten. Danach würde er als eine Art Racheengel von einer Seligkeit, von einer ewigen Herrlichkeit erfüllt. In seiner Fantasie entwickelte er sich zum Freiheitskämpfer, der Tausenden das Leben retten will, um nachher selbst zu sterben. Und stets ging es ihm um einen damals noch gar nicht real existierenden Staat – um Deutschland. Von etwaigen Beschäftigungen des Jünglings mit den damaligen politischen Verhältnissen oder den vorherrschenden geistigen Strömungen ist nichts bekannt.
In seiner religiös-träumerischen Art glaubte er, dass Gott ihn dazu erkoren hätte, den verhassten Tyrannen zu töten.
Im September 1809 brach er in Erfurt auf, versehen mit wenigen Barmitteln und einem gefälschten Reisepass. Irgendwie schaffte er es bis nach Regensburg in Bayern und dann bis in die Donaumetropole. Dort mietete er am 7. Oktober 1809 ein Zimmer. Amtliche Bezeichnung der Adresse der Unterkunft – kein Scherz – „Im Elend 188“. Nein, heute kann man dieses „Elend“ nicht mehr erkunden, es lag an der Ecke Tiefer Graben/Salzgries.
Barbara Wolflingseder erzählt, dass der sächsische Jüngling bereits am Folgetag, am 8. Oktober, nach Schönbrunn marschiert wäre und da erfahren hätte, dass sich Napoleon am 12. Oktober vor dem Schloss Schönbrunn bei seiner paradierenden Truppe in der Öffentlichkeit zeigen würde. Um den verhassten „Tyrannen“ zu ermorden, hatte er sich einen langen, biegsamen Stockdegen verschafft. Doch offenbar erkannte er, dass er mit dieser auffälligen Waffe nicht bis zu Napoleon hätte vordringen können, also kehrte er wieder in sein Quartier „Im Elend“ zurück und änderte seine Methode. Er kaufte das extralange Küchenmesser, das den Korsen so beunruhigen sollte, sicherheitshalber ließ er die Klinge und die Spitze schleifen. Er wickelte es in eine Papierrolle und wagte am 12. Oktober den zweiten Versuch. Und der sollte letztendlich tödlich enden – für ihn, den gescheiterten Attentäter.
Seine Grabstätte ist wie erwähnt nicht bekannt, niemand kann trauernd zu ihr pilgern und sich von unserem Helden mit deutschem Gruße verabschieden. Der, den er nicht erdolchte, ist im Pariser Invalidendom bestattet, tagtäglich besuchen Tausende von Touristen seine Grabstätte und verneigen sich in gebotener Stille vor den Lorbeerkränzen auf dem imposanten Sarkophag.
xxx
Ein Adler, der Trophäen in seinen Fängen hält, flankiert von zwei Kürissen: die Denkmalgruppe für Friedrich Staps, versteckt im Hof des Hauses Oesterleingasse 1 im 15. Bezirk. Kaum jemand weiß wohl noch um ihre Bedeutung Bescheid …REINE LIEBEUND EWIGE TREUE
FERDINAND RAIMUND FEIERT MIT TONI WAGNER AM 10. SEPTEMBER 1821 PRIVATE HOCHZEIT
Wie komme ich zur Mariensäule in der Mitterwurzergasse? Am Beginn des Heurigenortes Neustift am Walde führt vom Tale des Krottenbachs die Agnesgasse bis zur beliebten Buschenschank Zimmermann. Dort nach links – nein, links und rechts hilft mir beim Wandern nicht weiter, also nach Westen in die Mitterwurzergasse. Die gibt es seit 1928 und ist nach dem heute beinahe vergessenen Schauspielerehepaar Friedrich und Wilhelmine Mitterwurzer benannt. Und nach zehn Minuten stehe ich vor der Mariensäule. Flankiert wird sie von den hängenden, violett schimmernden Blütenständen eines prächtig wuchernden Blauregens.
Und wie kamen anno 1821 Ferdinand Raimund und Toni (Antonia) Wagner zur Mariensäule? Der Weg von Wien nach Neustift und das anschließende Salmannsdorf war weit. Nicht selten musste man den Überschwemmungen des Krottenbachs ausweichen. Oder der Weg war überhaupt zur Gänze unpassierbar, dann blieb nur noch der Umweg über Pötzleinsdorf. Aber im schönen September des Jahres 1821 dürfte das Paar mit einem Zeiserlwagen schon gut durchgekommen sein.
Den Briefen des Schauspielers und Dichters entnehme ich, dass er die Gegend um Neustift und Salmannsdorf kannte und schätzte. Vermutlich hat er mit seiner viel geliebten Toni diese entlegene Gegend öfter besucht. Schließlich war er seit April 1820 mit der Sängerin und Schauspielerkollegin Aloisia (Luise) Gleich verheiratet, und es wäre nicht sehr klug und taktvoll gewesen, sich in der Wienerstadt in der Öffentlichkeit mit seiner Geliebten zu zeigen.
Ferdinand Raimund, geboren 1790 im Haus Mariahilf 10, heute Mariahilfer Straße 45, war im Jahr 1821 ein noch aufstrebender Schauspieler, der es gerne im ernsten Fach probiert hätte, aber ausgerechnet in den komischen Rollen, die er mit bitterem Ernst vortrug, konnte er brillieren und zum Publikumsliebling aufsteigen. Dabei gelang es ihm, seine fehlende Ausbildung zum Schauspieler und seine nicht ideale Artikulationstechnik blendend zu überspielen. Seinen ersten großen Erfolg verbuchte er im Jahre 1815 – mit 25 Jahren – in einem Stück, das sein Schwiegervater in spe Josef Alois Gleich geschrieben hatte: als Geiger Adam Kratzerl in der Alt-Wiener Karnevalsposse Die Musikanten am Hohen Markt. Als Autor und gleichzeitig als Hauptdarsteller von Theaterstücken sollte er erst später die Bühnen erobern, sein erstes Stück schrieb er 1823: die Zauberposse Der Barometermacher auf der Zauberinsel.
Und zusätzlich sollte die Heilige auf der Säule das innig-traute Anliegen des Paars von oben her segnen.
Über Toni Wagner (1799–1879) ist nicht allzu viel bekannt. Sie war die Tochter des wohlhabenden Kaffeehausbesitzers und Konditors Ignaz Wagner in der Leopoldstadt, das „Wagnersche Kaffeehaus“ lag unmittelbar an der Schlagbrücke – heute die Schwedenbrücke – und war eine allseits beliebte Wiener Institution. Abwechselnd mit ihrer Mutter Theresia und ihren jüngeren Schwestern saß Toni hier als „Sitzkassiererin“ an der sogenannten „Kredenz“. Mit den turbulenten Exzessen der Wiener Theaterwelt war sie wohl kaum vertraut, die Namen der Publikumslieblinge, zu denen auch Raimund zählte, kannte sie aber sicher gut. Zudem galt die damals neunzehnjährige Toni als äußerst fromm und gläubig.
Am Abend des 10. September 1821 war es noch sehr warm. Ferdinand und Toni – die beiden werden mir verzeihen, dass ich sie mit dem Vornamen nenne – wanderten die paar Minuten vom Beginn des Weinhauerdorfs Neustift am Walde hinauf zur Mariensäule.