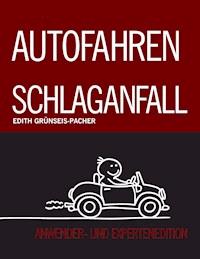
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mag. Edith Grünseis-Pacher, MSc, international anerkannte Mobilitätsexpertin, verleiht dem Thema SICHER AUTOFAHREN NACH SCHLAGANFALL eine völlig neue Dimension: Die auf Schlaganfall anwendbaren Symptome, Risiken sowie die Wahrnehmung, Kommunikationsempfehlung und Gesetzeslage sind auf sämtliche neurologischen Akutereignisse, internistischen Erkrankungen sowie unfall- und altersbedingten Einschränkungen übertragbar. Basierend auf jahrelanger Erfahrung wird zudem die Notwendigkeit einer objektiven Überprüfung der Fahrtauglichkeit nach Änderung des Gesundheitszustands aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MMag. Edith Grünseis-Pacher, MSc
Gesetzeslage • Krankheitsbild • SymptomeRisiken • Wahrnehmung • KommunikationPräsentation einer Überprüfungsmethode
Wissenschaftlich erforschte ErgebnisseANWENDER- und EXPERTENEDITION
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
VORWORT
1 EINLEITUNG
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel und Zweck der Forschung
1.3 Aufbau der Forschungsarbeit
2 ERKLÄRUNGEN DER RELEVANTEN BEGRIFFE
2.1 Überprüfung/überprüfen
2.2 Fahreignung/Fahrtauglichkeit/fahren
2.3 Diskrepanz/Unterschied/Abweichung
2.4 subjektiv/objektiv
2.5 Signifikanz/signifikant
2.6 Schlaganfall
2.7 Wahrnehmung/wahrnehmen
2.8 Sicherheit/sichern
2.9 Verkehr
2.10 Verkehrssicherheit
3 GESETZLICHE VORSCHRIFTEN
3.1 Straßenverkehrsordnung (StVO)
3.2 Führerscheingesetz (FSG)
3.2.1 Beurteilung der Fahreignung
3.2.2 Entziehung, Einschränkung und Erlöschen der Lenkberechtigung
3.3 Führerscheingesetz Gesundheitsverordnung (FSG-GV)
3.4 Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung (FSG-DV)
3.5 Versicherungsvertragsgesetz
3.6 Konklusio der gesetzlichen Vorschriften
3.7 Zusammenfassung
4 DER SCHLAGANFALL
4.1 Verlauf des Schlaganfalls
4.2 Therapie des Schlaganfalls
4.3 Klinische Symptomatik
4.3.1 Motorische Einschränkungen
4.3.2 Defizite der Sensorik
4.3.2.1 Gesichtsfeldausfälle
4.3.2.2 Weitere Störungen
4.3.3 Störungen der Sprache
4.3.4 Beeinträchtigungen des Sprechens
4.3.5 Agnostische Störungen
4.3.5.1 Neglect
4.3.5.2 Räumliche Störung
4.3.5.3 Anosognosie
4.3.6 Organisches Psychosyndrom
4.3.6.1 Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit
4.3.6.2 Aufmerksamkeitsdefizit
4.3.6.3 Gedächtnisstörungen
4.3.6.4 Veränderungen in Entscheidungsprozessen und Reaktionen
4.3.6.5 Verminderungen der geistigen Belastbarkeit
4.3.7 Affektive Störungen
4.3.7.1 Änderungen der Persönlichkeit
4.3.7.2 Änderungen des Verhaltens
4.4 Anfallsleiden
4.5 Zukunftsperspektiven
5 WAHRNEHMUNG
5.1 Wahrnehmung im Allgemeinen
5.2 Wahrnehmung der Verkehrssicherheit
5.2.1 Aspekte der Wahrnehmung
5.2.1.1 Visuelle Wahrnehmung
5.2.1.2 Akustische Wahrnehmung
5.2.1.3 Haptische Wahrnehmung
5.2.2 Risikowahrnehmung
5.2.2.1 Subjektive vs. objektive Risikowahrnehmung
5.2.2.2 Aktive vs. passive Risikowahrnehmung
5.2.2.3 Individuelle vs. kollektive Risikowahrnehmung
5.2.2.4 Unmittelbare vs. mittelbare Risikowahrnehmung
5.3 Fehlhandlungen/Verkehrsrisiken
6 KOMMUNIKATION UND KOMMUNIKATIONS-STÖRUNGEN
6.1 Zwischenmenschliche Kommunikation
6.2 Gesprächsführung während der Überprüfung
6.3 Kommunikationsstörungen
6.3.1 Psychische Verarbeitung
6.3.2 Seelische Auswirkungen
6.3.2.1 Ängste
6.3.2.2 Depressionen
6.3.2.3 Schuldgefühle und Schuldzuweisungen
6.3.2.4 Schamgefühle und Einsamkeit
6.3.3 Bewältigungsverhalten
7 EMPIRIE
7.1 Rechtfertigung der Forschungsmethode
7.2 Forschungsdesign
7.2.1 Rahmenbedingungen der Überprüfung
7.2.1.1 Zielgruppe/Stichprobe
7.2.1.2 Veranstaltungsort
7.2.1.3 Besonderheiten der Prüfungsmethode
7.2.1.4 Überprüfungsablauf
7.2.2 Erhebungsmethoden
7.2.2.1 Primärdatenerhebung
7.2.2.2 Sekundärdatenerhebung
7.3 Operationalisierung der Variablen
7.4 Testgütekriterien
7.5 Statistische Testverfahren
7.6 Forschungsfrage und präzisierte Hypothese
7.6.1 Deskriptive Analyse: Grundgesamtheit
7.6.2 Deskriptive Analyse: Subjektive Fahreignungsbeurteilung
7.6.3 Deskriptive Analyse: Objektive Fahreignungsbeurteilung
7.6.4 Deskriptive Analyse: Beschränkung
7.6.5 Bivariate Analyse: Subjektivität vs. Objektivität
7.6.6 Bivariate Analyse: Subjektive vs. objektive Beurteilung nach dem Schulnotensystem von »Sehr gut (1)« bis »Nicht genügend (5)«
7.6.7 Analyse: Diskrepanz in der Gesamtbeurteilung
8 SCHLUSSFOLGERUNGEN
ÜBUNGEN FÜR KOGNITIVES TRAINING
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG 1
ANHANG 2
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abs.
Absatz
AKES
Allgemeine Bedingungen für den Kfz-Europaschutz
AKHB
Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
AKKB
Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung
AUVA
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
AV
abhängige Variable
Bez.
Bezeichnung
BMVIT
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologien
CT
Computertomografie
CVA
cerebrovascular accident
EKG
Elektrokardiogramm
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
FSG
Führerscheingesetz
FSG-DV
Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung
FSG-GV
Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung
ggf.
gegebenenfalls
H
0
Nullhypothese
H
1
Hypothese 1 oder Alternativhypothese
i.d.g.F.
in der geltenden Fassung
KHK
koronare Herzerkrankung
MRT
Magnetresonanztomografie
ÖAMTC
Österreichischer Automobil- und Touringclub
o.Ä.
oder Ähnlichem
OGfE
Österreichischen Gesellschaft für Epileptologie
Stvo
Straßenverkehrsordnung
TIA
transitorische ischämische Attacke
UV
unabhängige Variable
V
Variable
v. Chr.
vor Christus
vgl.
vergleiche
VPU
verkehrspsychologische Überprüfung
vs.
versus
WHO
Weltgesundheitsorganisation
Z.
Ziffer
VORWORT
Ein folgeschwerer Verkehrsunfall unterbrach 1989 für mehrere Jahre mein »aktives« Leben. Nach zahlreichen Krankenhaus- und Reha-Aufenthalten wurde mir bewusst, dass ich meine bleibende Behinderung besser annehmen konnte als das daraus resultierende »Nichtmobilsein«. Da damals weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene Beratungsstellen zum Thema »Autofahren und Behinderung« tätig waren, begann ich 1993 mich auf diese Materie zu spezialisieren. Aufgrund der großen Nachfrage entstand 1996 die Initiative CLUB MOBIL.
Das Verfassen zahlreicher Studien und mein Engagement, sowohl die Mobilität von Menschen mit Handicap als auch die Verkehrssicherheit generell zu erhöhen, machten mich zur international anerkannten Mobilitätsexpertin.
Um neben den jährlich stattfindenden, speziell auf Menschen mit Handicap abgestimmten Fahrsicherheitskursen auch den zahlreichen Anfragen bezüglich einer Fahreignungsüberprüfung nach einem neurologischen, internistischen bzw. unfall- oder altersbedingten Akutereignis gerecht zu werden, entwickelte ich 2005 ein weltweit einzigartiges, auf Vertraulichkeit basierendes Konzept, welches unter anderem 2010 vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie mit dem »Staatspreis-Gütesiegel Verkehr« ausgezeichnet wurde.
Die im Rahmen meiner neuesten Studie wissenschaftlich erhobenen Resultate im Bereich »Pkw-Fahreignung bei Menschen nach Schlaganfall« brachten aufschlussreiche Erkenntnisse, die erstmals in diesem Buch veröffentlicht werden.
Die Daten und Fakten dieser Studie sollen dazu beitragen,
die Kommunikationsgrundlagen aller Personen im Umgang mit Schlaganfall betroffenen zu stärken,
das Thema »Fahrfähigkeit« nach einem neurologischen Akutereignis nicht länger zu tabuisieren,
bereits im Frühstadium der Rehabilitation die Risiken einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr anzusprechen,
Schlaganfallpatientinnen und Schlaganfallpatienten die Notwendigkeit einer objektiven Überprüfung und einer realistischen Einschätzung der Eignung zum Lenken eines Pkws zu vermitteln und somit
sowohl die Mobilität als auch die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.
MMag. Edith Grünseis-Pacher, MSc
1 EINLEITUNG
Autofahren ist im 21. Jahrhundert ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität und bedeutet für die Gesellschaft Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Mobilität, Eigenständigkeit und Flexibilität, welche durch das Fahren von Autos erleichtert werden, sind weitere Faktoren, die in der Öffentlichkeit einen hohen Stellenwert einnehmen und somit als erstrebenswert und unverzichtbar angesehen werden. War vor einigen Jahrzehnten der Führerscheinbesitz nur bestimmten Gesellschaftsschichten vorbehalten, ist innerhalb von nur einer Generation (30 Jahre) die Absolvierung einer Lenkberechtigung zur Selbstverständlichkeit geworden. Diese Tatsache führte dazu, dass in Europa derzeit die ersten Frauen und Männer altern, die ihr Leben lang Auto gefahren sind und die eigenständige Fahrt mit dem Personenkraftwagen (Pkw) im Alter weder missen möchten noch missen können: Ihr Tagesablauf beruht auf aktiver Mobilität im Straßenverkehr. Auch bei jüngeren Generationen bedeutet der Führerschein noch immer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, selbst wenn der Erwerb der Lenkberechtigung durch die zunehmende Urbanisierung und dem daraus folgenden Ausbau der öffentlichen Verkehrsnetze an Wichtigkeit verliert.
Tritt – unabhängig vom Alter – ein mobilitätseinschränkendes Akutereignis ein, steht nach Wiedererlernen grundlegender Fähigkeiten zur Bewältigung des Alltags bei mehr als 90% der Betroffenen an erster Stelle der Wunsch, sich (wieder) selbst ans Steuer eines Fahrzeuges zu setzen, um die Verminderung der aktiven Bewegungsfähigkeit bzw. der Extremitätenmotorik zu kompensieren.1
Da in Österreich die gesetzlichen Vorschriften für den Fahrzeugverkehr keine Meldepflicht einer Erkrankung vorsehen, beruht die aktive Teilnahme am Straßenverkehr auf Basis der Eigenverantwortung.2 Aus Angst vor der Führerscheinabnahme wird einer freiwilligen Meldeempfehlung von Seiten der Krankenanstalten, der Ärztinnen und Ärzte oder dem sozialen Umfeld jedoch kaum nachgekommen. Dies führt dazu, dass von den meisten Autofahrerinnen und Autofahrern trotz vorliegender psychischer und/oder physischer Einschränkungen ein unverändertes Mobilitätsverhalten in Bezug auf das Lenken eines Personenkraftwagens an den Tag gelegt wird.
Dies veranlasste die Mobilitätsexpertinnen und Mobilitätsexperten der österreichischen Initiative CLUB MOBIL3 (www.clubmobil.at) im Jahr 2005, ein auf Vertraulichkeit basierendes Konzept zu entwickeln, in dessen Zuge die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr – und nicht wie bei anderen Projekten am Simulator – getestet wird. (Details zu den Rahmenbedingungen und dem Überprüfungsablauf können dem Kapitel 7.2, ab Seite → entnommen werden.) CLUB MOBIL bietet für diese Zwecke eine vertrauliche Fahreignungsuntersuchung an und befasst sich in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), dem Österreichischen Automobil- und Touringclub (ÖAMTC) und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) seit 1996 mit dem Thema »sicheres Autofahren mit gesundheitlichen Einschränkungen«.
Zwischen 2007 bis 2012 wurde im Rahmen des erwähnten ersten Forschungsprojekts des CLUB MOBIL vor den Praxisfahrten im Schonbereich der Straße und im Straßenverkehr zusätzlich ein verkehrspsychologisches Testverfahren eingesetzt. Die Überprüfung der kraftfahrspezifischen Leistungsfunktionen wurde von Verkehrspsychologinnen und Verkehrspsychologen mit der »Testbatterie Standard« und zwei ergänzenden Leistungstests aus dem »Expertensystem Verkehr« der Firma Schuhfried4 durchgeführt. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen verkehrspsychologischen Untersuchung schien plausibel, zumal neurologische Akutereignisse zu zahlreichen psychologischen Defiziten führen können. Die Aufgabe wirkte einfach: das Expertenteam ging von der Validität der eingesetzten Testverfahren aus, da die Prognose für sicheres Fahrverhalten bereits in mehreren Studien mit gesunden Erwachsenen mittleren bis höheren Lebensalters empirisch belegt worden war.5 Umso überraschender war es, als sich bei 43, 9% der 458 am ersten Forschungsprojekt teilnehmenden Probandinnen und Probanden nach einem neurologischen Akutereignis zeigte, dass das Fahreignungsergebnis aus der verkehrspsychologischen Untersuchung (VPU) nicht mit dem Resultat der Fahrproben übereinstimmte.6
Die unzureichende Aussagekraft der testpsychologischen Leistungsvariablen bei Personen nach einem neurologischen Akutereiqnis wird auch von Spezialistinnen und Spezialisten der klinischen Neuropsychologie mit Skepsis betrachtet.7 Diese Tatsache und das Resultat aus der Regressionsanalyse zur Prognose der Gesamtbeurteilung lassen daraufschließen, dass das Fahrverhalten in der Fahrprobe den größten Erklärungsbeitrag zur Fahrtauglichkeit einer gesundheitlich beeinträchtigten Person liefert. Dies veranlasste die Organisatorin des CLUB MOBIL, ab Juni 2012 auf die verkehrspsychologische Untersuchung (VPU) zu verzichten und stattdessen die standardisierte Fahrprobe im Straßenverkehr von den bisherigen 30 Minuten auf eine Dauer von 50 bis 60 Minuten auszudehnen.
Zudem konnte im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen festgestellt werden, dass bei einer generellen Nachfragesteigerung nach CLUB MOBIL Fahreignungsüberprüfungen vor allem die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Diagnose Schlaganfall über die Jahre signifikant zugenommen hat, wobei unter den Begriffen Schlaganfall/Apoplex/Insult sowohl blutungs- als auch arterienverkalkungsbedingte Ereignisse im Gehirn zusammengefasst werden.
Hochrechnungen verschiedener Institute (zum Beispiel (z.B.) J.W.Goethe Universität in Frankfurt am Main8) bestätigen diese Wachstumsbeobachtung und gehen davon aus, dass die Anzahl von derzeit jährlich 24.000 Insult-Patientinnen und Insult-Patienten9 in Österreich durch den allgemeinen Alterungsprozess der Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten (bis 2050) auf etwa 40.000 Personen ansteigen wird.10 Dies ist darauf zurückzuführen, dass Schlaganfälle eine stark altersabhängige Inzidenz aufweisen. Ab dem 55. Lebensjahr verdoppeln sich die kritischen Störungen der Blutversorgung im Gehirn mit jedem Lebensjahrzehnt. Bei jüngeren Personen hingegen nehmen die Inzidenzraten des Schlaganfalles aufgrund vaskulärer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Rauchen zu. Dieses Akutereignis ist im Kontext mit dem Autofahren von großer Relevanz, da bereits heute die Auswirkungen des Insults europaweit am häufigsten zu dauerhafter Invalidität führen.
Im Rahmen des von CLUB MOBIL initiierten Projektes wurde von den Mobilitätsexpertinnen und Mobilitätsexperten beobachtet, dass sich bei Probandinnen und Probanden mit dieser neurologischen Diagnose häufig eine andere Wahrnehmung als die von Spezialisten objektiv festgestellten Eignungsvoraussetzungen zeigt.
1.1 Problemstellung
Die psychischen und/oder physischen Einschränkungen nach einem Hirninfarkt oder einer Hirnblutung machen sich in unterschiedlichen Konfliktbereichen bemerkbar. Zum einen besteht bei der Mehrheit der Betroffenen eine intrapersonelle Disharmonie im Sinne von Frustration und Einnahme einer Opferhaltung inklusive der Befürchtung des Führerscheinentzuges. Zum anderen treten häufig Spannungen im familiären Umfeld auf, wenn die oder der Betroffene bestehende Defizite nicht wahrnimmt und ohne Überprüfung der Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges sowie ohne Feststellung der eventuell notwendigen Fahrhilfen durch Expertinnen bzw. Experten weiterhin aktiv am Straßenverkehr teilnimmt oder zumindest teilnehmen möchte. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Interessenskonflikt zwischen dem Wunsch der/des Einzelnen, soviel Mobilität wie möglich wieder zu erlangen, um im Alltag selbstständig zu sein, und der gesellschaftlichen Forderung, Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.
Die Selbsteinschätzung, die aufgrund von Wahrnehmungsdefiziten erfahrungsgemäß in vielen Fällen fehlerbehaftet ist, trägt zu einer erhöhten Fremd- und Selbstgefährdung im Straßenverkehr bei und kann somit zu Kontroversen zwischen Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmern und deren Angehörigen sowie den zuständigen Behörden führen. Ein Nichtmelden der gesundheitlichen Veränderungen bei der Behörde und ein Nichteintragen der benötigten Ausgleichseinrichtungen in die Lenkberechtigung können im Falle eines Unfalles sowohl zu rechtlichen als auch zu versicherungstechnischen Schwierigkeiten führen.11
Verkehrspsychologische Studien, die sich mit dem Thema Autofahren im Kontext mit neurologischen Defiziten befassen, stellen bei Probandinnen/Probanden Mängel auf operativer, taktischer und/oder strategischer Ebene fest. Die Abweichung der intrapersonellen Überzeugung, ein Kraftfahrzeug steuern zu können, von der von unabhängigen Expertinnen und Experten festgestellten Eignung zum Lenken eines Pkws wird jedoch nur (wenn überhaupt) peripher erwähnt.
1.2 ZielundZweckderForschung
Nachdem in dieser Studie der Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung beim Lenken eines Kraftfahrzeuges schwerpunktmäßig wissenschaftlich erforscht wurde, kann Schlaganfall-Patientinnen und Schlaganfall-Patienten zum Zweck der Bewusstseinsbildung eine andere, belegbare, objektive Sichtweise der Ergebnisse unterbreitet werden. Den Angehörigen soll zudem verdeutlicht werden, dass aufgrund auftretender kognitiver Defizite eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr nicht vernachlässigbare Risiken birgt.
Letztendlich soll diese Arbeit auch dem medizinischen Fachpersonal nützliche Anhaltspunkte liefern, um mit Insultpatientinnen und Insultpatienten in Bezug auf das Thema Autofahren erfolgreich kommunizieren und eine effektive Rehabilitation durchführen zu können.
In der Kommunikation weisen neben der Übermittlung von Diagnosen auch die Belegung und die Bewusstmachung von Defiziten und deren Folgen – wie z. B. die Feststellung der Nichteignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges – ein großes Konfliktpotenzial auf. Zahlreiche Studien zeigen, dass diese Aufgaben durch Erlernen von Kommunikationstechniken und Reflexion der intrapersonellen Einstellungen erfolgreich bewältigt werden können.12 Um eine befriedigende Beziehung zwischen den Kommunikationsparteien herzustellen, postuliert der amerikanische Psychologe Carl Rogers (1902 – 1987) die »Kernvariablen der Gesprächsführung«, Empathie, Echtheit, Wertschätzung und Akzeptanz, als unumgänglich.13
Dieses Buch soll die Kommunikationsfähigkeit aller in die Bewusstmachung und Überprüfung der Fahreignung involvierten Personen verbessern, indem die Wahrnehmung der Menschen nach einem Schlaganfall untersucht wird und daraufhin Zahlen, Daten und Fakten zur Übermittlung der daraus resultierenden Botschaften auf Sachebene zur Verfügung gestellt werden.14 Bei der Bewusstmachung respektive der Bewusstwerdung handelt es sich oft um einen sehr schmerzhaften Prozess, der ganz am Anfang einer Konfliktbewältigung steht. Gerade in dieser ersten Phase ist es von Vorteil, dass sowohl das medizinische Fachpersonal als auch die zuständigen Behördenvertreter und das Mobilitätsteam des CLUB MOBIL kein Naheverhältnis zu den zu überprüfenden Personen haben und sie deshalb nicht unmittelbar in das Geschehen eingebunden sind.
Zusammengefasst soll anhand empirischer Sozialforschung die Forschungsfrage bezüglich potenzieller Wahrnehmungsdiskrepanzen im Bereich der Fahreignung beantwortet werden. Die Umsetzung der Erkenntnisse soll zur Optimierung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten, der Erhöhung sicherer Mobilität von Menschen nach Schlaganfällen und genereller Verkehrssicherheit beitragen.
1.3 AufbauderForschungsarbeit
Das erste Kapitel (ab Seite →) dient der Einführung in die Thematik »Autofahren nach einem Schlaganfall«, der Darstellung der Ausgangssituation, der Sensibilisierung für die Problemstellung und der Erklärung von Ziel und Zweck der Studie.
Im zweiten Kapitel (ab Seite →) werden die in den Hypothesen und der Forschungsfrage verwendeten relevanten Begriffe definiert, um eine unmissverständliche Basis für die nachfolgenden Ausführungen zu erstellen. Jedes Unterkapitel schließt mit einer Klarstellung, wie der Begriff im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit zu verstehen ist, ab.15
Die gesetzlichen Vorschriften zum Lenken eines Kraftfahrzeuges in Österreich werden im dritten Kapitel (ab Seite →) aufgearbeitet, wobei jedoch ausschließlich auf die für den Insult relevanten Bereiche eingegangen wird.
Im folgenden und somit vierten Kapitel (ab Seite →) stehen das Krankheitsbild des Schlaganfalles, die Symptome und die Folgen der Erkrankung im Mittelpunkt. Zudem wird auf die Auswirkungen der physischen und psychischen Beeinträchtigungen von Frauen und Männern nach Schlaganfällen eingegangen, welche in Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit stehen.
Kapitel fünf (ab Seite →) befasst sich mit der Aufmerksamkeit im Allgemeinen und in weiterer Folge im Speziellen mit der subjektiven und objektiven Wahrnehmungsfähigkeit von Personen, die schlaganfallbedingt an kognitiven Restriktionen leiden.
In Kapitel sechs (ab Seite →) liegt das Hauptaugenmerk auf der Kommunikation, der mediativen konfliktentschärfenden Gesprächsführung und den insultbedingt auftretenden Kommunikationsstörungen. Es wird dargestellt, wie Personen nach einem Schlaganfall durch empathische, wertschätzende Verständigung die Wahrnehmungsunterschiede zwischen subjektiv wahrgenommener und objektiv bewerteter Eignungsvoraussetzung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges sowie die damit verbundenen Gefahren bewusst gemacht werden können. Um bei all jenen, die mit dem Thema Schlaganfall konfrontiert werden, Verständnis für die seelischen Auswirkungen dieses neurologischen Akutereignisses auf die Fahreignung zu schaffen, wird gezielt auf die Beschwerden und Hindernisse eingegangen, mit denen die Betroffenen persönlich und individuell ringen müssen.
Das siebte Kapitel (ab Seite →) handelt von der empirischen quantitativen Sozialforschung durch Einzelerhebung mittels standardisierten, von der Autorin erstellten Fragebogens16 und durch qualitativ orientierte Verhaltensbeobachtung17 im Feld durch Expertinnen respektive Experten. Dazu wurden 322 Frauen und Männer nach dem neurologischen Akutereignis »Schlaganfall« befragt und getestet.
Die gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse werden in Kapitel acht (ab Seite →) unter »Schlussfolgerungen« zusammengefasst und zur Diskussion gestellt.
1 Vgl. Grünseis-Pacher, E./Beggiato, M./Reiter, D. et al.: Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen. Sicher mobil mit Handicap, Band 193; Wien: 2009, S. 7
2 Vgl. Grünseis-Pacher, E./Beggiato, M./Reiter, D. et al.: Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen. Sicher mobil mit Handicap, Band 193; Wien: 2009, S. 16
3 Anmerkung: Die Initiative CLUB MOBIL – für Menschen mit Handicap hat sich seit 1996 auf die Mobilität behinderter Menschen spezialisiert. Nähere Informationen unter: www.clubmobil.at
4 Anmerkung: Die österreichische Firma Schuhfried entwickelte 1947 als erstes Unternehmen weltweit ein psychologisches Testsystem. Diese international ausgerichtete Firma beschäftigt sich mit Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen psychologische Diagnostik, kognitives Training und Biofeedback. Nähere Informationen unter: www.schuhfried.at
5 Vgl. Grünseis-Pacher, E./Beggiato, M./Reiter, D. et al.: Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen. Sicher mobil mit Handicap, Band 193; Wien: 2009, S. 47
6 Vgl. Grünseis-Pacher, E./Bachmaier, C./Grünseis, D. et al.: Sicher mobil mit Handicap. Vertrauliche Fahreignungsüberprüfung im Vorfeld der Behörde, Studie aus dem Verkehrswesen 2012; o. O.: 2012, S. 28f.
7 Vgl. Dettmers, C./Weiller, C. (Hrsg.): Fahreignung bei neurologischen Erkrankungen; Bad Honnef: 2004, S. 19ff.
8 Vgl. Curado: Ihr Leben – Ihre Gesundheit; http://www.curado.de/Schlaganfall-Hirninfarkt/Schlaganfallzahl-nimmt-bis-2050-um-68-Prozent-zu-841 (27.11.2014, 12:47)
9 Vgl. Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft: Zahlen und Fakten; http://www.oegsf.at/aerzte/index.php?page=zahlen-und-fakten-2 (27.11.2014, 13:50)
10 Vgl. pressetextaustria; http://www.pressetext.com/news/20080714034 (15.9.14; 02:14)
11 Vgl. Grünseis-Pacher, E./Beggiato, M./Reiter, D. et al.: Forschungsarbeiten aus dem Verkehrswesen. Sicher mobil mit Handicap, Band 193; Wien: 2009, S. 16
12 Vgl. Österreichische Ärztezeitung: Kommunikation in Grenzsituationen; http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2009/oeaez25012009/kommunikation-ingrenzsituationen-gespraechsfuehrung-in-heiklen-situationen.html (19.01.2015, 11:28)
13 Vgl. Rogers, C. R.: Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten. Konzepte der Humanwissenschaften, E-Book, 19. Auflage; Leipzig: 2014, Position 1396
14 Vgl. Schulz von Thun, F.: Miteinander reden: 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung, Differenzielle Psychologie der Kommunikation, 3. Auflage; Reinbek bei Hamburg: 2014, S. 21
15 Vgl. Mayer, H. O.: Interview und schriftliche Befragung – Entwicklung, Durchführung und Auswertung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung, 6„ überarbeitete Auflage; München: 2013, S. 10
16 Vgl. Moosbrugger, H./Kelava, A. (Hrsg.): Testtheorie und Fragebogenkonstruktion, 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage; Heidelberg: 2012, S. 204 ff.
17 Vgl. Atteslander, P.: Methoden der empirischen Sozialforschung, 13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage; Berlin: 2010, S. 77 f.
2 ERKLÄRUNGEN DER RELEVANTEN BEGRIFFE
Bevor das Thema »Schlaganfall und Autofahren« detailliert betrachtet wird, finden sich in diesem Kapitel die Definitionen für jene Begriffe, die für die Nachvollziehbarkeit der vorliegenden Studie als wichtig und nützlich erachtet werden.
2.1 Überprüfung/überprüfen
Das Substantiv Überprüfung und das dazugehörige Verb überprüfen sind Schlüsselbegriffe in dieser Forschung.
Überprüfen kann zum einen mit „nochmals prüfen, ob etwas in Ordnung ist, seine Richtigkeit hat, funktioniert: […] (im Originaltext kursiv)“ zum anderen auch mittels der Begriffe „noch einmal überdenken, durchdenken: […] (im Originaltext kursiv)“18 beschrieben werden. Im praktischen Sinne kann überprüfen auch als „[…] (nochmals) genau prüfen, ob etwas richtig ist […] ≈ kontrollieren“19 verstanden werden.
In Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache findet sich keine aussagekräftige Definition des Wortes Überprüfung, das nur mit den substantivierten Verben „das Überprüfen, das Überprüftwerden (im Originaltext kursiv)“20 umschrieben wird. Duden – Das Synonymwörterbuch nennt als sinn- und sachverwandte Wörter „Begutachtung, Durchsicht, Inspektion, Kontrolle, Musterung, Nachprüfung, Probe, Prüfung, Revision, Stichprobe, Test, Untersuchung, Visitation; […]“21. Das TheFreeDictionary.com führt u.a. „Verifikation, [..], Beurteilung, [..], Kontrolle“22 als Synonyme an.
Schon eine erste Betrachtung der verschiedenen Definitionen lässt deutlich erkennen, dass bei den Termini Überprüfung und überprüfen allgemein der Faktor der Wiederholung dominiert. Bei den dieser Studie zugrunde liegenden Fahrverhaltensbeobachtungen handelt es sich jedoch um einmalige Beurteilungen der Fähigkeit, nach einem Schlaganfall einen Pkw zu lenken. Deshalb sind für diese Arbeit die sich aus TheFreeDictionary.com ergebenden Begriffsbestimmungen am relevantesten.
2.2 Fahreignung/Fahrtauglichkeit/fahren
Fahreignung bzw. Fahrtauglichkeit sind der eigentliche Gegenstand der Forschungsarbeit und bedürfen daher einer eingehenden Definition.
In beiden zusammengesetzten Substantiven findet sich das Verb fahren, das im Duden als „1. a) [..] sich rollend, gleitend [mit Hilfe einer antreibenden Kraft] fortbewegen: […] 2. a) sich [in bestimmter Weise] mit einem Fahrzeug o. Ä. fortbewegen (im Originaltext kursiv)“23 definiert wird.
Diese Definition entspricht dem Sinn nach der aus Wahrig Deutsches Wörterbuch:
„fah/ren (im Originaltext färbig) […] 1 ein Fahrzeug benutzen, sich mit einem Fahrzeug fortbewegen […] (im Originaltext kursiv)“24.
Aus dieser kurzen Beschreibung ergibt sich, dass »fahren« ein der Fortbewegung dienendes Objekt voraussetzt.
Die Substantive Fahreignung und Fahrtauglichkeit lassen sich laut Duden in einer allgemeinen Beschreibung als „Eignung zum Fahren eines Kraftfahrzeugs (im Originaltext kursiv)“25 und die „geistige, körperliche Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu fahren (im Originaltext kursiv)“26 definieren.
In Bezug auf die Beurteilung der Fahreignung kann gerade bei neurologischen Patientinnen und Patienten „[von einer] primär klinischen Aufgabe, der sich Neuropsychologen häufig gegenübersehen“27 gesprochen werden. „[…] Der Begriff der Eignung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, so dass zur Beurteilung und Konkretisierung Leitlinien notwendig sind. […]“28 Das österreichische Verkehrsministerium BMVIT hat deshalb das Handbuch für Amts- bzw. Fachärzte und die Verwaltung „Leitlinien für die gesundheitliche Eignung von Kraftfahrzeuglenkern“29 herausgegeben. Hier können sich





























