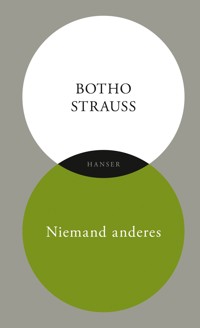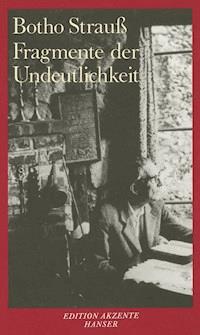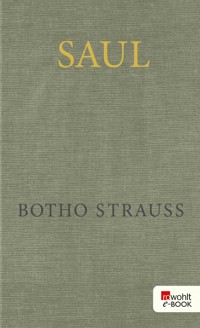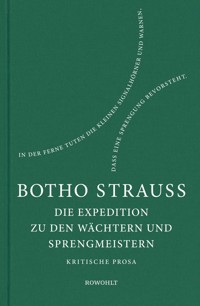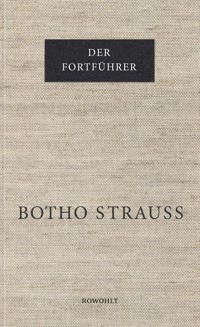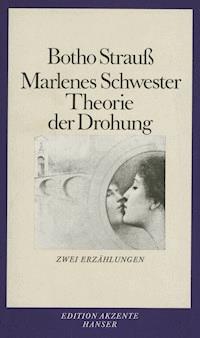Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Botho Strauß hat Liebesgeschichten der besonderen Art geschrieben. Kein anderer Schriftsteller seiner Generation hat so eindringlich über Herzensbrecher und Heiratsschwindler, über Liebesbetrug und armselige Hochstapler, über Täuschung, Lüge und Schweinerei geschrieben - und natürlich über die Leidenschaft. Thomas Hürlimann hat aus den vielen Erzählungen die ihm liebsten Geschichten herausgesucht und neu gemischt. Entstanden ist ein Lesebuch über die Nachtseiten der Liebe zwischen Mann und Frau, wie es reicher und geheimnisvoller nicht zu denken ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser eBook
Botho Strauß
Sie / Er
Erzählungen
Ausgewähltund mit einem Nachwortvon Thomas Hürlimann
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-23927-2
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2012
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Unser gesamtes lieferbares Programmund viele andere Informationen finden Sie unter:www.hanser-literaturverlage.de
Inhalt
Die Buchfee
Die Straße
Die Entgegenkommende
Leicas
Der Pakt
Verlorene Liebesmüh
Falsche Vorstellungen
Der arme Angeber
Mädchen mit Zierkamm
Drüben
Die Eine und die Andere
Die Händlerin auf der hohen Kante
Frau mit Telefon
Ein Ausrutscher
Die Getäuschte
Ihr Brief zur Hochzeit
Das Fleischhemd
Mikado
Der Arglose
Die Möbel
Rückkehr
Zu Besuch
Die Zahlen
Ein Zeichen
Verkennung
Wohnen
Das Geschenk
Der Kinderfeind
Früher
Die Schlaflose
Späte Schüchternheit
In Flammen
Staustufe
Der Wald
Die Buchfee
Nachwort
Nachweise
Über den Autor
»Was wollen Sie sagen? Sagen Sie es mir! Sie brauchen nicht laut zu sprechen. Ich sehe Sie unter Ihrer Schreibtischlampe sitzen, Sie beugen den Kopf über das Buch, doch Sie lesen nicht. Ihr Blick streift nur eben diesen Flitterkram der Schrift, man möchte meinen, er stöbere darin wie die Fußspitze des verkaterten Frühaufstehers, der am Morgen nach dem Fest im bunten Abfall von Luftschlangen, Seidenpapier, zerfetzten Knallbonbons raschelt, lustlos, ohne den geringsten Versuch, mit dem Aufräumen zu beginnen. Sie sehen hinein, als hätten Sie gestern eine Bekanntschaft gemacht, von der Ihnen heute nur noch ein rötlicher stechender Umriß geblieben ist. Von der Ihnen heute etwas ebenso Ungefähres wie Unliebsames schwant. Sie haben vielleicht irgend etwas getan, oder besser gesagt: Sie haben etwas in die Vergessenheit befördert, um die Art und Weise Ihres Vorgehens einmal höflich zu umschreiben. Sie können sich nicht von diesen Zeilen trennen, denn Sie spüren eine gewisse Geborgenheit in ihrem bequemen, geraden Verlauf, eine gewisse Leichtigkeit, auf ihrem Fluß dahingetragen zu werden. Sie können sich nicht von ihnen trennen, aber Sie hängen auch nicht an ihnen. Sie könnten genauso gut das Buch schließen, Ihren Papierkorb ausleeren, die Servietten im Schrank umsortieren oder etwas beliebig anderes tun, um Ihre Gedankenverlorenheit zu genießen. Um sich schließlich doch dafür zu entscheiden, leise und vorsichtig mit dem Sprechen zu beginnen, es auszusagen, was nun einmal heraus muß, mir das Vertrauen zu schenken, das ich verdiene.«
Der Leser senkte den Kopf und blies in die feine, staubfeine Stimme hinab, die aus der Ritze zwischen den Seiten, aus der Vertiefung des Buchs geflüstert hatte. Er war tatsächlich sehr müde und kämpfte mit dichtem Auge gegen die Gewalt des Verlesens an. Die Zeilen wurden dunkler und vager, so daß er den deutenden Finger zur Stütze nahm. Doch die Sprünge, die Schründe des goldenen Mißverstehens taten sich unter ihm auf, und er sah die Irrlettern tanzen, die Grammaiaden glänzend fließen und hörte wieder die winzige Stimme, die ihm befahl: »Nun sprich! Buch zu!«
Aber das wollte er nicht, um keinen Preis, wenn es auch in seiner Kehle zuckte und seine Wangenmulden zu zittern begannen.
»Sie lesen, um von den Zeilen gefressen zu werden. Wie andere reisen, um vom Reisen gejagt zu werden. Wann endlich befällt Sie der Ekel vor dem Gewürm der Schrift und der Ekel vor der Last, mit Hilfe dieser kleinen Krüppel sich etwas Schönes in den Geist zu rufen? Wann endlich zermürbt Sie der kalte Fleiß, mit dem Ihre Vorstellungskraft das unermüdliche Symbolstechen betreibt? Nur um in irgendeinem ungestalten Buchstabeninsekt den Adler zu sehen? Wann endlich wird Sie das leise Fauchen der Schrift nicht mehr antreiben, es sich emsig auszumalen, Wort für Wort, was Sie da lesen? Ich warte nur, bis Ihr ganzer großer Vorstellungsraum feurig zusammenstürzt wie ein Riesenstern und seine Masse sich, endlos weiterstürzend, schließlich zum schwarzen Loch in Ihrer Kognition verdichtet, so daß Ihnen nichts, gar nichts mehr lesbar sein wird und Sie endlich wieder lernen, auf Stimmen zu hören und in Bildern zu leben, ohne Trennung von nah und fern, von außen und innen, alles glaubend und allem gehorsam. Dann werden Sie Ihre Hände auf die Druckseiten legen wie auf feinstes Sägemehl und sie nicht-lesen, denn Ihr Sinn wird durch diesen Streu hindurchgehen verständnislos wie durch jede andere Materie …«
»Ich will nicht reden!« rief endlich der Leser kläglich aus, da ihm Hermetia, die Buchfee, so lästig zusetzte und sichelnd einflüsterte. »Ich erinnere mich an nichts und bestehe genau wie Sie selbst von innen nach außen nur aus Blättern und Geblättertwerden!«
»Aber ich! – Ich bin der Staubpuff des zugeschlagenen Buchs!« stöhnte sie den Bund entlang.
»Was sollte ich denn wohl mit einem zugeschlagenen Buch anfangen? Hinausgehen in die Welt und mich wieder unmöglich machen?
Vielleicht lebe ich hier wie ein Kranker und Süchtiger; vielleicht wie ein Greis oder wie ein reicher absonderlicher Erbe; jedenfalls als ein unbedingt lesendes Individuum. Blind, verrannt und unbelehrbar. Unbelehrbar, ja – und doch hängt dieses hilflose Dasein an der feinsten und sichersten Naht, mit der der Mensch an den Himmel geflickt ist. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um mich von ihr blamieren zu lassen.«
»Eine Stubengeburt. Ein Stubenleben. Ein Stubentod … Eine Stubenfliege«, verhöhnte ihn die Buchin. »Es wird aber der Tag kommen, da Sie mich mit lebendigem Auge erblicken und mit Ihrer ganzen stübischen Leidenschaft entdecken werden. Dann nämlich wird die Unansehnlichkeit, werden die häßlichen Schrift-Schnüre, in denen ich jetzt gefesselt liege, endgültig von mir gefallen sein und Sie werden mich mit ganzem Leib und in freier Gestalt vor sich finden – und dann, Leser, dann du: dann wirst du mir erzählen und nicht aufhören zu erzählen, denn ich werde mir entfallen sein …«
Mit diesen letzten Worten, die ihm dunkel blieben, hatte sie sich fürs erste verabschiedet, und es waren ihm darauf noch ein paar Stunden vergönnt, in denen er sich unbelästigt in sein Buch vertiefen konnte.
Seit geraumer Zeit hatte Friedrich Aminghaus unter dergleichen Störungen zu leiden, bei denen seine stete Lektüre von unregelmäßigen Einsprüchen, die aus der Stille kamen, unterbrochen und seine Zuverlässigkeit als Leser (im übrigen seine einzige zu Erwerbszwecken nutzbare Begabung) auf eine harte Probe gestellt wurde. Früher schon war es zu ähnlichen Einwirkungen gekommen von undeutlichen Wesen, die in sein Gehege gedrungen waren, ja sich regelrecht bei ihm eingenistet hatten. Da gab es eine Zeitlang jenen Mann im glänzenden Purpurgewand, die Kapuze über dem Kopf, der in einer Ecke des Zimmers beständig hockte, derselbe, der einst zu dem tafelnden Swedenborg gesagt hatte: »Iß nicht soviel!«, durchtriebene Erscheinung, hatte inzwischen eher eine Art Trainingsmantel übergeworfen, mit denen die Boxer in den Ring steigen, man sah ja nicht viel von ihm, bloß die nackten, spärlich behaarten Beine, der streunte offenbar seit Jahrhunderten durch die Geistesgeschichte und war nun auch Aminghaus zugewandert.
Nun mußte man ihm nicht Mäßigung im Essen anbefehlen, da er hierin eine beinahe ungesunde Zurückhaltung bewahrte. Des Gastes leise, wie nebenhin gesprochene, aber umstandslos klare Anweisungen galten denn auch dem einzigen Laster, dem Aminghaus verfallen war. Und so hörte er von früh bis spät: »Lies nicht soviel!« Kaum daß er am Morgen zu seinem Tisch schritt und die Bücher aufschlug: »Lies nicht soviel!« Folgte er nicht sogleich, dann wiederholte sich der Befehl bei jedem Umblättern der Seite, solange, bis er nicht mehr wagte, weiterzuschlagen, da ihm der unvermeidliche Verweis schon im voraus im Ohr klang und seine Geistesgegenwart von der Lektüre ablenkte. Da er aber bald bemerkte, daß dieser Bote zu nichts weiterem fähig war, als ihm einsilbig das Lesen zu vermahnen, und jede nähere Erläuterung schuldig blieb, sah er keine andere Möglichkeit, als ihm zunächst zu gehorchen und für sich selbst herauszufinden, was er denn statt des Lesens Richtigeres oder Gesünderes tun könnte.
Es war nicht leicht, mit diesem abseitigen Gesellen auszukommen, der immerzu anwesend war und nur diese eine monotone Order erteilte. Friedrich wünschte sich dringend seinen nächsthöheren Vorgestellten herbei, der ihn vielleicht mit weiterführender Hand in der neu entstandenen, lähmenden Offenheit allen beliebigen Tuns und Lassens betreut hätte. Aber dieser konnte so bald nicht erscheinen. Zuerst hatte man aus eigener Wahl den ersten richtigen Schritt zu tun. Vom Einstellen des Lesens führte ein direkter Weg zum Handeln als seinem klassischen Gegenteil. Dieses wiederum war in noch unabsehbarere Bereiche unterteilt, als selbst die Bibliotheken von Alexandria es gewesen sein mögen. Man konnte Gutes tun und man konnte Schlechtes tun. Man konnte Sport treiben oder Geschäfte machen. Man konnte seinen Garten pflegen oder dem Staat dienen. Die Welt des Handelns für sich genommen war schon unermeßlich, ganz zu schweigen davon, daß nicht auszumachen war, ob Handeln tatsächlich der erste richtige Schritt weg vom Lesen war. Dieser hätte ebensogut im Schreiben liegen können oder im Reisen. Oder im Gespräch mit guten Freunden. Lauter Beschäftigungen, die weder mit Lesen noch im strengen Sinn mit Handeln etwas zu tun hatten. Er versuchte es also zuerst mit dem Reisen, der Einfachheit halber und der angeblichen Zerstreuung, die man dabei ähnlich wie beim Lesen erfahren sollte. Er reiste ohne ein einziges Buch im Gepäck – und erfuhr nie bewußter und hilfloser, von Bestimmung und Charakter ausschließlich ein Leser zu sein, als unterwegs in der Entbehrung des Buchs.
Nichts konnte ihn weniger von sich selbst entfernen als die weite Reise, die großen fremden Städte, die er nur besuchte, um sie zu sehen und sie sehenswürdig zu finden. Im Mittelpunkt seiner Ausflüge standen nicht die Straßen, Bauwerke, Gärten und Säulen, im Mittelpunkt stand einzig sein unentwickeltes, mangelhaftes Interesse daran, der quälende Schwund an Beeindruckbarkeit, der sich vor Ort, vor den Kostbarkeiten, den Denkmälern der Fremde jedesmal einstellte. Sein borniertes Erleben war es, das ihn am meisten befremdete und ermüdete.
Er dachte: indem ich meine Erkundungsgänge vornehme, kehre ich in die ewigen touristischen Runden ein, die wie magische Pfade sind und mich der Kraft zu einer einzigen besonderen Wahrnehmung berauben. Diese Pfade unterströmen den Einzelgänger mit einer universellen Gleichgültigkeit, gegen die er kaum Widerstand aufbieten kann. Er sah sich dann zuweilen unterwegs wie der gefangene Greis vormals in der Spandauer Festung, der auf seinen Hofgängen schon mehrfach die Erde umrundet hatte.
Warum bin ich hier? Warum bin ich ausgesetzt in der Mitte all derer, die hier so offenkundig und so unberührbar heimisch sind? Die ihre Kirchen, Plätze, Caféhäuser, Gassen und Brunnen nicht angaffen müssen, sondern mit Gewohnheit erfüllen, sie benutzen und leicht übersehen dürfen. Die heimische Welt, die man bei sich selbst zu Haus niemals zu spüren bekommt, hier läuft sie ab vor dir, vordergründig und unantastbar wie ein Film. In der Trägheit des Trottens, im Zerfall des Sehens erhöhte sich das Begehren, und er suchte die schönen Gesichter der Entgegenkommenden, der Verkäuferinnen oder der Käuferinnen, mehr war im Grunde nicht zu unterscheiden, im Augenblick der intimen Zuwendung, in der plötzlichen Begegnung mit ihm, dem Fremden, zu erraten. Alles reizte doppelt in der flimmernden Interesselosigkeit. Wenn also die Fremde die Gesamtheit alles Heimischen ist außer dir, so sagte er sich, dann gibt es nur ein Abenteuer, das sich hier lohnt, und das ist, einen Fuß in ihre Tür zu kriegen … Wo Worte und Verbindungen fehlen, suchen es eindringliche Blicke allein zu schaffen. Jedoch bei einem Film, dieser unnahbaren Haut, kann man von außen niemanden zum Innehalten bewegen. Man wird nicht einmal bemerkt. Zu Hause ist man nicht heimisch, in der Fremde sind es die anderen. Wo soll man hin? Man kann versuchen am Ende des Trottens, abends, einige Worte mit dem Hotelportier zu wechseln, der englisch oder französisch versteht. Das kann Wunder wirken, große Erleichterung schaffen, wenn man sich kurz vor dem Zubettgehen noch einmal als sprechender Mensch bewährt hat. Vielleicht nur, um eine Flasche Rotwein aufs Zimmer zu bestellen. Funktionslust. Es klappt. Um zehn Uhr ist der Abend noch sehr früh (wenn man sich nicht gerade im Ostblock oder in Zürich aufhält). Es wird zur Qual, sich vorzustellen, wie aus allen Schlupfwinkeln das erfrischte Leben in die Straßen treibt, das man bereits um sechs Uhr gesucht hatte, als es jedoch nur geschäftig und abgespannt hatte sein können. Aber nun nichts mehr. Nicht wieder hinunter und am Film entlang. Man hat genug gesehen. Und genug Blicke tun jetzt noch weh, die alle gebeugt, unterworfen wurden von Mauern, dunklen Augen und teuren Gemälden. Morgen früh ist eine Busfahrt angesetzt um achtuhrdreißig, nach dem Frühstück ohne deutsches Brot. Der Tag ist gut verplant, die Zeit gestreckt und hängt nicht durch. Es wird nicht ganz unwichtig sein, wer im Bus neben einem sitzt. Die Tour soll viereinhalb Stunden dauern. Man wird wiederum nichts sehen. Vor den Dingen wird man die letzten geringen Kenntnisse verlieren. Die Ahnungslosigkeit und Stumpfheit vor diesen unzugänglichen Orten, den Sehenswürdigkeiten, bei denen man abgesetzt wird, ist so geheimnisvoll und dicht geballt, daß eigentlich im nächsten Augenblick der Umschlag in ein fremdartiges Erkennen, eine geschichtliche Entrückung erfolgen müßte. Dazu kommt es jedoch nicht: die Gemeinschaft der Gaffenden, der mittelmäßig Aufmerkenden, mittelmäßig Informierten, mittelmäßig Erfreuten und Einfühlsamen, die Gemeinschaft mit diesen leichten Besichtigern, die weder ganz ergeben noch ganz vergeßlich sind, die sich die Dinge allesamt verkleinern und einreihen können, die ein Ding bereits haben, wenn sie nur die geringste Ähnlichkeit mit einem anderen, ihnen bekannten daran entdecken, die sich vollkommen gewiß sind, daß dieses seltene, erlesene Ding ihnen, den Massen, gehört und folglich nur von den mittelmäßig aufgeklärten Massen auf die angemessene, in der Geschichte bisher einmalige Weise verstanden werden kann – diese Gemeinschaft verschluckte sein Bewußtsein. Das war alles.
Der Leser blieb daraufhin wieder zu Haus. Offenbar hatte er aber doch einen ersten richtigen Schritt unternommen, denn mit Hermetia, dem Plaggeist im Buch, war zweifellos ein ranghöheres Wesen zu ihm geschickt worden. (Welche Hierarchie in der sonderbaren Versuchung, die ihm angetan wurde, und in wessen Namen diese überhaupt herrschte, blieb ihm jedoch weiterhin undurchsichtig.) Zwar lief auch das Flüstern und Drängen dieser Gesandten auf denselben Befehl hinaus: das Buch zu schließen, das er gerade las, doch stellte sie dem Nicht-Lesen nun ein festes Ziel in Aussicht, und dieses war sie selbst, ihre leibhaftige Gesellschaft. Allerdings, im Vergleich mit dem einsilbigen, im Dunklen kauernden Swedenborg-Mann erwies sich die sehr gesprächige Hermetia als die weitaus lästigere Störung. Um sich ihrer Zudringlichkeit zu entziehen, benutzte er den nächstliegenden Ausschlupf und suchte Zuflucht in der zentralen öffentlichen Bibliothek. Natürlich würde er ihr auch an diesem Ort nicht unerreichbar sein. Aber da es hier nie ganz still war, sollte es ihr nicht so leicht gelingen, mit ihrer staubfeinen Stimme aus der Mitte des Buchs, in das er jeweils vertieft war, bis an sein Ohr zu dringen.
Literatur mag zu mancherlei nützlich sein. Gewiß dient sie auch dazu, daß sich der Mensch während seiner eigenen geringen Lebensspanne einen zweiten, größeren Zeitraum erschaffe, insofern er, was in Wirklichkeit vielleicht hundert oder mehrere hundert Jahre entfernt voneinander entstand, auf seiner Tischplatte genauso wie in seinem Geist enge zusammenrückt und in eine auffordernde, beunruhigende Nachbarschaft versetzt. Auf diese Weise durchlebte ein so gewaltiger Leser wie Aminghaus, der, außer dem spärlichen Grüßen morgens, wenn er die Bibliothek betrat, kaum einen Menschen beachtete, die Ideen von Fortschritt und Niedergang, von Hoffnung und Empörung, Verdammnis und Erlösung quer durch die Zeitalter in der gedrängtesten Folge, und dabei löste sich das geschichtlich Gebundene von seinem Grund und verwob sich ihm zu einem nervlichen Einerlei; selbst das Feinste, Tiefste und Unvergänglichste der Kulturen enthüllte im Tempo des Lesens seine letzte bittere Wahrheit: eine unerhörte Vergeblichkeit. Zuletzt waren es eben nur schöne Flausen, die durch die Geschichte tanzten, sehr viel Schönes, gewiß, aber nichts darunter, an das man sich auf Dauer halten konnte – jedenfalls, wenn man immer weiterlas.
In Wirklichkeit zog ihn das große Totum simul, das Megagedächtnis, in dem er dahinstrudelte, immer tiefer in die Windungen einer Zerstörung hinein, bis ans Herz der Erschütterung, immer tiefer hinein in die Ruinenstadt der Erzählung, denn dies hier war ihre Nekropole, wo alles miteinander hauste, wie in den gewaltigen Wandelhallen, die man jetzt draußen vor den Städten errichtete zum Kaufen, Spielen, Geschäftemachen, mit Eisbahnen, Kinos, Gräbern und Zoo, alles unter dem Lichtdach für immer. Wer nicht in der Halle geht, den straft die Zeit. Die huschenden Geister, die stehende Geschichte, Wahn und Bewahrung, Verenden in einem dunklen Zimmer und Empfänge in einem festlichen Spiegelsaal, das endlose Nebenan. Der Zuspruch des Weisen und der Biß einer wollüstigen Zecke im Busch. Einst, Jetzt, Nie, demokratisch vereint, die Toten, die Unsicheren zwischen Tod und Leben und die Erfundenen. Die Erloschenen in ihrem blühenden, goldschimmernden Damals und die Jetzt-Chimären, die mit winzigen Fuchsköpfen aus ihren Schneckengehäusen lugen. Und all das weitläufige Volk von Helden und Krüppeln, Mädchen und Priestern, Nachtpförtnern und Dschungelkindern, sarabanda notturna, girotondo di una compagnia immortale. Angestellte und Führer des erdumkreisenden Traums, Atem-Hülle des Geistes, unsere Nähr-Zeit aus etwas, das es nie gab und niemals geben wird.
Und doch beschlich ihn manchmal der Verdacht, daß die Große Bibliothek ihm etwas verbarg, das er nie entdecken dürfte.
»Ich habe den Wälzer gewälzt, ich habe die Blume im Album gewendet: ich habe nie die Kehrseite gefunden, die dunkle, wo die Asseln hausen. Jedes Umschlagen brachte ein neues Vorderblatt. Vielleicht rückwärts der letzten Seite, die ich lesen kann, beginnt alles ein Ungeziefer gewesen zu sein.«
*
Da saß er nun als der letzte Leser des Tags allein am langen Tisch der Bibliothek. Durch die trüben Fenster der Galerie brach die sinkende Sonne einen schmalen Lichtsteig, der über Buchrand und Tischplatte hinab auf das zerstoßene Parkett führte. Im Prismenrauch schwebte die feine Last seines trockenen Atems, winzige Sicheln und Grieße des Staubs schimmerten wie galaktische Schleier.
Er hatte beide Hände flach auf die Buchseiten gelegt. Er zögerte vor dem klaren und nahen Glück dieser Zeilen, die sich jeder eifrigen Kenntnisnahme, jeder raschen Nutzung wie Elfen entzogen. Ein sanftes Nachgeben seines Geistes mußte er abwarten, eine innerste Bereitschaft zum Nicht-Verstehen.
Das Buch – das einzige Wesen, vor dem der heutige Mensch noch den Blick niederschlägt, niederschlagen muß! Alles Höhere sonst wird geradeaus besehen, ohne Scham und Scheu!
Es gab noch eine andere Leiter als das geschliffene Licht, das von draußen eindrang. Sie hing an einer Schiene vom oberen Rand der Galerie. Dort oben war es dämmerig jetzt, und dunkle hohe Folianten ragten wie Föhren auf dem kahlen Berg. Aus dieser Abgeschiedenheit, in die der Lesesaal um jene Stunde getaucht war, und aus der Stille, die erst recht geräumig wurde, wenn draußen in der Garderobe die Wärter plauderten, aus einer spürbaren Hohlstelle in der gesamten Ereigniswelt stiegen lang und länger, Sprosse für Sprosse hinab die hohen Beine, die spitzen Absätze, die burgunderroten Schuhe, der enge, geschlitzte Rock, der erhabene Rücken, der weiße Nacken, das aufgesteckte platinblonde Lockenhaar – trat hervor die hellste je aus dem Dunkeln niedergestiegene Frau.
»Ich habe Sie nicht bemerkt. Ich dachte, es wäre niemand mehr hier«, sagte sie noch auf der Leiter, wobei sie anhielt und auf Aminghaus herabblickte. »Ich habe dort oben Stunden gewartet, aber er kam nicht.«
»Warum haben Sie nicht gelesen?« fragte er erstaunt.
»Ich habe gewartet, ich war beschäftigt. Wir waren hier verabredet schon für den frühen Nachmittag. Ich habe die Buchreihen durchgezählt von links nach rechts, von oben bis unten. Ich glaube, er liest auch nicht gern. Wir lesen beide nicht gern. Aber so genau kannte ich ihn noch gar nicht! Und jetzt, fürchte ich, haben wir nichts mehr miteinander zu schaffen!«
Sie ging, sie wiegte sich herbei. Wahrhaftig, sie gehörte nicht in diesen Raum, sie querte eine fremde Welt!
Sie setzte sich leicht zu ihm über die Tischkante, schlug die Beine übereinander und klappte den linken Schuh auf und ab. Sie schien rundum unschlüssig und nur allzu bereit, für die geplatzte Verabredung irgendeinen Ersatz zu finden. Dies spürte Aminghaus und es machte ihn beklommen. »Lesen wir«, sagte er plötzlich leise und verwirrt, »lesen wir hier. Lesen wir augenblicklich. Sie werden sehen, selbst Platon zu lesen ist weitaus einfacher, als eine U-Bahn-Karte zu lösen am Automaten …« Da mußte die Frau auf seinem Tisch lachen, aber sie lachte ihn nicht aus, es klang etwas Schönes, Gläsernes, Fernes aus ihrem Mund.
Aber war sie es etwa – war das vielleicht Hermetia, Hermetia ohne Schrift, wie sie sich ihm für einen nahenden Tag angekündigt hatte? Oh nein! Sie war es noch lange nicht. Nur eine ihrer vorderen Botinnen, Wegweiserinnen, in deren Folge er schließlich bis zu ihr, bis ins Haus der Verführerin selbst gelangen sollte. Aber seltsam! Ihm schien, die Mittlerin könnte ebensogut bereits die endliche Geliebte sein, so wie in burlesken Romanen bisweilen der Held die Quartiermacherin heftig und gerne verwechselt mit der später eintreffenden, heimlichen Braut. Ja, er folgte ihr, der herabgestiegenen Blonden, er konnte ihrer Anziehung nichts mehr entgegensetzen. Er ließ das Buch aufgeschlagen und unverstanden auf seinem Platz zurück und schnürte hinter der elegant und frei den Käfig des Geistes durchschreitenden Gestalt. Natürlich verlor er draußen sehr bald ihre Spur. Auf der Straße, unter dem Verkehr der vielen Menschen, die er nicht zu unterscheiden geübt war, verschwand sie ihm auf einmal zwischen vielen ähnlichen. Aber sie hatte bereits ihre Aufgabe erfüllt, er war vom Tisch und Buch fortgebracht, er irrte umher. Denn ihrem Einfluß allein war es zuzuschreiben, daß er an den folgenden Tagen mit einer nie gekannten Unruhe die Stadt durchstreifte, nicht etwa in der Hoffnung, sie wiederzusehen, sondern vielmehr um ›innerlich‹ voranzukommen, wie er meinte, um mit dieser Rundung, die auf seiner Tischplatte geruht hatte, und mit diesem sicheren Auge, das mit einem einzigen Aufschlag sein Versteck ausgehoben hatte, irgendwie ins reine zu kommen …
Die Straße
»Nach einer solchen Arbeit wirst du erst einmal in ein tiefes Loch fallen.« Man hatte mich gewarnt. Es war dann auch genauso gekommen. Ich wußte nichts mit mir anzufangen. Tagsüber lief ich in der Stadt herum, suchte mir die Zeit in Cafés und Spielhallen zu vertreiben, in Kinos, Parks und Kaufhäusern. Am Abend dann, ganz zufällig und doch unvermeidlich, fand ich mich in der Nähe des Theaters ein. Ich erkundigte mich nach dem Kartenverkauf, ich beobachtete den Zulauf des Publikums, ich besuchte die Schauspieler in ihren Garderoben, ich saß in der Kantine mit den Bühnenarbeitern beim Kartenspiel, oft bis in den frühen Morgen.
Aber irgendwie gehörte ich nicht mehr dazu. Meine Inszenierung war nun in den gewöhnlichen Betrieb des Theaters übergegangen. Was auf der Bühne geschah, erschien durchaus als das eigene Werk der Schauspieler, kaum ein Zuschauer hätte hier nach dem Regisseur gefragt. Die neuen Wagnisse, die die Schauspieler Abend für Abend mit guten oder weniger guten Vorstellungen, mit wachem oder stumpfem Publikum bestehen mußten, hatten längst das intime Abenteuer verdrängt, das uns über sechs Probenwochen so eng und schonungslos zusammengeführt hatte. Zwar empfingen mich die Schauspieler gern und behandelten mich freundlich – schließlich hatte unsere Aufführung wider Erwarten doch noch einen mittleren Erfolg erzielt –, aber ich spürte wohl, wie unsere Fühlung bald nachließ und vager wurde. Schon waren sie in neue Proben eingespannt und hatten sich einem anderen Seelenführer anvertraut.
Zwei- oder dreimal hatte ich mir die Vorstellung noch angesehen, aber es hatte mich nur gequält. Ich war nicht imstande, eine nützliche Abendkritik zu machen. Ja, es fiel mir sehr schwer, aus dieser engen, bewegten Gemeinschaft, in die ich mich begeben hatte, so plötzlich wieder ausgeschieden zu sein und vollkommen alleine zurückzubleiben. Ich fühlte mich hundeeinsam. Von bitterer Enttäuschung, von süchtiger Anhänglichkeit gleich stark geplagt, verfolgte mich meine erste größere Theaterarbeit mit den zwiespältigsten Nachwirkungen. Immer, wenn ich unterwegs war und ringsum die blöde Gegenwart erblickte, kamen mir in dichten, abgerissenen Schwaden die dunkelsten und schwierigsten Tage der langen Proben in den Sinn, und es regnete dann noch einmal all die schreckenerregenden Vorzeichen, die tausend Widrigkeiten, Infamien und Wechselfälle auf mich hernieder, die ich hatte ertragen müssen, und jedesmal war es so, als stünde mir das Ganze erst noch bevor. An die spätere, dann doch eher sieghafte Schlußphase erinnerte ich mich dagegen sehr viel seltener. Nein, Erinnerung war es ja nicht, meine Nerven käuten wieder, es war die reine Vergegenwärtigung. Oder um es mit einem Lieblingswort der Theaterleute zu sagen: intensive Zustände ließen mich Furcht und Krise dieser Tage in ungemilderter Augenblicklichkeit noch einmal erleben. Gewiß war auch dies eine Spätfolge des ungewohnten und absonderlichen Zeitmaßes der Wiederholung, welches das Theater beherrscht und dem ich mich wochenlang unterworfen hatte. Diese beschwörenden Wiederholungen, die gleichwohl Stück um Stück etwas zutage befördern, entstehen lassen oder auch nur etwas zurückgewinnen wollen, das vielleicht ganz zu Anfang, auf den ersten Proben bereits ›da war‹, zum Greifen nahe, vollendet, jedoch nur im glücklichen Vorschein. Oft genug sorgt ja eine ganze langwierige Inszenierung einzig dafür, daß am Ende die überraschende Höhe des Anfangs, der Anfang selber wiedergefunden, erfüllt und festgehalten wird. Das klingt wahrhaftig leichter als es ist. Ich kann es bezeugen. Mir jedenfalls fiel es sehr schwer, mich in der nötigen Geduld zu üben und in die runde Zeit hineinzufinden, oder sagen wir: in die spiralförmige, die keinen unumwundenen Fortschritt kennt und gegen die gerichtet am Theater selbst der heftigste Überschwang, die erhellendste Idee, der eisernste Wille nicht das geringste vermögen.
Wie aber sollte es nun weitergehen? Ich hatte meine Arbeit beendet. Ich war ein Regisseur geworden. War ich damit nicht ans Ziel meiner Wünsche gelangt? Ich dachte jetzt eher: ich hab’s hinter mir. Gerettet, geschafft. Nichts wie weg. Auch dachte ich nun häufiger wieder an die verzweifelten Versuche meines Vaters, mich von dieser Reise, dieser fluchwürdigen, nach Köln, von dieser Höllenreise zum Theater abzuhalten. Bis zum letzten Augenblick hatte er mich nicht losgeben wollen, hatte mich zu Hause in Kandern nicht nur an den Bahnhof gebracht, sondern war auch noch mit in den Zug gestiegen und bis Freiburg mitgefahren, unablässig bemüht, mich zur Umkehr, zur Aufgabe meiner törichten Absichten zu bewegen.
»Tu es nicht, Leon. Ich bitte dich. Laß dich doch nicht auf diese Albernheiten ein.« Er hielt die Schauspielkunst noch für weit überflüssiger als das Turmspringen oder das Dressurreiten. »Es genügt, die Klassiker zu Hause zu lesen. Man verdirbt sich bloß die Fantasie, wenn man ins Theater geht. Dort herrscht der Firlefanz, das Showgeschäft.« Das war nun seit langem seine Meinung und ihr getreu hatte er, solange ich mich erinnern kann, niemals eine Theateraufführung, und erst recht nicht an den Städtischen Bühnen, besucht. Folglich war auch ich als der Nachgeborene seiner beiden Söhne erst verhältnismäßig spät mit dem Theater in Berührung gekommen. Anders als es bei meinem Bruder geschehen war, wollte er meine Lenkung und Bildung nicht der Mutter überlassen, sondern drängte sie viel zu früh von mir und verschloß mich eifersüchtig in seiner Obhut. Die rein väterliche Erziehung führte mich denn auch unweigerlich in die einzige Richtung, die ihm überhaupt vertraut war und in der er furchtlos voranschritt, nämlich geradewegs auf sein eigenes Lehrfach zu, die Religionsgeschichte. Zu der Zeit, da es zwischen uns über meinen Werdegang wohl nicht zum Zerwürfnis, aber doch zu nervösen Meinungsverschiedenheiten kam, war er längst emeritiert, fuhr jedoch noch zweimal wöchentlich in sein Freiburger Seminar und las über koptisches Christentum. Seine späten Jahre waren ausschließlich der Montanus-Forschung gewidmet, seinem eigentlichen Spezialgebiet, und hierin hatte er auch mich, nachdem ich erst wenige Semester in seinem Fach studiert hatte, zu seinem Gesprächspartner und dann zu seiner wissenschaftlichen Hilfskraft ausgebildet. Mit kaum 22 Jahren war mein Horizont erfüllt von frühchristlichen Ketzern und Anachoreten, von Säulen- und Höhlenheiligen, und während anderswo meine Altersgenossen zum Aufruhr riefen, überall Väter stürzen und Völker befreien wollten, da ergab ich mich geduldig dem Studium der aramäischen und koptischen Sprache, da entzifferte ich an der Seite des Vaters brav die gerade erst entdeckten Schriftrollen gnostischer Evangelien. Die große Leidenschaft, mit der der alte Mann seine Forschung betrieb, seine erzählerische Begabung und Fantasie, mit denen er mir den trockenen Gelehrtenstaub von den Dokumenten blies, hatten ihre Wirkung auf mich nicht verfehlt. Er erreichte es bald, daß ich mich freiwillig und neugierig in jene christlichen Geheimlehren vertiefte, in denen so viel von weiblicher Weisheit, von ›Gott der Mutter‹ die Rede war, von einer allmächtigen erotischen Gnade, wie ich es denn empfand.
Jedoch, ich mußte für einen Ausgleich sorgen. Ich war bereit, den gestrengen Ansprüchen an meinen Dienst zu genügen, aber nicht, mich vollkommen von ihnen beherrschen zu lassen. Ich war durchaus zu der Überzeugung gelangt, daß ich nicht für die Wissenschaft taugte und auch die Arbeit des Vaters nicht nach dessen Tod fortsetzen wollte, wie er es doch heimlich erhoffte.
In Freiburg hatte ich damals einen jungen Dramaturgen kennengelernt, einen mir ganz entgegengesetzten Charakter, einen rundum kritisch eingestellten Menschen, der sich von Herzen für kaum etwas erwärmen konnte, am wenigsten für das Theater, an dem er selbst beschäftigt war. Doch ich suchte ihn häufiger auf. Es interessierte mich nicht nur, seine Meinungen und kritischen Lebensbeschwerden zu erfahren, sondern auch, was denn seine Tätigkeit an den Städtischen Bühnen eigentlich ausmachte. Durch ihn erhielt ich eines Tages die Aufforderung, vor einigen Schauspielern, die gerade Shaws ›Heilige Johanna‹ einstudieren wollten, ein Referat über Stimmen und Visionen, über Seherinnen und Gottbesessene zu halten. Hierzu mußte man mich nicht lange überreden. Ein paar Tage später stand ich, sorgfältig vorbereitet, vor dem Ensemble und hielt meinen kleinen Vortrag. Offenbar gelang es mir, ihr Interesse zu gewinnen, denn sonst hätten mich nicht hinterher einige von ihnen, darunter der Regisseur, so eindringlich gebeten, auch die kommenden Proben zu besuchen und sie, falls ich Gefallen daran fände, mit fachlicher Beratung zu begleiten. Nur zu gerne willigte ich ein, ich fühlte mich herzlich begrüßt und zutiefst hingezogen zu dieser anderen, gemeinschaftlichen Welt des Schauspieltheaters. Von nun an ließ ich mein Studium merklich in den Hintergrund treten und teilte meine Arbeit gewissenhaft zwischen der häuslichen Gelehrtenstube und der Probebühne des Städtischen Theaters. Es dauerte auch nicht lange und ich hatte mir nebenbei eine ganze Reihe von bühnenpraktischen Kenntnissen erworben. Ich lernte mit einem allesfressenden Eifer und Ehrgeiz. So war es denn nicht weiter verwunderlich, daß man mir schon für eine der nächsten Produktionen die Stelle eines Regieassistenten anbot. Mein Interesse und meine grundsätzliche Befähigung für das Theater erhielten durch diese neue Anforderung einen großen Aufschwung, und meine wachsame Mitarbeit brachte mir im Ensemble Freundschaft und Zutrauen ein. Ein halbes Jahr darauf sollte ich eine erste eigene Regie übernehmen, umständehalber, denn der vorgesehene Mann, ein zwischen ›befreitem Theater‹ und radikaler Theaterverneinung schwankendes Talent, hatte es kurzerhand vorgezogen, in den – wie es damals hieß – politischen Untergrund zu verschwinden. So standen nun auf einmal drei leibhaftige Schauspieler fordernd vor mir und erwarteten, daß ich etwas Aufregendes mit ihnen anstellen würde. Ich sollte innerhalb von drei Wochen ›Fräulein Julie‹ von Strindberg inszenieren.
Bis hierher waren meine Abschweife zum Theater unter der kritischen Duldung des Vaters geschehen, wenngleich seine gegrummelten Beschwerden, daß die gemeinsame Arbeit zusehends Schaden nähme, nicht zu überhören waren. Er war wohl der Meinung, daß man einem jungen Menschen schlecht jede Art von Ablenkung und Unterhaltung abschlagen könnte. Daher wollte er mir das Theater als beiläufige Liebhaberei gestatten, zum Ausgleich für die harte Wissenschaftsfron. Die Mutter hingegen hatte längst verspürt, daß meine Neigungen tiefer reichten, und heimlich unterstützte sie diese sogar. Der einseitige und übermächtige Beschlag, unter den mich der Vater genommen hatte, schien ihr auf die Dauer eine Gefahr zu bedeuten. Sie fürchtete um meine selbständige Fortentwicklung, auf welchem Gebiet diese auch stattfinden würde. Sie setzte ein blindes und warmes Vertrauen in mich. Es hätte mich auch wunderbar festigen und vorantreiben können, wenn nicht der schwere, dunkle Flügel des Vaters sich schon in aller Frühe so dicht über mich gelegt hätte.
Mein Verhältnis zu ihm verschlechterte sich nun alle Tage. Zu gewissen Zeiten war ich durch meine Theaterarbeit so stark in Anspruch genommen, daß ich zwangsläufig den Dienst am großen Montanus-Werk einschränken mußte. Der alte Mann sah nun schon unsere offene und endgültige Trennung heraufziehen, machte mir bittere Vorhaltungen und zeigte sich überhaupt unleidlich und griesgrämig.
Aber meine ›Fräulein Julie‹ hatte Erfolg! Die Inszenierung bekam sehr gute Kritiken in der Lokalpresse und erwarb sich sogar einen gewissen Ruf über die Stadtgrenzen von Freiburg hinaus. Vor allem Theaterleute kamen, zuweilen aus entfernten Städten, um sich die vielversprechende Anfängerarbeit, wie es hieß, anzuschauen.
Unter ihnen befanden sich eines Abends auch die beiden ersten Schauspielerinnen des Kölner Theaters, Margarethe Wirth und Petra Kurzrok, die mir wohl bekannt waren, wenngleich ich sie nie auf der Bühne gesehen hatte. Ich erhielt Nachricht von meinem Intendanten, daß mich die beiden nach der Vorstellung in der Halle ihres Hotels zu sprechen wünschten. Recht beklommen war mir zumute, als ich mich schließlich dort einfand. Ich lief etwas tapsig umher, konnte aber die berühmten Gestalten nirgends entdecken. Ich wußte nicht, wie ich meine Unruhe verbergen sollte, mochte aber auch nicht den Gelangweilten spielen und mich in eine Zeitung vergraben. Da bemerkte ich plötzlich hinter einem dichten Spalier von Gummibäumen zwei blitzende Augenpaare, die keine Bewegung von mir ausließen und mich offenbar schon seit längerem beobachtet hatten. Natürlich, es waren die beiden Schauspielerinnen, die dort hinter dem Grünzeug wie die Raubkatzen lauerten und jeden meiner unsicheren Schritte überwacht hatten. Ich trat ihnen also entgegen, und sie begrüßten mich mit freundlichen, förmlichen Worten. Ich sah, daß sie ein sehr ungleiches Frauen-Paar abgaben. Margarethe war die größere, damenhaftere Erscheinung. Ihr langes rotblondes Haar fiel offen über ihre Schulter, sie trug einen plissierten dreiviertellangen Rock, eine graue Seidenbluse unter einer dunklen, ärmellosen Weste. Sie hatte sich zweifellos für den Theaterbesuch eigens umgezogen. Anders die Kurzrok, die ihre Arbeitskleidung nicht gewechselt hatte und in ihrem schäbigen Jeansanzug sich beinahe etwas gewollt gegen den schlichten bürgerlichen Stil ihrer Kollegin abzusetzen suchte. Gleichwohl gehörten die beiden aufs engste zusammen, das war nicht nur überall bekannt, man konnte es auch auf den ersten Blick selber bemerken. Sie bildeten ein ebenso schmiegsames wie eifersüchtiges Gespann. Pat kam mir überraschend klein vor, zierlich und zäh, von fast knäbischer Statur, weshalb wohl auch die Koseform des ›Patrick‹ an ihr hängengeblieben war und ihren weiblichen Vornamen verdrängt hatte. Dunkelblonde lange Ponyfransen verdeckten ihre starke, gewölbte Stirn. Am Hinterkopf war das kurze Haar mit einem gewöhnlichen Gummiring zu einem schlappen Zöpfchen zusammengefaßt.
Es dauerte nicht lange und ich erhielt bereits eine Kostprobe ihres feinentwickelten Paar-Spiels. Ohne Umschweife begannen sie über ihren Theaterbesuch zu sprechen und führten sich dabei so auf, als sei ich gar nicht anwesend. Sie nahmen die Sache wahrhaftig gründlich durch. Eine solche Kollegenkritik kann sich auf eine sehr zartfühlende und schlangenhafte Weise an denjenigen heranschleichen, der schließlich das eigentliche Opfer sein soll. Zunächst hält man sich ein wenig beim Bühnenbild auf, findet daran manches problematisch, nicht sehr hilfreich, letztlich schrecklich. Daraufhin riskiert man die eine oder andere launige Frage an das Stück, sieht seinen heutigen Aussagewert verblassen, läßt es aber dabei schnell wieder bewenden, denn hier hat der Gegenstand womöglich schon härtere Prüfungen bestanden, als sie der eigne kritische Geschmack vornehmen könnte. Dann muß es wohl an der unzureichenden Übersetzung liegen, daß das alte Werk keine durchschlagende Wirkung erzielen konnte. Jetzt nähert man sich bereits der heiklen Zone, in der es gewisse schauspielerische Schwächen zu beklagen gibt. Dabei werden die Kollegen als solche säuberlich geschont, es wird vielmehr die Besetzungsfrage aufgeworfen oder schlimmstenfalls eine glatte Fehlbesetzung festgestellt. Hiermit ist man endlich in den Verantwortungsbereich des Regisseurs vorgedrungen, und nun kommt es darauf an, wer was bei wem ausrichten möchte. Denn alles bis dahin Vorgebrachte kann nunmehr zum höchsten Tadel des Regisseurs wie auch zu seiner bedingten Entschuldigung zusammengefaßt werden. Die zwei berühmten Schauspielerinnen hatten dieser Art unsere ›Fräulein Julie‹ Punkt für Punkt durchgesprochen, als sie sich schließlich mit besonderer Gewichtung auf dem eigentlichen »Dilemma« des Abends niederließen und mit dem jungen, sehr jungen, allzu jungen Strindberg-Regisseur ins Gericht gingen. In dessen menschlicher, weltlicher und erotischer Unerfahrenheit fanden sie denn auch die Ursache dafür, daß man auf der Bühne zwar einer reizenden Fülle von formalen Übungen, aber nur einem Minimum an seelischer Handlung beigewohnt habe.
Sie sprachen nach wie vor kunstvoll einander zugewandt, in geübter Wechselrede, in der ein heftiges gegenseitiges Beipflichten nur zu oft zu einer schrecklichen Verschärfung ihrer Urteile führte. Hin und wieder traf den Delinquenten dabei ein rascher Seitenblick, und er traf ihn wie ein Prankenhieb. Nein, die verehrten Frauen ließen wahrhaftig kein gutes Haar an meiner Inszenierung. Ich fand aber ihre Schmähungen ungerecht und übertrieben und wäre am liebsten heulend davongelaufen. Alle frühere Anerkennung, Presselob und Talentbeweis waren mit diesem Verriß hinfällig geworden und in den Staub gestürzt. Da aber unterbrachen sie plötzlich ihren Bund und öffneten sich zu mir hin. Nun legten sie auf einmal eine schamlose Liebenswürdigkeit an den Tag. Aus heiterem Himmel erklärten sie, wie sehr ihnen daran gelegen sei, gemeinsam mit mir in Köln ›Die Zofen‹ von Genet zu erarbeiten.
Halb Kandern sollte an meinem Abschied von zu Hause und meiner großen Lebensveränderung Anteil nehmen, da mein Vater es sich nicht verkneifen konnte, mir noch im Bahnhofswartesaal vor allen Leuten eine anstrengende Szene zu machen.
»Der Regisseur!« rief er immer wieder, »der Regisseur! Was ist das überhaupt für einer? Ein Handlanger und ein Affendressierer, das ist er vielleicht, aber ganz bestimmt kein schöpferischer Mensch. Er ist nicht einmal ein richtiger Künstler!« Ich bat ihn, unbedingt leiser zu sprechen. »Du weißt ja gar nicht, wie wichtig heutzutage der Regisseur ist, Vater. Er ist der eigentliche Gestalter, er macht das Theater überhaupt erst zu einem Ereignis. Er kann sogar ein Visionär sein!« Nun mischte sich gleich unsere Nachbarsfrau ein: »Herr Professor, nun lassen Sie den Leon erst einmal losziehen. Man soll niemanden festhalten. Ich war mein Lebtag in keinem Theater, das dürfen Sie mir glauben, aber ich hab bei meinen sechs Buben immer darauf gesehen, daß sie sich rechtzeitig die Hörner abstoßen. Heute sind doch die jungen Leute viel besser dran. Warum soll er nicht nach Köln fahren, wo es doch ein besseres Theater gibt als bei uns hier. Vielleicht wird er noch einmal ein berühmter Mann, der Leon Pracht!«
Hierauf entgegnete der Vater erzürnt: »Berühmt! Was reden Sie da? Kennen Sie Dölger? Heiler? Reitzenstein? Na! Das sind berühmte Männer. Berühmt kann er auch in meinem Fach werden!«
Jetzt ging es lebhaft durcheinander, und beinahe jeder im Wartesaal teilte seine Ansichten zum Regisseursberuf mit, was immer er darunter verstehen mochte. Der Arbeiter vom Gaswerk, der neue Kinobesitzer, die Operationsschwester Frau Veldstein, sie alle stellten sich entschlossen hinter mich und nahmen an der starrsinnigen Haltung meines Vaters Anstoß. Er tat mir schon recht leid, wie er von allen Seiten getadelt oder mit Kopfschütteln bedacht wurde. Er setzte sich aber ungerührt über die leichtsinnige Parteinahme der Leute hinweg, beugte sich zu mir und beklagte sich nun leiser, aber dafür um so eindringlicher: »Du willst also unsere gemeinsame Arbeit endgültig im Stich lassen, mein Junge?« Ich erwiderte traurig, daß ich nun eben nicht für die Gelehrtenstube geschaffen sei und meinen eigenen Weg finden müsse. »Aber für das Theater bist du auch nicht geschaffen! Jedenfalls nicht von mir!« Meine Mutter überhörte es, und sie versuchte zwischen uns zu schlichten. »Nun laßt es endlich gut sein. Leon macht ja doch, was er will.« Ich wollte den Vater auf einen versöhnlicheren Ton umstimmen und versicherte, daß ich auch ins Theater als sein erster Schüler einkehren wollte und dort gewiß meine Kenntnisse von religiösen Festen und Riten zu nutzen wüßte. Er ging nicht darauf ein, er war viel zu aufgewühlt, viel zu beunruhigt über die bevorstehende Trennung. »Jetzt hast du schon einmal Regie führen können. Ist denn das nicht genug? Warum willst du jetzt auch noch in eine andere Stadt? Es ist nicht deine Sache, Leon, glaub es mir.«
Als er später in Freiburg aus dem Zug stieg und unter mein Abteilfenster trat, kam es auch mich hart an. In solch mutloser Verlassenheit stand er da vor mir, daß ich es kaum mitansehen konnte. Er hatte nun aufgegeben. Er mußte ertragen, daß er nichts mehr über mich vermochte. Wie er noch einmal den Kopf zu mir erhob, den schmalen, den grauen und feurigen Gelehrtenkopf, da lag eine stille und tiefe Erschrockenheit auf seinem Gesicht. »Sieh mich nicht so an«, bat ich streng, doch die Stimme sank mir in die Kehle. Leise und aus unerfindlichem Anlaß sagte er darauf: »Sorg, daß du kein Blatt vor den Mund nimmst, mein Junge.« Ich wußte nicht, was mir dieser halbe, vage Rat bedeuten sollte. Ich nickte aber und gab ihm die Hand. Es war aus der sanften Verworrenheit seiner Worte eine Verständigung hervorgegangen. Der Zug begann lautlos und gleitend die Fahrt. Der Vater hielt die Hand lange mit kleinem, tatterndem Gruß in die Höhe. Ein heftiges Winken aus ganzem Arm, das den Abschied gleichsam auswischen möchte, schien ihm nicht angebracht. Das blieb Kindern und Verliebten vorbehalten. Der alte Mann aber nahm den Abschied an, und seine Hand erhob sich nicht gegen die rasche Entfernung.
In Köln war man zu folgender Überlegung gekommen: Alfred Weigert, der erste Spielleiter am Haus und zugleich der Leib- und Seelenregisseur von Pat und Margarethe, sollte endlich Gelegenheit erhalten, seinen ›Wallenstein‹ in allen drei Teilen zu inszenieren. Unterdessen durften sich die verwaisten Protagonistinnen ihrerseits einen langgehegten Wunsch erfüllen, nämlich in zwei ebenbürtigen Rollen gemeinsam auf der Bühne zu stehen und ihr ganzes Können einmal ohne den großen Meister unter Beweis zu stellen. Selbstverständlich sollte es sich dabei um eine kleine Produktion handeln, irgend etwas im Kammerspiel, nicht unter aller literarischer Würde, aber doch zuerst mit dem Anspruch auf Paraderolle und Solistenpart. Es lag nahe, sich hierfür Genets ›Zofen‹ auszusuchen; und da die beiden Stars zudem noch die freie Wahl des Regisseurs hatten und sie unbedingt, wie es damals hieß, »neue Erfahrungen« machen wollten, hatten sie sich also auf die Suche nach dem jungen, aufstrebenden Talent gemacht. Was sie sich letztlich von mir versprachen, war mir nicht ersichtlich. Vielleicht erhofften sie sich einfach größere Freiheiten, als sie ihnen ihr Meister zugestand, und dachten, daß ich sie in ihren Unarten nicht beschränken, sondern nur unterstützen würde. Aber ich verstand mich keineswegs als ein angemieteter Tourneetheater-Regisseur. Ich hatte ja etwas vor, ich kam mit großem Programm.
Die dritte Person, die wir brauchten, um die Rolle der Gnädigen Frau zu besetzen, wurde mir von Pat und Margarethe sozusagen wärmstens aufgedrängt. Es handelte sich um eine ältere Schauspielerin, die beide in den höchsten Tönen lobten, obschon sie doch eigentlich den Typ der gutmütigen Amme vorstellte und gewiß niemals die brutale Härte aufbringen würde, niemals derart Idolfigur und Herrin sein würde, um das Mordgelüst der beiden Mädchen glaubhaft erscheinen zu lassen. Es war klar, daß diese Kollegin lediglich als milde Zugabe gedacht war. Pat und Margarethe wollten sich die Schlacht alleine liefern, und ich sollte wohl am ehesten die Rolle des Ringrichters bestellen, der für einen fairen Kampf zu sorgen hatte.
Jedoch: wie anders dachte ich selbst über meine Berufung zu diesen wunderbaren Künstlerinnen! Geradezu ein neuer Montanus wollte ich sein, und so wie dieser Visionär mit seinen beiden Prophetinnen, mit Priscilla und Maximilla durch die phrygischen Städte gezogen war, um die Herabkunft des neuen Jerusalems zu verkünden, so wollte auch ich mit meinen beiden Schauspielerinnen eine Erneuerungsbewegung mindestens des Theaters, der Schauspielkunst begründen. Während der vielen, einsamen Wochen, in denen ich mich auf meine Arbeit vorbereitete und die Inszenierung schon bis ins kleinste Detail voraussah und vorausbestimmte, verstärkte sich in mir der Gedanke, daß ich meinen Vormarsch mit Pat und Margarethe durchaus als Sendung aufzufassen hatte, als eine legitime Travestie des montanischen Dreier-Bunds. Dieser war mir durch die lange Arbeit mit dem Vater so vertraut geworden und saß mir als Sehnsuchts-Modell so tief inne, daß ich mehr und mehr zu der Überzeugung kam, die beiden Schauspielerinnen seien aus meinen Studien gleichsam wie ausgebrütet hervorgegangen. Ich glaubte wahrhaftig, daß ihr Erscheinen in meinem Leben nicht zufällig und abrupt, sondern durch ursprüngliche Verwandlung geschehen sei. Allzu leicht übersah ich dabei, daß der eigentliche Montanus des beglänzten Paars jedoch Alfred Weigert hieß, ihr Erwecker und Wundertäter, ihr Seelengeleiter; es gab ihn schon.
Ich wußte also genau, wie es auszusehen hatte, mein Theater, meine Zofen, mein ekstatisches Spiel. Ich nannte es nicht mit geringen Namen. Die Gegen-Welt, die Mythenwanderung, die Überschreitung, die Bühne als Eingangspforte zur Großen Erinnerung, Tanz der Reflexionen mit den Geistern, das Gebärden-Zeremoniell, die Lupe hinhalten, auf die Jagd gehen, den Zuschauer in den ›Hinteren Raum‹ locken, Zustände auslösen … Ach, die Begriffe türmten sich und schwankten. In meiner Konzeption spielte das Stück in einer nicht allzu fernen Zukunft. Eigentlich nach dem Zusammenbruch aller menschlichen Kommunikation. Die Menschen haben sich in ihre Zeremonien zurückgezogen, verkrochen, verkapselt. Die Spiele sind ihre seelischen Überlebensnischen. Der Ort: eine Höhle in der Zeit …
Du liebe Güte. Und was ist am Ende dabei herausgekommen? Eine Inszenierung, über die es in den Kritiken hieß, sie wäre im ganzen ein wenig bieder ausgefallen, trotz einiger überragender Schauspielerleistungen. Die eigentliche Überraschung des Abends sei weniger der junge Regisseur als vielmehr die Entdeckung, daß ein poète maudit veraltet, ein Genet staubgrau geworden sei. Und dafür hatte ich nun mit den höllischen und herrlichen Gewalten gerungen, war ich durch Ohnmacht und Kälte, durch Feuer und Sümpfe geschritten. Aber so ist wohl das Theater: ein gewundenes Instrument, in das man seine ganze Seele hineinblasen muß, um am Ende wenigstens einen kleinen geziemenden Ton herauszubringen. Mehr nicht, aber schon dafür braucht man eine große Puste.
*
Montag früh. Eine Stunde vor Probenbeginn bin ich ins Kammerspiel gekommen. Der Bühnenbildassistent und zwei Bühnenarbeiter haben eine Probendekoration hergerichtet, die in etwa dem entspricht, was ich mit Volker, dem Ausstattungsleiter, verabredet hatte. Es sieht abscheulich aus. Ich will nicht diesen Plüsch und Plunder auf der Bühne. Keinen stickigen Boudoir-Pomp, auch nicht mit Blumen überladen, selbst wenn ich damit gegen die Anweisungen des Autors verstoße. Mit V. alles noch einmal neu durchdenken! Dies hier ist nicht das abgewohnte Futur, das ich mir vorgestellt habe.
Was für eine lange Flucht ist dieser Zuschauersaal! Wie soll ich denn meine abgeschlossene Nische auf diesen schmalen Schlauch hin ausrichten? Theater, Geburt des Spiels, sollte doch immer vom Publikum halbwegs umrundet sein … In einer knappen Stunde beginnt nun unwiderruflich mein Abstieg zu den Geistern. Die Nervosität nimmt zu, die Beklommenheit, die nackte Angst – oder, um wie der Traum die Wörter beim Bild zu nehmen: die Angst, nackt dazustehen. Obschon bis an die Zähne bewaffnet mit Zetteln, Plänen, Skizzen, auf denen jede Stellung, jeder Gang vorgezeichnet ist, fühle ich mich plötzlich ungenügend vorbereitet. Werde ich schnell und angemessen reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes eintritt, wenn plötzlich Änderungen fällig werden, wie etwa jetzt beim Bühnenbild? Ich weiß doch, daß mich das Tatsächliche, wenn es mit voller Wucht in Erscheinung tritt und nicht der Vorstellung entspricht, jedesmal in eine tiefe Schreckenslähmung versetzt.