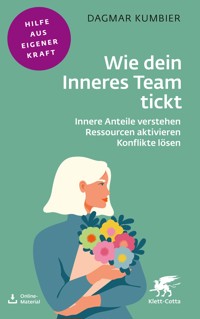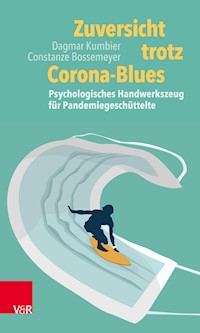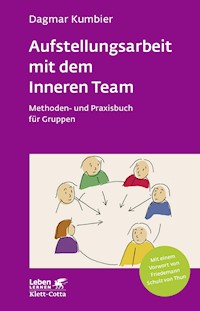10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der kleine Unterschied – und seine kommunikativen Folgen Kommunikation zwischen Frauen und Männern ist häufig nicht einfach, sie führt in der Partnerschaft wie im Beruf immer wieder in typische Sackgassen. Die Kommunikationspsychologie kann dabei helfen, diese Sackgassen zu erkennen und sich aus ihnen zu befreien. Die Methode des Inneren Teams macht verständlich, welche Persönlichkeitsanteile in Konflikten aufeinandertreffen, und sie öffnet Wege zu einer lebendigen, konstruktiven Kommunikation zwischen Männern und Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dagmar Kumbier
Sie sagt, er sagt
Kommunikationspsychologie für Partnerschaft, Familie und Beruf
Mit einem Vorwort von Friedemann Schulz von Thun
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Friedemann Schulz von Thun
VORBEMERKUNGEN
EINFÜHRUNG
Typische Sackgassen für Frauen und Männer
«Bring wenigstens den Müll raus!» Aufgabenteilung in Haushalt und Familie
«Ich erreiche ihn einfach nicht!» Gespräche in Partnerschaften
Die Spitze ist männlich: Die «gläserne Decke» im Beruf
Beliebte Erklärungen
Sind die Männer an allem schuld?
Back to the roots: Liegt die Wurzel des Übels in der Steinzeit?
Von der Schuldfrage zur Frage nach dem Zusammenspiel
Täter-Opfer-Modell und systemische Herangehensweise
Das Modell der Heim- und Auswärtsspiele
HEIMVORTEIL UND AUSWÄRTSSPIEL: DREI PERSPEKTIVEN AUF FAMILIE UND BERUF
1. ERSTE PERSPEKTIVE: KOMPETENZ, SELBSTVERTRAUEN UND INNERE BREMSEN
1.1 Mit Schwung auf die Karriereleiter?
Frauen im Beruf: Ein Auswärtsspiel
«Was hab ich schon zu bieten …»: Die ‹Selbstzweiflerin› als innere Bremse
Schreckensbild Mannweib: Haben Frauen Angst vor Erfolg?
Auf Erfolg gepolt: Männer in der Berufswelt
Warum Männer sich im Beruf mehr zutrauen
Erfolg macht sexy!
Der Preis des Erfolgs
1.2 Mythen und Fakten zur elterlichen Kompetenz
Die Mutterrolle als Heimspiel
«Frauen können das einfach besser!»
Der Heimspielvorteil
… Vater sein dagegen sehr!
Von den Schwierigkeiten, ein «richtiger Junge» zu sein
Familie als Auswärtsspiel
Die Abseitsfalle
2. ZWEITE PERSPEKTIVE: MACHT UND OHNMACHT
2.1 Wer hat zu Hause die Hosen an?
Wann ist ein Bad wirklich sauber?
Die Richtlinienkompetenz der Frauen in Partnerschaft und Familie
Der ‹Moralapostel›: Wie Frauen Macht ausüben und welchen Preis sie dafür zahlen
Warum Männer nicht dagegen ankommen
«Ich bin nicht dazu gekommen, was regst du dich so auf?!?» Wie Männer Macht ausüben
Der ‹Unschuldsengel›: Verweigerung und heimliche Sabotage
Warum Männer genauso anspruchsvoll wie Frauen sind
Machtkampf der Heiligen: Teufelskreise
Die Macht der Frauen als Tabu? Eine persönliche Randbemerkung
2.2 Der Kampf um Nähe
Machtkampf und Verletzlichkeit in Partnerschaften
«Nun sag endlich was!!!» Gespräche über Gefühle
Wenn der Teufelskreis eskaliert: Gewalt in Partnerschaften
Männer und der weite Weg vom Bauch zum Mund
Warum Frauen oft nicht begeistert reagieren, wenn Männer Gefühle zeigen
«Ich zeige was, was du nicht siehst!» Die Dynamik in Teufelskreisen
Frauensprache und Männersprache. Von verschiedenen Arten, Gefühle zu zeigen
Gefühlvoll – aber bitte kein Softie! Von widersprüchlichen Erwartungen an Männer
Gespräche über Gefühle als gemeinsames Lernfeld
2.3 Kampfplatz Büro
‹Kämpfer› und ‹PR-Experte›: Zur Dominanz männlicher Regeln in der Berufswelt
Warum Frauen nicht dagegen ankommen
Konkurrenz als Fremdsprache
Das Kindchenschema: Wie Frauen klein gemacht werden
«Ich Tarzan – du Jane!» Sexualität als Waffe
Autorität und Weiblichkeit: Ein Widerspruch?
Vom Mythos, dass Leistung der Weg zum Erfolg ist
Das Beziehungsohr als Stolperstein
3. DRITTE PERSPEKTIVE: PFLICHTBEWUSSTSEIN UND ROSINENPICKEREI
3.1 Von überarbeiteten Müttern und Tobepapis
«Ein Kind gehört zur Mutter!»
Was ist eine «gute Mutter»?
Der Blick über den Zaun: Warum unsere Nachbarn das ganz anders sehen
Können Mütter berufstätig sein?!?
Nicht nur sauber, sondern rein: Perfektionismus als Falle
Sind Väter anders oder faul? Zwei Perspektiven auf Männer
Erste Perspektive: Männer als Rosinenpicker auf Kosten der Frauen
Zweite Perspektive: Väter sind anders!
Die Gretchenfrage
3.2 Breadwinner und Cakewinner
Wann ist ein Mann ein Mann? Zur Untrennbarkeit von Erfolg und Männlichkeit
Berufstätigkeit als Kern männlicher Identität
Der Druck der Familienernährerrolle
Arbeit: Lust oder Last?
A poor lonesome cowboy a long way from home
Frauen und die Rosinen der Berufswelt
Berufstätigkeit als Selbstverwirklichung
Die Rolle der Zuverdienerin
Rosinenpickerei oder innere Freiheit? Zwei Perspektiven auf Frauen
4. FAZIT
Warum zwischen Männern und Frauen manches beim Alten bleibt
Frauen und Männer zwischen zwei Welten
UND WAS NUN? WEGE AUS DEN SACKGASSEN
5. PARTNERSCHAFT UND FAMILIE
5.1 Konflikte im Inneren Team klären
Innere Konflikte und ihre Wirkung auf die Partnerschaft
Klärungsschritte
Teamentwicklung braucht Zeit
5.2 Vom Grabenkampf zur offenen Auseinandersetzung: Entwicklungsrichtungen für Frauen und Männer
Vom ‹Moralapostel› zur ‹Anwältin der eigenen Bedürfnisse und Interessen›
Vom ‹Unschuldsengel› zum ‹(Mit-)Gestalter der Familie›
5.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
5.4 Teufelskreise: Wie man sie erkennt und wie man sie verlassen kann
Merkmale von Teufelskreisen
Wie und woran man Teufelskreise erkennt
Wie man aus Teufelskreisen aussteigen kann
5.5 Hilfen zum konstruktiven Gespräch
Einen guten Rahmen für Gespräche schaffen
Streitphasen
Sich gegenseitig zuhören
Passive und aktive Fremdsprachenkompetenz
Mit Unterschieden leben lernen
5.6 Tragfähige Einigungen finden
Eine Bestandsaufnahme machen
Die niederlagelose Methode der Konfliktklärung nach Gordon
5.7 Wenn alles nichts hilft
6. BERUFLICHE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN UND STRATEGIEN FÜR FRAUEN
6.1 Ziel: das Spiel mitspielen!
Die eigenen Ziele klären
Die Spielregeln durchschauen: Passive Fremdsprachenkompetenz
Strategien entwickeln und experimentieren: Aktive Fremdsprachenkompetenz
6.2 Konkrete Schritte
Wünsche anmelden und dafür kämpfen
Sich Gehör verschaffen
Auch verlieren will gelernt sein!
6.3 Umgang mit Machtgesten: Von der ‹Kämpferin› zur ‹Leibwächterin›
Die Notwendigkeit eines abgestuften Arsenals
Irritationen auf der Beziehungsebene wahrnehmen und ernst nehmen
Die Diagnose: Worum geht es hier eigentlich?
Die sportliche Ebene: Der Florettkampf
Klärungsgespräche: Die Situation zum Thema machen
Wenn es hart auf hart kommt: Die ‹Leibwächterin›
6.4 Innere Stimmen aufbauen
Interne und externe Stellenausschreibung
Visionen entwickeln
Konkrete und realistische Schritte entwickeln
6.5 Die Auseinandersetzung mit inneren Bremserinnen
Innere Bremserinnen aufspüren
Bremserinnen würdigen und begrenzen
7. BERUFLICHE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN FÜR MÄNNER
7.1 Die Auseinandersetzung mit inneren Antreibern
Innere Antreiber aufspüren
Antreiber würdigen und begrenzen
7.2 Vom Einzelkämpfer zum Teamspieler
Die zwei Seiten sozialer Kompetenz
Vom Mr. Perfekt zur «Souveränität höherer Ordnung»
Teamspielerqualitäten trainieren
EPILOG
DANK
ANMERKUNGEN
LITERATUR
VORWORT
Friedemann Schulz von Thun
Wie können Frauen und Männer gut miteinander reden, gut miteinander klarkommen? Hat die Kommunikationspsychologie dazu etwas beizutragen, was substanziell und aussichtsreich wäre? Sie hat.
Das Thema fasziniert! Die Betroffenen sind alle ein wenig kompetent, und die Kompetenten sind nicht wenig betroffen. Und wir wollen ja miteinander zu tun haben (und es miteinander zu tun kriegen), wir Frauen und Männer! Es ist so viel Glücksverheißung darin, aber auch viel Verzweiflung und Galgenhumor nach gescheiterten oder mühseligen Erfahrungen. «Mühselig», ein schönes deutsches Wort (auch wenn es etymologisch mehr mit Mühsal als mit Seligkeit zu tun hat – nehmen wir es einmal so, wie es heute zusammengesetzt ist): Da klingt die Mühe an, die wir uns geben müssen; die Seligkeit, die in der Begegnung von Mann und Frau sein kann; und eben die Mühseligkeit, von der manche Frau ein Lied zu singen und mancher Loriot eine Lachnummer vorzuführen weiß. «Das Ei ist hart.» «Zu viele Eier sind gar nicht gesund…»
Kommen Frauen und Männer wirklich von unterschiedlichen Sternen, was ihre Kommunikation angeht? Angenommen, A und B (ich verrate das Geschlecht noch nicht) sind verheiratet und haben eine für sie wichtige Entscheidung getroffen. Jeder berichtet darüber in jeweils seinem/ihrem Kollegenkreis in einer Kaffeepause. Jeder berichtet auf seine Weise, und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sollen raten: Wer von A und B ist Mann und Frau?
Na?
Die Lösung:
Sie stutzen, Sie glauben es nicht? Obwohl ich ein bekannter Fachmann in diesen Fragen bin? Oder Sie vermuten einen Druckfehler? Also gut, ich gebe zu: A ist ein untypischer Mann und B vielleicht eine etwas untypische Frau. Aber das «Typische» ist heute längst nicht mehr so typisch, vieles hat sich getan hierzulande: Männer äußern sich spontan, sprechen über ihre Gefühle, und Frauen haben sich im Berufsleben die bedachtsame Sprache der nüchternen Sachlichkeit angeeignet. Wir haben entdeckt, dass wir auf das Typische nicht festgelegt sind, dass wir nicht auf immer und ewig in unserem kommunikativen Heimathafen ankern müssen.
Also gut, ich gebe zu: Ich habe geflunkert. Natürlich («natürlich»?) ist A die Frau und B der Mann. Aber ich hatte ein edles didaktisches Motiv zu flunkern: Ich wollte Ihnen das Erlebnis des Stutzens vermitteln! Offenbar war die empirische Evidenz Ihrer Erfahrungen mit Frauen und Männern größer als Ihr Glaube an die (vermeintliche) wissenschaftliche Autorität.
Frauen und Männer sind, beileibe nicht in jedem Einzelfall, aber auf den Durchschnitt gesehen, anders in ihrer Art, Kontakte und Beziehungen zu gestalten, zu reden, zuzuhören und auf den anderen einzugehen. Dagmar Kumbier nimmt diese Befunde auf und erörtert die spannenden Fragen, die von ihnen aufgeworfen werden:
1. Worin bestehen diese Unterschiede vor allem, wo zeigen sie sich wie am deutlichsten?
Ich habe seit Jahrzehnten gelehrt, dass, bezogen auf unser Kommunikationsquadrat, die Männer ihr Heimspiel eher auf der Sach- und Appellseite, die Frauen eher auf der Selbstkundgabe- und Beziehungsseite haben:
Insofern war die Zusammenfügung dieser vier Seiten zum Quadrat mit vier gleichwertigen und gleich wichtigen Seiten eine klammheimliche androgyne Integration (was einen Teil seiner Beliebtheit erklären könnte). Von Dagmar Kumbier werden wir erfahren, dass dies zwar eine tendenzielle Wahrheit bleibt, jedoch weiterer Ausdifferenzierung bedarf.
2. Woran liegt es, wie kommen diese Unterschiede zustande?
Liegt es in der Natur von Frauen und Männern, dass sie mit unterschiedlicher Gen-Ausstattung auf die Welt kommen, als Ergebnis einer jahrmillionenlangen Stammesentwicklung des Menschen, der am besten arbeitsteilig und mit komplementärer Talentausstattung überleben konnte? Vieles spricht dafür. Oder liegt es an der unterschiedlichen Sozialisation von Mädchen und Jungen in unserer Kultur, die vom Leitbild eines richtigen Jungen und eines richtigen Mädchens beeinflusst ist, sodass wir, genetisch flexibel und plastisch, zur Frau und zum Mann «gemacht» werden? Auch dafür spricht vieles. Die ganze Wahrheit wird sich aus beiden Faktoren zusammensetzen. Aber für unser Thema ist die ganze Frage nach den Ursachen zweitrangig. Denn weder genetische Vorprägungen noch sozialisationsbedingte Festlegungen können uns daran hindern, durch Übung und Entwicklung auch in den Auswärtsspielen zu guter Form aufzulaufen. Mag ja sein, dass Frauen im Durchschnitt 2 bis 3Fahrstunden mehr brauchen, um das Einparken zu lernen; und dass Männer ein paar Jahre länger brauchen und ein paar innere Hindernisse mehr überwinden müssen, bevor sie einfühlsames Zuhören erlernen – so what?
3. Wie können denn Frauen und Männer gut miteinander klarkommen, wenn sie nicht nur unterschiedliche Muster, sondern auch unterschiedliche Bedürfnisse in den Kontakt einbringen?
Dagmar Kumbier arbeitet die typischen Fallstricke und Verklemmungen so heraus, dass kommunikationspsychologische Hilfe greifbar wird. Interplanetarisches Befremden wird bearbeitbar, wenn wir es verstehen und einordnen können, am besten mit ein wenig Humor. Humor bedeutet, dem Mühseligen auch eine komische Seite abzugewinnen, auch über sich selbst schmunzeln zu können. Das gelingt umso eher, wenn ich in der Mühsal nicht nur mittendrin stecke, sondern sie aus übergeordneter Perspektive betrachten kann. Dann werden Auswege sichtbar. Der hier gewiesene Weg ermöglicht eine solche Metaperspektive, verweist aber auch auf das Erfordernis, sich selbst «von innen» besser kennen zu lernen.
4. Sollen denn Männer, entgegen ihrer Natur und ihrem Rollenbild, «weibliche» Kommunikationsformen übernehmen und umgekehrt?
Ich erinnere mich an eine Führungskraft, einen Mann, im Kommunikationsseminar. Er war dort nicht freiwillig. Er sagte: «Mein Vorgesetzter hat mich hierher geschickt, weil er meine soziale Kompetenz im Umgang mit Mitarbeitern in Zweifel zieht. Ich aber sage Ihnen: Meine drei Leitsterne sind die drei ‹E›. (Ehrgeiz– Effektivität– Erfolg), und Sie machen keinen Softie aus mir!» Und ein anderer zitierte seine Frau, die bei seiner Abreise zum Seminar gesagt habe: «Du gehst als Mann – komm nicht als Pfeife wieder!» Die Befürchtung, durch Erwerb von «soft skills» und menschlicher Sensibilität an Männlichkeit einzubüßen, beruht auf der irrigen Annahme, dass «männliche» und «weibliche» Talente auf einer Dimension angeordnet seien:
Eine Zunahme an Empathie würde unter dieser eindimensionalen Sichtweise tatsächlich eine Entfernung vom «männlichen» Pol bedeuten. Mein Kollege Gerhard Vagt (2004) hat aber ganz Recht, wenn er das «Männliche» und das «Weibliche» eher auf zwei unabhängigen Dimensionen lokalisieren will, sodass ein Mensch durchaus hohe Ausprägungen auf beiden Dimensionen haben oder entwickeln kann:
Diese androgyne Perspektive menschlicher Entwicklung dürfte für Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv sein, weil sie seelisches Wachstum fördert und typisierende Vereinseitigung vermeidet, die immer mit innerer Unterdrückung oder Brachlegung erkauft werden muss. Und für das Miteinander von Frauen und Männern dürfte es eine Erleichterung und eine Intensivierung des Kontakts bedeuten.
Damit ist aber nicht einer Gleichmacherei das Wort geredet, welche die angestammten Unterschiede einebnen will. Möge jede Frau, jeder Mann ihrer/seiner angestammten Talentausstattung und seiner dementsprechenden Ausstrahlung treu bleiben (oder treu werden!). Die Liebe ist eine Frucht der Gemeinsamkeit und des Unterschiedes! Und wo immer Frau und Mann sich nicht symmetrisch, sondern komplementär organisieren, ist das auch aus moderner Sicht nicht zu tadeln, solange ihnen der Gegenpol nicht verschlossen bleibt. Der Fisch soll kein Vogel werden, aber ein paar Flügel können ihn zum fliegenden Fisch machen. Der Vogel kann Schwimmflossen entwickeln, ohne zum Fisch zu werden. Der Mann kann an Einfühlungsvermögen gewinnen, ohne zum Softie oder zur Pfeife zu werden.
Unser Wertequadrat kann helfen, den Kompass richtig zu stellen. Er weist auf die dialektische Balance von androgyner Aufeinander-zu-Entwicklung und (Unterschiede bewahrende und begrüßende) Komplementarität. Beide Prinzipien kippen ins ungute Extrem, wenn sie sich gegenseitig nicht in der Waage halten:
Während die androgyne Entwicklung jeder individuell vollziehen kann, ist die zwischengeschlechtliche Kommunikation unter dem Vorzeichen der Komplementarität nur gemeinsam zu meistern. Dagmar Kumbier erörtert in diesem Buch beide Perspektiven. Es trifft sich ausgezeichnet, dass sie alles in einer ist: eine Kennerin der Geschlechtsforschung, deren Befunde sie zum Teil mit anderen, neuen Augen liest; eine Kommunikationspsychologin, die mit unseren Modellen bestens vertraut ist und nun erstmalig zum Beispiel das «Innere Team» systematisch, genial und mit Gewinn auf die Begegnung der Geschlechter in Beruf und Familie anwendet; eine erfahrene Eheberaterin, die ihre Pappenheimer und Pappenheimerinnen kennt und vor allem auch die Dynamiken zwischen ihnen (und wie man ihnen beikommen kann); letztlich auch ein Mensch und eine Frau mit einigen Entwicklungsschritten hinter sich und mit der Fähigkeit, die eigene Betroffenheit im Lichte der theoretischen Erkenntnisse zu reflektieren.
Was dabei herausgekommen ist, kann uns auf dem Weg zur Menschwerdung, zur guten Kooperation und, ja auch und besonders, zur Liebesfähigkeit einen wichtigen Schritt voranbringen. Möge dieses Buch zur Pflicht- und Freudelektüre für die größte Zielgruppe der Welt werden: für alle Frauen und Männer!
VORBEMERKUNGEN
Noch ein Buch über die Kommunikation zwischen Männern und Frauen? Ist nicht wirklich schon genug darüber nachgedacht und geschrieben worden, warum Frauen und Männer sich einfach nicht verstehen können? Sind nicht schon genug Erklärungen dafür angeboten worden, warum Männer (angeblich) nicht zuhören und Frauen (vermeintlich) nicht einparken können? Männer und Frauen kommen offenbar aus unterschiedlichen Welten, wenn nicht sogar von verschiedenen Planeten – und das macht die Kommunikation zwischen ihnen zu einem heiklen Unterfangen und zu einer Art Pas de deux auf Glatteis.
In der Tat gibt es (neben vielen Allgemeinplätzen und Plattitüden) bereits gute und fruchtbare Ansätze. Gleichwohl wurde keine der Erklärungen, die bislang für die typischen Probleme zwischen Männern und Frauen angeboten worden sind, meinen Erfahrungen als Paarberaterin, Kommunikationstrainerin und Coach wirklich gerecht – und keine den Erfahrungen, die ich selbst als Frau in der Kommunikation mit Männern und anderen Frauen beruflich und privat mache. So ist eine wesentliche Erfahrung, dass sich die private und die berufliche Kommunikation zwischen Frauen und Männern beträchtlich und grundlegend voneinander unterscheiden – und diesen Unterschied fand ich in der Literatur so gut wie gar nicht beschrieben. Offenbar wird meist vorausgesetzt, dass beides den gleichen Gesetzen folgt – was mir ein fundamentaler Irrtum zu sein scheint.
Und es wurden zwar immer wieder die Sackgassen zwischen Männern und Frauen beschrieben, aber dabei blieben wichtige Fragen offen. Warum sind diese Probleme so hartnäckig und warum neigen sie derart zur Eskalation? Warum ist es so schwer, sein Verhalten an diesen Punkten zu ändern? Und um welche Veränderungen würde es eigentlich konkret gehen? Diese Fragen blieben offen – entweder, weil die Autoren die Welt nur erklären, aber nicht verändern wollten. Oder weil sie die Ursache der Schwierigkeiten in der Biologie und den Ursprüngen der Menschheit fanden und daher wenig Spielraum für wirkliche Veränderungen sahen. Oder weil sie voller Optimismus lange Listen mit Tipps und Tricks lieferten, die man im Dienste einer glücklichen Partnerschaft offenbar einfach nur abarbeiten müsste. Oder sie sahen die Ursache der Probleme in der Böswilligkeit der Männer, die sich schlicht weigern, sich angemessen am Haushalt zu beteiligen und Frauen Karriere machen zu lassen – und konnten diese Renitenz nur zornig, hilflos oder resigniert zur Kenntnis nehmen.
Kurz gesagt: Es blieben gerade die Fragen offen, die für mich als Kommunikationspsychologin von besonderer Bedeutung sind. Ich möchte also in diesem Buch die Kommunikation zwischen Männern und Frauen in den Blick nehmen – und dabei die Bereiche von Partnerschaft und Beruf getrennt betrachten. Wie gehen Frauen an diese beiden Bereiche heran und wie Männer – und was passiert, wenn sie in den verschiedenen Bereichen aufeinander treffen? Welche Dynamik entwickelt sich jeweils zwischen ihnen, welche Spielregeln gelten (und wer gibt sie vor), wie ist die Macht verteilt (und welches Gesicht hat diese)? Woher kommt der Drang zur Veränderung – und warum verändert sich häufig trotzdem nichts?
Dabei werde ich von einer einfachen These ausgehen. Frauen und Männer haben jeweils in einem dieser Bereiche ein Heimspiel und treten im anderen zum Auswärtsspiel an. Während Männer einen enormen Heimspielvorteil im Beruf haben, weil sie sehr viel besser mit Leistungs- und Konkurrenzsituationen klarkommen, haben Frauen einen großen Vorsprung im Umgang mit Gefühlen und nahen Beziehungen. Ihr Heimspiel liegt daher im Bereich von Partnerschaft und Familie.
Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Männern und Frauen im Bereich der Familie eine deutlich andere ist als im Beruf. Im Beruf treten Frauen zum Auswärtsspiel an – und dort gelten die Regeln der Männer. Sie treffen auf Männer, die auf diesem Platz trainiert haben und eingespielt sind, die sich entsprechend mehr zutrauen und sich besser behaupten können. Umgekehrt ist der Bereich der Partnerschaft für die Männer ein Auswärtsspiel nach den Regeln der Frauen. Hier treffen sie auf Partnerinnen, die einen jahrelangen Übungsvorsprung haben und deshalb sehr viel selbstbewusster sind als sie selbst. Dadurch entwickelt sich in beiden Bereichen eine unterschiedliche Dynamik – und Frauen wie Männer nehmen jeweils vollkommen andere Rollen ein. Aus dieser Perspektive können die typischen Probleme in Partnerschaft und Beruf also getrennt betrachtet und gleichzeitig in Zusammenhang gebracht werden.
Diese Perspektive ist geprägt durch Erfahrungen, die ich als Beraterin und Trainerin mit Paaren, Einzelnen und Gruppen gemacht habe. Mein Handwerkszeug sind im Wesentlichen die Modelle und Methoden der Hamburger Kommunikationspsychologie, die Friedemann Schulz von Thun und der Arbeitskreis Kommunikation und Klärungshilfe entwickelt haben. Als Hintergrund werde ich überdies immer wieder Erkenntnisse der Geschlechterforschung einbeziehen. Die unterschiedliche Weise, wie Jungen und Mädchen aufwachsen, ist inzwischen gut untersucht worden, ebenso wie manche Aspekte der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Diese Forschung eignet sich gut, um die Hintergründe mancher Teufelskreise zu beleuchten. Umgekehrt werden aus der Perspektive der Heim- und Auswärtsspiele auch blinde Flecken der bisherigen Forschung deutlich, sodass sich neue Fragestellungen ergeben können.
Im ersten Teil des Buches werde ich zunächst die typischen Sackgassen im Verhältnis zwischen Männern und Frauen beschreiben und diese anschließend genauer untersuchen. Was passiert, wenn Frauen und Männer im Heimspielbereich der Frauen aufeinander treffen – und was passiert im Heimspielbereich der Männer? Welche Wege führen unweigerlich in die beschriebenen Sackgassen, und welche Teufelskreise entwickeln sich? Im zweiten Teil wird es dann um die Suche nach Auswegen aus diesen Sackgassen gehen.
Als Leser habe ich dabei nicht nur die Praktikerin oder den Praktiker im Auge, der als Berater oder Trainer arbeitet, sondern ganz generell Frauen und Männer, die nach einem konstruktiven, lebendigen (und womöglich sogar lustvollen) Umgang mit dem oft so befremdend anderen Geschlecht suchen.
Noch eine Bemerkung vorab. Ich bin bei der Arbeit an diesem Buch immer wieder auf die argwöhnische Frage gestoßen, ob ich denn nicht nur einmal mehr die alten Klischees wiederhole. Sind nicht jede Frau und jeder Mann und jede Begegnung einmalig und individuell? Macht es überhaupt Sinn, über Frauen und Männer als Gruppen zu reden? Dieser Einwand, dieses Misstrauen hat durchaus seine Berechtigung. Über Männer und Frauen im Allgemeinen zu reden, bedeutet eine Vereinfachung. Wenn ich es dennoch mache, dann deswegen, weil Erfahrung und Wissenschaft zeigen, dass es bei aller Individualität gleichwohl Typisches gibt. Dieses Typische gilt nicht für alle Menschen an allen Punkten gleichermaßen, und so ist nicht damit zu rechnen, dass Sie sich und Ihre Erfahrungen an jeder Stelle wiederfinden werden. Wenn Sie sich also aus diesem Buch das heraussuchen, was für Sie passt oder was Sie für sich anpassen können, dann wäre das im Sinne der Erfinderin.
Einführung
TYPISCHE SACKGASSEN FÜR MÄNNER UND FRAUEN
«Bring wenigstens den Müll raus!»Aufgabenteilung in Haushalt und Familie
«Bring wenigstens den Müll raus!» Wie kommt es, dass wir alle eine präzise Vorstellung haben, wer das zu wem sagt? Wir hören förmlich den Tonfall, wir ahnen die Vorgeschichte und wie die Situation sich weiterentwickeln könnte. Ob man den persönlichen Freundeskreis nimmt, die Klientel einer Paarberatungsstelle oder wissenschaftliche Untersuchungen über Partnerschaften: Überall stößt man auf ein zentrales Problem. Nämlich darauf, dass sie sich mit Haushalt und Kindern mehr oder weniger allein gelassen fühlt und (je nach Temperament) klagt, resigniert oder kämpft – während er zunehmend das Gefühl hat, es ihr bei allem Bemühen ohnehin nie recht machen zu können und sich (je nach Temperament) verteidigt, zurückzieht oder in die Karriere stürzt.
Das ist durchaus erstaunlich, denn eigentlich scheinen sich Männer und Frauen in dem, was sie sich in ihrer Partnerschaft wünschen, gar nicht so sehr zu unterscheiden. Eine partnerschaftliche Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung ist heute für beide Geschlechter selbstverständlich – und in der Regel möchten sich beide Partner sowohl in der Familie als auch im Beruf engagieren.1 Trotzdem hat sich an der häuslichen Aufgabenteilung wenig geändert: Hausarbeit ist nach wie vor im Wesentlichen Frauensache, und zwar auch dann, wenn beide Partner berufstätig sind.2 Diese seltsame Kluft zwischen dem gemeinsamen Ideal, das Männer und Frauen von ihrer Partnerschaft entwerfen, und der Realität der allermeisten Partnerschaften beschäftigt nicht nur die Wissenschaft, welche immer wieder versucht hat, diese Kluft zu erklären und Wege zu finden, wie sie zu schließen sei. Sie beschäftigt vor allem die Paare selbst. Frauen und Männer leiden gleichermaßen unter dieser Spannung – allerdings leiden sie auf recht unterschiedliche Weise.
Die Frauen leiden darunter, für all die kleinen und großen familiären Aufgaben im Wesentlichen allein zuständig zu sein. Auch wenn er ‹mithilft›, in aller Regel erledigt sie den Löwenanteil, und vor allem ist sie es auch, die alles im Blick haben, regeln und koordinieren muss. Oftmals fühlen sich die Frauen nicht nur überfordert, sondern auch im Stich gelassen und geradezu verraten: «Wir waren uns doch einig, dass es nicht so werden sollte wie bei unseren Eltern, dass wir uns den Haushalt teilen und uns gemeinsam um die Kinder kümmern! Und jetzt bleibt trotzdem mehr und mehr an mir hängen, und er zieht sich ins Büro zurück!» Wenn Erschöpfung, Frustration und Enttäuschung lange genug vor sich hin gären, ergibt sich nicht selten ein brisantes Gemisch – vor allem dann, wenn Gespräche darüber nicht möglich sind oder alles nur noch schlimmer machen. An diesem Punkt fangen Frauen oft an, an seiner Liebe zu ihr und den Kindern zu zweifeln: Denn zeigt er durch sein Verhalten nicht deutlich, dass ihn letztlich nur der Beruf interessiert? Wie könnte er sie so behandeln und ihre Gefühle derart ignorieren, wenn er sie lieben würde? Und umgekehrt: Wie kann sie ihn lieben, wenn sie sich so verraten und verkauft fühlt? Schlimmstenfalls endet diese Entwicklung in offener Verachtung. Dann fallen in der Paarberatung Sätze wie: «Wissen Sie, mein Mann, das ist im Grunde mein drittes Kind.» oder «Ohne ihn läuft es genauso gut – eher besser.»
Sätze, die Männer tief verletzen, auch wenn sie dies oft kaum oder gar nicht zeigen. Für Männer ist die Brisanz, welche dieses Thema für Frauen hat, meist überhaupt nicht nachvollziehbar: Es geht doch nur um Kleinigkeiten! Gut, der Abwasch bleibt schon mal stehen, und es ist wahr, dass er gestern wieder zu spät nach Hause gekommen ist – aber wie kann all das dazu führen, dass sie an seiner Liebe zweifelt? Für Männer sind das zwei völlig verschiedene Ebenen, und es ist für sie ausgesprochen kränkend, wenn ihre Frauen vom einen auf das andere schließen.
Das Problem der Männer liegt in erster Linie in der Unzufriedenheit ihrer Frauen, die sie umso mehr trifft, als sie diese Unzufriedenheit nicht verstehen und sie als kleinlich und zutiefst ungerecht empfinden. Oft haben sie das Gefühl, dass ihr Beitrag zur Familie weder gesehen noch gewürdigt wird. Und: Egal, was sie tun – es scheint nie zu genügen. Das Maß an Vorwürfen ändert sich nicht, wenn sie mehr im Haushalt tun – im Gegenteil, dann kommt sogar die sarkastische Frage dazu, wie lange er sich denn noch auf der Heldentat ausruhen wolle, einmal den Abwasch gemacht zu haben. Gibt er ihr den kleinen Finger, will sie gleich die ganze Hand. Es scheint also besser zu sein, gar nicht erst mit Zugeständnissen anzufangen! Kränkend für die Männer ist das dauernde Gefühl, nicht zu genügen, weder mit ihrem Beitrag zum Familienleben noch mit ihrer Art, ihre Liebe zu zeigen.
Je nach Verfassung der Partnerschaft nagt also die immer gleiche Unzufriedenheit, tobt der immer gleiche Streit. Das Problem scheint sich nicht recht lösen zu lassen. Und mit Hilflosigkeit und Erbitterung stellen viele Paare fest, dass die Debatte über so banale Dinge wie Abwasch, Kloputz oder den Weg zum Kindergarten immer mehr Raum einnimmt, ihre Liebe anfrisst, diese gar aufzuzehren droht.
«Ich erreiche ihn einfach nicht!» Gespräche in Partnerschaften
Dazu kommt in vielen Partnerschaften, dass auch das Gespräch zwischen Mann und Frau schwierig ist – und umso schwieriger wird, je persönlicher und gefühlshaltiger die Themen werden. «Wir können einfach nicht mehr miteinander sprechen»: So oder ähnlich lautet häufig der erste Satz einer Paarberatung. Auch hier ist es in der Regel sie, die unzufrieden ist, während er unter ihrer Unzufriedenheit leidet und darunter, sie als Partner nicht glücklich machen zu können (was den Männern in der Regel sehr viel wichtiger ist, als ihren Frauen klar ist).
Sie möchte mit ihm sprechen – über die Kinder, über das, was sie gerade beschäftigt, über Probleme, die sie mit ihm hat. Sie wünscht sich Austausch und Nähe, will selbst erzählen – und hören, was ihn bewegt. All das gestaltet sich jedoch nicht so einfach, denn er gibt sich verschlossen. Sie unternimmt immer wieder neue Anläufe, anfangs geduldig, später immer ungeduldiger. In ihrem Notfall-Set die berühmt-berüchtigte Frage: «Was denkst du gerade?» – auf die sie mit unfehlbarer Sicherheit (wieder einmal) die Antwort bekommt: «Ach, nichts.» Sie weiß es schon vorher, aber was soll sie machen, wenn er von sich aus nicht darüber spricht? Überhaupt: Wenn er doch wenigstens ab und zu mal von sich aus käme! Denn wenn er sie liebt – muss er dann nicht auch selber das Bedürfnis haben, mit ihr zu sprechen, sich ihr mitzuteilen, ihr nah zu sein? Für sie wiederholt sich auf dieser Ebene das Gefühl, allein zu sein, nicht gesehen zu werden, ignoriert zu werden. Und oftmals nährt auch seine Verschlossenheit leise Zweifel daran, ob er sie wirklich liebt.
Er dagegen fühlt sich bedrängt, oftmals geradezu belästigt von ihrem ständigen Bedürfnis, reden zu wollen. Er möchte einfach ruhig zu Hause sein, sich erholen, fernsehen, basteln und es genießen, seine Frau und seine Familie um sich zu wissen. Ihre ständigen Fragen sind für ihn wie Daumenschrauben, er fühlt sich unter Leistungsdruck. Und wenn er dann einmal etwas erzählt (vielleicht sogar von sich aus!), dann ist es entweder nicht das Richtige oder nicht genug. Was er bei der Arbeit erlebt, interessiert sie nicht wirklich (es sei denn, er erzählt von den Konflikten mit den Kollegen, aber er hat nicht das leiseste Bedürfnis, sich damit auch noch den Feierabend zu verderben!). Und wenn er etwas darüber erzählt, wie es ihm geht – mit Kollegen, mit seiner Arbeit, mit den Kindern, mit ihr–, dann ist sie nicht etwa froh und zufrieden, sondern nimmt es im Gegenteil zum Anlass, ihre Fragen zu verstärken. Was für ihn eine fertige Erzählung ist, scheint für sie nur die verheißungsvolle Einleitung zu einem ganzen Roman zu sein. Und wenn sie schon die Einleitung hat, dann will sie auch den Rest – und ist ärgerlich auf ihn, wenn er ihr diesen vorenthält. Besser also, gar nicht erst damit anzufangen!
Auch für ihn wiederholt sich in diesem Bereich also etwas: nämlich das Gefühl, ihr nicht zu genügen. Was er tut, reicht nie; er reicht nie. Und auch er fühlt sich von ihr nicht gesehen.
Die Spitze ist männlich:Die «gläserne Decke» im Beruf
Nicht nur im Privatleben bleiben die typischen Rollen von Männern und Frauen trotz aller Veränderungswünsche recht stabil. Auch im beruflichen Bereich ändert sich erstaunlich wenig – und zwar trotz beträchtlicher gesellschaftlicher Anstrengungen. Auch wenn Frauen hierzulande in ihrer Ausbildung mindestens den Gleichstand erreicht haben, auch wenn sie in großer Zahl berufstätig sind und sein wollen, auch wenn man die berufliche Förderung von Frauen inzwischen getrost als gesellschaftliches Ziel sehen kann – die oberen Etagen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bleiben fast frauenfrei. Das Ausmaß, in dem die Wahl von Angela Merkel zur ersten deutschen Bundeskanzlerin bestaunt, gefeiert und diskutiert wurde, hat deutlich gemacht, wie sehr Frauen in Spitzenpositionen immer noch eine Ausnahme sind. Jahrelange Versuche mit Frauenquoten und Förderplänen haben daran nichts Wesentliches ändern können.
Dieses politische Phänomen spiegelt sich in der Klage vieler Frauen darüber, dass sie ihre männlichen Kollegen auf der Karrierestraße an sich vorbeiziehen sehen – und in ihrem Eindruck, dass sie doppelt so gut sein müssen wie die Männer, um nach oben zu kommen. Dabei sind die Hindernisse, die sich Frauen auf dem Weg nach oben entgegenstellen, schwer greifbar; entsprechend kursiert die Metapher der «gläsernen Decke»: Das Hindernis ist zwar nicht zu sehen, aber vom Ergebnis her deutlich spürbar.
Bei den Männern sieht die Lage gewissermaßen umgekehrt aus. Obwohl viele Männer gerne weniger arbeiten würden, finden sich kaum Männer auf Teilzeitstellen. Ganz im Gegenteil, viele machen Überstunde um Überstunde. Irgendwie bleibt selten so viel Zeit für die Familie, für Freunde oder für sich selbst übrig, wie doch eigentlich gedacht war. Und obwohl sich die Väter zunehmend am Leitbild des ‹neuen Vaters› orientieren, der für die Kinder präsent ist und sich zu Hause engagiert, sind es in den seltensten Fällen sie, die den Erziehungsurlaub nehmen. Es scheint Männern schwer zu fallen, die Prioritäten anders als beim Beruf zu setzen. Zunehmend wird der Befund gestellt und beklagt, dass die Männer «mit dem Beruf verheiratet» und in Gefahr seien, sich in ihrer Arbeit zu verlieren – und dass sie dafür einen hohen Preis an Gesundheit, familiärem Zusammenhalt und Lebenszufriedenheit zahlen.3
Etwas pointiert stellt sich die Lage so dar, dass die Frauen im beruflichen Bereich gerade mal einen Fuß in die Tür bekommen haben, während die Männer offenbar Mühe haben, die Tür auch mal hinter sich zu schließen.
BELIEBTE ERKLÄRUNGEN
Wie kommt es zu diesen Sackgassen? Warum ändert sich so wenig Grundlegendes im Verhältnis von Männern und Frauen, obwohl wir doch offenbar alle eine Veränderung wollen, obwohl sich doch im Kleinen sehr viel ändert? Zu diesen Fragen haben die meisten Menschen eine klare Meinung und eine klare Antwort. Zwei dieser Antwortmöglichkeiten sind besonders beliebt und einflussreich. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass ein klarer Schuldiger gefunden wird: Im einen Fall sind es die Männer – im anderen ist es die Steinzeit.
Sind die Männer an allem schuld?
Die Frage, warum sich Partnerschaften so oft im Kleinkrieg um Haushaltsdinge festfahren, warum Gespräche zwischen Männern und Frauen oft so schwierig und unbefriedigend sind und warum die oberen Sprossen der Karriereleiter für Frauen kaum zugänglich sind, ist oft schnell beantwortet. Die Diagnose, die unter Frauen, in Frauen-Zeitschriften, aber auch in der seriösen wissenschaftlichen Literatur die Debatte dominiert, ist von bestechender Klarheit und bemerkenswerter Schlichtheit: Es liegt an den Männern. Männer bilden im Beruf Netzwerke, die dafür sorgen, dass nur ihresgleichen nach oben kommt, und die gezielt die Karriere von Frauen behindern. Männer sind Paschas, die sich für den Kloputz zu fein sind, sich bei der Kindererziehung die Rosinen herauspicken und das mühsame Alltagsgeschäft den Frauen überlassen. Männer sind nicht fähig, über Gefühle zu sprechen, anderen zuzuhören und sich auf Nähe einzulassen – im Grunde sind sie beziehungsunfähig.
Vor allem kommen sie weder privat noch im Beruf mit starken Frauen klar. Während die Frauen sich auf den Weg in die moderne Gesellschaft gemacht haben, sind die Männer in der Feudalgesellschaft stehen geblieben, verweigern jegliche Weiterentwicklung und beharren verbissen auf ihren alten Privilegien. Und in dieser Beharrlichkeit sind die Männer der Bremsklotz auf dem Weg zur Veränderung: «Eine Frau hat heute ein anderes Selbstbewusstsein als vor 40Jahren: sie will die Hälfte der Welt – und erwartet, dass die Männer die Hälfte des Hauses übernehmen. Aber im Beruf stoßen die Karrierefrauen an die gläserne Decke, die die oberen Etagen frauenfrei hält, und im Haus an die gläserne Wand, wo die meisten Männer sie meist allein lassen mit Haushalt und Kind.» So Alice Schwarzer in gewohnter Prägnanz.4 Kurz gesagt: Die Männer lassen die Frauen entweder nicht herein (nämlich in die Führungsetage) oder nicht heraus (aus dem Haushalt).
Und zumindest, was die Partnerschaft angeht, stimmen die Männer dieser Deutung im Wesentlichen zu. Fast jeder Mann, der in einer Partnerschaft lebt und nicht zur raren Gattung der Hausmänner gehört, hat heute latent ein schlechtes Gewissen, weil er befürchtet, sich zu wenig am Haushalt zu beteiligen. Auf entsprechende Vorwürfe ihrer Frauen reagieren die Männer meist mit vielen Rechtfertigungen und Hinweisen auf das, was sie aber doch tun. Sie befinden sich jedoch eindeutig in der Defensive. Sie stellen die Deutung, dass das Problem bei ihnen liegt, nicht in Frage – sie finden nur, dass es nicht ganz so groß ist, wie ihre Frau es darstellt, und dass sie sich doch immerhin Mühe geben und schon bei weitem mehr tun als früher, als der Nachbar, der Freund Peter oder sämtliche ihrer Kollegen!
Mittlerweile scheint sich der Wind ein wenig zu drehen. Vereinzelt gibt es jetzt Ansätze, dieses Erklärungsmuster umzukehren: Eigentlich sind die Frauen an allem schuld. Die Männer würden sich ja gerne zum Beispiel in der Kindererziehung engagieren – wenn man sie nur ließe! Aber die Mütter sitzen wie die Glucken auf den Kindern und lassen die Väter nicht ran; sie sind die Türwächter zwischen den Vätern und den Kindern. Manche Autoren verweisen auf Studien, in denen gezeigt wurde, dass Väter umso aktiver sind, je mehr ihre Frauen ihnen das auch zutrauen. Auch wenn die Frauen also mehr Engagement der Männer einklagen, seien gleichzeitig sie selbst und ihr Misstrauen den Männern gegenüber das entscheidende Hindernis für eine Veränderung.5 Männer finden diese Sichtweise oft sehr einleuchtend, denn sie entspricht ihrem Gefühl, eigentlich keine Chance zu haben.
Sind also die Männer das Problem? Oder die Frauen? Aber wie kommt es, dass sich die Männer den Zugang zu ihren Kindern von den Frauen versperren lassen – wo sie doch offenbar ansonsten dazu neigen, Frauen zu unterdrücken? Wieso lassen sich die selbstbewussten modernen Frauen von heute von ihren Männern zu Hause einsperren? Wie kommt es, dass die beruflichen Männernetzwerke so lückenlos, unauffällig und perfekt funktionieren wie kaum etwas anderes in der männerdominierten Welt von Wirtschaft und Politik? Warum haben dreißig Jahre Frauenbewegung und unzählige Frauenförderpläne und Quoten daran nichts Wesentliches ändern können? Und: Ist es wirklich so eindeutig, wer der Gewinner in diesem Spiel ist?
Back to the roots:Liegt die Wurzel des Übels in der Steinzeit?
Eine zweite Erklärung, die in letzter Zeit durch das populäre Buch von Pease & Pease (2000) wieder an Boden gewonnen hat, ist die These, dass die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen biologisch bedingt ist. Männer und Frauen hätten seit Urzeiten unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen und daher vollkommen unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt. Frauen seien schon immer vor allem dafür zuständig gewesen, Kinder aufzuziehen und gemeinsam das Feuer zu hüten. Daher seien Frauen besonders gut darin, sich auf andere einzustellen, Gefühle wahrzunehmen und Beziehungen zu gestalten. Wenn man sie dagegen in einer fremden Steppe oder Großstadt aussetze, dann hätten sie wenig Chancen, den Ort der Mammutjagd oder das Haus von Freunden zu finden, da sie es nie gelernt hätten und auch nie hätten lernen müssen, sich in unbekanntem Gelände zurechtzufinden. Denn weiter als bis zur nächsten Himbeerhecke mussten sie sich ja nie von der Höhle entfernen.
Aufgabe der Männer dagegen sei es immer gewesen, Nahrung zu erjagen und die Gruppe gegen andere zu verteidigen. Sie seien daher risikobereiter, auf Wettkampf und Auseinandersetzung ausgerichtet, und es falle ihnen leicht, sich räumlich zu orientieren. Für den Umgang mit Gefühlen und nahen Beziehungen dagegen seien sie von ihrer biologischen Ausstattung her nicht vorbereitet; hier seien sie daher eher minderbemittelt, geradezu hoffnungslose Fälle. Denn sie mussten nicht für andere sorgen und sich auf deren Bedürfnisse einstellen. Bei der gemeinsamen Jagd stand die Auseinandersetzung mit schwierigen und potenziell lebensgefährlichen Situationen im Vordergrund – und dabei kann übermäßige Sensibilität durchaus hinderlich sein! Wenn man einem wütenden Mammut oder einem Säbelzahntiger gegenübersteht, dann empfiehlt es sich nicht unbedingt, sensibel auf die eigenen Gefühle zu lauschen! Stattdessen sollte man geistesgegenwärtig und schnellstmöglich Auswege und Lösungen finden. Entsprechend werde genau dieser Umgang mit Problemen Männern oft vorgeworfen: Statt sich mit den Gefühlen ihrer Frauen auseinander zu setzen, bieten sie direkt Lösungen an.
Der Vorteil dieser Sichtweise ist, dass sie Paaren ermöglichen kann, der Andersartigkeit des Partners gelassener und womöglich sogar mit Humor zu begegnen – statt mit Vorwürfen, Bitterkeit und Unterstellungen. Sie führt aus der leidigen Frage heraus, wer schuld an der ganzen Misere ist. Und tatsächlich liegt eine Fülle wissenschaftlicher Studien vor, die Hinweise auf biologisch bedingte Verhaltensunterschiede zwischen Jungen und Mädchen, zwischen Männern und Frauen geben.
Allerdings lässt auch diese Erklärung wichtige Fragen offen. Wir brauchen heute völlig andere Fähigkeiten als der Urzeitmensch (sei er männlich oder weiblich). Das Leben in einer Großstadt folgt anderen Gesetzen als das Überleben in der Steppe. Wir haben das Internet und über 1000km/h schnelle Fortbewegungsmittel entwickelt und einigermaßen gelernt, damit umzugehen. Wir haben das menschliche Zusammenleben durch die Ideen von der Würde jedes Menschen, durch Grundgesetz und Demokratie revolutioniert. Wir haben – manche anfangs mit Erstaunen – festgestellt, dass Frauen im Beruf durchaus ‹ihren Mann stehen› können. Wir lernen – wenn auch mühsam – Verhandlungen mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu führen und Konflikte gewaltfrei auszutragen. Warum sollte da ausgerechnet das Verhältnis zwischen Männern und Frauen seit Urzeiten betoniert und unveränderlich sein? Und wenn das Verhältnis zwischen den Geschlechtern biologisch vorbestimmt ist – woher kommt dann diese hartnäckige Unzufriedenheit? Wieso können sich die modernen Flausen von Gleichberechtigung überhaupt derartig in unserem Kopf ausbreiten, wenn alles so, wie es ist, unseren Anlagen in geradezu optimaler Weise entspricht? Müssten wir nicht glücklich und zufrieden sein?
Neben den Hinweisen auf biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es auch eine Fülle von Studien, die den enormen Einfluss von Erziehung und Gesellschaft auf die unterschiedliche Entwicklung von Jungen und Mädchen nachweisen. Das heißt, die Grundsatzdiskussion, ob die Unterschiede zwischen Männern und Frauen biologisch oder durch Erziehung und Gesellschaft verursacht sind, macht schon lange keinen Sinn mehr. Beides spielt eine Rolle, und beide Faktoren wirken gegenseitig aufeinander ein – so viel ist klar.
VON DER SCHULDFRAGE ZUR FRAGE NACH DEM ZUSAMMENSPIEL
Täter-Opfer-Modell und systemische Herangehensweise
Die bisherigen Erklärungen haben also die altbekannten Sackgassen zwischen Männern und Frauen nicht wirklich erklären können – und schon gar nicht haben sie Wege aus diesen Sackgassen heraus aufgezeigt.
Aus meiner Sicht als Paarberaterin ist das nicht weiter erstaunlich. Seit vielen Jahren hat sich in der Arbeit mit Paaren und Familien die Einsicht durchgesetzt, dass man Probleme in Partnerschaften und Familien nur angemessen verstehen kann, wenn man das Zusammenspiel aller Beteiligten betrachtet. Das heißt: Man sucht nicht nach dem oder der Schuldigen, sondern geht von der Hypothese aus, dass jeder der Partner gleich viel zum Problem beiträgt. Bei einer solchen Herangehensweise würde man von einer systemischen Haltung sprechen: Nicht einer der Beteiligten wird als das Problem identifiziert, sondern das Problem (und vor allem: die Lösung!) wird im System der Paarbeziehung gesucht, also in der Weise, wie die Partner miteinander umgehen. Ein Beispiel:
Peter und Simone Hansen kommen zur Paarberatung, weil – so weit sind sie sich einig – Simones Eifersucht mehr und mehr zum Problem wird. Die Gründe für dieses Problem beschreiben beide jedoch völlig unterschiedlich. Frau Hansen: «Peter erzählt mir einfach überhaupt nichts! Egal, was ich frage – er weicht aus und wechselt das Thema. Da ist es doch kein Wunder, wenn ich allmählich misstrauisch werde und auch schon mal intensiver nachfrage!» Die Geschichte ihres Mannes klingt anders: «Ständig werde ich verhört und ausgefragt! Ich kann überhaupt keinen Schritt mehr gehen, ohne dass ich kontrolliert werde! Und wehe, ich lasse mal nebenbei den Namen einer Kollegin fallen, dann habe ich den Rest des Abends überhaupt keine Ruhe mehr! Da ist doch das Beste, überhaupt nichts mehr zu erzählen!»
Zwischen dem Verhalten von Herrn und Frau Hansen besteht ein Teufelskreis: Je mehr sie nachfragt, desto mehr fühlt er sich bedrängt und zieht sich zurück. Und je mehr er sich zurückzieht, desto misstrauischer wird seine Frau – und desto mehr fragt sie nach. Jeder ist also – aus seiner Sicht völlig zu Recht! – davon überzeugt, doch nur auf den anderen zu reagieren. Und jeder trägt ungewollt und ohne es zu merken dazu bei, dass das Problem immer größer wird.
Abbildung 1: Im Teufelskreis verstärkt jeder ungewollt und ohne es zu merken das Verhalten des anderen
Hier nach dem oder der Schuldigen zu suchen, wäre also sinnlos und würde nur eine weitere Runde im Teufelskreis einleiten. Der erste Schritt zu einer guten Lösung besteht darin, dass beide diesen Teufelskreis erkennen – und damit verstehen, dass es zwei verschiedene Wahrheiten gibt. Nur wenn beide sehen, dass der andere aus seiner Sicht gute Gründe für sein Verhalten hat, und erkennen, wie sie selbst zu dem Problem beitragen, wird der Weg frei, gemeinsam nach einem anderen Umgang mit diesem Problem zu suchen. Anders gesagt: Nötig ist eine systemische Herangehensweise.
Was bedeutet das für die typischen Sackgassen im Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Auch hier ist die Versuchung groß, einer Seite Recht zu geben. Haben die Frauen denn nicht wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Männer zu mehr Engagement in Haushalt und Familie zu bewegen? Und ist es denn wirklich zu viel erwartet, dass sich die Männer endlich einmal bequemen, ihren Teil an den lästigen Alltagspflichten zu übernehmen? Oder auf der anderen Seite: Ist es denn nicht offensichtlich, wie oft Frauen ihre Männer korrigieren und bevormunden, indem sie ihnen zum Beispiel symbolisch oder real den Kochlöffel aus der Hand nehmen? Kennen wir nicht alle Beispiele dafür, dass Mütter ihren Männern einfach nicht zutrauen, dass sie mit Kindern und Haushalt auch alleine klarkommen können – und sei es nur für ein Wochenende?
Aber auch in diesem Feld führt die Täter-Opfer-Sicht in die Irre. Spannend wird die Frage nach den Ursachen der Probleme dort, wo es darum geht, welcher wahre Kern in jeder dieser Sichtweisen enthalten ist; spannend wird es bei der Frage, wie und womit Männer und Frauen gleichermaßen dazu beitragen, dass der Weg immer wieder in die alten Sackgassen führt. Was bewegt Männer und was bewegt Frauen dazu, bei allem Leidensdruck an den alten Spielregeln festzuhalten – und welche Teufelskreise entwickeln sich womöglich unbemerkt zwischen ihnen? Diese (systemischen) Fragen sind noch offen, und ihnen werde ich in den folgenden Kapiteln nachgehen.
Das Modell der Heim- und Auswärtsspiele
Dabei werde ich die Bereiche von Familie und Beruf aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchten. Zunächst werde ich der Frage nach Kompetenz und Selbstbewusstsein nachgehen. Welche Kompetenzen bringen Männer und Frauen für diese beiden Bereiche mit – und wie selbstverständlich vertrauen sie auch auf ihre Kompetenz?
Zweitens wird es um die Frage von Macht und Ohnmacht gehen. Welche Regeln – und wessen Regeln! – gelten eigentlich in der Familie auf der einen und im Beruf auf der anderen Seite? Wie und wodurch wird Macht ausgeübt – und wer hat die mächtigere Position? Und drittens schließlich: Wer übernimmt in welchem Bereich wie viel Verantwortung? Wo sind Männer und Frauen jeweils ausgesprochen pflichtbewusst, haben womöglich sogar eine Neigung zur Verbissenheit – und wo tendieren sie zur Rosinenpickerei?
Abbildung 2: Drei Perspektiven auf Familie und Beruf
Wenn man diese drei Perspektiven zusammenführt, dann wird die unterschiedliche Dynamik, die sich zwischen Männern und Frauen in der Partnerschaft einerseits und im Beruf andererseits entwickelt, sehr deutlich. Es ist das Zusammenspiel zwischen Frauen und Männern, das immer wieder in die beschriebenen Sackgassen führt. Insofern kann das Modell der Heim- und Auswärtsspiele aus der Spirale der gegenseitigen Schuldvorwürfe herausführen, indem es ein systemisches Verständnis der oft so quälenden Probleme ermöglicht. Eine solche neue Perspektive ist häufig der erste Schritt aus den Sackgassen heraus. Denn erst, wenn ich den anderen nicht mehr als (hysterischen, rücksichtslosen, xanthippenhaften, desinteressierten) Gegner wahrnehme, sondern anfange, ihn zu verstehen, wird der Weg zu einem anderen Umgang miteinander frei.
Auf dieser Basis wird es anschließend um Wege gehen, die aus den Sackgassen herausführen. Welche Entwicklungsrichtungen für Frauen und Männer bieten sich an, welche Hilfestellungen hat die Kommunikationspsychologie anzubieten, und welche pragmatischen Strategien haben sich bewährt?
Heimvorteil und Auswärtsspiel: Drei Perspektiven auf Familie und Beruf
1.ERSTE PERSPEKTIVE: SELBSTVERTRAUEN UND INNERE BREMSEN
Die erste Annäherung an die Sackgassen, in welchen Männer und Frauen immer wieder miteinander landen, gilt der Frage nach den Fähigkeiten und vor allem dem Selbstvertrauen, das beide Geschlechter für die Bereiche Beruf und Familie mitbringen. Was bringen Frauen und Männer also mit an Kompetenzen, an Selbstsicherheit und inneren Bremsen – und wie prägt diese unterschiedliche Ausstattung die Kommunikation zwischen den Geschlechtern?
1.1Mit Schwung auf die Karriereleiter?
FRAUEN IM BERUF: EIN AUSWÄRTSSPIEL
Mädchen und Frauen haben ihre Kompetenz in Schule und Beruf schon lange unter Beweis gestellt. Bei den Schulabschlüssen haben die Mädchen seit langem die Nase vorn: Sie haben bessere Zensuren und machen häufiger Abitur, sie verlassen die Schule seltener ohne Abschluss und landen seltener auf der Sonderschule. Der Anteil der Frauen an den Hochschulabschlüssen nähert sich kontinuierlich der 50%-Marke – und sie sind keinesfalls die schlechteren Studenten. Warum also enden die meisten Karrieren von Frauen im Mittelfeld?
«Was hab ich schon zu bieten…»: Die ‹Selbstzweiflerin› als innere Bremse
Ein Thema, das fast alle Frauen aus ihrer beruflichen Laufbahn kennen, ist die Auseinandersetzung mit einem hartnäckigen Selbstzweifel. Dazu hatte ich vor vielen Jahren ein Schlüsselerlebnis. Ich war eine junge Studentin im zweiten Semester und hatte eine Freundin, die ich sehr bewunderte. Sie hatte ihr Philosophiestudium mit Auszeichnung abgeschlossen, hatte anspruchsvolle Artikel zu den unterschiedlichsten philosophischen Themen veröffentlicht und arbeitete an ihrer Dissertation. Belesen und kompetent, wie sie war, schien sie mir ein unerreichbares Vorbild zu sein. Und eines Abends, nach dem dritten Glas Wein, beichtete sie mir, dass sie immer noch auf den Moment warten würde, in dem jemand herausfindet, dass sie in Wahrheit überhaupt keine Ahnung hätte. Das war meine erste Erfahrung damit, dass bei Frauen Selbstzweifel häufig herzlich wenig mit mangelnder Kompetenz zu tun haben.
In Kommunikationstrainings und Coachings wird immer wieder deutlich, in welchem Ausmaß Frauen an sich und an dem, was sie können, zweifeln – und zwar völlig unabhängig von ihrer tatsächlichen Kompetenz und auch unabhängig von ihrem Ehrgeiz und ihrer Karriereorientierung.
Susanne Frey hat lange und erfolgreich in der Personalabteilung eines großen Unternehmens gearbeitet. Dieser Job ist ihr inzwischen zu eng geworden – sie wünscht sich mehr Freiraum, will ihre eigene Chefin sein und plant schon seit einiger Zeit ihre Selbständigkeit. Ihre Voraussetzungen dafür sind gut, während ihrer Angestelltenzeit hat sie nicht nur Kompetenz, sondern auch Kontakte aufgebaut, die ihr jetzt zugute kommen. Sie hat bereits erste Aufträge in Aussicht, hat den Markt sondiert und einen soliden Finanzierungsplan aufgestellt. «Eigentlich steht alles – und trotzdem merke ich, dass ich immer wieder davor zurückschrecke, den entscheidenden Schritt zu tun und zu kündigen. Immer, wenn es konkret wird, meldet sich eine innere Stimme, die sagt: ‹Was hab ich schon zu bieten? Das werde ich nie schaffen!› Und dann verlässt mich aller Mut und alle Energie.»
Ulrike Schumann hat vor gut einem Jahr ihre Traumstelle in einer kleinen Werbeagentur angetreten. Aber die Freude an der Arbeit will sich nicht recht einstellen, denn immer wieder fährt ihr ein Kollege in die Parade. In Kundengesprächen übernimmt er – gegen jede Absprache – ihren Part gleich mit, er nimmt ohne ihr Wissen Kontakt zu ihren Kunden auf und nutzt dabei Informationen, die er aus Teamgesprächen mit ihr hatte. «Ich weiß genau, dass ich ein klares Gespräch mit ihm führen und ihn energisch in seine Grenzen weisen müsste – aber dann sitze ich da und frage mich heimlich, ob es denn nicht an mir liegt und ob er nicht ganz Recht hat, wenn er es machen will; vermutlich macht er es ohnehin besser.»
Beide Frauen beschreiben einen inneren Konflikt. Einerseits wissen beide genau, was sie können, und haben konkrete Vorstellungen davon, was sie gerne tun würden – aber zugleich meldet sich eine innere Stimme voller Selbstzweifel, die sie immer wieder ausbremst. Im Modell des Inneren Teams von Schulz von Thun (1998) lässt sich dieser lähmende Konflikt als Zusammentreffen unterschiedlicher innerer Stimmen darstellen: Eine innere ‹Selbstzweiflerin› trifft auf eine selbstbewusste ‹Karrierefrau›, die ihre Qualitäten kennt und die klare Vorstellungen davon hat, was sie tun könnte oder sollte, um beruflich erfolgreich zu sein.
Abbildung 3: Die ‹Selbstzweiflerin› im Inneren Team von Frauen
Diese ‹Selbstzweiflerin› ist im Inneren Team vieler Frauen gewissermaßen eine Stammspielerin. Wenn diese Stimme in Seminaren zum Thema wird, weiß praktisch jede Frau von einer solchen ‹Selbstzweiflerin› oder ‹Selbstentwerterin› zu berichten. Einen drastischen Spiegel findet diese innere Stimme in der Kultserie «Ally McBeal» – vermutlich ein Grund für den enormen Erfolg der Serie. Ally McBeal steht in extremer Weise unter dem Einfluss einer solchen Selbstentwerterin. Wie eine Souffleuse steht diese hinter ihr und kommentiert ununterbrochen wort- und bildreich alles, was sie tut, sagt oder erlebt. Aus der Distanz des Fernsehsessels ist das höchst amüsant, aber im beruflichen Alltag kann die beständige Auseinandersetzung mit einer solchen Selbstzweiflerin sehr aufreibend sein. Wer innerlich unter ihrem Einfluss steht, hat weniger Energie, und es wird einer Frau schwerer fallen, nach außen hin kraftvoll und souverän aufzutreten oder den Konflikt mit einem Kollegen durchzustehen. Häufig kann man den Einfluss einer solchen ‹Selbstentwerterin› geradezu hören – nämlich dann, wenn Frauen das, was sie sagen, gleichzeitig halb wieder zurücknehmen: «Vielleicht könnte man sagen…» Oder: «Es ist nur eine Idee, aber…» Solche Einleitungen schwächen natürlich die Wirkung des eigenen Beitrags schon im Ansatz.
Wie kommt es dazu, dass diese ‹Selbstzweiflerin› im Inneren Team von Frauen so stark werden kann? Diese Frage ist gut untersucht und kann recht eindeutig beantwortet werden: Sie haben in Elternhaus und Schule systematisch gelernt, sich nicht allzu viel zuzutrauen. Eltern und Lehrer haben heute zwar nahezu ausnahmslos das Ziel, Jungen und Mädchen gleich zu behandeln – und in aller Regel sind sie davon überzeugt, genau das auch zu tun. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass Eltern und Lehrer Mädchen im Bereich von Wissen und Leistung weniger zutrauen als Jungen. Das gilt auch heute noch, und das galt vor dreißig Jahren, als die heutigen Erwachsenen Kinder waren, noch viel mehr.6 So werden Mädchen in der Schule oft für geringere Leistungen gelobt als Jungen. Was zunächst wie eine Bevorzugung der Mädchen aussieht, erweist sich bei genauerer Betrachtung als fatal, wenn man dieses Lob nämlich unter der Lupe des Kommunikationsquadrates von Schulz von Thun (1981) betrachtet.
Das Kommunikationsquadrat unterscheidet vier verschiedene Ebenen in der Kommunikation. Jede Äußerung hat eine Sachseite, eine Selbstkundgabeseite, eine Beziehungsseite und eine Appellseite. Wenn ich mich jemand anderem gegenüber äußere, dann sage ich also nicht nur (erstens) etwas über die Sache aus, über die ich spreche, sondern (zweitens) auch etwas über mich selbst. Und drittens teile ich etwas darüber mit, wie ich mein Gegenüber und meine Beziehung zu ihm sehe. Viertens schließlich mache ich implizit oder explizit deutlich, was ich mir von meinem Gegenüber wünsche oder was ich ihm rate. Ich schicke also mit jeder Äußerung ein vierfaches Bündel an Botschaften auf den Weg – und alle sind in der Kommunikation wichtig und entfalten ihre je andersartige Wirkung.
Welche Botschaften sind nun darin enthalten, wenn ein Mädchen für geringere Leistungen gelobt wird als ein Junge? Auf der Sachebene wird die Botschaft übermittelt, dass das Mädchen eine Aufgabe richtig gelöst hat. Auf der Selbstkundgabeseite teilt der Erwachsene mit, dass er zufrieden ist. Diese Seiten der Nachricht sind wenig spektakulär. Wichtiger ist die Botschaft auf der Beziehungsseite der Nachricht, denn hier teilt der Erwachsene dem Mädchen mit, dass er ihm nicht allzu viel zutraut – denn warum sonst sollte er sie für leichtere Aufgaben loben als einen Jungen? Und auf der Appellseite schwingt der Ratschlag mit, sich lieber an leichtere Aufgaben zu halten.
Abbildung 4: Begleitbotschaften beim Lob für eine leichte Aufgabe
Implizit teilen Lehrer und Eltern Mädchen also mit, dass sie ihnen nicht besonders viel zutrauen. Das freizügig verteilte Lob hat dadurch paradoxerweise eine entmutigende Wirkung. Dazu kommt, dass Erfolg und Misserfolg bei Mädchen anders beurteilt werden. Wenn ein Junge eine gute Note schreibt, dann wird das eher mit Begabung erklärt («Das kann er eben!»), während eine schlechte Note oft darauf zurückgeführt wird, dass er halt zu faul war und («wieder mal!!») nicht gelernt hat. Wenn er nur endlich die Schule wichtiger nehmen und sich auf den Hosenboden setzen würde, dann würde es auch klappen! Oftmals wird bei Jungen auch die Ursache für einen Misserfolg in den äußeren Umständen gesucht: Die Klausur war zu schwer oder die Lehrerin kann einfach nicht gut erklären – kein Wunder also, dass er den Stoff nicht verstanden hat! Bei einem Mädchen dagegen wird eine gute Zensur viel häufiger damit erklärt, dass sie eben auch fleißig war, sich viel Mühe mit dem Führen ihrer Hefte gegeben hat und dass ja auch die Aufgaben nicht allzu schwer waren, während sie bei einer schlechten Zensur eher als ein Junge damit getröstet wird, dass sie das eben nicht so gut kann.
Das bedeutet: Indirekt werden Jungen sowohl bei guten als auch bei schlechten Zensuren in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Gute Noten beweisen ihre Kompetenz – und schlechte Noten können offenbar mit allem Möglichen zu tun haben, aber jedenfalls nicht mit mangelnder Begabung. Mädchen dagegen hören, dass schlechte Zensuren leider darauf hindeuten, dass sie etwas nicht so gut können, während Erfolge nicht unbedingt etwas mit ihren Fähigkeiten zu tun haben müssen.
Mädchen wie Jungen übernehmen diese Erklärungsmuster. Ein Mädchen lernt also, bei Misserfolgen an sich zu zweifeln und Erfolge eher für Zufall zu halten – ein Effekt, der sich auch bei beruflich erfolgreichen Frauen noch nachweisen lässt.7 Das erklärt ein ebenso eindeutiges wie seltsames Forschungsergebnis: Auch wenn Mädchen sehr viel bessere Noten haben als Jungen, sinkt ihr schulisches Selbstbewusstsein im Lauf der Schulzeit, während das der Jungen steigt. Denn während Misserfolge auf das Selbstbewusstsein der Mädchen durchschlagen, führen Erfolge nur sehr bedingt dazu, dass ihr Selbstbewusstsein steigt.
Abbildung 5: Deutung von Erfolg und Misserfolg bei Mädchen und Jungen
Auch als Erwachsene werden Frauen anders wahrgenommen als Männer und müssen mehr dafür tun, für kompetent und souverän gehalten zu werden. Diese Erfahrung habe ich vor allem in der Rolle als Seminarleiterin und Trainerin immer wieder gemacht, und viele andere Trainerinnen haben sie mir bestätigt. Frauen werden als Leiterinnen wesentlich stärker ausgetestet, und sie müssen sich die Akzeptanz ihrer Kompetenz und ihrer Souveränität sehr viel härter erarbeiten als Männer. Offenbar gehen Teilnehmer (und ebenso die Teilnehmerinnen!) bei einem Mann davon aus, dass er kompetent und sicher ist, während einer Frau zunächst einmal Unsicherheit unterstellt wird.
Diese andere Wahrnehmung von Frauen ließ sich auch in wissenschaftlichen Studien nachweisen. So wurde gezeigt, dass es Frauen (nicht aber Männern) zum Nachteil gereicht, wenn sie ihre Argumente nicht begründen oder wenn sie Nachfragen haben. Frauen werden im Gegensatz zu Männern dann als weniger intelligent und kenntnisreich eingeschätzt. Ebenso steigert es das Ansehen von Frauen (nicht aber das von Männern), wenn sie mehrere Argumente vorbringen, um ihre Meinung zu begründen.8 Kurz gesagt: Erwachsene Frauen stehen ebenso wie die Mädchen vor der Erfahrung, dass ihnen weniger zugetraut wird als Männern.
Die innere ‹Selbstzweiflerin› bekommt in der Sozialisation von Mädchen und Frauen also einiges an Nahrung. Dennoch gelingt es im beruflichen Alltag und in einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre oft, diese innere Stimme zu bändigen. Denn auch wenn Frauen dazu neigen, ihre Erfolge zu bagatellisieren, wächst natürlich mit einer erfolgreichen Berufstätigkeit auch das Selbstvertrauen. Die meisten Frauen lernen, mit ihren Selbstzweifeln umzugehen, ihnen nicht immer zu glauben und ihnen nicht immer zu folgen.
Es gibt jedoch typische Situationen, in denen sich diese Selbstzweifel besonders stark zu Wort melden. Zum einen sind dies neue Situationen und Veränderungen. Eine neue Stelle, der Wiedereinstieg nach der Kinderpause, eine Beförderung, ein besonders lukrativer neuer Auftrag, eine unbekannte, womöglich auch noch große Gruppe führen häufig dazu, dass diese Stimme mindestens kurzfristig wieder an Kraft gewinnt und alle Erfahrungen eigener Kompetenz, alle Erfolge und alle Anerkennung von außen wie weggewischt erscheinen. Ähnliches gilt, wenn man auf Gegenwind, Kritik oder Entwertung stößt. Auch diese Schützenhilfe von außen stärkt die innere ‹Selbstzweiflerin›, sodass es manchmal schwer wird, sich innerlich und äußerlich angemessen abzugrenzen. Ebenso aktivieren Misserfolge die inneren Selbstzweifel, denn Misserfolge dienen dieser Stimme als Beweis ihrer Überzeugung: «Ich habe ja schon immer gesagt, dass du in Wahrheit gar nichts kannst – und jetzt wird es für alle sichtbar!» An solchen Stellen ist es wichtig, sich mit der ‹Selbstzweiflerin› auseinander zu setzen und ihr etwas entgegenzusetzen, um zu verhindern, dass diese Stimme innerlich die Führung übernimmt und zur Bremse wird.
Abbildung 6: Veränderung, Kritik und Misserfolge können die ‹Selbstzweiflerin› stärken
Zur Bremse werden kann die ‹Selbstzweiflerin› auf zweierlei Wegen. Zum einen direkt durch ihre lähmende Wirkung: Wer innerlich unter ihrem Einfluss steht, kann weniger klar denken, traut sich weniger zu und tritt weniger bestimmt auf. Sie kann aber auch auf einem indirekten Wege wirken, denn unter ihrem Einfluss neigen Frauen oft zu einem übertriebenen Perfektionsdrang. Sie bereiten sich auf eine neue Aufgabe so vor, dass nach Möglichkeit nichts Unvorhergesehenes passieren kann – und investieren dadurch viel mehr Zeit und Mühe in Routineangelegenheiten, als angemessen wäre. Das kann eine sinnvolle Strategie sein, um sich Sicherheit zu verschaffen; im Übermaß führt sie allerdings dazu, dass zu wenig Zeit für wichtigere Dinge bleibt, weil die Vorbereitung nicht mehr primär der Sache dient, sondern der Beruhigung der inneren Selbstzweifel.
Abbildung 7: Die ‹Perfektionistin› als Reaktion auf Selbstzweifel
Schreckensbild Mannweib:Haben Frauen Angst vor Erfolg?
Sei wie das Veilchen im Moose,
bescheiden, sittsam und rein.
Und nicht wie die stolze Rose,
die stets bewundert will sein.
(Aus meinem Poesiealbum)
Wenn ich Frauen in der Beratung oder in Seminaren auffordere, von ihren Stärken und Erfolgen zu berichten, stoße ich oft auf eine typische Reaktion: Es ist den Frauen unangenehm, «aufzuschneiden». Es hat unter Frauen einen schlechten Beigeschmack, stolz auf Erfolge und die eigene Leistung zu sein und das womöglich auch noch offen zu zeigen – ein weiterer Grund, warum Frauen nicht selten dazu neigen, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und ihre Kompetenz herunterzuspielen. Frauen fürchten, sich unbeliebt zu machen, wenn sie zu sichtbar zu erfolgreich sind.
Ein seltsames Verhalten in unserer Leistungsgesellschaft! Wie kommt es zu dieser eigentümlichen Bescheidenheit? Vor dreißig Jahren haben Forscher Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Geschichten weiterzuerzählen, in denen jemand einen wichtigen Erfolg errungen hatte – zum Beispiel den ersten Preis in einem naturwissenschaftlichen Wettbewerb, ein besonders gutes Examen oder einen herausragenden beruflichen Erfolg. Jungen stellten die Folgen