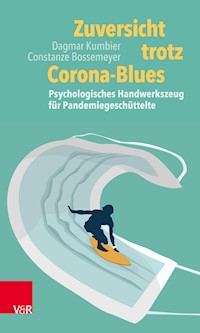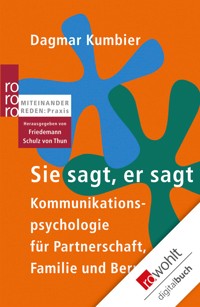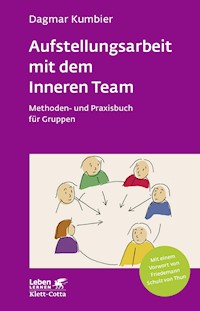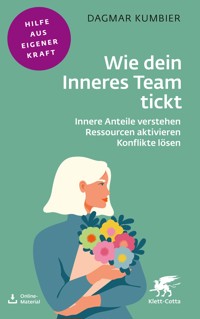
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachratgeber Klett-Cotta
- Sprache: Deutsch
Coach dein Inneres Team! Basierend auf der erfolgreichen Methode des »Inneren Teams« Das Selbsthilfebuch für einen hilfreichen Umgang mit inneren Anteilen Mit zahlreichen Abbildungen, Übungen und Audio-Imaginationen Das Thema »inneres Kind« ist inzwischen in aller Munde. Oft geht es dem inneren Kind nicht gut, so viel ist bekannt. Man muss sich um das Kind kümmern, wenn es uns gut gehen soll. Stimmt! Nur gibt es dabei leider einige Komplikationen. Denn wenn wir das versuchen, werden wir merken, dass wir es nicht mit nur einem inneren Kind zu tun haben, sondern mit einer ganzen Geschwisterschar. Und wir werden zusätzlich viele unterschiedliche andere Anteile in uns finden. Alle zusammen bilden ein komplexes System: Unser Inneres Team. Dieser Ratgeber zeigt anschaulich, wie das Innere Team tickt und gibt den Lesenden zugleich Anregungen, wie sie Zugang zu ihren Teammitgliedern bekommen und besser verstehen können, was in ihnen los ist. Sie erhalten wertvolle Hilfestellung, um ihr Team zu mobilisieren, innere Anteile zu versorgen und innere Konflikte nachhaltig zu lösen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM98878.
Die Audiodateien können Sie unter folgendem Link und QR-Code auch direkt anhören: www.klett-cotta.de/kumbier-inneres-team
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44b URHG vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg
unter Verwendung einer Abbildung von Mary Long / iStock by Getty ImagesAbbildungen im Innenteil: © Dagmar Kumbier
Gesetzt in den Tropen Studios, Leipzig
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Susanne Klein, Hamburg
ISBN978-3-608-98878-9
E-Book ISBN978-3-608-12434-7
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20714-9
Audio Download ISBN 978-3-608-98882-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Inhalt
Einleitung
1 Was es mit dem Inneren Team auf sich hat
Was sind innere Anteile?
Innen wie außen
Das integrative Modell des Inneren Teams
2 Alle beisammen? Das Innere Team erheben und gute Entscheidungen treffen
Die innere Dynamik herausarbeiten
Was ist eine gute Entscheidung?
3 Verschiedene Arten von Teammitgliedern
Verletzte innere Kinder
Bodyguards, Airbags & Co: Wächter im Inneren Team
Erwachsene Anteile
Freie Kinder als Quellen von Lebendigkeit und Lebensfreude
4 Sie als Chefin oder Chef Ihres Inneren Teams: Das Selbst
Was ist das Selbst?
Anderen Menschen vom Selbst aus begegnen
Das Selbst stärken
Resilienz vom Inneren Team aus gesehen
5 Inneren Anteilen mit Selbstenergie begegnen
Mit Wächtern in Kontakt gehen und verhandeln
Verletzte Anteile versorgen
Freie Kinder einladen
Erwachsene Anteile erkennen, würdigen und stärken
6 Teamentwicklung: Gut aufgestellt sein
Wie sieht eine gute Aufstellung aus?
Vakanzen besetzen
Ressourcenteile aufbauen
7 Was kann man ändern – und was nicht?
Das Wachstumspendel
Was bleibt
Wann es sinnvoll ist, sich Unterstützung zu suchen
Zum Schluss
Dank
Literatur
Einleitung
Die Rede vom »inneren Kind« ist inzwischen in aller Munde. Es hat sich herumgesprochen, dass wir kindliche innere Anteile in uns haben, die oft sehr schmerzhafte Gefühle mit sich herumtragen – und dass wir uns um diese Teile kümmern und sie versorgen müssen, wenn es uns gut gehen soll. Das stimmt, und es ist gut, dass uns das bewusster geworden ist.
Zugleich reicht das Bild vom »inneren Kind« nicht aus. Zum einen haben wir es nicht mit nur einem Kind zu tun – also nicht mit einem Einzelkind, sondern mit einer Geschwisterschar, einem Kindergarten, einer ganzen Horde von Kindern unterschiedlichen Alters. Zweitens – und das ist noch entscheidender – ist es oft gar nicht so einfach, sich um diese Kinder zu kümmern. Es ist zwar leicht einzusehen, dass wir das tun sollten, aber wenn wir wirklich versuchen, uns den verletzten, verstörten, einsamen inneren Kindern, die wir in uns tragen, zuzuwenden, dann stoßen wir oft auf Hindernisse.
Irgendwie kommt immer etwas dazwischen. Irgendwie vergessen wir es immer wieder, obwohl wir es uns doch vorgenommen hatten. Wir merken, dass wir irgendwann leicht gereizt denken: »Schon wieder ängstlich, obwohl ich mich so bemühe? Jetzt stell dich doch nicht so an, reiß dich zusammen!« oder: »Das ist so lange her, lass gut sein!« oder: »Nimm dich nicht so wichtig« oder: »Das ist lächerlich«. Wir merken, dass der Kontakt just dann abreißt, wenn wir Kontakt zur Traurigkeit des Kindes bekommen oder auch wenn es dem Kind besser zu gehen »droht«.
All das macht Sinn. Und all das sind Hinweise darauf, dass da nicht nur ein inneres Kind ist, das verletzt ist und um das sich alle kümmern wollen. Sondern wir haben es mit einem komplexen Inneren Team zu tun, das sich um dieses Kind, um diese Kinder gruppiert. Verletzt wird nicht ein Kind, sondern ein ganzes System. Um die inneren Kinder schart sich ein komplexes System von inneren Beschützern, die verhindern wollen, dass diese Kinder erneut verletzt werden – und dass die Gefühle dieser Kinder uns in Bedrängnis oder in Gefahr bringen. Nicht alle diese Beschützer wirken freundlich, nicht alle sind überhaupt als Beschützer erkennbar. Manche von ihnen wirken ganz im Gegenteil wie innere Widersacher und finstere Gesellen.
Dieses komplexe innere System, dieses Innere Team möchte ich mit Ihnen anschauen. Ich möchte erklären, wie dieses Team funktioniert – und Ihnen zugleich Anregungen dazu geben, Zugang zu Ihrem ureigenen Inneren Team zu bekommen, sodass Sie besser verstehen können, was in Ihnen los ist. Außerdem erfahren Sie,
wie Sie ein besseres Beziehungsklima in Ihrem Inneren Team schaffen,
konstruktiv mit inneren Konflikten umgehen,
hilfreiche Anteile aufbauen und stärken
und mit inneren Anteilen, die bislang schwierig für Sie waren, besser klarkommen können.
Sie werden viele Anregungen dazu bekommen, eigene Themen anzuschauen und in Kontakt mit Ihren unterschiedlichen inneren Anteilen zu gehen. Wenn Sie sich hier das erste Mal mit inneren Anteilen und dem Inneren Team beschäftigen, dann werden Sie womöglich nicht alle Übungen eins zu eins umsetzen können. Vor allem die Arbeit mit verletzten inneren Anteilen und ihren Wächtern setzt Erfahrung und / oder professionelle Begleitung voraus. Trotzdem kann Ihnen das Buch eine neue Perspektive auf diese Anteile eröffnen und Sie dabei unterstützen, in einen ersten Kontakt zu ihnen zu kommen.
Das Buch ist auch dazu gedacht, Sie zu begleiten, wenn Sie eine Psychotherapie, eine Beratung oder ein Coaching machen, wo mit inneren Anteilen gearbeitet wird. Das Buch kann hier Ihr Verständnis für Ihre inneren Anteile und die Dynamik zwischen diesen vertiefen und kann dem, was Sie in Ihrem Prozess erleben, einen Bezugsrahmen geben. Außerdem bietet es Ihnen die Möglichkeit, Ihren Entwicklungsprozess durch Reflexion und Übungen zu vertiefen.
Zugleich bekommen Sie hier einen kompakten Überblick über die Theorie und einen ersten Einblick in die Methodik der integrativen Arbeit mit dem Inneren Team, die ich am Institut für integrative Teilearbeit (IfiT) im Hamburg gemeinsam mit meinen Kolleginnen entwickelt habe.
1 Was es mit dem Inneren Team auf sich hat
Lassen Sie uns starten mit einem Blick darauf, was das »Innere Team« eigentlich ist. Wir alle haben viele und sehr unterschiedliche innere Anteile in uns, und das ist absolut normal und gesund. Je besser es uns gelingt, diese Anteile wahrzunehmen und sie in ihrer Unterschiedlichkeit zu respektieren und zu integrieren, desto mehr werden wir uns in Einklang mit uns selber fühlen. Und desto mehr steht uns auch unsere ganze Kraft zu Verfügung, um Schwierigkeiten zu bewältigen und den Platz im Leben zu finden, der zu uns passt.
Was sind innere Anteile?
Bei der Arbeit mit dem Inneren Team personalisieren wir die innere Dynamik. Das bedeutet: Wir verstehen die verschiedenen Anteile unserer Psyche als innere Personen, die eine eigene Geschichte, prägende biografische Erfahrungen und einen je eigenen Charakter haben. Die Bedürfnisse und Gefühle eines Teils unterscheiden sich je nach Situation. Der gleiche innere Anteil kann in einer Situation Angst haben, sich in einer anderen Situation sicher fühlen und in einer dritten wütend werden. Entsprechend wird er in jeder dieser Situationen unterschiedlich auftreten und sich unterschiedlich verhalten.
Innere Anteile sind also nicht identisch mit den Gefühlen, die sie haben. Wenn es uns gelingt, guten Kontakt zu einem Teil zu bekommen, der Angst hat oder wütend wird, dann können wir verstehen, was ihn bewegt, und können ihm helfen, sich zu beruhigen. Wir werden ihn tiefer und besser kennenlernen und dabei merken, dass seine aktuellen Gefühle und seine aktuellen Verhaltensweisen nicht seinen Kern ausmachen.
Wenn wir uns unsere unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile als Personen vorstellen, gelingt es uns leichter, uns in diese hineinzuversetzen. Denn über die Gefühle von Menschen und die Frage, warum Menschen sich so oder so verhalten, haben wir im Laufe unseres Lebens eine ganze Menge gelernt. Ebenso haben wir einiges an Wissen darüber erworben, was Menschen brauchen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie aufgebracht sind oder in Konflikten feststecken. Durch die Personalisierung der inneren Dynamik können wir dieses Wissen auf den Umgang mit uns selbst übertragen.
Innen wie außen
Diese Analogie »innen wie außen« durchzieht unsere gesamte Denk- und Arbeitsweise. Wir gehen davon aus, dass die Dynamik in unserem Inneren Team nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie die Dynamik in Arbeitsteams oder in Familien. Weil zum Inneren Team eben auch die inneren Kinder gehören, ist die Analogie »Familie« oft passender, weil man Kinder anders behandeln muss als Erwachsene. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Kinder im Inneren Team als solche zu identifizieren. Bei manchen ist das ganz leicht, da springt es uns förmlich ins Auge – bei anderen ist es schwierig. Denn manche inneren Kinder verkleiden sich als Erwachsene.
Innen wie außen gilt: Wie gut es den einzelnen Mitgliedern eines Teams oder einer Familie geht, hängt vom Beziehungsklima ab. Werden alle respektiert, gesehen und gehört? Geht es einigermaßen gerecht zu, haben also alle die gleichen Chancen, mit ihren womöglich ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen Gehör zu finden und berücksichtigt zu werden? Hört man sich gegenseitig zu oder ist die Kommunikation untereinander von Aggression, Abwertung oder Feindseligkeit geprägt? Gibt es Mitglieder, die ausgeschlossen, angefeindet, gemobbt werden? Und andere, die niemanden zu Wort kommen lassen und alle anderen dominieren? Dürfen Kinder auch wirklich ihr Kindsein leben – oder werden ihnen Aufgaben aufgeladen, die ihre Kräfte übersteigen?
Innen wie außen gilt auch: Je feindseliger der Umgang miteinander, desto anstrengender wird das Zusammenleben und desto schwieriger wird es, gute Lösungen zu finden. Wenn Teammitglieder gegeneinander arbeiten, werden sie sich gegenseitig blockieren. Wenn Mitglieder ausgeschlossen werden, dann können sie nichts beitragen, ziehen sich zurück und werden zum Bremsklotz. Wenn es einzelnen Mitgliedern sehr schlecht geht, dann hat das eine Wirkung auf alle und entzieht dem Team oder der Familie Energie.
Und schließlich gilt sowohl innen wie außen, dass es jemanden braucht, der in einem Team oder in einer Familie die Verantwortung trägt. Es braucht jemanden, der dafür sorgt, dass im Zusammenleben bestimmte Regeln eingehalten werden, der Konflikte moderieren kann und der Entscheidungen trifft, wenn alle gehört worden sind. Es braucht auch jemanden, der sich um Mitglieder kümmert, denen es schlecht geht. In Teams ist das die Chefin oder der Chef, in Familien sind es die Eltern, im Inneren Team ist es das Selbst. Diese Leitung kann gut oder schlecht gelingen. Wenn die einzelnen Mitglieder die Leitung nicht respektieren, wenn die Leitung Lieblinge hat und andere Mitglieder nicht mag oder wenn sie sich von einzelnen Mitgliedern die Führung aus der Hand nehmen lässt, dann wird es schwierig.
Das integrative Modell des Inneren Teams
Das integrative Modell des Inneren Teams, mit dem ich und mit dem wir in Hamburg am Institut für integrative Teilearbeit (IfiT) arbeiten, speist sich aus vielen Wurzeln.
Ich habe lange mit Friedemann Schulz von Thun zusammengearbeitet. Sein Coaching-Modell des Inneren Teams war die Keimzelle. Ich habe mich in die Bildlichkeit und Klarheit der Methode verliebt und fand wunderbar, dass wir in der Arbeit mit dem Inneren Team mit unseren Klientinnen und Klienten durchgehend auf Augenhöhe sind. Wir können die innere Dynamik auf sehr einfache und zugleich differenzierte Art gemeinsam erarbeiten und dabei sehr schnell in die Tiefe und auf den Punkt kommen.
Daher habe ich das Innere Team mitgenommen, als ich mich der Psychotherapie zugewandt habe. Zugleich merkte ich schnell, dass das Coaching-Modell hier an seine Grenzen stößt. Bei meinen Klientinnen und Klienten auf der Trauma-Station der Klinik, in der ich gearbeitet habe, begegnete ich inneren Anteilen, die eine Qualität an Angst, Wut oder Horror in sich trugen und sich manchmal auf eine Weise destruktiv verhielten, die ich mit meinem bisherigen Instrumentarium weder verstehen noch erreichen konnte. Ich musste das Modell also erweitern.
Dabei lernte ich viel von und mit meinen Klientinnen und Klienten. Ich erkannte, dass manche Teile so schwer verletzt wurden, dass sie in der verletzenden Situation wie erstarrt und eingefroren sind. Und ich verstand, dass es andere Teile gibt, welche diese verletzten Teile beschützen – manchmal mit Methoden, die heute sehr destruktiv wirken. Später fand ich ähnliche Gedanken im Modell der »Inneren Familiensysteme« (IFS) von Richard Schwartz wieder, habe lange mit Tom Holmes gearbeitet, der auch der IFS-Tradition entstammt, und viel aus der IFS integriert.
Ebenso habe ich transaktionsanalytische und psychodynamische Konzepte eingearbeitet. Das »freie Kind« aus der Transaktionsanalyse repräsentiert einen Teil unserer Persönlichkeit, den wir nicht in den Blick bekommen, wenn wir uns nur auf zielorientiertes Coaching oder auf Traumatherapie konzentrieren. Es erschien mir daher als wichtige Ergänzung. Und die Beziehungsmuster, die wir in der psychodynamischen Therapie bearbeiten wollen, finden wir auch im Inneren Team gespiegelt – denn wir alle neigen dazu, kindliche Anteile in unserem Inneren Team so zu behandeln, wie wir selber uns von unseren Eltern behandelt gefühlt haben. Wir können diese Muster daher auch mithilfe des Inneren Teams identifizieren und bearbeiten, was einige Vorteile gegenüber der Arbeit an der Übertragungsbeziehung (also der Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin) hat und diese daher sinnvoll ergänzen kann.
In jüngster Zeit habe ich begonnen, mich mit der Positiven Psychologie auseinanderzusetzen, und dadurch den Blick auf »freie Kinder« und Ressourcen noch einmal ausgearbeitet. Wer sich für diese verschiedenen Wurzeln interessiert, aus denen das integrative Modell des Inneren Teams gespeist wird, findet all das ausführlich dargestellt und zitiert in meinem Buch »Das Innere Team in der Psychotherapie« (Kumbier 2013).
Ziel war und ist es, diese verschiedenen Wurzeln zu einem schlüssigen Gesamtkonzept zu integrieren, das die gesamte Bandbreite von einer gut ausbalancierten und ausgewogenen psychischen Dynamik bis hin zu schweren Traumatisierungen verständlich machen kann. Einem Konzept, das uns Ansatzpunkte und Wege anbietet, verletzte und destruktiv agierende innere Anteile zu erreichen, zu versorgen und womöglich zu »heilen«, und uns dabei zugleich Zugang zu den Quellen von Lebensfreude, Kreativität und Leichtigkeit erschließt, die unser Inneres Team für uns bereithält.
2 Alle beisammen? Das Innere Team erheben und gute Entscheidungen treffen
Was heißt das nun für den Umgang mit dem eigenen Inneren Team? Das, was man in sich vorfindet, wirkt häufig zunächst einmal wie ein chaotischer Haufen. Was macht man, wenn alle durcheinanderreden, sodass man nur noch Chaos wahrnimmt? Was macht man, wenn jeder etwas anderes will? Oder wenn sich Anteile zu Wort melden, die man peinlich, unmoralisch oder unpassend findet, von denen man fürchtet, dass sie einen in Teufels Küche bringen können?
Gucken wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an.
Beispiel: Soll ich meine Mutter pflegen?1
»Karin überlegt, ob sie ihre Mutter bei sich aufnehmen will. Diese lebe seit dem Tod ihres Mannes alleine in Karins Elternhaus. Bislang sei das auch gut gegangen, aber allmählich werde es schwierig. Kürzlich sei die Mutter abends gestürzt und nur mit großer Mühe wieder auf die Beine gekommen. Und sie werde langsam »tüdelig«, vergesse, die Herdplatte abzustellen oder genügend Essen einzukaufen. Es sei absehbar, dass es nicht mehr lange allein gehen werde. Und die Mutter mache auch zunehmend Andeutungen (»Tante Hedwig hat es ja gut, die kann bei Anna wohnen«).
Ich schlage Karin vor, ihr Inneres Team zu der Situation zu erheben.
Die innere Dynamik herausarbeiten
Bei der Erhebung des Inneren Teams malen wir alle inneren Anteile auf, die sich zu einem bestimmten Thema zu Wort melden. Wir visualisieren also die innere Dynamik und machen uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild davon. Diese Methode hat Friedo Schulz von Thun entwickelt, und sie eignet sich sehr gut dazu, sich einen Überblick zu verschaffen und zu verstehen, was da los ist.
»Bei Karin meldet sich als Erstes ein Anteil, den sie »mitfühlendes Herz« nennt und der gut verstehen kann, dass die Mutter nicht in ein Altenheim will. Eine innere »Tochter« fügt hinzu, dass sie ja schließlich ihre Mutter sei. Als unmittelbare Reaktion auf diese beiden gibt eine »familiäre Grenzwächterin« zu bedenken, was es bedeuten würde, wenn die Mutter jeden Tag mit am Familientisch sitzen würde. Diese habe vollkommen andere Vorstellungen über Kindererziehung oder über einen guten Umgang mit Konflikten – und so wie die Mutter gestrickt sei, werde diese sich auch nicht zurückhalten, sondern eher das Gespräch dominieren! Die »Grenzwächterin« fürchtet, dass von der bisherigen Art des Familienlebens, an der Karin viel liegt, wenig übrig bleiben würde. Eine »startbereite Karrierefrau« fügt hinzu, dass Karin außerdem gerade die Chance habe, wieder richtig in den Beruf einzusteigen! Sie habe lange der Kinder wegen zurückgesteckt, jetzt sei endlich sie dran! Sie liebe ihren Beruf und wolle endlich wieder Raum dafür haben!
Das »Gewissen« findet diese Überlegungen egoistisch und unpassend. Es sei Aufgabe der Kinder, für die Eltern da zu sein, wenn diese alt werden, da gehe es nicht um Selbstverwirklichung, sondern schlicht um Pflicht! Und außerdem: Was würden die anderen sagen? Karin lebt in einem Umfeld, in dem es üblich und fast selbstverständlich ist, dass die Kinder im Alter für die Eltern sorgen. Und eine »Dankbare« findet das auch ganz richtig so. Ihre Mutter habe schließlich auch viel für sie getan, und jetzt sei sie eben dran!
Als wir diese Teammitglieder aufgemalt haben, überlegt Karin länger. Doch, eine Stimme gebe es noch. Sie sei ja eigentlich ein umgänglicher Mensch und sie komme gut mit Menschen klar. Aber ihrer Mutter gegenüber würde sie sich regelmäßig innerhalb kürzester Zeit in eine angespannte Schreckschraube verwandeln. Sie sei dann viel härter und aufbrausender, als sie sich sonst kenne. Und ihr Eindruck sei, dass es der Mutter ähnlich gehe. Beide würden sich aufeinander freuen, wenn es darum gehe, einen Abend oder einen Nachmittag zusammen zu verbringen – aber bei längerem Zusammensein werde es sehr schnell sehr schwierig. Wie das werden solle, wenn sie zusammenleben, das wolle sie sich gar nicht vorstellen. Karin nennt diese Stimme das »gebrannte Kind«. Dann ist sie zufrieden: Das seien jetzt alle.
Zur nächsten Sitzung kommt Karin mit einer Spätmelderin. Es habe sich noch ein »alter Groll« in ihr zu Wort gemeldet. Ganz anders als die dankbare Tochter schaue dieser keineswegs mit guten Gefühlen auf ihre Mutter. Sie habe neben den guten auch sehr schlechte Erinnerungen. Die Mutter habe sie an vielen Punkten, wo sie diese gebraucht hätte, in sehr schmerzhafter Weise hängen gelassen. Dieses Teammitglied reagiere wütend und aufgebracht auf die Vorstellung, dass Karin ihr eigenes Leben so stark einschränken solle, um nun, wo die Mutter sie brauche, zur Verfügung zu stehen.
Abbildung 1: Karins Inneres Team
Nun haben wir alle beisammen, und Karin ist erleichtert. Kein Wunder, dass sie so hin- und hergerissen ist! Kein Wunder, dass sie nachts oft wachliegt und sich nicht entscheiden kann, bei so vielen und so unterschiedlichen Gefühlen und Impulsen! So ein Chaos, und alle reden durcheinander.
Übung: Ihr Inneres Team erheben
Bevor wir mit dem Beispiel »Soll ich meine Mutter pflegen?« weitermachen, möchte ich Sie einladen, ein eigenes Inneres Team zu einem Thema zu erheben, das Sie gerade beschäftigt. So bekommen Sie ein Gefühl für die Sache und können alles, worüber wir im Laufe des Buches sprechen werden, auf Ihr eigenes Beispiel übertragen. Und wenn es gut läuft, dann werden Sie mit Ihrem Thema ein ganzes Stück weiterkommen.
Ja, ich weiß, das hält auf und die Verführung ist groß, die Übung auszulassen … Aber das wäre schade!
Wenn Sie mitmachen wollen, dann nehmen Sie sich bitte ein Blatt Papier. Wenn Sie einen Malblock zur Hand haben, gerne im DIN-A3-Format, aber normales Druckerpapier tut es auch. Malen Sie oben einen Kopf für sich selber als Chefin oder Chef ihres Inneren Teams hin und dann einen möglichst großen Brustraum dazu. Denn Sie wissen noch nicht, wie viele Teammitglieder es geben wird. Es können fünf oder auch zwanzig sein – und alles wäre »normal«.
Um welches Thema soll es gehen?
Gibt es gerade ein Thema, das Sie beschäftigt und bei dem es sich lohnen würde, zu schauen, welche inneren Anteile es dazu in Ihnen gibt?
Stehen Sie vor einer (kleinen oder großen) Entscheidung?
Oder es gibt einen Menschen, mit dem Sie es aktuell schwer haben oder der Sie beschäftigt? Das kann ein wichtiger Mensch sein – ein Freund, eine Freundin oder jemand aus Ihrer Familie – oder auch jemand, der im Grunde gar keine so große Rolle in Ihrem Leben spielt, wie eine Nachbarin, ein Kollege oder Kunde oder die Mutter vom besten Freund Ihres Sohnes.
Es kann sich auch lohnen, das Innere Team zu einer Konfliktsituation oder zu einer beruflichen Situation anzuschauen.
Wenn Sie ein Thema gefunden haben, auf das Sie Lust haben und mit dem Sie gerne ein Stück weiterkommen würden, dann notieren Sie ein Stichwort dazu oben auf Ihrem Blatt, um es während der Erhebung präsent zu halten.
Abbildung 2: Die Erhebung des Inneren Teams
Dann schauen Sie, welches Mitglied Ihres Inneren Teams, welcher innere Anteil sich als Erstes in Ihnen zu Wort meldet. Innere Anteile können sich auf ganz unterschiedliche Weise bemerkbar machen, sie sprechen gewissermaßen unterschiedliche Sprachen. Was ist der erste Gedanke, der Ihnen durch den Kopf schießt (»Der spinnt wohl, wenn er denkt, mich so behandeln zu können!«)? Welches ist das erste Gefühl, das sich meldet (zum Beispiel Wut, Angst, Trauer oder Freude)? Manchmal spüren wir auch einen Impuls (zum Beispiel weglaufen, jemandem die Meinung sagen, beschwichtigen wollen). Oder der Teil meldet sich über unseren Körper, indem auf einmal der Bauch kribbelt oder wir Kopfschmerzen bekommen. Manchmal können wir dann mit der Frage »Wenn die Kopfschmerzen sprechen könnten, was würden sie sagen?« diese Körpersprache in Worte fassen.
Wenden Sie sich diesem Anteil zu. Wie reagiert dieser auf Ihr Thema? Welchen Impuls, welches Gefühl hat er dazu? Was will er Ihnen oder auch dem Menschen, um den sich Ihr Thema dreht, sagen? Hören Sie dem Teammitglied zu und versuchen Sie, sein Anliegen und seine Gefühlslage zu verstehen, wenn möglich ohne Bewertung.
Wenn Sie eine Idee haben, wie es diesem Teammitglied geht, dann malen Sie es in den Brustraum der Figur auf Ihrem Blatt (nicht zu groß, denn Sie wissen ja nicht, wie viele noch kommen!). Malen Sie ihm auch ein Gesicht und einen Gesichtsausdruck – und lassen Sie sich dabei nicht von der Vorstellung stressen, dass Sie nicht malen können. Doch, das können Sie! Es geht hier nicht um Perfektion, sondern nur darum, dass man dem Teil grob ansieht, ob er traurig, zufrieden oder wütend ist. Dazu braucht es nur wenige Striche, die leicht zu lernen sind.
Abbildung 3: Doch, Sie können malen!
Sie werden merken: Es macht einen Unterschied, ob Sie nur ein Stichwort notieren oder ob der Anteil Sie anschauen kann. Stichworte erreichen nur Ihren Kopf, mit dem Gesicht kommt auch das Gefühl dazu. Sie bekommen so mehr Kontakt zu diesem Anteil.