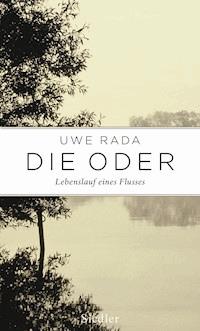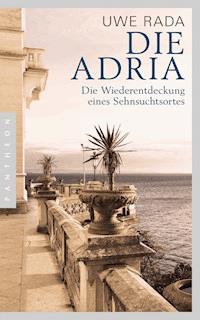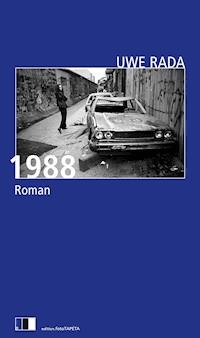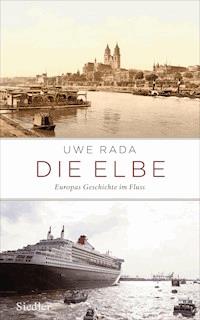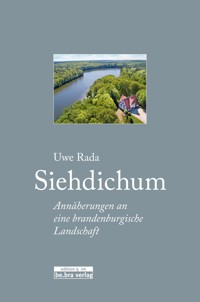
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo liegt eigentlich Siehdichum? In seinem vielleicht persönlichsten Buch erkundet Uwe Rada eine Region zwischen Spree und Oder, die weitgehend unbekannt ist, obwohl es hier viel zu entdecken gibt: das romantische Schlaubetal, das Barockwunder von Neuzelle, aber auch die Lieberoser Heide, wo die Urwälder von morgen entstehen. Und dann ist da noch die Grenze zwischen der Mark Brandenburg und der Niederlausitz, die über Jahrhunderte hinweg abgehängt war, aber nun – wie die gesamte Region rund um Siehdichum – zum Zukunftslabor einer neuen Schwellenzeit geworden ist. Auf seinen Streifzügen nähert sich Uwe Rada dem Verhältnis von Geschichte und Landschaft, Provinz und Metropole, Mensch und Wald. Aus vielen Facetten entsteht so das Porträt einer faszinierenden Region, in der es zwar keine herrschaftlichen Schlösser gibt, dafür aber jede Menge Geschichten über die Menschen und die Landschaft, die sie geprägt haben. "Uwe Rada hat die phänomenale Fähigkeit, komplizierte historische und geografische Zusammenhänge so leichthin aufzubereiten, dass man gar nicht merkt, wieviel an Informationen man geschluckt hat und ein bisschen gescheiter geworden ist." Karl-Markus Gauss
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Rada
Siehdichum
Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft
Mit Fotografien von Inka Schwand
Für meine Frau Inka Schwand, mit der ich ins Schlaubetal gezogen bin,
und für Diana Baesler, die uns hier ankommen ließ.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
ebook im be.bra verlag, 2021
© der Originalausgabe:
berlin edition im be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2021
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Ingrid Kirschey-Feix, Berlin
Umschlag: typegerecht berlin
ISBN 978-3-8393-2145-4 (epub)
ISBN 978-3-86124-742-5 (print)
www.bebraverlag.de
INHALT
Torfstiche Grunow
Am Bahnhof Grunow
Wasserscheide Dammendorf, Bremsdorf
Siehdichum
Die Schlaube
Unter den Eichen Krügersdorf
Holznot. Notholz Schernsdorf
Im toten Winkel
Landschaftspuzzle
Himmlisches Theater Neuzelle
Heidereiterei Dammendorf, Friedland
Ausmisten Beeskow
Wendische Kirche Lieberose
Offene Erinnerungslandschaft Jamlitz
Über Oder und Neiße Ratzdorf
Kohle machen Schönfließ
Werk und Stadt Eisenhüttenstadt
Auf den Tisch Kieselwitz, Berlin-Neukölln
Der Nord-Süd-Konflikt Frankfurt, Lübben
Tief durchatmen Ranzig, Müllrose
Neue Wildnis Lieberoser Heide
Stoffwechsel Müllrose
Abendrunde Grunow
Karte
Literatur
Danke
Der Autor
Mit dem Namen Siehdichum haben die Mönche des Klosters Neuzelle nicht nur den schönsten und wildesten Ort des Schlaubetals gewürdigt, sondern der Nachwelt auch ein Vermächtnis hinterlassen. Siehdichum ist eine Aufforderung, die Sinne zu schärfen, die Landschaft mit eigenen Augen zu sehen und zu beschreiben, ohne dabei zu vergessen, warum sie so geworden ist. Siehdichum heißt aber auch: Bleib nicht stehen, mache dich auf den Weg, begib dich selbst auf die Suche nach anderen Orten, die diesen Namen verdienen.
Mein Siehdichum ist deshalb realer Ort und Imagination zugleich, ästhetischer Imperativ und Platzhalter für eine weitgehend unbekannte Region im toten Winkel zwischen Mark und Niederlausitz. Als Sehschule macht Siehdichum neugierig auf das Verhältnis von Landschaft und Geschichte, Metropole und Provinz, Mensch und Wald. Und es öffnet den Blick für eine ganz neue Sicht auf eine Region, die bislang noch nicht einmal einen Namen hatte.
TORFSTICHE
Grunow
Meine erste Begegnung mit den Torfstichen hatte ich, bevor ich wusste, dass es die Torfstiche waren. Es war an einem Nachmittag Ende August. Über dem Feld stand die Abendsonne und tauchte die gelb blühenden Senfhalme samt dem Waldsaum dahinter in ein mildes Licht. Wir gingen am Feldrand entlang und kletterten durch eine Senke, durch die einmal die alte Bahnstrecke von Frankfurt nach Cottbus führte. Um zur Niederung der Oelse zu gelangen, deren Namen ich erst einige Tage zuvor zum ersten Mal gehört hatte, mussten wir uns durch dichte Brombeerbüsche und das Unterholz schlagen, dann standen wir vor einem See. Eine Tarkowski-Landschaft, dachte ich augenblicklich, einen anderen Vergleich hatte ich nicht zur Hand. Wäre Stalker, der Film des sowjetischen Regisseurs Andrej Tarkowski, nicht an der Pirita bei Tallinn, sondern in Brandenburg gedreht worden, müsste er genau an dieser Stelle spielen.
Vor uns breitete sich eine Landschaft aus, geheimnisvoll, schweigsam und fast gespenstisch unberührt. In die Mitte des schmalen Sees ragte von Norden eine Landzunge, bestanden mit Totholz, die Erlenstämme steckten in kleinen Grüppchen im Sumpf, über ihnen übten Kraniche den Flug in den Süden. Kahle, astlose Stämme, die sich im Wasser spiegelten und etwas Unheimliches ausstrahlten als ob sie zur unbewohnten Zone unseres Bewusstseins gehörten. Ich versuchte zu fotografieren, was ich sah, und wusste doch, dass es mir nicht gelingen würde. Wie fotografiert man eine Tarkowski-Landschaft?
Auch am Ufer gegenüber, hinter der Halbinsel, standen die Erlen wie Bleistifte ins Wasser gesteckt, als hätten sie sich versammelt zu einem Totengebet. Der See, das konnte ich an der kleinen Sandbucht sehen, die die Brombeersträucher freigegeben hatten, streckte sich von Norden nach Süden, wo er bald zu Ende war und in ein Niedermoor überging. Nach Norden hin sah ich kein Ende, je weiter wir gingen, desto unzugänglicher wurde das Unterholz, das Dickicht schloss sich, kein Weg, der weiterführte, nicht einmal ein Trampelpfad.
Das Wasser des Sees, den die Oelse an dieser Stelle bildete, sah trübe aus, kein Ort zum Abbaden. Vor dem Ufer vereinzelte Büschel von Seggen, ich konnte nicht erkennen, wie tief das Wasser reichte. Die Oelse, das hatte ich der Karte entnommen, die seit ein paar Tagen in unserer Küche hing, entspringt dem Möschensee, fließt durch den Chossewitzer See, speiste vor Zeiten einige Mühlen, die längst nicht mehr in Betrieb sind, und mündet schließlich, da hat sie die Tarkowski-Landschaft längst verlassen, bei Beeskow in die Spree. Das Wasser, vor dem wir standen, würde also irgendwann durch Berlin und weiter dann über die Elbe und Hamburg in die Nordsee fließen.
Aber Hamburg und die Nordsee waren an diesem Nachmittag Ende August weit entfernt. Eher hatte ich das Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem die Zeit nicht nur stillstand. Vielleicht war auch ich in eine andere Zeitzone geraten. Das Wasser zu unseren Füßen regte sich kaum, nur bei einem Windstoß kräuselte sich die Oberfläche. Die Kraniche zogen längs des Sees und zwei Schwäne, die an seinem Ende waghalsige Landungen veranstalteten. Trotz ihres Lärms lag über dieser unwirklichen Landschaft eine unwirkliche Stille. Kam diese Stille aus mir?
Als ich einige Tage später wieder an diesen Ort zurückkehren wollte, fragte unsere Nachbarin: Du gehst zu den Torfstichen? Nein, antwortete ich etwas verunsichert, ich will noch einmal hinunter zu dieser wilden Landschaft an der Oelse und zu diesem See. Das sind ehemalige Torfstiche, lächelte die Nachbarin, früher haben sie dort Torf abgebaut, zur Bodenverbesserung. Nur war der Torf sauer und musste mit Kalk abgebunden werden. Ich nickte. Später entdeckte ich, dass das Gebiet als jüngstes Naturschutzgebiet in Brandenburg ausgewiesen worden war. Die Tarkowski-Landschaft, die ich entdeckt hatte, hatte einen amtlichen Namen: »Oelseniederung mit Torfstichen«.
Eine Zeitlang ging ich dann nicht mehr zu den Torfstichen. Wollte die erste Begegnung mit der Landschaft, die mich seit diesem Augusttag beheimatet, nicht verblassen lassen durch ein Übermaß an Wiederholung. Wollte den Zauber der Landschaft nicht unnötig strapazieren. Wollte mich dem See, den ich entdeckt hatte, auch nicht von Westen her nähern, dort wo die Bleistifterlen ihr Totengebet halten. Auf den Karten sind dort seltsame Waben eingezeichnet. Zelte oder Tarnnetze, schien es uns, als wir in den Tagen unserer Ankunft bei Google Maps nachschauten. Tatsächlich ist es ein Munitionsdepot der Bundeswehr. Zunächst hat uns das noch beunruhigt. Mit der Zeit haben wir es ausgeblendet. Es ist hinter der unwirklichen Landschaft an der Oelseniederung, weit weg, auf der gegenüberliegenden Seite.
Vielleicht wollte ich auch nicht mehr zu den Torfstichen, weil auf dem Weg dorthin ein scharfer Hund mit wütendem Gebell den Gartenzaun entlang hetzt. Es ist ein schöner Weg, bequemer als der über den Feldrand, den wir damals gegangen waren. Gleich hinter dem Grundstück mit dem Hund geht es auf einem mit alten Feldsteinen gepflasterten Weg über eine Brücke, unter der die Eisenbahn zwischen Frankfurt und Beeskow und weiter nach Königs Wusterhausen verkehrt. Auch das alte Bahnhaus, in dem wir wohnen, kann man von der Brücke aus sehen. Im Abendrot leuchten die Ziegel, und hinter dem Fachwerkgiebel beginnt eine Weite, die ich seitdem nicht mehr missen mag. Hinter den Wäldern, die ich von der Bahnbrücke besser überblicken kann als von unserem Garten, liegen Mixdorf und Siehdichum, dahinter Müllrose, wo die Schlaube einst scharf nach rechts bog und schließlich vor Frankfurt in die Oder mündete.
Von der Bahnbrücke war es noch eine Viertelstunde bis zur Oelse, daran erinnerte ich mich, als ich vor kurzem den Weg wieder ging, trotz des scharfen Hundes mit seinem Drohgebaren. Zuvor war ich Johannes Brisch und seiner Frau Brigitte begegnet, die mir erzählten, was es mit meiner Tarkowski-Landschaft auf sich hat. Johannes Brisch, Jahrgang 1936, arbeitete wie sein Vater Max in der LPG Pflanzenproduktion Schlaubetal, die ihren Sitz in Grunow hatte. Von seinem Vater hatte er erfahren, wie vor dem Krieg Torf abgebaut wurde, allerdings auf der westlich gelegenen »Schneeberger Seite« der Oelse, nicht auf der östlichen, unserer »Grunower Seite«. »Der Torf wurde noch mit dem Spaten gestochen und dann mit Loren zu Sammelstellen gefahren«, sagt Johannes Brisch. Damals war mit dem Torf, diesem über Hunderte von Jahren entstandenen pflanzlichen Substrat, noch geheizt worden.
In den sechziger Jahren kamen dann nicht mehr die Schneeberger oder die Beeskower mit dem Spaten, sondern die Grunower mit dem Bagger. »Vor allem im Winter, wenn es auf den Feldern nichts zu tun gab, sind wir runter an die Oelse«, erinnert sich Johannes Brisch. »Weil es da etwas sumpfig war, haben wir Betonplatten ausgelegt, damit die Bagger nicht absaufen. Den Torf haben wir auf die Felder gefahren und den Stallmist dazu gemischt.«
Erst in dieser Zeit ist der See entstanden, den ich bei meiner ersten Begegnung mit den Torfstichen entdeckt hatte. Die geheimnisvolle, schweigsame und fast gespenstisch unberührte Landschaft ist von Menschenhand gemacht. Mein Auge hatte mir eine Falle gestellt. Es sollte nicht die letzte sein bei meinen Streifzügen durch die Region um Siehdichum.
Mit der Wende endete dann die Geschichte des Torfabbaus in Grunow. Auf der Schneeberger Seite aber ging die Geschichte weiter, weiß Brigitte Brisch. »Wo heute das Munitionsdepot der Bundeswehr ist, war zu DDR-Zeiten das Depot der Nationalen Volksarmee. 1969/70 wurde es gebaut, ein Jahr später habe ich angefangen dort zu arbeiten, da stand schon ein Teil von den Baracken. Und die Bunker standen auch alle schon.« Unterirdische Bunker, betont sie.
Die damals 27-Jährige arbeitete in der Küche des Munitionsdepots. »Die Soldaten mussten ja was essen, und manchmal hatte ich auch Sonnabend und Sonntag Schicht. Da ist der Bus nicht gefahren, der uns sonst immer nach Beeskow oder Grunow brachte. Da sind wir mit dem Fahrrad immer einen Schleichweg gefahren. Wo man heute nach Beeskow fährt, ging auf der linken Seite ein Weg rein. Dann sind wir am Bahndamm lang gefahren. Da hat der Otto ein Stück Wiese gehabt, auch ein paar Karnickel. Heu hat er da auch gemacht. Immer, wenn wir bei ihm lang gefahren sind, haben wir wahrscheinlich sein Gras plattgedrückt. Deshalb hat er uns Reißzwecken hingepackt. Wir mussten unser Fahrrad dann übern Bahndamm rübermachen, und da sind wir denn rausgekommen an dem Tor, wo der Zug immer reingefahren ist. Am Eisenbahntor.«
Das Munitionsdepot der Nationalen Volksarmee hatte einen Anschluss an die Bahnstrecke Grunow-Beeskow. Und alles war streng geheim. »Früher wusste keiner, was da war, da haben wir immer gesagt, das ist eine Schokoladenfabrik.« Einmal, erinnert sich Brigitte Brisch, wurde sie nachts geweckt und zum Depot geholt. »Ein Jagdflugzeug war abgestürzt. Der Lehrausbilder und der Stift kamen ums Leben. Das können Sie noch heute sehen, wenn Sie nach Beeskow fahren, links von der Straße aus gesehen sieht man das, da ist ein kleines Wäldchen, da ist das Flugzeug abgestürzt. Ein kleines bisschen weiter wäre es, auf Deutsch gesagt, auf der Munition gelandet.«
Die Nacht damals wird Brigitte Brisch nicht vergessen. »Wir mussten den Soldaten Tee und Bockwurst bringen, auch von Marxwalde waren sie gekommen. Die haben mit einer kleinen Harke den Wald geharkt. Bis sie vom Flugzeugführer und Stift alles gefunden haben. Der Kopf mit dem Helm hing in den Bäumen. Ich sag dann, neugierig war ich ja schon immer gewesen, Jungs, schmeckt euch die Bockwurst, könnt ihr das hier essen? Da sagt einer: Das sehen wir alle Tage.«
Ein paar Tage, nachdem mir die Brischs ihre Geschichten erzählt haben, bin ich also vorbei am scharfen Hund, über die gepflasterte Bahnbrücke, von der ich unser Haus sehen kann und die Wälder, die bis Müllrose reichen, weiter auf dem Forstweg, an dem mich, als sei ich nie fort gewesen, links die Robinien und rechts die Kiefern grüßten, kam dann endlich hinunter zur Niederung und kämpfte mich durch das dichte Brombeergestrüpp zur kleinen Sandbucht.
Es war alles noch da. Auf der Landzunge und dahinter hielten die kahlen, astlosen Erlen noch immer ihr Totengebet, auch ein Schwan zog über mich hinweg. Das Wasser der Oelse war noch immer trüb, ich wusste nun auch, dass sich das nicht mehr ändern würde und warum. Eine geschundene Landschaft, dachte ich, und ich war auf sie hereingefallen. An Tarkowski dachte ich nun nicht mehr. Dennoch werde ich wiederkommen.
AM BAHNHOF
Grunow
Wo ist das eigentlich, das Ankommen? Und wie ist es zu beschreiben? Ist es ein Ort, vom dem man ausschwärmt in die Umgebung, um dann wieder zurückzukehren und am Abend beim Glas Wein im Garten oder an der Feuerschale von der wilden Landschaft an den Torfstichen, der Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee oder dem Jagdhaus in Siehdichum zu berichten? Von der Landschaft, die ich mir langsam zusammenpuzzeln muss, vom Neuzelle der Mönche, den Heidereitern in Dammendorf und den Ordensrittern in Friedland, den sorbischen Predigern in Lieberose, den Schmugglern an der ehemaligen märkisch-sächsischen Grenze. Aber wie groß ist der Radius, den man ziehen darf, um das Ankommen nicht zu strapazieren? Wird es, wenn die Streifzüge zu weit in entlegenes Gelände führen, seine Anziehungskraft verlieren, schwebt über allem auch die Drohung des Fortgehens?
Oder ist es genau andersherum? So wie bei einer Liebe, deren Geheimnis nicht auf einem Versprechen beruht, sondern auf dem innigen Gefühl der Verbundenheit und Vertrautheit, das ein Wiedersehen hervorruft? Ich komme wieder, weil ich es will und nicht, weil es von mir erwartet wird?
Oft stellen sich solche Fragen in ihrer sanften Hartnäckigkeit an Bahnhöfen. Bahnhöfe, und seien es nur die Haltepunkte einer Regionalbahn, sind, so würden es Geografen sagen, die Schnittstellen zwischen den Spaces of place und den Spaces of flow. Das Bahnhofsgebäude und der Bahnsteig sind als Orte unverrückbar und im Liegenschaftskataster eingezeichnet. Der Zug hingegen, in den man einsteigt, lässt diese Orte binnen kurzer Zeit verschwinden – oder aber er steigert, wenn man nicht abfährt, sondern zurückkehrt, die Vorfreude auf das Ankommen.
So habe ich es immer wieder erlebt. Wenn ich in die Regionalbahn der Linie 36 steige, ein kleiner, wenn auch moderner Dieseltriebwagen in gewöhnungsbedürftigem Blauweißgold, der von der Niederbarnimer Eisenbahn betrieben wird, dauert es zwar ein wenig, bis mich die vertraute Umgebung des Bahnhofs ins Unbestimmte des Raums entlässt. Spätestens in Frankfurt (Oder) aber, nach 25 Minuten Fahrt durch ausgedehnte Robinien- und Kiefernwälder, habe ich Anschluss an die Welt, kann umsteigen auf den RE1 nach Berlin oder den Eurocity nach Warschau.
Manchmal steht auf dem Bahnsteig, an dem die Regionalbahn ankommt, auch ein Zug nach Moskau zum Einstieg bereit. Er ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich auf dem Metropolitan Corridor angekommen bin, den der einst an der Viadrina lehrende Osteuropahistoriker Karl Schlögel beschrieben hat. Dieser Korridor, meint Schlögel, »ist ein Raum verdichteter Bewegung, mit Staus und Knotenpunkten. Die Städte, die im Metropolitan Corridor liegen, haben mehr miteinander zu tun als mit den Provinzen, die sie umgeben. Im Korridor herrscht CNN-Zeit. Sie ist in Moskau nicht anders als in Warschau oder Berlin.«
Meistens denke ich in Frankfurt aber nicht an Moskau oder Warschau, eher frage ich mich, ob ich in der Bahnhofshalle noch einen Kaffee hole, denn der Regionalexpress nach Berlin fährt erst eine Viertelstunde später ab. Auch dann geht es zunächst über Felder und Wälder und Orte, die heißen Hangelsberg oder Fangschleuse. Erst in Erkner wird es voller im Zug, nun ist die Entfernung erreicht, in der die Pendler ihren Radius gezogen haben. Bin ich auch einer von ihnen, nur dass ich von weiter herkomme? Oder bin ich nur ein Gelegenheitsfahrer, der nicht täglich in die Stadt muss, weil es seit Corona ein neues Zauberwort gibt: Homeoffice.
Und dann kommt, unerwartet, dieser Moment, in dem sich alle Fragen auf einmal stellen. Kurz hinter der Jannowitzbrücke, wo sich der Regionalexpress von einer Kurve in die andere legt und den Blick freigibt auf die Spree und den Fernsehturm, kündigt die Lautsprecherstimme an: Wir erreichen nun Berlin-Alexanderplatz. In diesem Moment bin ich nicht mehr der, der 35 Jahre ausschließlich in Berlin gelebt hat. Vielmehr werde ich zu einem, der die Stadt plötzlich von außen sieht, der sich überfordert fühlt, wenn er Berlin-Alexanderplatz hört, weil diese beiden Wörter aufgeladen sind mit all dem, was den Mythos dieser Stadt ausmacht: Literatur, Architektur, Tempo, friedliche Revolution. Wer bin ich, der sich in diesen mythischen Raum hineinbegibt, denn ein Space of place, ein bloßer Ort, ist der Alexanderplatz nur für die, die bei Galeria Kaufhof arbeiten?
Ganz anders fühle ich mich, wenn ich von Berlin nach Grunow fahre. Schon auf dem Bahnsteig an der Friedrichstraße spüre ich, wie der Atem langsamer geht, ich muss mir keine Sorgen mehr um meinen Platz in der Stadt machen. Der Regionalexpress wird mich wieder hinausbringen, erst nach Frankfurt und dann an den Ort, von dem ich aufgebrochen war vor ein paar Tagen. In knapp zwei Stunden werde ich in Grunow aus der Regionalbahn steigen, gut möglich, dass mich meine Frau abholt oder Moritz, unser Kater, der nur die Abende bei uns verbringt. Als wir einmal vom Grunower Bahnhof in den Urlaub aufgebrochen sind, hat er uns zum Bahnsteig begleitet. Es war einer der wehmütigsten Abschiede, die ich erlebt habe.
Wenn mich niemand abholt, bleibe ich erst einmal auf dem Bahnsteig stehen. Lasse den blauweißgoldenen Zug vorfahren, beobachte, wie er die Bundesstraße überquert und leicht geneigt in einer Rechtskurve in den Wald entschwindet. Erst dann gehe ich los. Sehe den Sternenhimmel über mir oder schmecke den Frühling, biege ein aufs Grundstück, schaue in den Garten, setze mich einen Moment. Ich bin wieder angekommen und nichts, denke ich, deutet darauf hin, dass ich je weg gewesen war.
Ging es den Bewohnern unseres Hauses vor hundert Jahren ähnlich? Oder vor knapp 150 Jahren, als die Bahnstrecke von Cottbus nach Frankfurt (Oder) in Betrieb genommen wurde? Am 1. Januar 1877 wurde die Strecke feierlich eröffnet. Weil damals schon die Verbindung zwischen Cottbus und Dresden bestand, konnte man von Grunow nun ohne Umsteigen ins sächsische Elbflorenz fahren und in der Gegenrichtung nach Frankfurt (Oder). Der erste Tageszug von Frankfurt startete um 4.15 Uhr und kam um 8.55 Uhr in Dresden an. Etwas mehr als viereinhalb Stunden von der Oder an die Elbe. Die Fahrpreise betrugen in der 2. Klasse 10 Mark, und in der 3. Klasse 6.50 Mark.
Ein Bahnhofsgebäude gab es damals in Grunow nicht, das wurde erst 1888 eingeweiht, ein Jahr später kam ein Erweiterungsbau dazu. Wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg musste der Bahnhof dann umbenannt werden. Die Königliche Eisenbahndirektion Halle/Saale hatte am 1. Oktober 1908 mitgeteilt, dass der Stationsname Grunow geändert werden müsse, weil beim Neubau der Strecke von Topper nach Meseritz in der Eisenbahndirektion Posen ebenfalls ein Dorf namens Grunow den Anschluss an die Bahn bekommen sollte. Aus dem Grunow dort wurde Grunow (Neumark), unseres hieß Grunow (Lausitz). Inzwischen wurde aus der Lausitz die Niederlausitz, während eine Station weiter Richtung Beeskow der Haltepunkt Schneeberg den Zusatz Mark trägt. So lässt uns die Bahn die alte Grenze zwischen der bis 1815 zu Sachsen gehörenden Niederlausitz und der Mark Brandenburg in Erinnerung behalten. Es ist beileibe nicht die einzige ehemalige Grenze, die sich durch die Region rund um Siehdichum zieht.
Zuvor war schon 1898 die Nebenstrecke von Grunow nach Königs Wusterhausen eingeweiht worden. Für die Grunower gab es nun drei Möglichkeiten, in die Ferne aufzubrechen: An die Oder, an die Elbe oder an den Scharmützelsee, das »Märkische Meer«. Heute ist das Geschichte. 1996 wurde die alte Strecke von Frankfurt nach Cottbus stillgelegt. Sie war nicht mehr rentabel. Nun fährt die Regionalbahn von Frankfurt nur noch nach Königs Wusterhausen, immerhin stündlich.
Am Grunower Bahnsteig sind die Gleise der Stammstrecke längst abgebaut. Nur die Schwellen und der Schotter liegen noch da. Oft frage ich mich, ob das vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass Bahnhöfe nicht nur Schnittstellen sind zwischen den Spaces of place und den Spaces of flow. Dass der Gegensatz zwischen dem Bahnhof als Ort und dem Zug als Raumkapsel eigentlich erweitert werden müsste um dieses stillgelegte Gleis. Aber was wäre es dann? Erzwungener Stillstand? Das Abhängen einer Region, so wie man in den Western einen Güterwagen abhängt, auf dem die Indianer in Deckung gegangen sind, bevor sie angreifen können?
Wir in Grunow haben noch gut reden, wir kommen mit der Dieselbahn immerhin weg vom Bahnhof. Aber was ist mit denen in Groß Briesen und Weichensdorf, in Ullersdorf und Lieberose, in Tauer, Peitz und Willmersdorf? An den Bahnhöfen dort gibt es nur noch stillgelegte Bahnsteige und Schotter zwischen den Schwellen. Und was ist mit Siehdichum, das noch nicht einmal eine Bushaltestelle hat? Gehören sie zur abgewandten Seite des Metropolitan Corridor? Wer den Korridor verlässt, schreibt Schlögel, »fällt aus der CNN-Zeit heraus. Er ist nicht mehr erreichbar, nicht einmal durch die Briefpost, auf die kein Verlass mehr ist. Hier gibt es keine Highways. Hier gibt es vielleicht schöne Wälder, aber keine Hoffnung und keine Arbeit mit Perspektive. Während im Korridor die zivile Armada der Trucks rollt, leuchtet in der Dunkelheit, die jenseits des Korridors herrscht, der Mond. Tau fällt.«
Keine Schnittstellen zwischen Spaces of place und Spaces of flow sind die Bahnhöfe dort, sondern liegengelassene Orte, an denen es an keiner Schranke mehr bimmelt und keiner mehr ankommt, um vom Kater oder dem Sternenhimmel begrüßt zu werden. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass das der Normalzustand ist in dieser Region, die schon immer im toten Winkel der Geschichte gelegen war.
Aber ein wenig Hoffnung gibt es doch. Bald soll es auf der ehemaligen Trasse von Cottbus einen Heideradweg geben. Vielleicht findet er ja in Grunow Anschluss an die Bahnstrecke.
WASSERSCHEIDE
Dammendorf, Bremsdorf
Auf dem Weg nach Siehdichum habe ich schon in den ersten Tagen dieses Schild entdeckt. Kein Wegweiser, der in die eine oder andere Richtung gedeutet hätte, auch kein touristisches Hinweisschild auf eine Sehenswürdigkeit im Schlaubetal, nicht einmal eine Werbung für ein Landhotel oder einen Campinglatz. Das Schild auf der Bundesstraße 246 von Dammendorf nach Bremsdorf hatte einzig und allein eine hydrologische Tatsache zu behaupten: Wasserscheide Nordsee-Ostsee.
Neugierig stellte ich mein Fahrrad ab und ging zu diesem Schild. Kurz überlegte ich, mich mit dem einen Bein auf die Nordsee- und mit dem anderen auf die Ostseeseite zu stellen, aber das schien mir zu theatralisch. Außerdem war auf der Höhe des Schildes keine gestrichelte Linie gezogen wie etwa beim Polarkreis nördlich von Rovaniemi in Finnland. Dennoch löste dieses Schild etwas in mir aus. Die Regentropfen, die östlich des Schildes, also Richtung Bremsdorf auf die Erde fielen und dort versickerten, würden demnach Richtung Oder und damit in die Ostsee entwässern. Die Tropfen auf der Dammendorfer Seite würden dagegen irgendwann in der Elbe und der Nordsee landen.
Das Gleiche galt für die beiden Bäche, die die Region von Süden nach Norden durchfließen. Die Oelse, an deren Ufer ich die Torfstiche entdeckt hatte, schleicht der Spree entgegen, deren Wasser wiederum über die Havel in die Elbe mündet. Die Schlaube dagegen, die dem Schlaubetal ihren Namen gibt, mündete einst über den Brieskower See kurz vor Frankfurt in die Oder. Vielleicht war mir deshalb etwas unwohl in dem Moment, als ich das Schild an der B 246 entdeckt hatte. Irgendetwas in mir flüsterte: Du irrst dich, wenn du denkst, Flüsse können eine Landschaft zusammenhalten. Du musst dich entscheiden! Bist du nun ein Mensch der Oder oder ein Mensch der Elbe?
Ich wusste auch, dass mich diese Frage zerreißen würde. Mein erstes Buch über einen Fluss hatte ich 2005 der Oder gewidmet. Ich wollte den Leserinnen und Lesern in Deutschland diesen großen europäischen Strom nahebringen, den die meisten noch immer als Grenzfluss betrachteten. Dabei ist die Grenzoder zwischen Deutschland und Polen nur 162 Kilometer lang. Ein Nichts ist das im Vergleich zu den 860 Kilometern, die die Oder auf dem Buckel hat, wenn sie ins Stettiner Haff mündet und von dort als Peenestrom, Swine und Dievenow in die Ostsee.
Seit dieser Zeit bin ich der Oder verbunden. Nicht mit dem Grenzfluss, sondern dem deutsch-polnischer Begegnungsraum, den sie erschließt. Etwas anders war es bei der Elbe. Sie habe ich schon als kleines Kind kennengelernt. Als Vierjähriger besuchten wir die tschechische Verwandtschaft im Riesengebirge. Später haben mein Bruder und ich bei den Recherchen zu unserer Familie ein Geheimnis entdeckt. Unser Großonkel Jozef Novák brachte 1948 auf seinem Elbkahn ČSPL 346 einen in Ungnade gefallenen Politiker von Prag nach Hamburg. Diese Geschichte wurde das sehr persönliche erste Kapitel meines Buches über die Elbe, das ich acht Jahre nach meinem Buch über die Oder veröffentlichte. Auch darin wurde eine Grenze überschritten. Der Fluchtkahn meines Großonkels war einfach durch den Eisernen Vorhang geschippert.
Und nun sollte ich mich, an diesem Schild auf der B246 zwischen Dammendorf und Bremsdorf, plötzlich für eine Seite entscheiden? Oder musste ich das gar nicht, weil Wasser nicht nur scheiden, sondern auch verbinden kann?
Vor Fragen wie diesen standen vor fünfhundert Jahren schon der österreichische Kaiser Ferdinand I. und der preußische Kurfürst Joachim II. Der eine wachte über Spree und Elbe, der andere über die Oder. Warum sich aber nicht zusammentun, warum nicht das eine mit dem anderen verknüpfen? Also beschlossen Ferdinand und Joachim 1558 im Vertrag von Müllrose, einen Kanal zu bauen. Er sollte von Neuhaus an der Spree bis Brieskow reichen und dort die Oder begrüßen. Den Kaufleuten, die mit ihren Flussschiffen von Breslau unterwegs nach Berlin waren, würde das eine Wegstrecke von 1.660 Kilometern sparen. Statt zweitausend Kilometer lang über Stettin, die Ostsee, den Skagerrak, die Elbe aufwärts bis zu Havel und Spree zu segeln, wären nun nur noch 340 Kilometer zurückzulegen.
Außerdem waren an der Stelle, an der sich Spree und Oder am nächsten sind, nur 27 Kilometer Entfernung zu überwinden. Auch über die Kosten des Kanalbaus waren sich beide Seiten einig geworden. Den westlichen Teil des Kanals von Müllrose bis Neuhaus sollte der Kaiser finanzieren, den östlichen Teil der brandenburgische Kurfürst. Gespeist werden sollte der Kanal durch das Wasser der Spree und von der Schlaube, die auf Müllrose von Siehdichum zueilt, dann nach Osten biegt und in die Oder mündet. Die Schlaube hat ab Müllrose dem Kanal also schon mal das Bett gemacht.
1564 war der Kaisergraben von Neuhaus bis Müllrose, auch Alter Graben genannt, fertiggestellt. Doch der brandenburgische Kurfürst dachte gar nicht daran, seinen Teil des Vertrags zu erfüllen. So blieb die Verbindung zwischen Spree und Oder vorerst unvollendet. Erst als mit dem Dreißigjährigen Krieg die Odermündung mit Stettin an die Schweden und die Niederlausitz an Sachsen gefallen waren, griff Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen, das Vorhaben wieder auf.
1662 gingen die Bauarbeiten los. Sechs Jahre später lud Friedrich Wilhelm zu einem Festakt ein. Anschließend wurde der Kanalabschnitt geflutet, und die Gesellschaft befuhr den Neuen Graben