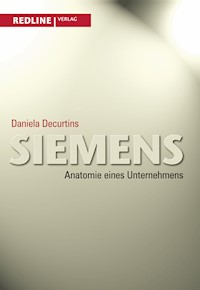
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Siemens ist immer noch das Flaggschiff der deutschen Industrie. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen eine halbe Million Menschen in insgesamt 190 Ländern. Was aber macht das Phänomen Siemens aus? Die Wirtschaftsjournalistin Daniela Decurtins vom Schweizer Tages Anzeiger ist dieser Frage nachgegangen und hat versucht, darauf differenzierte Antworten zu geben. Positiv ist deshalb auch hervorzuheben, dass die Autorin nüchtern und unparteiisch bleibt. So würdigt sie beispielsweise mit kritischer Distanz die Ausgliederung des Halbleiter-Bereichs an Infineon -- mit allem Auf und Ab. Decurtins hat zweifellos Durchblick. Auch was die Entwicklung des Unternehmens unter dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Heinrich von Pierer betrifft. Jener Pierer, der 1998 sein berühmtes Zehn-Punkte-Programm für mehr Produktivität und Wachstum vorlegte und so dem damaligen miesen Geschäft entgegenwirken wollte. 50 Konzern-Geschäftsfelder wurden überdies ausgegliedert. 1999/2000 wurde zum besten Geschäftsjahr der Firmengeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Daniela Decurtins
Siemens
Daniela Decurtins
Siemens
Anatomie eines Unternehmens
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen: [email protected]
Nachdruck 2012 © 2002 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH Nymphenburger Straße 86 D-80636 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096
© 2002 by Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter, Frankfurt/Wien
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: INIT, Büro für Gestaltung, Bielefeld Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN Print 978-3-86881-395-1 ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-163-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter www.redline-verlag.de Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.muenchner-verlagsgruppe.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
«Ein Weltunternehmen à la Fugger»
Karlheinz Kaske, der Innenministe
Existenzielle Nöte eines Jungunternehmers
Ausgeprägter Familiensinn: Beschränkung mit Folgen
Schützenhilfe für die AEG
Im Schatten des Zweiten Weltkrieges
Der Konzern am Rande der Zerschlagung
Die «Bank» Siemens
Der Glaube an die Selbstheilungskräfte
Helmut Ottl, der Mann mit der Begrüßungskartei
Im Sog der Liberalisierung
In den Schranken der eigenen Kultur
Konservative Finanzpolitik: solid und liquid
Technische Leistungsfähigkeit: Pioniere und Trendsetter
Kontinuität: Korpsgeist und Inzucht
Restrukturierungsprogramme –Tummelfeld für Unternehmensberater
Top – Time Optimized Processes
«Tot oder pensioniert»
Falsch kalkuliert
Im Wettlauf mit General Electric und ABB
Kulturwandel im Zeichen des Shareholder Value
Heinrich von Pierer, der Chefverkäufer
Die Gründerfamilie begehrt auf
Ein neues Leitbild soll Abhilfe leisten
Die Hardliner setzen sich durch
EVA – die neue Zauberformel
Das 10-Punkte-Programm –Wendepunkt in der Siemenskultur?
Appell in Feldafing
Die Musterkinder
Die Verkehrstechnik
Die Medizintechnik
Top+ – ein Modell mit Tücken
Wie Siemens die Sprache der Finanzmärkte lernt
Adrian Hopkinson, der «very strong buy»
Jäger und Gejagte, Gewinner und Verlierer
Rezepte, um die Jäger bei Laune zu halten
Vom Finanzverwalter zum Zahlenakrobaten
Das Verhältnis zwischen Kontrolleuren und Kontrollierten
Der Aufsichtsrat wird internationaler
Die Analysten – Handlanger der Milliardenverschieber
Die Mitarbeiter schlagen zurück
«Unfinished Business»
Buy, cooperate, sell or close
Tihomir Krpan, der Berliner Turbinenbauer
Integration als Knochenarbeit
Siemens Nixdorf, der größte Schuldenmacher
Unter einem schlechten Stern
Die «Roadmap zum Erfolg»
Elektrowatt, ein Schnäppchen
Die Profiteure des Bankenstreits
Ceberus – der dreiköpfige Höllenhund macht Probleme
Die Demontage des deutschen Aktienwunders
Ulrich Schumacher, der Unbequeme
Die Halbleiterindustrie – mörderische Branche
Im Elfenbeinturm
Griff nach dem Subventionstopf
Von der Schlüsseltechnologie zum Spielverderber
Der Börsenhype
Infineon-Papiere – die «Mauschelaktien»
Ein Verhältnis wie zwischen Mutter und Tochter
Ulrich Schumachers Nerventest
Das Handybusiness – der graue Planet wird farbiger
Wolfgang Dötz, der Werbedinosaurier
«Klinisch praktisch tot»
Testfall 25er-Reihe
Auf der Achterbahn der Emotionen
UMTS – vom Zauberwort zum Schreckgespenst
Notruf der Netzwerkausrüster
Die Marke Siemens: menschlicher und emotionaler
Das Dilemma der Technokraten
Erich Gebhardt, der U-Boot-Kapitän
Der Schatten des Gründervaters
Pleiten, Pech und Pannen
Die Fallstricke
Kampf gegen Innovationsfallen
«Inkubatoren» – Brutkästen für den Nachwuchs
Das Beispiel Workstation
Die Bedingungen einer innovationsfreundlichen Kultur
Abschied von der deutschen Vorherrschaft
Daniela Fehring, die Wandlerin zwischen den Kulturen
In der Champions League der Weltwirtschaft
Der Griff nach China
Kostspielig und riskant
Elefanten im Porzellanladen
Interkulturelle Fallen
Schwieriger Umgang mit Korruption
Die Leidtragenden der Globalisierungs-Strategie
Auf der Suche nach einer neu-alten Identität
Alfons Graf, der Kunstturner
«Low Performer» und «HC Reduction»
Alcatel wählt einen anderen Weg
Bremsklötze des Wandels
Abschied von der klassischen Unternehmenspolitik
Eine Kultur des Abbaus
«Beitrag für eine bessere Welt»
Anhang
Chronologie: Vom 10-Mann-Betrieb zum Weltkonzern
Die Siemens-Kultur: Leitbilder
Literaturauswahl
Einleitung
Was für Menschen gilt, besitzt für Unternehmen heute keine Gültigkeit mehr: Während wir immer älter werden, stirbt eine Vielzahl von Firmen immer früher, sie fusionieren, werden aufgekauft und hören auf zu existieren. Andere überleben zwar, geben aber heute Medikamente statt Kredite ab oder sorgen sich um ihren Immobilienbestand statt um Bierherstellung. Von den 500 wichtigsten Firmen, aus denen sich 1957 der Standard & Poor’s-Index (S & P) zusammensetzte, finden sich 40 Jahre später gerade noch deren 74 auf der Liste. Heutzutage wird ein Unternehmen im Schnitt zehn Jahre alt, in den 1920er-Jah-ren lag die durchschnittliche Lebenserwartung noch bei 65 Jahren. Die immer rascheren Innovations- und Produktezyklen sowie die Öffnung und Globalisierung der Märkte sind für diesen Trend verantwortlich.
Der deutsche Elektrokonzern Siemens stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung dar. Das Unternehmen, das wie kein anderes «Made in Germany» verkörpert, feiert dieses Jahr seinen 155. Geburtstag. Der legenden-umrankte Firmengründer Werner von Siemens gab zu seinen Lebzeiten die Strategie – die Ausrichtung auf die Elektrotechnik im ganzen Umfang – vor. Sie hat bis heute im Wesentlichen überdauert. Kaum ein Unternehmen dieser Welt verfügt über eine derart breite Produktpalette. Das Spektrum reicht von der Gasturbine bis zum Mikrochip, von der Glühbirne bis zum Ultraschallgerät, vom Computer bis zur Waschmaschine. Wohl niemand kann sagen, wie viele verschiedene Siemens-Erzeugnisse vom Centartikel bis zum Milliardenprodukt in den 190 Ländern der Welt, in denen das Unternehmen heute vertreten ist, verkauft werden. Beinahe eine halbe Million Beschäftigte weltweit beziehen heute ihr Gehalt vom deutschen Elektrokonzern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört er zu den größten industriellen Arbeitgebern. Allein in Deutschland sind mehr als eine Million Arbeitsplätze direkt oder indirekt von Siemens abhängig, ganze Regionen wie Bayern, Erlangen oder Berlin profitieren wesentlich davon. Es gibt auch kaum ein anderes privates Unternehmen, das eine derartige Symbiose mit der Politik eingegangen ist.
In den frühen neunziger Jahren schlitterte der Traditionskonzern in eine Krise, von der einige glaubten, dass sie nicht mehr zu bewältigen sei. Die Margen brachen um mehr als die Hälfte ein. Siemens kam an der Börse unter Druck, und Analysten drängten, den Konzern in mehrere Teile zu zerschlagen. Die Liberalisierungswelle, die Öffnung der einst abgeschotteten Märkte und die Globalisierung der Kapitalmärkte stellten die Spielregeln, die das Unternehmen einst so perfekt beherrschte, auf den Kopf. Siemens musste sich ändern. Nur wie?
Eineinhalb Jahrhunderte Unternehmensgeschichte mit all den dazugehörigen Erfahrungen, die Märkte, Kunden, Technologien und die Nähe zur Politik hatten den Elektrokonzern und seine Mitarbeiter nachhaltig geprägt. Eine eigentümliche Mischung aus Konservatismus, Fortschritts- und Kontinuitätsorientierung war entstanden, die den Kern der alten Unternehmenskultur ausmachte und sich Außenstehenden im Denken und Verhalten des Managements sowie der Mitarbeiter erschließt. Diese Regeln waren teils explizit als Leitlinien, soziale Grundsätze, Produktnormen oder Qualifikationsanforderungen formuliert, teils waren sie nicht unmittelbar greifbar, sondern basierten auf geteilten Erfahrungen und spiegelten sich in Ritualen oder Firmenmythen wider. Die alte Unternehmenskultur hatte sich früher als Erfolgsgarant erwiesen, doch jetzt schien sie nicht mehr zeitgemäß. Da die Welt eine andere geworden war, musste das Unternehmen, um unter den neuen Bedingungen zu überleben, zwingend seine Kultur anpassen.
Ob und wie sich eine Unternehmenskultur formen lässt, ist in der Forschung umstritten: Die einen verstehen sie als Größe, die gleich einer beliebigen Variabel verändert werden kann und damit zum Steuerungsinstrument des Unternehmenserfolges wird. Diese Vorstellung verlieh Beratern, die «Culture Change»-Programme anbieten oder entsprechende Bücher verfassen, Auftrieb. Eine zweite Gruppe von Forschern betrachtet Unternehmen selbst als historisch gewachsene Kulturgefüge und stellt deren beliebige Beeinflussbarkeit in Frage. Die Unternehmensgeschichte ist damit Ausgangspunkt für die Erfassung einer Unternehmenskultur, die sich über die Zeit zwar verformt, als Folge von Krisen auch Brüche aufweist, aber nicht einfach über Bord geworfen werden kann.
Siemens verordnete sich erst spät einen Kulturwandel, der zum Ziel hatte, sich stärker an Leistung zu orientieren, sich unablässig mit Konkurrenten zu messen und konsequent den Willen zu beweisen, neue Märkte zu erobern. Die früher konsensorientierte Siemens-Familie sollte sich in den Augen des Topmangements zu einem sich weitgehend an Aktionärsinteressen ausrichtenden Unternehmen wandeln, ohne deswegen die Interessen der Mitarbeiter und der Gesellschaft zu vernachlässigen oder seine historisch gewachsene Identität aufzugeben. Wie sich Siemens in der «neuen Wirtschaftswelt» neu orientierte, wo sich Probleme stellten, welche Muster Beharrungsvermögen bewiesen und welche Bilanz die verschiedenen Gruppen heute ziehen, ist Gegenstand dieses Buches.
Die Diskussionen innerhalb und um Siemens spiegeln aber auch ein Stück der jüngsten Zeitgeschichte wider. An Siemens manifestieren sich Erscheinungen wie das Regiment der Investmentbanken und Fondsgesellschaften, die Börseneuphorie, der Schock der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone für die Deutschland AG oder die Globalisierung – all die inneren und äußeren Kräfte, die in den neunziger Jahren auf Unternehmen generell einwirkten. Siemens eignet sich in vorzüglicher Weise als Beispiel, seiner Tradition, Größe, breiten Aufstellung und der Märkte wegen, in denen sich der Konzern bewegt. An seinem Beispiel lässt sich zeigen, wie schnell sich die Meinung der Öffentlichkeit über einen Konzernchef ins Konträre wendet, wie brutal Integrationsprozesse ein Unternehmen lähmen können und wie Managementmethoden verwissenschaftlicht werden.
Das Buch bietet weder einen lückenlosen, chronologischen Abriss der Geschichte des Konzerns der letzten Jahre noch eine Beschreibung, die allen Bereichen und Entwicklungen innerhalb des Unternehmens gerecht werden kann. Es greift vielmehr verschiedene Themen auf und erschließt das Phänomen Siemens und seine Kultur über die Menschen – Vorstandsvorsitzende, Pförtner, Turbinenbauer, Elektroingenieure, Ausbildner, Betriebsräte und Analysten.
Die im Buch verwendeten Quellen sind vielfältig: Zum einen kommen Personen rund um Siemens – in- und außerhalb des Unternehmens – zu Wort. Als Grundlage dienen zusätzlich Interviews mit verschiedenen Beteiligten, Betroffenen, Kunden, Konkurrenten oder Analysten und Siemens-Beobachtern sowie Dokumente aus dem Siemens-Archiv, Geschäftsberichte, diverse Zeitungs- und Zeitschriftenartikel und Bücher. Im Anhang findet sich neben den wichtigsten Dokumenten zur Siemens-Unternehmenskultur ein ausführliches Verzeichnis der verwendeten Literatur.
Am Schluss soll ein Dank an all die Personen stehen, die das Projekt maßgeblich unterstützten. An dieser Stelle können nur einige wenige namentlich erwähnt werden: in erster Linie Bettina Schmidt-Breitenstein, Siemens München, und das Presseteam von Siemens Schweiz, die dabei behilflich waren, Interviewpartner innerhalb des Unternehmens zu gewinnen. Schließlich all diejenigen, die sich für längere Gespräche zur Verfügung stellten. Dann vor allem auch Werner Schüepp, der den Entstehungsprozesses des Buches mit seinen kritischen Anmerkungen begleitete, und die Tamedia AG, die mir eine Auszeit für dieses Projekt ermöglichte.
Zürich, Juni 2002
«Ein Weltunternehmen à la Fugger»
Karlheinz Kaske, der Innenminister
Am 12. März 1992 trat er in der Münchener Olympiahalle ein letztes Mal vor das Rednerpult, um zu den Aktionärinnen und Aktionären zu sprechen. Mit versteinerter Miene musterte er das Publikum und wirkte – wie immer – zurückhaltend. Kein Muskel zuckte im Gesicht. Das schlohweiße Haar streng nach hinten gekämmt, die Hände ruhend auf dem Pult.
Noch im Januar, an der Bilanzpressekonferenz, hatte der Siemens-Vorstandsvorsitzende passen und seinem Stellvertreter Heinrich von Pierer den Vortritt lassen müssen. Nach einem Sturz, bei dem er sich den Oberschenkelhals gebrochen hatte, ordneten die Ärzte strikte Bettruhe an. Erholt und genesen saß er nun im März wieder stramm auf der Kommandobrücke des elektrotechnischen Tausendfüßlers und hätte eigentlich allen Grund zur Freude gehabt: Die Redakteure des US-Wirtschaftsmagazins «Business Week» feierten Siemens als «Europas Technologiehoffnung». Aber ausgerechnet in Deutschland, dem nach wie vor wichtigsten Markt, blies ein schärferer Wind denn je.
Von draußen drangen Ruffetzen der Demonstranten in die Olympiahalle. «Siemens strahlt, schlampt und schmiert», prangte in klotzigen Buchstaben auf ihren Transparenten. Schwere Vorwürfe prasselten wie ein heftiges Gewitter auf dem Vorstand nieder. «Ein Unternehmen wie Siemens kann sich solche Dinge nicht leisten», erhob ein Aktionär den Mahnfinger. Das Image des Elektrokonzerns hatte durch eine Reihe von Negativschlagzeilen arge Schrammen erlitten. Der Grund: acht Siemens-Manager, die sich vor der Vierten Strafkammer des Münchner Landesgerichts I wegen unsauberer Geschäftspraktiken verantworten mussten.
Sie hatten 1986 und 1990 einen städtischen Angestellten bestochen, um sich Millionenaufträge für den Bau zweier Kläranlagen in München zu sichern. Kaske selbst wurde in den Zeugenstand zitiert, weil der Eindruck entstanden war, das Unternehmen hätte die unsauberen Methoden seiner Mitarbeiter zumindest geduldet. Der Druck wuchs täglich, die Aktionäre forderten eine Antwort. Natürlich, die Manager hätten interne und externe Regeln verletzt, aber Strafen – teils auf Bewährung – von bis zu 40 Monaten seien dann doch «besonders hart», sprach er ins Mikrofon. Schließlich handelte es sich um verdiente Leute, für die es eine Art Fürsorgepflicht gab.
Beinahe gleichzeitig flogen Schlampereien in einem Siemens-Betrieb für atomare Brennstäbe in Karlstein bei Aschaffenburg auf. Versehentlich und unbewacht waren 50 radioaktive Brennelemente für Kernkraftwerke durch Deutschland transportiert worden. Adolf Hüttl, Leiter des Unternehmensbereichs Energieerzeugung, wiegelte ab und sprach von einer «alltäglichen Unachtsamkeit», die menschlich sei. Nachdem die Umweltminister in Bonn und München interveniert hatten, sah sich Kaske schließlich doch noch veranlasst, die Verantwortlichen zu suspendieren.
Auch die Zahlen gaben keinen Anlass für ein rauschendes Fest. Kaske hatte zwar nach dem Fall der Mauer 1989 mit viel Energie und Milliardeninvestitionen das Geschäft in der ehemaligen DDR angekurbelt, und es warf auch bald erste Früchte ab. Nur flachte im Ausland die Auftragslage ab. Schließlich hielten auch die Inländer immer mehr mit Bestellungen zurück, klagte Kaske im März 1992 bei seiner Abschiedsvorstellung. Siemens müsse dringend in einigen Bereichen seine Position überprüfen und komme an «Beschäftigungsanpassungen» nicht vorbei. «Aber wir haben gelernt, mit solchen Problemen fertig zu werden und auch in schwierigen Zeiten Kurs zu halten. Mir ist um die Zukunft des Unternehmens nicht bange», bekräftigte er mit fester Stimme.
Ein trauriger Abgang für einen einsamen Mann, in dessen Gesicht das Schicksal tiefe Furchen gezogen hat. Von seinen drei Söhnen waren zwei bei einem Autounfall umgekommen. Der hoch begabte Diplomphysiker sagte jeweils all seine Termine ab und reiste an die Unglücksorte zur persönlichen Trauerbewältigung. Er wollte mit eigenen Augen sehen, versuchen zu begreifen, was geschehen war – und wurde noch wortkarger und verschlossener als er ohnehin schon war, berichten Mitarbeiter aus seinem Umfeld.
Er selbst sprang dem Tod nur mit knapper Not und der Hilfe eines Dienst habenden Arztes von der Schippe. Kurz vor Weihnachten 1989 war er in seiner Villa am Starnberger See bewusstlos zusammengebrochen. Diagnose: geplatzte Bauchschlagader. Eine Notoperation konnte verhindern, dass er verblutete. Für Kaske gehörte das Risiko im Leben längst zur Tagesordnung. In den Augen der RAF-Terroristen war er ein «Nutznießer des Ausbeuter-Kapitalismus» und stand als deutsche Top-Führungskraft der Wirtschaft auf der berüchtigten RAF-Mordliste. Der Siemens-Chef genoss Personenschutz rund um die Uhr und machte in der Öffentlichkeit keine Bewegung, ohne nicht von schwer bewaffneten Leibwächtern flankiert zu werden.
Karlheinz Kaske war ein Siemens-Mann von Geburt. Schon der Vater arbeitete als Ingenieur beim Unternehmen, und der 1928 in Essen geborene Karlheinz schien schon früh keinen andern Wunsch gehabt zu haben, als möglichst rasch in Vaters Fußstapfen zu treten. Als ein Schüler mit brillanten Noten verließ er bereits nach drei Jahren die Volksschule, machte mit 16 Abitur in Danzig und war als 21-Jähriger bereits diplomierter Physiker.
Nach verschiedenen Stationen bei Siemens – mit einer kleinen Unterbrechung in den fünfziger Jahren – wurde Kaske, in der Öffentlichkeit bis dato ein unbeschriebenes Blatt, 1981 zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Er löste Bernhard Plettner ab, der als erster Familienfremder an die Spitze des Aufsichtsrates rückte. Das grelle Rampenlicht und die glitzernde Welt der Publizität waren nicht seine Bühne. Kaske tauchte in keiner Klatschspalte auf. Während andere Firmenchefs sich mit ihren Golf-Handicaps abmühten, liebte er ausgedehnte Streifzüge durch Wald und Feld.
Kaske schien sich nur unter Elektrotechnikern richtig wohl zu fühlen. Der stattliche Mann wirkte bei seinen Auftritten seltsam farblos. Seine hölzernen Bewegungen konnten schlecht seinen linkischen Umgang vertuschen. Seine Berater hatten ihn überzeugt, in der Öffentlichkeit statt Zigaretten Pfeife zu rauchen, weil ihm dies einen staatsmännischen Touch verleihe und Denkpausen so als habituskonform verziehen würden. Die «Bonner-Besuche», wie er die Gespräche mit Politikern und Vertretern der staatlichen Organisationen nannte, waren für ihn zwar notwendig, aber ein Gräuel. «Das Beste ist jetzt, dass diese Bonner-Besuche wegfallen», vertraute Kaske den Zentralvorständen bei seinem Abschied an. Ihm war nur eins bedeutend: die Wirkung im eigenen Haus. Viel wichtiger war es, von den Mitarbeitern ernst genommen als auf der Straße erkannt zu werden. Nicht umsonst galt er als der «Gorbatschow des Unternehmens». Er schaffte es mit seiner moderaten Art, dass Entscheidungen auch ohne böses Blut durchgesetzt wurden.
Geld verdiente Siemens unter seiner Führung in Fülle, allerdings nicht mit dem Kerngeschäft, sondern vor allem mit ausgeklügelten Finanzanlagen. Börsianer frotzelten, Siemens sei eine Bank, die nebenher auch noch eine Elektroabteilung unterhalte. Das Nachrichtenmagazin «Stern» erklärte den gewaltigen Produktionsapparat mit mehr als 300.000 Mitarbeitern, 165 Tochtergesellschaften weltweit und einem Jahresumsatz von mehr als 40 Milliarden Mark zur «Liebhaberei».
Kaske bediente sich dieser Kasse, um die «Kompanien», wie er die Geschäftsbereiche nannte, den «Erfordernissen der Zeit» entsprechend neu auszurichten. Seine Analyse: Zunehmend steigende Entwicklungskosten und kürzere Produktlebenszyklen sind nur zu bewältigen, wenn gleichzeitig die Produkte in Massen abgesetzt werden könnten. Diese Grundvoraussetzung war seiner Meinung nach in vielen Bereichen nicht gegeben, bei den öffentlichen Vermittlungssystemen etwa oder den Halbleitern. Die Manager schwärmten mit dem Auftrag aus, die verschiedenen Bereiche hartnäckig nach geeigneten Partnern oder Kaufobjekten abzuklopfen. Seinen Managern hatte er eingebläut, die Begriffe «Verhandlungen» und «Abkommen» aus ihrem Vokabular zu streichen und in der Öffentlichkeit allenfalls von «Gesprächen» zu sprechen.
Aus dem Elektrokonzern war in den achtziger Jahren ein für deutsche Verhältnisse aggressives Unternehmen geworden. «Im Grunde kaufen wir Zeit und Marktanteile und sparen damit Geld», sagte Kaske. 150 Beteiligungen reihte er in den achtziger Jahren in das Beteiligungsportfeuille ein, 50 davon allein 1988 und 1989, darunter etwa die IBM-Tochter Rolm Systems, ein renommierter Hersteller von Telefonnebenstellenanlagen, oder die Bendix Electronics Group in Detroit, um das noch junge Geschäft in der Autoelektronik zu verstärken. Mit IBM kooperierte er bei der Entwicklung eines Megachips, um den Rückstand auf die Japaner aufzuholen.
Der Konzern schreckte nicht einmal vor einer unfreundlichen Übernahme im Ausland zurück. 1989 schluckte Siemens gemeinsam mit dem britischen Wettbewerber General Electric das englische Elektronikunternehmen Plessey – gegen den Willen des dortigen Managements. Der spektakulärste Kauf ging in Deutschland über die Bühne. Nachdem Kaske öffentlich jahrelang die Möglichkeit, den Paderborner Computerhersteller Nixdorf zu kaufen, abgelehnt hatte, schlug er im Dezember 1989 doch zu. Zu jener Zeit prägte Kaske den Satz: «Wir werden jedes Schiff kapern, das vorbeikommt und zu unserem Unternehmen passt.»
Nach wie vor nichts wissen wollte er vom Verkauf einzelner Geschäftsbereiche. Entrüstet wies er die Forderung von Finanzanalysten zurück, den Halbleiterbereich abzustoßen. Drei Viertel des künftigen Umsatzes würden direkt oder indirekt vom Know-how in der Mikroelektronik abhängen, verteidigte er sich. Deshalb sei ein unmittelbarer Zugriff auf diese Technik überlebensnotwendig und der Gedanke an einen Abstoß deshalb völlig abwegig.
Dank der Zukäufe konnte Kaske in seiner mehr als elfjährigen Amtszeit den Umsatz zwar auf 73 Milliarden Mark steigern und damit mehr als verdoppeln. Die Bilanz blieb aber zwiespältig. Aus eigener Kraft war das Unternehmen kaum gewachsen, und von qualitativem Wachstum konnte schon gar keine Rede sein: Die Umsatzrendite stagnierte auf unbefriedigenden 2,5 Prozent.
Als es darum ging, Bilanz zu ziehen, entzog sich Kaske in einem Interview einem Urteil über Höhepunkte und Niederlagen, ganz der alten Siemens-Tugend verpflichtet und auf Ausgleich bedacht. «Es wäre gegenüber dem einen oder andern Bereich unfair, wenn ich sage, also das war besonders schön, das weniger.»
Existenzielle Nöte eines Jungunternehmers
Diese Art von Problemen waren Werner von Siemens, dem Gründer des Unternehmens, noch fremd. Ihn plagten andere Sorgen – existenziellere. Am 1. Oktober 1847 gründeten er und Johann Georg Halske in Berlin die Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske. Siemens hatte die notwendigen technischen Kenntnisse auf dem «zweiten Bildungsweg» in der preußischen Armee erworben, wo er die Artillerie- und Ingenieursschule besuchte. Während seiner Militärzeit lernte er den Mechaniker Halske kennen, der schließlich seine Erfindungen baute. An ein Studium war für Werner von Siemens aus finanziellen Gründen nicht im Traum zu denken gewesen – seine Eltern waren schon früh gestorben und er musste seine jüngeren Geschwister unterhalten. Deshalb war es für ihn nahe liegend, seine Erfindungen kommerziell zu nutzen.
Der wohlhabende Vetter Johann Georg Siemens, der später die Deutsche Bank gründete, griff den beiden Jungunternehmern finanziell unter die Arme. Die Finanzierung durch eigene Mittel und Mittel von Verwandten war typisch für jene Zeit, da der Kapitalbedarf sich damals noch in engen Grenzen bewegte. Um Telegrafenapparate herzustellen, benötigte man keine teuren Maschinen, da reichte gutes Werkzeug. Erst 1863 wurde für die nun normierte, serienmäßige Fertigung von Einzelteilen eine Dampfmaschine angeschafft.
Halske und Siemens wollten aus Werner von Siemens’ erster großer Erfindung – einer Weiterentwicklung des Wheatstonschen Zeigertelegraphen – Kapitel schlagen. Siemens hatte dem Telegrafen, der ähnlich wie ein Uhrwerk arbeitet, einen selbsttätig gesteuerten Synchronlauf zwischen Sender und Empfänger eingebaut. Das Gerät wurde zwar schnell durch ein neues, von Morse konstruiertes abgelöst, Siemens & Halske gelang es aber, dieses ebenfalls erfolgreich zu verbessern. Ende der vierziger Jahre begann das junge Unternehmen zudem Pressen zu fertigen, die dazu dienten, elektrische Leiter nahtlos mit Guttapercha zu isolieren. Dies ermöglichte es erst, die Leitungen unterirdisch im Wasser zu verlegen.
Werner von Siemens träumte von mehr als Reichtum, er wollte Macht und Ansehen für sich und für seine Familie: «So habe ich für die Gründung eines Weltgeschäfts à la Fugger von Jugend an geschwärmt, welches nicht nur mir, sondern auch meinen Nachkommen Macht und Ansehen in der Welt gäbe», schrieb er im Rückblick an seinen Bruder Carl. «Ich sehe im Geschäft erst in zweiter Linie ein Geldeswert-Objekt, es ist für mich mehr ein Reich, welches ich gegründet habe und welches ich meinen Nachkommen ungeschmälert überlassen möchte, um in ihm weiter zu schaffen.» Seine Vision ließ sich in den Startjahren nicht so einfach realisieren. Das Geschäft lief harzig an: Zehn Mitarbeiter arbeiteten Ende 1847 in der Hinterhofwerkstatt an der Schöneberger Straße 19 in Berlin, und Werner von Siemens diente immer noch in der Preußischen Armee, um den Unterhalt seiner jüngeren Geschwister zu finanzieren.
Der Telegrafenmarkt, in dem sich Siemens & Halske bewegte, kannte spezielle Gesetze. Weniger, weil er weitgehend immun gegen konjunkturelle Schwankungen war, sondern wegen seines engen Kundenkreises – ein Aspekt, der noch heute viele Siemens-Tätigkeiten prägt. Militärinteressen dominierten zunächst den Aufbau von Telegrafennetzen; dann entstanden sukzessive auch rivate Betreibergesellschaften, die Telegrafen für wirtschaftliche Zwecke nutzten, beispielsweise um Börsengeschäfte zu vermitteln. Schließlich bestellten zunehmend auch Eisenbahnverwaltungen die neuen Kommunikationsmittel, die halfen, Zeit und Raum zu überwinden.
«So habe ich für die Gründung eines Weltgeschäfts à la Fugger von Jugend an geschwärmt, welches nicht nur mir, sondern auch meinen Nachkommen Macht und Ansehen in der Welt gäbe.»
Werner von Siemens
Siemens und Halske profitierten zunächst davon, dass sie nahezu über ein Monopol und hervorragende persönliche Beziehungen verfügten. Die Unternehmer engagierten sich zudem in wissenschaftlichen Vereinen, um sich zu vernetzen. Um Kontakte hatten sich Werner von Siemens und sein jüngerer Bruder Wilhelm schon lange vor der Firmengründung bemüht, sowohl in Deutschland als auch England. Sie waren das A und O in dieser Branche. Als beratendes Mitglied der militärischen preußischen Telegraphenkommission konnte Werner von Siemens bereits im Vorfeld der Gründung des Unternehmens prestigereiche Aufträge an Land ziehen: den Bau der Telegrafenlinie von Berlin nach Frankfurt und schließlich weitere Linien im Rheinland. Rechtzeitig, als der preußische König Friedrich Wilhelm IV. am 28. März 1849 zum Deutschen Erbkaiser gewählt wurde, war die Verbindung zwischen Frankfurt und Berlin hergestellt worden und das Wahlergebnis konnte just nach der Verkündigung in der Frankfurter Paulskirche nach Berlin übermittelt werden. Der Erfolg hielt allerdings nicht lange an: Das zuvor mit Lorbeeren überschüttete Telegrafennetz sorgte wegen permanenter Störfälle für Ärger. Schuld waren das technisch noch wenig ausgereifte Produkt, die mangelhafte Isolierung der unterirdischen Leitungen und überhastet vorgenommene Verlegungsarbeiten. Friedrich Wilhelm Nottebohm, der Chef der preußischen Telegraphenverwaltung, kündigte die Zusammenarbeit. Das junge Unternehmen stand auf der Kippe.
Das Risiko war den Gründern seit ihrem Start bewusst gewesen. Sie hatten deshalb versucht, ihre Aktivitäten zu diversifizieren – was die Produktpalette anbelangt, vor allem aber auch geographisch. Werner von Siemens stellte später den Grundsatz auf, sämtliche Gebiete der Elektrotechnik zu bearbeiten, lehnte aber eine Expansion darüber hinaus ab. Da waren zum einen die Eisenbahnsignalapparate und jene Wassermesser, die speziell für den englischen Markt entwickelt worden waren, zum andern auch so genannte Alkoholmesser, die den russischen Steuerbehörden dazu dienten, die Höhe der Alkoholsteuer festzulegen. Letztere beide warfen vorerst nicht allzu großen Gewinn ab, dafür erlaubten sie Siemens & Halske, die nur mühsam zu findenden Facharbeiter auch in auftragsschwachen Zeiten zu halten und zu beschäftigen. In den sechziger Jahren entwickelte Werner von Siemens eine Dynamomaschine, die zunächst lediglich zu militärischen Zwecken eingesetzt wurde, später, als die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit verbessert worden waren, sah er in der Beleuchtung der elektrischen Straßenbahn und für Elektromotoren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ab 1877 kamen Telefone zum Sortiment hinzu: Siemens verbesserte die von Graham Bell entwickelten, aber in Deutschland nicht patentierten Apparate, die vorerst nur zwei Personen miteinander verbanden, und verkaufte in den ersten drei Jahren bereits 10.000 Stück. Die aufsehenerregendste Aktion war Siemens & Halske aber mit dem Bau der indoeuropäischen Telegrafenlinie Kalkutta-London (1870) gelungen. Sie funktionierte über 8000 Kilometer Entfernung, obwohl es noch keine Verstärkerröhren gab.
Werner von Siemens versprach sich vor allem viel davon, ins Ausland zu expandieren. Seine Brüder Wilhelm, Carl und Friedrich unterstützten ihn dabei. Die Planung, Entwicklung und Produktion zentralisierte er zwar weitgehend in Berlin, aber schon bald versuchte er Zweigstellen in ganz Europa zu errichten. Ein erster Vorstoß in England – noch vor der Unternehmensgründung – scheiterte unter anderem an mangelnden Beziehungen des jüngeren Bruders Wilhelm. Zudem fehlte das Gespür dafür, in anderen Kulturen Geschäfte zu machen. «... ich habe Gelegenheit gehabt, sehr viel über den Charakter der Engländer zu hören und bin zur Einsicht gelangt, dass er aus purem Egoismus zusammengebaut ist; so ist es z.B. durchaus keine Schande für ihn, jemanden zu betrügen, und es gibt keinen größeren Triumph für ihn, als einen Ausländer und besonders einen Deutschen hinters Licht zu führen», schrieb der knapp 20-jährige Wilhelm 1844 niedergeschlagen an seinen älteren Bruder.
In den fünfziger Jahren hatten Siemens & Halske mehr Erfolg, zumindest in Nischen des zwar privatwirtschaftlichen, aber stark regulierten britischen Marktes vorzustoßen. Wilhelm knüpfte interessante Beziehungen, nicht zuletzt indem er die Tochter eines Ingenieurprofessors und Teilhabers eines Kabelherstellers heiratete. Im Jahre 1863 bewies Werner von Siemens auf Drängen Wilhelms – für seinen Kompagnon Halske allzu – große Risikobereitschaft, als er ins äußerst kapitalintensive Geschäft mit unterirdisch verlegten Seekabeln einstieg. Das Abenteuer scheiterte bereits beim ersten Versuch, als ein Seekabel zwischen Cartagena und Oran hätte verlegt werden sollen: Das Kabel ging zwei Mal verloren, und das für die Verlegearbeiten ungeeignete Schiff wurde beschädigt. Halske plädierte nach dieser Blamage, das Haus in London sofort zu schließen. Der sich daran entzündende Streit führte schließlich dazu, dass Halske aus dem Unternehmen ausstieg. Erfolgreicher lief das Geschäft in Russland an. Es sicherte Siemens & Halske dank langfristiger Wartungsverträge, bei denen die Russen im wahrsten Sinne geschröpft wurden, bis weit in die 1860er-Jahre satte Gewinne.
Ausgeprägter Familiensinn: Beschränkung mit Folgen
Der Traum vom «Weltgeschäft» war aber aus einem ganz anderen Grund gefährdet. Nachdem Halske ausgestiegen war, lag das Unternehmen seit 1868 bis auf einige Kapitalanteile ganz in der Hand der Brüder Siemens. Werner von Siemens beanspruchte als Seniorchef und Familienoberhaupt die Leitung der Firma. Seine Managementprinzipien gründeten auf Loyalität und einem ausgeprägten Familiensinn, was angesichts des immer größer und schwieriger zu koordinierenden Unternehmens zu einigen Fehlentwicklungen führte. Während die Elektroindustrie weltweit einen ungeheuren Aufschwung nahm und die jüngere Konkurrenz mit Hilfe der teilweise in der Industriellen Revolution neu entstehenden Banken schnell expandierte, blieb Siemens & Halske durch interne Querelen und die Gesellschaftsform in seinen Möglichkeiten begrenzt.
Die Managementkapazitäten waren schon allein dadurch, dass letztlich nur seine Brüdern in Frage kamen, für ihn und mit ihm die Geschäfte zu leiten, stark beschränkt. Werner von Siemens konnte sich lediglich Familienmitglieder in der Geschäftsleitung vorstellen, da quasi deren Herkunft Garant für ihre Loyalität war. Noch in der 1882 akut werdenden Führungskrise seiner Firma hielt er es für unmöglich, einen «Fremden» in eine leitende Position des Geschäfts aufzunehmen
Ein zweiter kritischer Punkt war die Belegschaft, die bis 1867 auf 150 Mitarbeiter angewachsen war, und die damit zusammenhängende Rentabilität des Geschäfts. Bereits Mitte der fünfziger Jahre führte der Buchhalter bei Siemens eine Arbeitskostenrechnung ein, die zwischen verschiedenen Funktionen unterschied. Mit diesem Lohnmodell schlug Siemens gleich zwei Fliegen auf einen Schlag: Die kurzen Lohnberechnungsperioden für Arbeitsleute und Gehilfen ermöglichten es, bei schlechter Auftragslage die Arbeiter kurzfristig auf die Straße zu setzen beziehungsweise Kurzarbeit einzuführen – mit entsprechend positiver Wirkung auf die Rentabilitätskennzahlen. Umgekehrt musste Siemens alles daran setzen die ut ebildeten erfahrenen Leute an das Unternehmen zu binden. «Im Beamtenpersonal liegt unsere Achillesferse», hatte Werner von Siemens schon 1857 erkannt. Während er bei seinen Familienmitgliedern Loyalität voraussetzte, musste er sie bei den höheren Angestellten mit langfristigen Verträgen, vom Dienstalter abhängigen Löhnen, Urlaubsregelungen und Erfolgsbeteiligungen – so genannten «Inventurprämien» – erkaufen.
«Im Beamtenpersonal liegt unsere Achillesferse.»
Werner von Siemens
Das Gedeihen des Unternehmens war aber auch durch die Kapitalstruktur begrenzt. Als Werner von Siemens 1867 erstmals einen Bankkredit beanspruchen und dafür hohe Zinsen zahlen musste, traf ihn das hart. Die Deutsche Bank wurde in dieser Zeit rasch die Hausbank von Siemens. Schließlich war ihr Gründer in den Anfangsjahren maßgeblich am Unternehmen beteiligt gewesen und auch noch verwandt. Der Seniorchef weigerte sich aber Zeit seines Lebens, die Firma in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, und beschränkte dadurch den finanziellen Spielraum der Firma in der immer kapitalintensiver werdenden Elektroindustrie
Am meisten war aber die Realisierung seiner Vision eines weltweit agierenden, eng verknüpften Familienunternehmens unter seiner Führung durch ein eigenes Familienmitglied bedroht: Sein Bruder Wilhelm – und nach dessen Tod 1883 Ludwig Löffler, der von Wilhelm bevollmächtigt war, da er keine eigenen Nachkommen hatte – widersetzten sich bei jeder Gelegenheit. Sie kämpften mit betriebswirtschaftlichen Argumenten für mehr Unabhängigkeit. Briefe mit deutlichen Worten wurden über den Kanal geschickt: einmal waren es die zu hohen Preise des Berliner Stammhauses, die Wilhelm reizten, eine eigene Produktion in England aufzubauen, dann wieder die fehlende Risikobereitschaft und der argwöhnisch gehütete Vormachtsanspruch des Familienältesten. Werner von Siemens beharrte auf seiner Vision, gestand den Brüdern später aber zu, auf eigene Rechnung weitere Geschäfte zu führen. 1890 trat Werner von Siemens schließlich als 74-Jähriger formell aus der Firmenleitung aus. Sein Bruder Carl und seine Söhne Arnold und Wilhelm führten fortan das Unternehmen. Doch Werner von Siemens behielt nicht nur sein Büro bis zu seinem Tod im Dezember 1892, bei zentralen Entscheidungen sprach er nach wie vor mit.
In den späten achtziger Jahren waren der Gründer und seine Familie mit Ehrungen (unter anderem mit dem erblichen Adelstitel) überhäuft worden, Siemens & Halske hatte bis dahin aber einen erheblichen Teil des Vorsprungs eingebüßt, den das Unternehmen der Konkurrenz gegenüber besessen hatte. Mit der von Emil Rathenau gegründeten «Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft» (AEG) entstand ein ernst zu nehmender Konkurrent auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Beide Unternehmen entwickelten sich in der Folge sehr unterschiedlich, obwohl sie über ein vergleichbares Produkteportfolio verfügten.
Schützenhilfe für die AEG
1890 hatte die sieben Jahre zuvor gegründete AEG Siemens «an Kapitalkraft, Innovationsfähigkeit und Einfluss auf dem neu entwickelten Starkstrommarkt» überholt, wie der Historiker Jürgen Kocka schreibt. Werner von Siemens hatte das aus der Deutschen Edison-Gesellschaft hervorgehende Unternehmen unterschätzt und es lediglich als Bankengebilde betrachtet, das man sich mittels Absprachen auf Distanz hielt. Im Kooperationsvertrag von 1883 wurden die Felder abgesteckt: Die AEG sollte Kraftwerke bauen und Glühlampen herstellen und verpflichtete sich im Gegenzug, Bogenlampen, Dynamomaschinen, Motoren, Kabel und Drähte bei Siemens & Halske zu kaufen. Der Vertrag währte nicht lange, weil er die Unternehmen in ihren Expansionsgelüsten beschränkte.
Während die AEG eine fremdfinanzierte und in der Hauptsache von Banken geführte Gesellschaft blieb, behielt Siemens stets genügend finanzielle Mittel in der Rückhand, um weiterhin selbst die Geschäfte zu bestimmen. Damit verbunden war eine eher defensive Unternehmensstrategie, die erst den Raum für Rathenaus Neugründung schuf. Die AEG hingegen ging aggressiv vor und scheute auch das Risiko nicht. Rathenau gründete zahlreiche Betriebs-, Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften, vor allem für Elektrizitätswerke und Straßenbahnen, um so die Nachfrage nach seinen Produkten zu stimulieren. Durch die Ausgabe von Aktien und Obligationen wurde etwa der Bau eines Kraftwerkes durch das Elektrounternehmen vorfinanziert. Das war deshalb notwendig, weil die neu entdeckten Anwendungsmöglichkeiten der Elektrizität Ende des 19. Jahrhunderts zwar faszinierten, aber niemand wusste, ob sich die horrenden Investitionen je rechnen würden. Die Elektrounternehmen mussten also die Nachfrage nach elektrischen Maschinen und Apparaten selber schaffen, indem sie diese Anlagen und Übertragungsnetze auch selber finanzierten. Dieses neue Prinzip, Märkte zu erschließen, wurde bereits von den Zeitgenossen «Unternehmergeschäft» genannt und kommt auch heute noch häufig beim Bau von Kraftwerken in der Dritten Welt, aber auch der Finanzierung von Mobilfunknetzen der dritten Generation UMTS zum Tragen. Die Zürcher Elektrobank zählt zu einer solchen AEG-Initiative. Sie sollte für Siemens noch eine wichtige Rolle spielen.
Die Ausbreitung des Unternehmergeschäfts und auch die Zurückhaltung von Siemens & Halske in diesem Bereich schufen in den neunziger Jahren ein Tummelfeld für junge, risikobereite Unternehmen. Die AEG war schon früh zu einem kaum noch durchschaubaren Industriegeflecht gediehen, in dem unzählige Beteiligungsgesellschaften relativ unabhängig agierten. Neben der AEG und Siemens & Halske gab es zur Jahrhundertwende in Deutschland eine Hand voll kleinerer Unternehmen, welche die andere Markthälfte unter sich aufteilten. Die Entwicklung des Unternehmergeschäfts und das ihm inhärente Finanzierungsrisiko löste aber schon bald einen Konzentrationsprozess aus, der durch einen Konjunktureinbruch noch beschleunigt wurde. Am Schluss blieben Siemens & Halske und die AEG übrig. Siemens hatte sich mit der Übernahme der 1873 in Nürnberg gegründeten Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, vorm. Schuckert & Co., im Starkstromgeschäft durchgesetzt, das zuvor eine Domäne der AEG war. Doch auch die AEG konnte in einigen Geschäftsbereichen zulegen und machte seit 1899 mehr Umsatz als Siemens, das nun sein Geschäft in Stark- und Schwachstrom aufteilte. Von dieser Trennung in Siemens Schuckertwerke (SSW) und Siemens & Halske (S & H) her rührt der erst nach dem Ersten Weltkrieg geprägte Begriff vom «Haus Siemens» und entsprechend dem «Chef des Hauses», wobei Haus gleichbedeutend mit Familie verstanden wurde.
AEG und Siemens konkurrenzierten sich nicht nur, sie arbeiteten – teils freiwillig, teils unfreiwillig – auch zusammen. Das Gemeinschaftsunternehmen Telefunken etwa war auf Druck Kaiser Wilhelms II. zustande gekommen. Im Deutschen Reich benutzten Heeres- und Marineverwaltung Funksysteme unterschiedlicher Hersteller, um nicht beim damaligen britischen Weltmarktführer Marconi einkaufen zu müssen, der die feindlichen Streitkräfte belieferte. Die Heeresverwaltung fürchtete aber, dass durch die verschiedenen Systeme im Kriegsfall die Kommunikation zwischen den Teilstreitkräften erheblich gestört sein könnte und drängte Siemens und AEG zur Kooperation.
Aus eigenen Stücken kooperierten die Konkurrenten 1919 mit der Deutschen Gasglühlicht AG, um die Glühlampenfertigung zusammenzulegen. Sie nannten das neue Gebilde, das den Amerikanern Paroli bieten sollte, Osram (der Name bildet sich aus den Worten Osmium und Wolfram).
Im Schatten des Zweiten Weltkrieges
Siemens & Halske war in der Zwischenzeit (1897) in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Die Aktienmehrheit verblieb aber bei der Familie, und das Unternehmen wurde weiterhin zentralistisch von Berlin aus geführt. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die deutsche Elektroindustrie an Terrain eingebüßt. Ausländischer Besitz und Patente waren verloren und die Firmen hatten Probleme, die nötigen Rohstoffe zu besorgen. Deshalb begab sich Siemens 1920 das erste und einzige Mal in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens: Die Gesellschaft verbandelte sich mit der Stinnes-Gruppe zur SiemensRheinelbe-Schuckert-Union, die faktisch aber bereits 1925 wieder aufhörte zu existieren.
Während der Weimarer Republik beziehungsweise den Depressionsjahren überflügelte der Elektrokonzern schließlich seinen Hauptkonkurrenten AEG wieder und beschäftigte 1930 127.000 Mitarbeiter – eine Zahl, die sich bis 1944 verdoppeln sollte. Bei der AEG war es nach dem Tod des Firmengründers 1915 zu Machtkämpfen gekommen. Die rapide Geldentwertung nach Kriegsende machte es notwendig, die Kapitalbasis aufzustocken, der veraltete Maschinenpark war nicht erneuert worden und die Tochtergesellschaften machten Verluste. Nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise geriet die AEG sogar an den Rand der Zahlungsunfähigkeit.
Siemens hingegen war inzwischen zu Europas größtem Elektrokonzern aufgestiegen. Der Konzern spürte aber zunehmend die britische und amerikanische Konkurrenz – IBM, die International Telephone & Telegraph Corporation oder General Electric. IBM etwa war es gelungen, den deutschen Konzernen bei den Nationalsozialisten lukrative Aufträge vor der Nase wegzuschnappen. Siemens gehört aber mit Sicherheit zu denjenigen Unternehmen, die von der wieder-beginnenden Aufrüstung in Deutschland in den dreißiger Jahren profitierten. Gemäß dem Mediziner und Historiker Karl Heinz Roth hatte der Konzern nach dem Ersten Weltkrieg die gesamte – durch den Versailler Vertrag in Deutschland verbotene – elektrotechnische Rüstungsentwicklung ins europäische Ausland verlagert. Die ansteigende Nachfrage nach der Machtergreifung der Nazis hatte den Effekt, dass Siemens schon sehr früh in einen Engpass schlitterte, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Siemens optimierte zunächst seine innerbetrieblichen Prozesse und baute in den noch wenig erschlossenen Grenzregionen Deutschlands neue Werke. Historiker sprechen in diesem Zusammenhang von einer «Politik der verlängerten Werkbank»: Zu Kriegsbeginn waren die acht Siemens-Halske-Werke mit 20 Betrieben noch auf neun Städte beschränkt gewesen. Ende 1944 verteilten sie sich auf 518 Orte; die Siemens-Schuckert-Werke waren zu diesem Zeitpunkt an 140 Standorten präsent (1939: 13 Werke mit 34 Betrieben in 17 Städten). Der Personalmangel war für diese Entwicklung allerdings nur ein Grund, später kam hinzu, dass die Werke auch wegen der Gefährdung oder Zerstörung durch Luftangriffe verlagert wurden.
Der Bedarf an Arbeitskräften konnte aber auf diese Weise nicht gedeckt werden. Viele deutsche Unternehmen suchten in dieser Zeit die Nähe zu den neu entstehenden, unerschöpflichen Arbeitskräftereservoirs, den Konzentrationslagern. IG Farben war der erste deutsche Industriekonzern, der 1940/41 bei Auschwitz ein Werk aufbaute, gefolgt von den Henkel-Werken. Und schon bald schrieben sich auch Siemens und die AEG in dieses traurige Kapitel ein.
Im Sommer 1942 errichtete Siemens mit der Unterstützung des Wirtschafts-Verwaltungshauptamts der SS und des Reichsluftfahrtministeriums im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ein Werk für feinmechanische Montage- und Justiertätigkeiten. Die Fertigkeiten feiner Frauenhände waren unentbehrlich, um elektrisches Kriegsgerät wie Relais, Einrichtungen für Unterseeboote und Flugzeuge, Zeitzünder für Bomben, Sende- und Empfangsanlagen etc. herzustellen. Beaufsichtigt von 150 deutschen Fachkräften – Meister, Kalkulatoren, Vorarbeiterinnen – arbeiteten bis zum Kriegsende 2000 bis 2300 Frauen in den zwanzig von Siemens gebauten Baracken.
Die Erfahrungen mit Ravensbrück setzten Maßstäbe. Ein halbes Jahr nach der Errichtung der ersten Baracke hieß es an einer firmeninternen Grundsatztagung über die Beschäftigung von Zwangsarbeitern, der ganze Erfolg des «Ausländereinsatzes» hänge davon ab, inwieweit es gelänge, die Rekrutierungsbehörden zu beeinflussen, «um das Brauchbarste für uns herauszuholen». Die Siemens-Manager erörterten gemäß Roth Eignungstests, aber auch die Frage, wie man die «Fremdvölkischen» einsetzen sollte. Der hochrangige Hanns Benkert machte zum Schluss der Tagung klar: Die Zeit des «Provisoriums» sei vorüber, man müsse nun die Beschäftigung von «Fremdvölkischen» als Dauereinrichtung aufziehen.
Insgesamt waren etwa 50.000 Arbeitskräfte «gegen ihren Willen» beim Elektrokonzern beschäftigt.
Mitte 1944 waren von insgesamt 244.000 Siemens-Beschäftigten 15.200 Personen KZ-Häftlinge. Hinzu kommen die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die aus besetzten Gebieten deportiert wurden. Gemäß dem Historiker Wilfried Feldenkirchen waren insgesamt etwa 50.000 Arbeitskräfte «gegen ihren Willen» beim Elektrokonzern beschäftigt. Bei der AEG war 1944 von den 102.000 Beschäftigten jeder Vierte ein ausländischer Zivilarbeiter oder Kriegsgefangener. Eingesetzt wurden die Zwangsarbeiter sowohl in den eigenen Werken als auch in den in unmittelbarer Nähe zu den Konzentrationslagern errichteten Betrieben. Aber auch auf Baustellen, wie beispielsweise beim Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Weichselbrücke oder eines gesprengten Wassergroßkraftwerkes in der Ukraine, griff Siemens auf diese Arbeitskräfte zurück.
Dass die deutschen Industrieunternehmen während des Zweiten Weltkriegs zu den Nutznießern der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen gehörten, ist heute unbestritten. Unter Historikerinnen und Historikern ist man sich aber nach wie vor uneins, welches Verhältnis die Unternehmen zum Nazistaat und seinem KZ-System pflegten: War die Beschäftigung von KZ-Häftlingen Teil der staatlichen Wirtschaftslenkung, der sich Unternehmen nicht entziehen konnten? Oder erfolgte die industrielle Ausbeutung jüdischer KZ-Häftlinge aus ideologischen Motiven, da sowohl Unternehmer als auch Manager den Antisemitismus des NS-Regimes teilten?
Für die zweite These existiert eine Reihe von Belegen, die zumindest verschiedene Siemens-Manager in die Nähe der NSDAP rücken. Als Großunternehmen bildete Siemens wohl ziemlich genau die in der Bevölkerung herrschenden Werthaltungen ab. Carl Friedrich von Siemens äußerte sich beispielsweise in einer Runde von amerikanischen Industriellen 1931 voller Lobes für die Nationalsozialisten. «Hitler hat seine wirklichen Anhänger zu starker Disziplin erzogen, um revolutionäre Bewegungen des Kommunismus zu verhindern.» Hanns Benkert hatte schon vor dem Novemberprogrom von 1938 angeordnet, dass die jüdischen Beschäftigten bei Siemens zu separieren seien. Die Oberingenieure und Werkleiter rechneten die deutschen jüdischen Zwangsarbeiter generell zu den «Volksfremden» und hohe Siemens-Manager waren in wichtigen Arbeitsgruppen vertreten, welche die Kriegswirtschaft organisierten. Friedrich Lüschen etwa, seit 1941 stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Siemens & Halske und Leiter der Wirtschaftsgruppe Elektroindustrie, folgte 1945 Hitler in den Freitod.
Völkisches Denken ist deshalb zumindest in die Art, wie Zwangsarbeiter durch bestimmte Siemens-Führungskräfte behandelt wurden, eingeflossen. Die Quellen belegen außerdem einen gewissen Handlungsspielraum der Manager, den sie nutzten, um das «Brauchbarste» für das Unternehmen herauszuholen – das heißt, den inhaftierten Arbeitskräften ein Maximum an wirtschaftlichem Nutzen abzuringen. Die Lageraufsicht verfügte über Möglichkeiten, strebsame Häftlinge zu belohnen und ihnen Zusatzverpflegung oder Ernährungszulagen zuzuteilen. Im Gegenzug übte sie auch Terror aus. Die Inhaftierten wussten sehr genau, dass sie produktiv und arbeitsfähig bleiben mussten, um der drohenden Vernichtung zu entgehen. Wer beispielsweise im KZ-Außenlager Haselhorst nicht mehr in der Lage war, die erwartete Leistung zu erbringen, wurde laut dem Historiker Rolf Schmolling in Siemens-eigene Lkws verfrachtet und ins KZ Sachsenhausen abgeschoben.
Aus dem Konzentrationslager Ravensbrück liegen verschiedene, in ihren Aussagen übereinstimmende Erlebnisberichte vor. «Als ich im November 1942 zum ersten Mal die Baracke 2 des Siemens-Häftlingsbetriebs betrat, verschlug es mir den Atem. Im Lager Ravensbrück hatte ich erlebt, wie wir, etwa 18 Frauen, einen eisenbereiten Pferdewagen zogen und schoben, wie der Sinn unserer Arbeit nicht im Arbeitsergebnis, sondern im Quälen und Vernichten der Häftlinge bestand. Und nun so etwas, eine helle, gut eingerichtete und gut geheizte, blitzsaubere Fabrikhalle. Auch die Arbeitsplätze entsprachen dem damaligen Stand: verstellbare Arbeitsstühle mit Rücken- und Armstützen. Natürlich war der Komfort nicht den Häftlingen zuliebe geschaffen. Ohne diese Arbeitshilfen wären die Leistungen der Spulenwicklerinnen niedriger, die Ausschussquoten wesentlich höher gewesen. Bei zu niedriger Raumtemperatur waren die Drähte überhaupt nicht zu bearbeiten. Unabhängig von den Ursachen all dieses Komforts verzögerte es zunächst einmal unser Ende», erinnert sich Rita Sprengel. Die KZ-Häftlinge wurden nach ihren manuellen und handwerklichen Fertigkeiten ausgewählt. Ihre Leistungsfähigkeit wurde gemessen; Fernbleiben von der Arbeit wurde der KZ-Leitung gemeldet, die mit Schlägen antwortete. In Schreiben an die Leitung des Arbeitseinsatzes des Frauen-KZs seien ausführliche Charakterprofile erstellt worden: Die Person ist faul, frech, schmutzig, ungeschickt, schläft dauernd ein, gibt sich keine Mühe, hieß es da.
Der Grad der Ausbeutung scheint sich gegen Kriegsende gesteigert zu haben, wie eine belgische Zwangsarbeiterin berichtet: «Wir setzten nicht mehr nur kleine Teile zusammen; wir produzierten nun auch die Teile selbst, mit großen Maschinen. Wir arbeiteten an Pressen, Drehbänken, Bohrmaschinen und an einer Art Sägemaschine. Die Arbeitsbedingungen in Ravensbrück waren sehr schwer, und es gab häufig Unfälle. Ich persönlich war noch Schülerin der Normalschule gewesen und hatte nie eine Maschine gesehen. Das alles trug dazu bei, dass wir uns oft in sehr schlimmen Situationen befanden. Es gab Verletzungen an den Händen, durchbohrte Finger und oft bekamen wir Eisensplitter in die Augen, denn die Maschinen hatten keinerlei Schutzvorrichtungen. Auch im Labor wurde die Arbeit gefährlich, wir mussten mit Säuren umgehen. Es kam zu Übelkeit und Erbrechen ... Waren die Häftlinge verletzt oder krank, so schickte man sie ins Lager zurück, und Siemens konnte erneut die Auswahl treffen unter den jungen Häftlingen, die neu ins Lager gekommen waren, und so die fehlenden Arbeitskräfte ersetzen.»
Der Konzern am Rande der Zerschlagung
Am Kriegsende lag Hitlerdeutschland am Boden, und mit ihm Siemens. Doch auch dieses Mal kam der Firma ihr gutes Kontaktnetz im In- und Ausland zugute – eine der Konstanten in ihrer Geschichte. Es sicherte dem
Unternehmen zunächst den Weiterbestand. Im Herbst 1944 hatte der Siemens-Vorstand über verschlungene Wege von der künftigen Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen erfahren. Angeblich hatte der junge, im neutralen Schweden eingesetzte Prokurist und spätere Siemens-Vorstandsvorsitzende Gerd Tacke eine geheime Karte mit den Beschlüssen der Jalta-Konferenz von Stockholm in die Berliner Zentrale geschmuggelt. Der Siemens-Historiker Wilfried Feldenkirchen verbannt diese These ins Reich der Legendenbildung. Seiner Meinung nach waren die Vorstände des Berliner Stammhauses spätestens im Herbst 1944 zur Einsicht gelangt, dass Deutschland den Krieg verlieren und nur die Einrichtung von Gruppenleitungen außerhalb Berlins den Bestand des Unternehmens sichern könnte – eine für den Bereich West (Mülheimer Werk), eine für den Bereich Süd (die in Mitteldeutschland, Sachsen und Bayern gelegenen Werke) und eine für den Bereich Südost (für die in der Ostmark befindlichen Werke). Im Februar 1945 informierten sie die Behörden von ihren Plänen, mit der vorgeschobenen Begründung, dass die Errichtung der Gruppenleitungen dazu diene, die Wehrkraft aufrechtzuerhalten. Noch im Februar – also vor Kriegsende – brachen die Auserkorenen, meist zu dritt, gut geschützt in einem Kohlevergaserwagen in den Süden und Westen auf.
Ernst von Siemens, der Sohn des früheren Chefs Carl Friedrich, wurde inzwischen beauftragt, die Gesamtinteressen des Unternehmens wahrzunehmen, und nach München geschickt, wo er eine Villa am Starnberger See besaß – wohlwissentlich, dass der damalige Vorstandsvorsitzende, Hermann von Siemens, nicht mehr in der Lage dazu sein würde, denn nach der Kriegsniederlage rechnete man mit seiner Verhaftung.
Das Unternehmen hatte massiv an Substanz eingebüßt. Feldenkirchen schätzt die Gesamtschäden auf insgesamt 2,58 Milliarden Reichsmark – was vier Fünftel der damaligen Substanz entsprach. Die Werke waren in sehr unterschiedlichem Maße zerstört. In Siemensstadt hatten die Russen alles, was sie für brauchbar hielten, abmontiert, die Barmittel eingesackt und die Lager mit Fertig- und Halbfabrikaten sowie Rohstoffen geplündert. Im Ausland wurden verschiedene Werke enteignet und das Siemens-Vermögen beschlagnahmt. Die wertvollen Patentrechte wurden aufgehoben. Schließlich beklagte Siemens den Verlust von Zeichnungen, Mess- und Prüfunterlagen sowie Konstruktionsplänen.
Auch die Belegschaft bei Siemens wurde erheblich dezimiert: Viele Beschäftigte waren im Krieg gefallen. Man fürchtete, durch die Entnazifizierung würden die Reihen vor allem des Topmanagements noch weiter ausgedünnt. Die sozialpolitische Abteilung verfasste deshalb einen für interne Zwecke gedachten Rechtfertigungsbericht, in dem behauptet wurde, dass Siemens vom Staat zum Einsatz von Zwangsarbeitern gezwungen worden sei, im Gegenzug aber für gute Arbeitsplätze gesorgt habe.
Vorsorglich hatte Siemens rasch nach Kriegsende seine eigenen Reihen überprüft und den einen oder andern Mitarbeiter entlassen. Das Topmanagement kam trotzdem nicht ungeschoren davon. Der Vorstandsvorsitzende Hermann von Siemens gelangte auf die Kriegsverbrecherliste, wurde aber nach dreijähriger Internierung 1948 bereits wieder frei gelassen – «was den guten Beziehungen des Hauses zur amerikanischen Besatzungsmacht und den zahlreichen Industriellen in ihrem Offizierskorps zu danken war», wie Friedrich Christian Delius, Schriftsteller und Verfasser einer Siemens-Pseudo-Festschrift, vermutet.
Anderen «Siemensianern» misslang die Bewältigung der Vergangenheit. Einige Vorstandsmitglieder begingen Selbstmord, andere wurden nach Russland deportiert, wo sie entweder starben, sich selber umbrachten oder erst nach Jahren wieder nach Deutschland zurückkehrten. Im Rahmen der Entnazifizierung wurden im Siemens-Vorstand zwei ehemalige NSDAP-Mitglieder identifiziert. Dem bereits erwähnten Hanns Benkert wurde vorgeworfen, dass seine Reden an Betriebsversammlungen von Naziterminologie nur so gestrotzt hätten. Zu einer Verurteilung kam es aber nie – Benkert starb während des Verfahrens an einem Herzinfarkt. «Insgesamt lief die Entnazifizierung für Siemens aber glimpflich ab», schreibt Bernhard Plettner, der nachmalige Vorstandsvorsitzende.
Was die Diskussion über den Einsatz von Zwangsarbeitern anbelangt, zöge er wohl nicht den gleichen Schluss. Der oben erwähnte interne Rechtfertigungsbericht des Hauses Siemens wurde zwar nie veröffentlicht, in den fünfziger Jahren gelangte aber die Jewish Claims Conferenence an ein Exemplar. Er wurde zum entscheidenden Beweismittel gegen Siemens in den zähen Verhandlungen um Entschädigungsleistungen für ehemalige jüdische Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter. Der Konzern zahlte Anfang der sechziger Jahre insgesamt sieben Millionen DM – ohne dass man sich rechtlich oder moralisch dazu verpflichtet gesehen hätte, aber um eine öffentliche Debatte zu verhindern und Interessen in den USA zu wahren. Später schaltete die Siemens-Führung auf die harte Linie: 1974/75 beschäftigte sich ein Heer von Anwälten von Siemens mit der Pseudo-Festschrift «Unsere Siemens-Welt» von Delius. Schließlich setzten sich die Juristen in 9 der 19 Klagepunkte durch, darunter auch einige Aussagen zum Thema Zwangsarbeit.
Die Debatten um Nazigold, Bankenschuld und Versicherungsbetrug erhöhten nach 1996 den Druck auf die deutschen Industrieunternehmen massiv und brachten das Kapitel Zwangsarbeit nicht zufällig wieder ans Tageslicht. Nach zähen Verhandlungen zeigten sich zuerst die Schweizer Großbanken kompromissbereit. Später rang sich auch Siemens durch, gemeinsam mit andern Konzernen einen Entschädigungsfonds einzurichten.
Die zweite Schockwelle, was die veränderten Rahmenbedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg anbelangt, erreichte den Konzern, als die Amerikaner den Plan verfolgten, Siemens ähnlich wie die IG Farben zu zerschlagen. Eine im Februar 1947 zur Beratung vorgelegte Verordnung der amerikanischen Militärregierung sah vor, dass die Kartelle und großen Konzerne beseitigt werden müssten und in Deutschland keine Unternehmen mit mehr als 10.000 Beschäftigten existieren dürften. Der Plan versandete.
Das Unternehmen wäre aber beinahe doch noch in mehrere Teile aufgespalten worden – und zwar wegen interner Streitigkeiten. Die unterschiedlichen Ausgangslagen der beiden Stammfirmen S & H und SSW einerseits und der Produktionsstandorte in Berlin und den Westzonen andererseits verliehen Eigeninteressen der verschiedenen Gruppen Auftrieb. Der Finanzchef etwa weigerte sich, von Berlin aus die Gruppenleitungen mit Geld zu versorgen, was prompt dazu führte, dass sämtliche liquiden Mittel verloren gingen. Streit gab es auch um den Standort des Mutterhauses: Für die einen kam nur die einst stolze Siemensstadt in Berlin, ein Monument der Industriearchitekturgeschichte und Sinnbild der Größe und Macht des Konzerns, in Frage, für die Gruppenleitungen hingegen war eine Verlegung in den Westen unumgänglich. Der Streit eskalierte im August 1948, als der provisorische Aufsichtsrat in Berlin Ernst von Siemens und auch den Leiter der Gruppe Süd absetzte. Nach zähen Verhandlungen, die ein halbes Jahr dauerten, erhielten die beiden Unternehmensteile – Siemens & Halske und Siemens Schuckertwerke – wieder eine einheitliche Führung für ganz Deutschland, darunter die beiden von den Alliierten angeklagten Hermann von Siemens als Aufsichtsratsvorsitzenden und Wolf-Dietrich von Witzleben als seinen Stellvertreter. Von Siemens richtete sein Büro in München an der Hofmannstraße ein, wo seit 1927 Fernsprechgeräte produziert wurden. Und obwohl es offiziell verboten war, neue Industriegebiete anzusiedeln, gelang es dennoch, die Genehmigung zu erhalten, in Erlangen, jenem von den Kriegszerstörungen weitgehend verschonten Universitätsstädtchen, eine Produktion aufzubauen.
Während die Bevölkerung Deutschlands hungerte und noch niemand den Begriff des deutschen Wirtschaftswunders in den Mund nahm, erholte sich Siemens relativ rasch. Das lag daran, dass die westlichen Alliierten die Besitzrechte der Privatindustrie nach und nach wieder akzeptierten und Siemens die Produktion schnell wieder hoch ziehen konnte. Eine sehr wichtige Rolle spielten aber auch die über Jahrzehnte hinweg aufgebauten Kontakte, einerseits zu den Auslandgesellschaften, aber auch zu den Kunden, die sich wieder meldeten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte etwa die junge österreichische Republik kurzerhand Siemens-Beteiligungen in Österreich verstaatlicht, um dieses deutsche Eigentum vor dem Zugriff der Alliierten zu retten. Das Resultat: Als die Deutschen 1971 alle österreichischen Töchter zu Siemens Österreich zusammenfassten, war die Republik Österreich zu 43 Prozent beteiligt. Siemens Österreich war quasi eine Halbschwester der verstaatlichten Industrie und der öffentlichen Hand. Aussagekräftig sind in diesem Zusammenhang die Schreiben eines Ministeriums aus den siebziger Jahren, dass bei öffentlichen Aufträgen, bei Ausschreibungen von Post und verstaatlichter Industrie Siemens nach Möglichkeit zu bevorzugen sei.





























