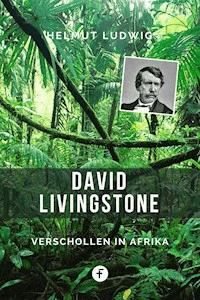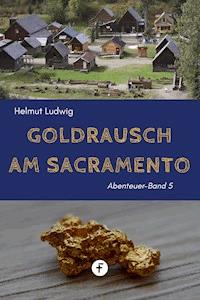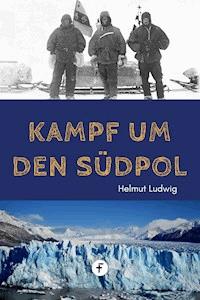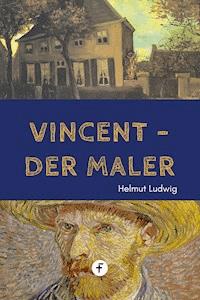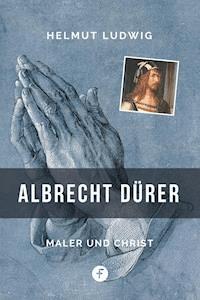Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Kurzgeschichten eines Pfarrers
- Sprache: Deutsch
Das eBook gibt einen eindrucksvollen Einblick in die Lebensrealitäten von Menschen, die sich in Grenzsituationen und ernsthaften Schwierigkeiten befinden. Alle Erzählungen basieren auf wahren Begebenheiten und werfen ein Licht auf die oft unsichtbare Arbeit der Nächstenliebe, die sich abseits der Öffentlichkeit in der Stille entfaltet. In Deutschland gibt es zahlreiche Einrichtungen und Heime, die häufig als Orte des Elends und menschlichen Leids wahrgenommen werden. Viele Menschen hinter diesen Anstaltsmauern werden von der Gesellschaft als „nicht tragbar“ abgestempelt und erleben Ablehnung. Einige dieser Geschichten könnten den Leser schockieren – und das ist gewollt. Diese Erzählungen sind dazu da, zum Nachdenken anzuregen und die Frage nach der Sinnerfüllung im Leben aufzuwerfen. Sie laden dazu ein, sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, die diese Menschen täglich meistern müssen. Wenn das eBook den einen oder anderen Leser inspiriert, aktiv im Dienst der Nächstenliebe tätig zu werden, wäre das das schönste Ergebnis. Denn Gott braucht Menschen, die bereit sind, ihren Glauben durch Taten sichtbar zu machen. Dieses Buch möchte ermutigen und herausfordern, sich für die Schwächeren in unserer Gesellschaft einzusetzen und mit offenen Herzen zu handeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Signale der Liebe
Wahre Erlebnisse
Helmut Ludwig
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Helmut Ludwig
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-067-4
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Das eBook Signale der Liebe ist als Buch erstmals 1968 erschienen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Autor
Helmut Ludwig (* 6. März 1930 in Marburg/Lahn; † 3. Januar 1999 in Niederaula) war ein deutscher protestantischer Geistlicher und Schriftsteller. Ludwig, der auch in der evangelischen Pressearbeit und im Pfarrerverein aktiv war, unternahm zahlreiche Reisen ins europäische Ausland und nach Afrika. Helmut Ludwig veröffentlichte neben theologischen Schriften zahlreiche Erzählungen für Jugendliche und Erwachsene.1
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Ludwig
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Dank
Newsletter
Autor
VORWORT
Sie hatten alles für ihn getan
Der Bann
Der namenlose Jimmy
Der Mann ohne Gesicht
Die Missetat der Väter
Kein Fußballspiel
»Liebe Gemeinde …«
Jörg denkt über die Auferstehung nach
Bitte eines Schlaflosen
Telefon nachts um drei
Der dunkle Plan
Eine unzeitgemäße Geschichte
Der Alptraum
Rufe in der Nacht
Ein Junge blieb übrig
Gott kam nicht vor
»Spezialist für Eigentumsveränderung«
Zusammenreißen hilft nicht
Auf dem Abstellgleis
Lieber Herr X!
Licht fiel in ein verpfuschtes Leben
Leidenschaft
Advent in Zelle Ps 8
Am seidenen Faden
Jürgen erzieht seinen Erzieher
Diakon und Fabrikchef
Diakonie hinter Anstaltsmauern und »draußen«
Unsere Empfehlungen
VORWORT
Das Buch zeigt Menschen in Grenzsituationen und ernsten Schwierigkeiten. In sechs Abschnitten bringt es ein Bündel von Schicksalsberichten aus dem Leben junger Menschen. Alle Erzählungen sind der Wirklichkeit entnommen.
Es sind harte Geschichten darunter. Sie wollen und sollen nachdenklich machen, erschüttern, aufrütteln und manche Fragen aufwerfen. Nicht jede Geschichte hat am Schluss ein Happy-End.
Manches bleibt offen, weil das Leben so oder so weitergeht. Viel Schuld und Versagen kommt in diesem Buch zur Sprache. Einige Schicksalsberichte ähneln sich merkwürdig. Aber weil das Leben diese Berichte geschrieben hat, ist darauf verzichtet worden, die Dinge zu harmonisieren oder künstliche Differenzierungen einzubauen. Mancher Leser hat vielleicht ähnliches erlebt und gehört.
Man kann das Buch lesen und über die einzelnen Begebenheiten nachdenken. Man kann dieses Buch aber auch als Arbeits- und Vorlesebuch für Jugendgruppen, Gemeindekreise, für Heimabende, kirchliche Veranstaltungen oder in Auswahl als Beispielsammlung benutzen. Zur Auswertung dienen die kurzen Inhaltsangaben mit ungefährer Vorlesedauer der einzelnen Beiträge sowie Vorschläge zu Diskussionsthemen und ein Stichwortverzeichnis am Schluss des Buches.
Die Berichte gewähren Einblick in eine Arbeit, die sich weithin abseits der Öffentlichkeit in der Stille des Dienstes der Nächstenliebe vollzieht. Es gibt viele Anstalten und Heime in Deutschland. Sie sind oft Ghettos des Elends und menschlichen Leides. Viele Menschen hinter Anstaltsmauern sind draußen »nicht tragbar«. Von manchen wendet sich die Gesellschaft ab. Das vorliegende Buch wird gelegentlich schockieren. Das kann heilsam und nachdenkenswert sein.
Manche Geschichten stellen die Frage nach der Sinnerfüllung des Lebens. Das ist vom Verfasser durchaus gewollt. Sollte sich durch den Umgang mit diesem Buch der eine oder andere Leser aufgerufen fühlen zum praktischen Dienst tätiger Nächstenliebe, wäre das das Schönste, was geschehen könnte. Gott braucht Menschen in seinem Dienst.
Der Verfasser hat viele Jahre seines Lebens in dem Dienst gestanden, den das Buch umreißt. Er verwaltet heute ein Pfarramt im Zonengrenzgebiet. Er wünscht dem Buch einen interessierten und engagierten Leserkreis und einen gesegneten Gebrauch in Gruppen und Kreisen, in Kirche, Gemeinschaft, Gemeinde- und Jugendarbeit.
Helmut Ludwig
Sie hatten alles für ihn getan
Peter sitzt auf der hohen Mülltonne, wie sie in Großstädten üblich sind, und denkt nach. Vierzehn Jahre ist er alt. Wer ihn so gleichgültig, lässig, mit den viel zu langen, baumelnden Beinen hocken sieht, kommt kaum auf den Gedanken, dass hinter dieser Jungenstirn tieftraurige Gedanken kreisen. Es ist immer derselbe Kreislauf – nirgends zeigt sich ein Ausweg. Peter hat sich so sehr an all die Dinge seines täglichen Lebens gewöhnt, dass er sich nicht vorstellen kann, es könnte auch anders sein. Während Peter grübelt, dringen Fetzen einer sentimentalen Schlagermelodie aus dem Fenster des gegenüberliegenden Hauses. Verächtlich schaut der Junge zum Fenster seiner elterlichen Wohnung hinüber.
»Da lässt das Hausmädchen den Musikkasten wieder mit voller Lautstärke laufen!« Peter erschrickt, als er merkt, dass er den Satz laut vor sich hingesagt hat. Aber mit wem kann man sich überhaupt noch vernünftig unterhalten? Er spinnt seine Gedanken von vorhin weiter: Vater versteht mich nicht. Der denkt nur an das viele Geld, das Mutter für den Haushalt und zu Anschaffungen braucht. Abends ist er vom Dienst im Betrieb erledigt. Wenn Mutter das Fernsehgerät andreht, wird Vater nervös und sagt, dass er das Flimmern nicht vertrage. Und dann gehen sie zusammen aus, Vater und Mutter; und sie kommen erst spät in der Nacht wieder. Manchmal nehmen sie den Wagen, der – genau betrachtet – Vater gar nicht gehört. Es ist das Dienstauto. Und ich liege dann Nacht für Nacht und lese. Eigentlich sind diese Hefte immer gleichlautend. Manchmal sind sie sogar langweilig, trotz aller Spannung, weil man ja schon weiß, wie das alles ausgeht.
Dann grübelt er weiter: Ob meine Eltern eigentlich glücklich sind? Sieht nicht so aus. Mutter ist immer am Nörgeln. Ob sie mich überhaupt leiden mögen? Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich nur so zur Familie gezählt werde wie das Radio, der neue Plattenspieler, den Mutter zum Geburtstag von Onkel Freddy bekam, wie der Kühlschrank und wie die Hausbar. Das alles gehört uns …, denkt Peter. Aber es ist doch immer langweilig zu Hause. Ich glaube, sie haben mich überhaupt nicht lieb. Vielleicht sind sie zu müde dazu. Mutter muss für die Versicherung viel herumfahren im Land. Sie arbeitet, um mitzuverdienen. Sie glauben, dass ich bei Erna, die den ganzen Tag das Radio laufen lässt, gut aufgehoben bin.
Was hat Erna eigentlich zu tun? Sie bedient den Staubsauger und die elektrische Bohnermaschine, schön. Aber die meiste Zeit des Tages liest sie meine Hefte. Ich mag Erna nicht leiden. Sie ist langweilig und lieblos. Ich glaube, sie macht die Arbeit nur, um eine Beschäftigung zu haben und Geld zu verdienen. Meiner Mutter gibt sie oft freche Antworten, wenn sie abends müde und nervös nach Hause kommt. Und Vater macht sie verzückte Augen; eigentlich langweilig, immer dasselbe.
Peter beendet seine unerfreulichen Gedanken und kommt zu dem Schluss: Wir haben alles zu Hause; vom Dienstmädchen bis zum Starmix, vom Fernsehgerät bis zu den komischen Bildern im Schlafzimmer meiner Eltern. Aber wir sind alle unglücklich und langweilen uns, wenn wir zusammen sind.
Warum nur? Warum haben sie mich nicht lieb? Warum gehöre ich zu ihnen wie das dämliche Grammophon, das man an- und abstellen kann und das man dann wieder wegstellt, weil es langweilig ist, immer nur dieselben Platten zu hören?
Und dann kommt ein ziemlich unvermittelter Punkt hinter alle Überlegungen: Aber wir sind reich! Und wir haben mehr als andere Leute! Allein mein Taschengeld!!! Wir sind reich!
Peter springt mit einem Satz vom Mülleimer herunter, sucht einen der herumliegenden Kieselsteine und lässt ihn mit
Schwung über das Dach des elterlichen Einfamilienhauses fliegen.
Dann holt Peter das Leichtmetallfahrrad aus dem Keller, das ihm sein Vater anlässlich seiner Gehaltserhöhung, für Peter aber ohne jeden ersichtlichen Grund (wozu auch? Mein Vater hat genug Geld, kann auch für mich mal was springen lassen!), geschenkt hat, damit er in Zukunft zur Schule fahren kann. Die Schule ist nicht weit von zu Hause entfernt. Aber Peter ist stolz auf sein Fahrrad. Er schwingt sich auf den Sattel, kurvt über die Grasanlage unter das geöffnete Fenster, sieht, dass drinnen Erna wieder am Heftelesen ist und ruft in selbstverständlichem Tonfall, der keine Widerrede gewohnt ist: »Erna, ich fahre mal eben zum Kaufhof!«
»Mach, was du willst!« klingt es zurück.
Und die Musik trällert gerade den Schlager: »Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind …«
Peter bremst und überlegt: Wie das wohl mit dem Himmel ist? Darüber sagt bei uns keiner auch nur ein Wort. Sonntags fahre ich mit meinem Stahlhirsch allein zum Gottesdienst, weil der Pfarrer das während der Konfirmandenzeit so will. Vater und Mutter schlafen aus und schimpfen dann hinterher, weil sie sich über die Fliege an der Wand ärgern. Ob sie auch in den Himmel kommen? – Und ich? »Weil wir so brav sind«, dudelt das Ding immer. – Alles Quatsch!
Peter tritt in die Pedalen, schnippelt die Kurve an der Goethestraße und braust zur Innenstadt, dem Kaufhof entgegen.
Was will ich eigentlich da? – Ach, nur so. Da sind viele Menschen. Und da kann man umsonst Rolltreppe fahren. Da ist was los! Da ist Betrieb! Ich bin jeden Nachmittag allein. Die andern aus der Klasse wohnen nicht im Viertel der Reichen. Ich habe ja auch viel mehr Taschengeld als sie. Eigentlich könnte ich nachher noch zur Spielhölle, war seit vorgestern nicht mehr dort. Wenn man mich erwischt, kostet es Strafe. Aber ich sehe bestimmt älter aus als vierzehn! – Und dann muss ich auch mal wieder ins Kino. Da ist doch der tolle Wildwester! Gerd hat davon erzählt. Gerd raucht schon wie ein Alter. Der ist auch so ’ne Art Schlüsselkind. Mensch, wenn die Eltern wüssten, was man an so einem langen Nachmittag alles anstellen kann! Erna ist froh, wenn sie ihre Ruhe hat. – Übrigens schreibe ich die Schulaufgaben morgen früh ab. Der Schmidt hat immer alles richtig. Den lade ich für diese Gefälligkeit mal wieder ins Kino ein. Der kriegt kaum Geld von zu Hause. Armer Knauser! – Hoffentlich erfährt mein Vater nicht, dass ich die letzte Mathematikarbeit wieder danebengehauen habe! – Woher soll er’s erfahren? Er interessiert sich doch nicht dafür. Er sagt, ich lerne nur für mich. Quatsch! – Mein Vater hat das viele Geld. Ich werde später auch ohne Musterzeugnisse etwas. Vater hat Beziehungen.
Peter parkt das Rad im Fahrradständer des großen Kaufhauses, schließt es sorgsam ab und geht durch eine der großen Glastüren hinein. Der Betrieb, das Kommen und Gehen der vielen Menschen, das Summen in der Luft, das sich aus vielen hundert Stimmen zusammensetzt, das alles umflutet ihn, reißt ihn mit hinein in den Sog der sich drängenden Menschen.
Peter sucht den Betrieb, weil er sich im Prunk seines neureichen Elternhauses mutterseelenallein und verlassen fühlt. Er wächst ohne Liebe heran, und das weiß er ganz tief drinnen in seinem verlassenen Jungenherzen genau.
Wenn man das seinem Vater und seiner Mutter sagen würde, wären sie gewiss zutiefst erstaunt: Wofür arbeiten wir denn? Er ist unser Einziger. Er wird doch einmal alles übernehmen. Er hat es gut, bekommt sein Taschengeld und hat alles, was er braucht. Er ist schon sehr selbständig. So etwa werden sie antworten.
Im Kaufhof dudelt der Lautsprecher: »Cindy, o Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein …« Peter hört es, lässt Töne und Text ins Unterbewusste seines Ichs fallen und lässt sich dahintreiben inmitten der schiebenden und drängenden Menschen. Dann kommt er zur Rolltreppe, fährt nach oben und landet in der
Lebensmittelabteilung, in der das Gedränge noch schlimmer ist. Plötzlich stutzt Peter, sieht auf den Boden, bückt sich und hebt eine alte, abgegriffene Geldtasche auf. Hat sicher jemand verloren, denkt er und lässt sie instinktiv in seine Hosentasche gleiten, damit sie ihm niemand wegnehmen kann. Dann läuft er zum Fahrstuhl, gleitet darin nach unten, steuert dem Ausgang zu und atmet erleichtert auf, als er außerhalb allen Betriebs steht. Scheu sieht er sich um, holt die Geldtasche hervor und öffnet sie. Da liegen vorn einige Silbermünzen und ein paar Groschenstücke drin. Peter ist enttäuscht. Dann öffnet er das hintere Fach für die Geldscheine und zählt sechzig Mark zusammen.
Peter hat viel Geld gefunden. Und das soll ihm gehören! Peter überlegt: Abgeben? – Er verwirft den Gedanken wieder: Mein Vater und meine Mutter sind reich, haben viel Geld. Sie sparen für einen ganz tollen Wagen. Der wird uns dann ganz allein gehören! – Ich bekomme zwar nicht wenig Taschengeld. Aber ich will mehr haben. Ich will auch reich sein können! Sechzig Mark! Und noch mehr.
Peter zählt das Geld im vorderen Fach nach, dazu sein restliches Taschengeld, das er bei sich trägt. Sechsundsiebzig Mark sind es zusammen. Er ist mit einem Schlage reich geworden. Den Gedanken an die selbstverständliche Meldepflicht seines Fundes schiebt Peter weit von sich. Er ist ein reicher Junge, reicher als alle seine Klassenkameraden.
Da fällt ihm ganz unvermittelt die verpfuschte Mathematikarbeit ein. Und er hat sie offen liegenlassen! Wenn Vater nach Hause käme und einen Blick in Peters Zimmer würfe …
Erst will er noch zur Spielhölle fahren. Vielleicht kann er da noch etwas hinzuverdienen.
Um diese Zeit, während Peter die Räder und Scheiben des Automaten kreisen lässt, merkt das alte Mütterchen, dass ihre Geldtasche fehlt. Zuerst sucht sie mit zitternden Händen aufgeregt in der großen Einkaufstasche. Aber das Geld bleibt verschwunden. Sie überlegt fieberhaft, wo sie es zuletzt in der Hand gehabt hat. Richtig: in der Lebensmittelabteilung!
Das Mütterchen hetzt zurück, drängt sich zwischen der träge dahinströmenden Menge hindurch, wird gestoßen. Jemand schimpft. Zehn Minuten später findet sich die alte Frau völlig erschöpft am Ausgang des Kaufhauses wieder und hat Tränen in den Augen. Der Rest der spärlichen Monatsrente ist verlorengegangen. Vielleicht hat ein ehrlicher Mensch das Geld gefunden und abgegeben. Das Mütterchen eilt zurück, um den Verlust des Geldes bei der Direktion des Kaufhofs zu melden. Man registriert, zuckt mitleidig und nichtssagend die Schultern, gibt den Verlust auch zusätzlich telefonisch dem städtischen Fundbüro durch und vertröstet die alte Frau mit aufschiebenden Worten: Sie solle morgen noch einmal nachfragen, vielleicht werde das Geld auch beim Fundbüro im Rathaus abgegeben. Man werde das möglichste tun, aber man wolle nicht zu große Hoffnung machen. Heutzutage …
Als Peter die Spielhölle später verlässt, als er ursprünglich beabsichtigt hatte, besitzt er etwa zehn Mark weniger. Gewiss, die Automaten in der Spielhölle haben auch hin und wieder etwas ausgespuckt. Aber Peter wurde vom Spielfieber gepackt und erst nüchtern, als zehn Mark verspielt waren. Er sieht auf die vergoldete Armbanduhr, ein Geschenk seiner Mutter zum vierzehnten Geburtstag. Peter ist mächtig stolz darauf. Aber jetzt erschrickt er doch, wie weit die Zeit vorgeschritten ist. Er schwingt sich aufs Fahrrad und kurvt eiligst dem Elternhaus zu. Gewiss sind Vater und Mutter längst zu Hause und zanken mit Erna, weil sie ihn fortfahren ließ. Er denkt: Sollen sie ruhig zanken! Wenn ich da bin, übersehen sie mich. Erst wenn ich einmal ausbleibe, fragen sie nach mir. Und Erna kann es nichts schaden, wenn sie von Vater mal deutliche Worte zu hören bekommt!
Peter stellt das Rad in den Keller, erscheint mit großer Selbstverständlichkeit in der Wohnung. »Da bin ich wieder!«
In Vaters Augen steht Wut. Peter kann das nicht verstehen: Was hat der alte Herr wieder? Das kommt doch nicht nur von dem bisschen Verspätung? – Du liebe Zeit! Da liegt ja die verkorkste Mathematikarbeit auf geschlagen vor ihm!
Das kann nur Erna verraten haben, vielleicht aus Rache, weil sie meinetwegen ausgeschimpft wurde.
Diesmal zögert der Vater nicht lange. Es gibt kein fragendes und erklärendes Vorgespräch. Er nimmt seinen Sohn Peter beim Kragen. Die Nachbarschaft wundert sich über das Schreien im reichen Hause. Peter bezieht eine Tracht Prügel, wie er sie in seinem Alter nicht mehr für möglich gehalten hatte. Die Mutter dreht vor Angst und Aufregung das Radio auf höchste Lautstärke, damit man draußen das Geschrei nicht so hören soll.
Das Abendessen verläuft schweigsam. Peter hat eine Mordswut auf Erna und auf seinen Vater, er verachtet seine Mutter. Und mit einem Male ist alle Gleichgültigkeit in Hass verwandelt. Er hasst dieses Haus mit seiner kalten und lieblosen Pracht. Er hasst allen Reichtum, der doch nicht glücklich macht, und denkt mit verstärkten Gefühlen dieser Art an die Spielhölle, die einem das Geld aus der Tasche zieht. Welches Geld? Sein Geld? – Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ehrlicherweise hätte man sagen müssen, dass es unterschlagenes, gestohlenes Geld ist. – Peter aber verdrängt solche Gedanken und erstickt sie in seiner Wut. Die Eltern sind schuld an allem. Nie hat ihn jemand geliebt. Immer haben sie ihn so blödsinnig erwachsen behandelt. Immer mit dieser kalten Zurückhaltung. Und nun wagt es sein Vater, ihn so zu schlagen! Peter kommt zu dem Schluss: Alles wegen Erna und der dummen Schularbeit, wegen der Spielhölle und der dadurch entstandenen Verspätung! – Ich habe das satt, gründlich über! Ich haue ab!
Der Entschluss ist ganz plötzlich in Peter erwacht. Er hat noch immer genügend Geldscheine in der Tasche. Er besitzt ein Fahrrad. Ach was! Er wird …
An diesem Abend bleibt der Vater gereizt. Er kann das Flimmern des Fernsehgeräts wieder nicht ertragen. Mutter will ihn ablenken und schlägt einen abendlichen Bummel durch die Stadt vor. Peter weiß, in welchem Lokal dieser Bummel enden wird. Es gibt eine Stammkneipe, die Vater an solchen Abenden ansteuert.
Als die Eltern das Haus verlassen haben, packt Peter in aller Eile einige Habseligkeiten in die Büchertasche. Die Schulsachen knallt er erbost in die Ecke. Bald ist er reisefertig, zieht die Tür hinter sich zu und strebt der nächtlichen Stadt zu. Nur die Eltern nicht treffen! Vor dem Kino stehen Motorräder, Mopeds und Autos. Ein Motorrad ist zu schwierig zu fahren. Dabei kann viel passieren. Und man kann leicht geschnappt werden. Peter überlegt wieder und spürt nicht, dass diese Grübeleien ihn immer weiter in den Bannkreis des Bösen treiben. Ein Moped? – Die Dinger fahren zügig und sind nicht so schnell zu unterscheiden. – Also ein Moped!
Peter schlendert lässig zwischen den Fahrzeugen hindurch; hin und wieder wirft er einen forschenden Blick zu diesem und jenem Moped hinüber. Das grüne dort!
Das grüne Moped ist tatsächlich nicht abgeschlossen. Leichtsinn oder Vertrauensseligkeit? – Wie kann Peter wissen, dass der Besitzer Polizist ist und drüben am Kiosk nur Zigaretten kauft? Für Peter ist klar, dass der Mopedfahrer im Kino sitzt und zwei Stunden erholsamen Leinwandflimmer vor sich abrollen lässt. Er schiebt das Moped aus dem Parkplatzgelände heraus, tritt es an, nachdem er den Benzinhahn geöffnet hat, will sich auf den Sattel schwingen, davonbrausen, irgendwohin, nur weg vom lieblosen Neureichenhaushalt seiner Eltern – da fühlt er sich recht unsanft am Kragen gepackt und blickt einem Polizeibeamten in die Augen. Aus! Auch das noch!
Peter wird mitgenommen. Man stellt seine Personalien fest. Und als er mit der Sprache und den erfragten Angaben nicht heraus will, sucht der Polizist nach Ausweispapieren in Peters Taschen. Dabei wird die abgegriffene Geldbörse zutage gefördert, der Inhalt gezählt, notiert und Peter, nachdem er sich endlich zu sprechen bequemt, für diese Nacht in einen Sonderraum geführt. Die Tür schließt sich hinter ihm.
Peters Eltern sind verblüfft und erschrocken zugleich, als sie vom erholsamen Abendbummel nach Hause zurückkehren und ihren Sohn nicht im Bett finden, überhaupt nicht in seinem Zimmer. Die Bücher aus seiner Schultasche liegen in der Ecke, einige Sachen in Peters Schrank fehlen, eine Schublade ist durchwühlt. Da wissen die Eltern, dass Peter ausgerissen ist, und blicken äußerst bestürzt und erstaunt drein. Der Vater eilt zum Telefon und gibt eine Suchmeldung auf. Die Polizei klärt den Sachverhalt sehr schnell. Peter muss aber vorläufig bleiben, wo er ist. Der Vater ist unglücklich, schimpft und wettert. Er werde Beschwerde führen …
»Peter, unser Peter hat ein Moped gestohlen und achtundfünfzig Mark bei sich! Hast du ihm noch extra Taschengeld gegeben?« fragt der Vater höchst erstaunt seine überraschte Frau.
»Wie kann das nur möglich sein? Wo wir alles für den Jungen tun!«
Am nächsten Tag schaltet sich das Jugendamt in die Sache ein, die polizeilicherseits weitergegeben war. Peter hat inzwischen ein umfassendes Geständnis abgelegt und zeigt wenig Lust, nach Hause zurückzukehren. In der Nacht hat sich sein Trotz verhärtet. Sie haben mich doch nicht lieb!
Peter wird in ein Jungenheim überwiesen. Das Jugendamt hält diese Maßnahme, die einer nachfolgenden jugendrichterlichen Begründung standhalten wird, für unumgänglich. Es gibt Paragraphen, die hier das letzte Wort zu sagen haben.
Peters Vater läuft zu Hause aufgeregt in der luxuriös ausgestatteten Wohnung umher und fordert von seiner Frau, dass das Dienstmädchen entlassen würde, fristlos und sofort!
»Haben wir nicht alles getan für unseren Jungen? – Dieses Hausmädchen ist schuld an allem. Warum hat sie Peter nicht besser bewacht?«
»Ja, wir haben alles für ihn getan!« jammert die Mutter und überschlägt im Geiste die ungefähren Kosten des Heimaufenthalts, die sie gewiss selbst zu tragen haben. Das Geld würde im Haushalt fehlen.
Am Nachmittag des folgenden Tages erhält die alte Frau die verlorene Geldtasche auf der Polizeiwache ausgehändigt. Man hatte das Fundbüro verständigt, wo die Geldtasche abzuholen war. Peters Vater hat den fehlenden Rest draufgelegt. Das Mütterchen ist überglücklich.
Peter findet im Heim Kameraden. Viele Jungen kommen da zusammen. Man spricht, wenn die Erzieher unter sich sind, von zerrütteten Familien, entwurzelten Kindern, von fehlender Liebe und falscher Verwöhnung.
Über dem Heim ist das Zeichen des Kreuzes aufgerichtet, das Zeichen der Liebe, das der Gottessohn in die Welt brachte, damit die entzweite Menschheit wieder heil werde. Aus dem Schandzeichen des Kreuzes war auf dem Schädelberg vor Jerusalem das Zeichen der großen Liebe zur gefallenen und sich selbst zerstörenden Menschheit geworden. Und nun ist das Kreuz auf dem Dachgiebel jenes Jungenheims befestigt, hinter dessen Mauern junge Menschen aus vielen Städten des großen Landes Zusammenkommen und auf Liebe warten.
Eines Tages kommt ein Brief an Peter ins Heim. Er ist von der Hand seines Vaters geschrieben. Peter öffnet ihn mit raschen Fingern und liest: »…Gewöhne Dich an das Leben im Heim, lieber Peter! Mutti und ich arbeiten fleißig. In einigen Monaten werden wir ein feines Auto besitzen. Wir haben uns für einen Mercedes entschieden. Er soll dunkelblau aussehen und ist unverwüstlich. Wenn Du dann später wieder nach Hause kommen darfst, dann kannst Du mit uns im Mercedes verreisen …«
Peter zerreißt den Brief. Er ist wütend und kann doch die Tränen nicht zurückhalten. Sie sind reich und besitzen alles. Aber sie haben keine Liebe! »Ob mich überhaupt noch jemand liebhaben kann?« fragt er und erschrickt vor seinen eigenen Worten …
Der Bann
Aus der Sprechstunde eines Anstaltsseelsorgers der Inneren Mission:
Sie müssen mir helfen, Herr Pfarrer! Sie sind der einzige, der vielleicht auf meinen Sohn einen guten Einfluss ausüben kann und dem er das abnimmt, was ihm gesagt wird. Mir ist der Junge längst aus der Hand gewachsen. Er stiehlt mir kleine Dinge unter der Hand weg und setzt sie bei seinen Freunden um in Geld. Und an allem ist letztlich nur der verflixte Bann schuld, in dem sich unsere ganze Familie befindet. Wir können nicht mehr beten und nur noch an die Wahrsagerei denken.
Was für ein Bann, Herr Zimmermann? Wovon reden Sie? Sie können sich gern aussprechen. Aber reden Sie sich dann auch alles von der Seele herunter! Halbe Sachen sind nicht nützlich!
Ich bin froh, dass Sie mich anhören, Herr Pfarrer. Aber Sie brauchen schon ein wenig Zeit, wenn ich alles erzählen soll. Wir gehören doch zu Ihrer Stadtgemeinde, die Sie neben Ihrer Anstaltsarbeit betreuen. Sie kennen doch unseren Jungen!
Reden Sie nur, Herr Zimmermann! Ich höre Ihnen zu, bis Sie alles gesagt haben.
Halte ich Sie auch nicht auf?
Sie halten mich nicht auf; denn es ist sicher wichtig, was Sie sagen wollen.
Ja, wir leiden seit langem darunter. Und an allem ist letztlich Herr Siebert schuld, der Wahrsager, der meiner Frau damals, als wir noch gar nicht verheiratet waren, die Zukunft Voraussagen wollte. Wir leben noch heute, nach so vielen Jahren, unter dem Bann dieser Voraussage. Es ist vieles eingetroffen. Das ist das Furchtbare. Es klang zuerst alles so harmlos. Aber dann hat uns der Bann isoliert von Gott und allen guten Geistern. Und nun geht alles schief. Ich weiß nicht, was ich machen soll. – Aber ich wollte ja von Anfang an erzählen.
Es war im letzten großen Krieg. Ich war bei der Luftwaffe. Meine Frau, die ich damals noch gar nicht kannte, arbeitete als Luftwaffenhelferin auf einer Dienststelle. Dort war auch Herr Siebert dienstverpflichtet. Von ihm hieß es, dass er früher als Wahrsager tätig gewesen wäre. Niemand wusste so recht, was an dem Gerücht dran war.
Meine zukünftige Frau arbeitete also mit Herrn Siebert zusammen. Eines Tages war wieder Fliegeralarm. Sie saßen im Luftschutzkeller und hörten, wie draußen ein Bombenteppich auf die Stadt herniederging. Da fasste meine spätere Frau Herrn Sieben in ihrer Angst vor Tod und Untergang mit beiden Händen am Arm fest und fragte ihn, ob es stimme, dass er in die Zukunft schauen könnte. Und als er durch Kopfnicken bejahte, bat sie ihn um jeden Preis der Welt, ihr doch zu sagen, ob sie den Krieg und die Bomben überleben werde.
Herr Sieben wollte zuerst nicht, ließ sich dann aber doch erweichen und sagte, dass er keine Verantwortung für das übernehmen könnte, was er sehe und Voraussage. Er versank in einen merkwürdigen Trancezustand, sagt meine Frau, während draußen die Bomben dröhnten und krachten. Und unter dem Untergangsinferno der Stadt prophezeite Herr Siebert die Zukunft. Er sagte meiner Frau, dass sie einen Luftwaffensoldaten heiraten werde, der blond sei, blaue Augen habe und eben der zu jener Zeit verherrlichte Germanentyp wäre. Wir würden einen Sohn haben, sagte Herr Siebert. Er würde ein lockiges Kind sein, und es stecke Großes in ihm.
Danach komme eine dunkle Zeit. Er sehe in ein finsteres Rohr, das kein Ende freigebe. Dann, nach langem Warten und innerem Winden, sagte Herr Siebert, er sehe doch einen Ausgang, ganz weit weg, ganz in der Ferne. Da scheine die Sonne wieder. Es müsse das Rohr so etwas wie eine Zeit der Enge und Trennung und Finsternis sein, bevor endlich die Sonne wieder lache.
Während draußen die Welt im Bombenhagel unterging, wahrsagte Herr Siebert meiner Frau weiter. Wir müssten dem Kind freien Lauf lassen, dürften es nicht drängen und pressen. Es werde Großes in der Welt leisten. Und sein Vater werde später sein Manager und Reklamechef werden.
Dann würde uns ein Bombenloch angeboten, auf dem früher ein Haus sich erhoben habe. Das müssten wir kaufen und eine Fabrik darauf errichten. Es würde eine Goldgrube werden, auch wenn später ein anderer für uns das Gold dort scheffeln würde; denn ich wäre mit dem Sohn auf Reisen um die Welt. Großes stehe dann bevor.
Dann erwachte Herr Siebert, von dem meine Frau heute noch sehr ehrfürchtig redet. Und es gab einen furchtbaren Schlag. Eine Bombe war als Volltreffer eingeschlagen. Die Decke des Luftschutzkellers kam herunter und begrub Herrn Siebert unter sich. Er war buchstäblich von einem Eisenträger erschlagen worden. Das hatte er nicht vorausgesehen.
Meine Frau war ohnmächtig geworden und kam erst zu sich, als sie ins Lazarett eingeliefert worden war.
Dort hatte sie wochenlang Zeit zum Überlegen.
Dann setzte sie eine Zeitungsanzeige in der Rubrik Heiratsanzeigen auf und suchte damit den Mann, den Herr Siebert ihr beschrieben und vorausgesagt hatte. Dieser Mann war ich. Aber zunächst muss ich noch erzählen, dass meine Frau am Beerdigungstag des erschlagenen Wahrsagers einen furchtbaren Blutsturz bekam. Es dauerte lange, bis sie auf dem Weg der Genesung war. Ich las in Russland auf unserem Lufthafen, auf dem ich damals eingesetzt war, eine wochenalte Tageszeitung, die ich aus einem Päckchen herauskramte, in dem sie als Einwickelpapier Verwendung gefunden hatte. Meine Mutter hatte mir Heimatpost mit dem Päckchen zukommen lassen.