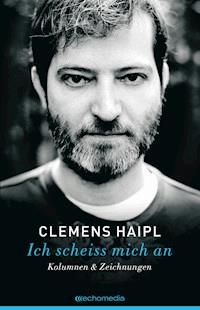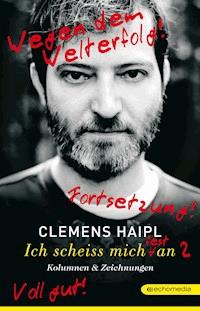Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Selbstfindung für Fahrzeughalter und Fußmüde: Clemens Haipl ist dann mal weg und bahnt sich seinen eigenen Jakobsweg Wer den Sinn des Lebens sucht, hat der bessere Chancen, wenn er zu Fuß geht? Und warum muss es Santiago de Compostela sein, wenn die St. Jakobs ums Eck auf der Straße liegen wie der Sand am Meer? Außerdem gibt es Jakobsmuscheln auch in Supermärkten, zumindest in der grenznahen Schweiz. Also macht sich Clemens Haipl auf den Weg und auf die Suche nach sich selbst, packt die Koffer, packt den Kofferraum, ein Mann der Großstadt mit dem Willen zum Einfachen und Wesentlichen: "Ein graubärtiger Vierzigjähriger in Fred-Perry-Polo am Volant eines Ersatzporsche, daneben eine junge blonde Dame mit Christian-Dior-Sonnenbrille, Evian schlürfend und Downbeat hörend." Dabei erlebt er allerhand Überraschungen, Enttäuschungen wie Offenbarungen, und gewinnt am Ende die Einsicht: Auch eine Muschel kann ein großer Fisch sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLEMENS HAIPLSIND WIR BALD DA?
Sind wirbald da?
Clemens Haiplsucht den Jakobsweg
Residenz Verlag
Mit freundlicher Unterstützung der
Kulturabteilung der Stadt Wien
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2010 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Covergestaltung: www.boutiquebrutal.comUmschlagbild: www.pertramer.at
ISBN ePub:
978-3-7017-4217-2
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1538-1
IM BASISLAGER
Ich habe ein E-Mail bekommen. Es hat mich über meine Website erreicht, die ich in dem mir eigenen Anspruch, alles alleine zu können, selbst gebastelt habe. Mit iWeb, dem Kinderspielzeugwebsitenmachprogramm von Apple, das jedem Fachmann einen Blick der Verachtung ins Gesicht zaubert. Ich versuche dann immer so zu tun, als wäre mir das egal, dass meine Website absichtlich so billig aussieht. Aber das ist etwa so, als versuchte man zu erklären, der Hosenschlitz sei absichtlich offen und der Schnittlauch auf den Zähnen genau so gewollt. Egal.
Ich wollte nie von IT-Fachleuten und Webprogrammierern geachtet und bewundert werden. Stimmt nicht, ich wollte eigentlich immer von allen Menschen geachtet und bewundert werden. IT-Fachleute und Webprogrammierer stachen dabei eben nicht besonders hervor. Ich muss jedenfalls damit leben lernen, dass ich es nicht allen Leuten recht machen kann. Radio, TV, Print, Kabarett, Musik (in drei Bands gleichzeitig, natürlich) und dann noch ein gemütlicher Kerl sein, der des Abends die Gastronomie in der Nachbarschaft gewissenhaft unterstützt ... das reicht irgendwie. Wenn ich jetzt auch noch anfange, Websites so zu programmieren, dass mich IT-Fachleute und Webprogrammierer achten und bewundern, dann könnte ich ein echtes Zeitproblem bekommen. Ich bin an sich sowieso schon nervös und mit dem Leben überfordert. Erhöhter Blutdruck ist vorhanden, und die Weltfinanzkrise trägt auch nicht zur Beruhigung der Gesamtsituation bei. Die bloße Tatsache, dass ich die letzten zwanzig Jahre aus eigener Kraft überlebt habe (und gar nicht mal schlecht: Es war immer Fleisch auf dem Tisch, die Urlaube waren dekadent und meinen Leib umschmiegen Damast und Seide), heißt nämlich nicht, dass ich die nächsten vierzehn Tage überleben werde. Also, es ist an sich schon wahrscheinlich, die Statistik spricht eindeutig dafür. Aber erklären Sie das einmal meinem neurotischen ... äh ... ja, wem eigentlich? Ist es mein neurotischer Kopf, mein Geist, mein Charakter, der mir Zukunftsängste macht? Mein Körper kann es ja schlecht sein, obwohl gerade der nervöse rote Flecken bekommt ... Ich weiß das alles nicht, vielleicht werde ich aber an anderer Stelle darauf zurückkommen.
Jedenfalls, ich habe ein E-Mail über meine Website bekommen. Das heißt, dass der Absender meinen Namen höchstwahrscheinlich gegoogelt hat. Es ist nämlich nicht sehr schwer, meine drei anderen E-Mail-Adressen herauszubekommen, wenn man sich ein bisschen in der sehr überschaubaren Wiener Medienszene umhört. Der Absender hat also meinen Namen gegoogelt (ich empfinde das als Kompliment) und mir geschrieben. Er sei von einem Verlag, und man würde gerne mit mir ein Buch machen.
Da schau einer an, ein Buch. Ja, das finde ich schön. Hat ein bisschen was Bleibendes. Bedeutsames. Wirkt nicht so billig wie Radio und TV-Sendungen, wird in den Kulturspalten respektvoller behandelt als Kabarett. Buchautoren wird automatisch unterstellt, dass sie gebildet und reflektiert sind und was weiß ich noch alles. Dass die meisten einfach verhaltensauffällig sind und Bücher schreiben, weil sich niemand mit ihnen beschäftigen will außer dem geduldigen Textverarbeitungsprogramm, in das sie dann völlig unwidersprochen hineinhämmern ... das, das wird nicht oft bedacht. In jedem anderen Gewerbe würde man solche Menschen als Koffer bezeichnen (okay, die zahlreichen zugeschalteten Leser aus dem Ausland können das Wort »Koffer« auch durch »Depp« oder »Idiot« oder »Vollidiot« ersetzen), im Kultur- und Literaturbetrieb gilt es aber schon als Auszeichnung, mürrisch, menschenfeindlich und schwierig zu sein. Wer viele As und Äs in Gespräche einbaut, vermittelt den Eindruck, sein Kopf platze vor Gedanken, und die Sprache komme eben nicht nach. Und selbstverständlich kann man sich auch ein paar Suppennudeln in den Fünftagebart drapieren. Leichte Verwirrtheit wirkt ja so sympathisch.
Fürchterlich.
Selbstredend finde ich den Gedanken, ein Buch zu schreiben, trotzdem hervorragend. Wie gesagt, ich will ja geachtet und geliebt werden. Ein Autor zu werden, schrullig und versponnen zu sein und dabei noch als intelligent zu gelten, erscheint mir als ein guter neuer Weg. Das mit dem Webprogrammieren kann ich später ja immer noch machen.
»Sind wir bald da?« soll der herzustellende Klassiker heißen, wie ich dem E-Mail-Verkehr entnehme. Aha, warum nicht? Zielt wohl ein bisschen auf das leicht infantile Image, das ich in der Öffentlichkeit habe und an dem ich nicht ganz unschuldig bin. »Sind wir bald da?« soll von Ortschaften handeln, die St. Jakob heißen. Ich soll sie mir ansehen und berichten, ob ich dort oder auf dem Weg dorthin irgendeine Form der Erleuchtung gehabt habe. Aha. Und dass das alles ein klein wenig nach Jakobsweg klingt, ist natürlich eine kleine Verrücktheit und bringt den nötigen Humor in die ganze Geschichte. Finde ich tadellos. Es wird nur schwierig sein zu erklären, dass dieser Klassiker der Weltliteratur nicht etwa ein Versuch ist, kaum acht Jahre nach Hape Kerkeling auf den Zug aufzuspringen. Auch, dass das Buch nicht als bloße Verarsche oder Satire gedacht ist. Was es ist, weiß ich nicht, ich habe es ja noch nicht geschrieben. Oder wissen Sie, was in Ihrem Leben in zirka zwei Monaten passiert sein wird? Ja? Ich beneide Sie. So viel Ordnung und Planung, alle Achtung. Da möchte man neidisch werden. Nein ... Scherz, natürlich nicht! Voll ure fade finde ich das, Spießer, elendiglicher.
Okay, ein kleines bisschen neidisch bin ich. Aber nicht sehr.
So.
Stimmt schon, Selbsterkenntnis, Erleuchtung und, generell gesprochen, alle Formen von Maßnahmen, die das Leben erleichtern, sind im Trend. Seit zirka zehntausend Jahren. Weil zur Zeit weniger Menschen in die Kirche gehen, gehen halt mehr auf den Jakobsweg oder zum Psychotherapeuten. Oder beides. Kinesiologie, Akupunktur, Shiatsu usw. usf. Aus der Konkursmasse der katholischen Kirche ist einiges zu holen. Das eine oder andere habe ich selbst probiert. Ob es geholfen hat? Ich glaube schon. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Sie schon? Aha, da haben wir es wieder, die Klugscheißer unter den Lesern. Ich merke mir das, keine Sorge ... (Auf Facebook gibt es eine Gruppe Menschen, die Sätze gerne mit »...« beenden. Ich bin beigetreten.) Egal.
Statistisch bin ich in der Mitte meines Lebens angelangt, habe aber nicht das Gefühl, die Hälfte zu wissen oder verstanden zu haben. Ich bin – ein Suchender! (An dieser Stelle setzen Streicher ein und das Bild wird unscharf. Die Sonne geht unter und ein Einhorn will von mir gefüttert werden. Ich denke an das »Füttern verboten!«-Schild im Zoo und foppe das Fabelwesen mit meiner flachen, leeren Hand. Ätsch!) Gründe hätte ich genug, mich den Tausenden von Pilgern anzuschließen, die den beschwerlichen, Segen bringenden Weg nach Santiago de Compostela auf sich nehmen. Die Meter für Meter auf ihren wunden Füßen bewältigen, erhellende menschliche Begegnungen haben, die Natur und dann auch gleich sich selbst neu kennenlernen. (Und dann ein Buch schreiben und in Talkshows auftreten und ordentlich Kohle abschöpfen.) Ich bin aber zu faul. Das liegt möglicherweise am mangelnden Leidensdruck. Man verändert ja immer nur dann etwas in seinem Leben, wenn die Alternative, also nichts zu verändern, noch unangenehmer ist. Was der Sinn des Leben ist und wie man glücklich wird ohne Lottogewinn und schönem Wetter, das wüsste ich aber schon alles sehr gerne.
DONNERSTAG, 30. APRIL
Ich beginne jetzt also zu schreiben.
Ha! Gar nicht wahr. Hätte ich nicht schon viel früher begonnen zu schreiben, wären die Seiten davor ja leer. Blättern Sie ruhig zurück, nur zu. Überprüfen Sie das, ich habe nichts zu verbergen.
Und?
Eben.
Man kann das Glücknicht erzwingen,und vielleicht ergibtsich ja an einemanderen Tag eineLösung.
Clemens Haipl
Ich habe mir also im Internet zusammengesucht, wie viele St. Jakobs infrage kommen. Inklusive Südtirol 16. In Worten, sechzehn! Da gehe ich nicht überall zu Fuß hin, kommt gar nicht infrage. Bin ja nicht mein eigener Feind. Wenn der Sinn des Lebens wäre, sich selbst zu quälen und zu kasteien, wäre das ein Totschlagargument für Suizid. Menschen, die glücklich sind oder wenigstens den Neid ihrer Mitmenschen schüren, wirken ja nicht gerade so, als müssten sie sich dafür wahnsinnig anstrengen. Dalai Lama, Bill Gates, Pamela Anderson, Udo Jürgens etc. Das muss auch anders gehen. Ich werde also mit der Bahn fahren oder mit dem Auto. Führerschein habe ich. Spät gemacht (ich glaube, mit 32), aber er gehört mir noch immer. Steht ja auch mein Name drauf, deswegen. (Schöne Vorstellung: Jeder Polizist, der einen Führerschein einzieht, darf diesen auch behalten und seinen Namen hineinschreiben. Besonders erfolgreiche Polizisten hätten dann so an die zehn, zwanzig Führerscheine und könnten bis an ihr Lebensende besoffen Auto fahren, weil sie immer genug Scheine hätten. Funktioniert im Prinzip wie der Geldverkehr. Geld wird nicht weniger, es gehört nur immer wem anderen. Jetzt ersetzen Sie »Geld« durch »Führerscheine« und Sie wissen, was ich meine.)
Heute bin ich auf der Suche nach dem ewigen Glück im Gastgarten eines Lokals im zweiten Bezirk von Wien zu sitzen gekommen. Ich wollte meinem Körper Sonne zuführen, auf dass die von Zukunftsängsten geschürten roten Flecken weniger werden. Quasi Sonnenflecken. Ich bin die Sonne, wenn man so will. (Und jetzt singen alle »Hier kommt die Sonne« von Rammstein ... na ja) Am Nebentisch sitzt eine adrette junge Dame mit drei nicht ganz so adretten, aber immer noch nett anzusehenden Herren, die ganz augenscheinlich in der Fernsehbranche tätig sind. Ich rieche so etwas, habe selbst lange genug in dem Gewerbe mein Unwesen getrieben. Sie, das habe ich schnell erkannt, ist eine bekannte Wetteransagerin (wie schön, das passt dazu, dass ich gerade die Sonne suche), und ihre Begleitherren sind Redakteure. Also Menschen, die nichts Wichtiges zum Gelingen einer TV-Sendung beitragen, aber sehr bemüht sind, ihre eigene Stellung als unentbehrlich zu manifestieren. Das ist ihre primäre Aufgabe. Keiner weiß genau, was TV-Redakteure machen, aber man ist sich einig, dass sie wichtig sind. Weil es genau das ist, was sie machen: wichtig sein. Ich höre ihnen zu und bin hellauf begeistert. Sie besprechen Banalitäten mit einer Inbrunst, die glauben macht, es ginge tatsächlich um etwas.
A: »Mir ist wichtig, dass wir das jeden Montag machen.«
B: »Ja, aber mir wäre recht, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit in das Ganze kommt.«
C: »Ich gebe zu bedenken, dass das genau das Problem war, das wir früher hatten: Es war kein System im Sendungsablauf.«
Sie (die Wetterschöne): »Also, von mir aus. Aber ich sage gleich, dass ich das nur machen kann, wenn es ... wie soll ich sagen? ... nicht willkürlich, sondern ... äh ...«
A: »Wöchentlich?«
B: »Regelmäßig?«
Sie: »Ja, genau, wenn es so ist. Das sage ich gleich.«
Danach angestrengte Blicke, leicht bitteres Schweigen, und alle konzentrieren sich darauf, eine Lösung für diesen Existenz bedrohenden Interessenkonflikt zu finden. B blättert in seinen Unterlagen, um sich zu beruhigen, weil man fürchten muss, er würde sonst explodieren. A verengt seine Augen und wirkt wie Rambo, kurz bevor er mit der Kraft der Verzweiflung über eine sehr tiefe Schlucht springt, weil das der einzige Weg ist, die Welt zu retten. Die Augen von C sagen: »Wir werden alle sterben«, und die Wetterschöne ist schon etwas weniger schön.
Am Ende beschließen sie, das Thema zu vertagen. Man kann das Glück nicht erzwingen, und vielleicht ergibt sich ja an einem anderen Tag eine Lösung. Sieht aber jedenfalls nach einem arbeitsreichen Wochenende aus. Als die vier zahlen, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass hier die wirklich wichtigen Dinge angepackt werden, und dankbar, dass diese verantwortungsvolle Last nicht auf meine schmalen Schultern drückt.
Ist es möglich, den Jakobsweg nur in Gedanken zu beschreiten? Führt der Weg zum Glück am Nebentisch vorbei?
Jetzt setzen sich vier männliche Wesen um die fünfzig neben mich. Die Tatsache, dass sie Kleidung tragen, lässt keinen Zweifel daran, dass es keine Affen sind. Ansonsten hätte ich auf die Schnelle keine Indizien dafür entdeckt. Sie atmen, grunzen, rülpsen und unterhalten sich über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Wein und Bier. Sie wirken aber sehr bei sich und glücklich. Vielleicht sollte ich mich als Naturfilmer ausgeben und mich in einem Glas Bier verstecken, um zu erforschen, wie sie leben. Vielleicht reicht auch ein Umhang in Bierfarbe, unter dem ich mich verstecken kann, mit einem winzigen Loch für meine Kamera. Und dann beginnt natürlich das Warten. Das sieht man dann ja nie in der fertigen Tierdoku, aber Warten ist das kleine Einmaleins der Naturfilmer. Vielleicht verkleide ich mich auch als Aschenbecher oder als Maggiflasche. Für gute Bilder tue ich alles. Irgendwann werden sie schon Vertrauen zu mir fassen, ich werde Mitglied ihrer Horde und ihre Sprache lernen. Gorillas im Alkoholnebel. Schön.
Ich habe dann aber doch beschlossen, nach Hause zu gehen, um die Blumenkistchen an den Fenstern neu zu bepflanzen.
Nicht etwa, wie man vermuten könnte, mit Jakobsblumen, sondern mit Tagetes. (Ein verheerender Fehler! Saufen Wasser in Massen und werden riesig.) Die gelbe Jakobsblume (oder Jakobskraut) ist ein Heilkraut und die Nationalblume der Isle of Man. Dummerweise ist sie giftig, sie schädigt die Leber und wird deswegen von Landwirten nicht gerne gesehen (außer wenn sie gerade der Meinung sind, zu viel Vieh zu besitzen). Sehr beliebt hingegen ist das Jakobskraut bei den Raupen des Jakobskrautbären, einem hochattraktiven, rotschwarzen Nachtfalter. Die Raupen sind schwarzgelb (machen einen auf Wespe) und werden für ihre Fressfeinde giftig, wenn sie Jakobskraut fressen. Nicht blöd!
Es gibt übrigens ein St. Jakob (das im Walde in der Steiermark), das wiederholt zum schönsten Blumendorf der Steiermark und einmal sogar zum schönsten Blumendorf Europas gewählt worden ist. Von den vielen zweiten Plätzen im Landesblumenschmuckwettbewerb gar nicht zu reden. »Respect!« und »Shout out!«, wie wir Hip-Hopper da zu sagen pflegen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer wie und warum den Bewerb zum schönsten Blumen dorf Europas ausrichtet und nach welchen Kriterien so etwas funktioniert. Wie eine Misswahl kann es wohl nicht sein. Schon allein deswegen, weil sich ganze Dörfer schlecht in einer Landdisco treffen können, um dann vor besoffener Landjugend und teilerregter C-Promijury über den Laufsteg zu wackeln. Schon gar nicht in Blumenschmuck. Oder gibt es da geheime Tester? Wie beim Gault Millau? Also auffällig unauffällige Herren mit Hut und Sonnenbrille, die sich als Touristen auf der Suche nach Landfrische ausgeben, aber in Wahrheit Tester sind? Geschickt von der Stiftung für Blumen und Schmuck in Berlin? Verschwiegene Einzelgänger, die nicht einmal ihren Familien erzählen, was sie beruflich wirklich machen? Weil es einfach zu riskant wäre und die Sache gefährden könnte? Die Suche nach Europas schönstem Blumendorf. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben auch nur die Leser der Zeitschrift Der gute Blumenschmuck abgestimmt. Alle elf Abonnenten haben ihre Stimme abgegeben, und St. Jakob im Walde hat eben gewonnen. Sie merken, es gibt viele Mysterien, wenn man sie nur finden will.
Zurück zu meinen Fensterkistchen. Die Zwiebeln und Samen, die ich einige Wochen davor verscharrt habe, sind unwiederbringlich verloren und denken nicht daran, in Form von Pflanzen mein Leben zu verschönern. Vielleicht habe ich auch besonders neidige Nachbarn, die sich nächtens vom Dach unseres fünfstöckigen Zinshauses abseilen, um heimlich Tulpenzwiebeln aus meinen Fensterkistchen auszugraben. Weil sie mir das bunte Glück blühender Tulpen nicht gönnen. Man kann und sollte nie irgendetwas ausschließen, ich gebe aber schon zu, dass diese Möglichkeit sehr unwahrscheinlich ist.
Als ich dann dabei war, nach Hause zu gehen, hat mein sehr schickes Telefon (die Marke, die so ähnlich heißt wie »Birne«, nur auf Englisch!), geläutet. Xaver war dran und hat gemeint, er wäre in der Gegend und hätte gerade Lust auf ein Bier. Oder zwei. Oder drei. Xaver wohnt um die Ecke und hat eigentlich immer Lust auf zwei Bier. Oder mehr. Insofern keine große Überraschung. Und weil ich einer jener Menschen bin, bei denen der Geist so schwach ist wie das Fleisch, habe ich sofort zugesagt. Vor die Wahl gestellt, den Weg zu meinem inneren Glück zu suchen, Fensterbänke zu bepflanzen oder Bier zu trinken, entscheide ich mich meistens für Letzteres. Eigentlich immer. Darum verunsichern mich Wein und Bier viel weniger als Dinge wie ... ja ... also, eben Dinge wie Jakobsweg, Therapie, Professional Coaching und das ganze Zeugs. Weil ich mehr Zeit darin investiere. Eigentlich dumm. Aber man sagt, dass man nie aufhört zu lernen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil wenn man das ganze Wissen seiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern usw., wenn man das alles dazunähme und dann vielleicht auch noch ein paar Reinkarnationen (Natürlich gibt es die, dem Universum ist ja nicht fad. Warum sollte es also dauernd neue Menschen erfinden, wenn es schon tote gibt, die man nur zu reinkarnieren braucht.) ... also, wenn man das alles zusammennimmt und dann den lächerlichen Kleinscheiß addiert, den man in seinem eigenen Leben gelernt hat, dann müssten lauter unfassbar weise Menschen herumlaufen. Tun sie aber nicht.
Der Kleinscheiß, den ich bisher in meinem Leben gelernt habe:
Außerdem habe ich gelernt: Im Nachhinein ist alles immer viel weniger schlimm. Wenn man von etwas überzeugt ist, dann sind es bald auch alle anderen. Problem: Warum sind so viele Vollidioten von sich und ihren Ideen überzeugt?
Schließlich kann ich einigermaßen mit einer Nähmaschine umgehen, Sequencer programmieren und Blockflöte spielen. Blockflöte spielen kann freilich jeder Pfosten. Die Existenz von Flötenlehrerinnen ist – abgesehen davon, dass sie meist sehr nette und angenehme Menschen sind – völlig unnötig. Wenn jemand nicht Blockflöte spielen kann, sollte man überprüfen, ob er oder sie atmen, zu Fuß gehen und sich den Hintern auswischen kann. Oder ob er oder sie vielleicht nicht doch ein Cyborg ist. Oder ein Tisch. Oder ein Philodendron. Also Lebensformen, bei denen man zu Recht davon ausgehen kann, dass sie nicht Blockflöte spielen können. Bei Menschen akzeptiere ich das nicht.
Jedenfalls bin ich dann mit Xaver in unser Stammlokal gegangen und habe versucht, Hirn, Augen und Ohren voneinander zu trennen. Ich muss das machen, wenn ich mit Xaver unterwegs bin. Würde ich Ohren und Hirn nicht entkoppeln, müsste ich über den ganzen Wahnsinn nachdenken, den er mir erzählt. Und wären meine Augen weiter mit meinem Hirn verkabelt, könnte ich nicht scheinbar auf ihn reagieren und zugleich am Telefon meine Facebook-Einträge abfragen. So aber wackelt mein Kopf in periodischen Abständen wie bei einem Wackeldackel, mein Mund sagt hin und wieder: »Ah ja, jaja, soso«, und meine Augen und Ohren checken Facebook und E-Mails, während mein Hirn ganz woanders ist. Meistens dabei, sich Sorgen zu machen und zu überlegen, wie ich am besten, einfachsten und dauerhaftesten die Weltherrschaft, Ruhm, Reichtum und große Zufriedenheit erringen könnte.
Das ist, wie Sie sich unschwer vorstellen können, sehr anstrengend, und nicht zuletzt deshalb würde ich gerne damit aufhören.
FREITAG, 1. MAI
Ich bin heute das erste Mal seit Jahren nicht vom Mai-Aufmarsch geweckt worden. Die letzten ihrer Art marschieren jedes Jahr am 1. Mai durch die Straße, in der ich wohne und spielen dann am Rathausplatz »Moskau, roter Platz 1976«. Früher dachte ich immer, das sei eine Art Faschingsumzug. In etwa so wie bei den Amerikanern, die in Originalkostümen die Schlacht von Gettysburg nachstellen. Oder wie die Niederösterreicher, die sich gerne wie römische Legionäre aus Carnuntum verkleiden. Mein Gott, warum nicht? Ich verkleide mich ja auch gerne. Und wenn man dann noch einen Haufen Gleichgesinnte hat, mit denen man frei von jedem falschen Schamgefühl Rollenspiele machen kann, bevor man sich betrinkt ... Würde mir auch gefallen. Jedenfalls dachte ich früher immer, dass das am 1. Mai am Rathausplatz so ähnlich funktionieren würde. Dicke Männer mit grauen Haaren, die rote Nelken halten und laut schreien. Das hat mich an die Nachrichten aus meiner Kindheit erinnert, an Breschnew und Andropow. Also habe ich geglaubt, die machen so etwas Ähnliches wie die Herren, die in Niederösterreich als römische Legionäre gehen.
Jedenfalls haben die Lauser mich heute nicht aufgeweckt. Gegen halb neun in der Früh marschieren sie normalerweise lärmend an meinem Fenster vorbei. Vielleicht war ich zu betrunken und habe sie deswegen nicht gehört. So gesehen müsste ich Xaver dankbar sein, dass ich wegen seiner Verführungskunst den Einmarsch der Roten Armee verschlafen habe. Auch nicht schlecht.
Ich schreibe mir auf Post-it-Zettelchen gerne auf, was ich an einem Tag zu erledigen gedenke. Natürlich ist das immer viel zu viel. Wenn ich es aber nicht tue, erdrückt mich das Chaos und das schlechte Gewissen quält mich, dass ich nichts weiterbringe. Wenn ich es tue und alles gewissenhaft aufschreibe, dann quält mich freilich das schlechte Gewissen, nicht einmal einen Bruchteil des Pensums abgearbeitet zu haben, und die schiere Masse an Erledigungen, die es theoretisch gibt, erdrückt mich. Die Erkenntnis, was ich alles nicht erledigen kann – an einem Tag, einer Woche, nicht in einem Leben –, die ist sehr niederschmetternd. Immer wieder. Weil das alles so erdrückend ist, habe ich vermutlich sehr schlechten Stuhlgang gehabt.
Na ja, ich schreibe also auf einen gelben Post-it-Zettel, was ich so alles vorhabe: ein TV-Konzept fertig ausarbeiten, eine Zeichentrickserie erfinden und fertigstellen, zwei Bands produzieren, einen Cartoon für eine Zeitung konzipieren und schreiben, ein Theaterstück schreiben, an die Sonne gehen, für meinen inneren Frieden sorgen, ausgeglichener werden usw. Um es kurz zu machen: Ich bin mit meinen Vorhaben wieder einmal grandios gescheitert.
Vielleicht war es doch zu viel für einen Tag. Ich sollte mir vielleicht weniger vornehmen oder kleinere Dinge, dann sind die Erfolgserlebnisse größer. Schuhe binden. Oder Zähneputzen. Einen Tee trinken und Blumen gießen. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich an einem Tag erledigen könnte.
Ich habe immerhin ein Lied aufgenommen. Ist ja auch der Tag der Arbeit, da kann man Fünfe auch mal gerade sein lassen. Ansonsten surfe ich ausgiebig im Internet, checke E-Mails und programmiere sehr viel Musik. Wenn ich nicht genau wüsste, dass es nicht stimmt, könnte ich glauben, ich sei Musikproduzent und Computertechniker. Irgendetwas läuft da falsch.
AUSSERDEM
Ich habe per E-Mail zugesagt, bei einer Benefizgala für Immigranten aus Afrika aufzutreten. Nicht weil ich glaube, dass ich nicht schon genug mache, oder weil ich mich für einen besonders guten Menschen halte, nein: Ich soll etwas zum Verlosen hergeben. Weil ich nichts habe, was fremde Menschen gerne in einer Tombola gewinnen würden, habe ich versprochen, eine Rolle in meinem nächsten Buch zu verlosen. Mal sehen, wer gewinnt. Außerdem: Wenn ich mir schon Gedanken mache, wie man die innere Mitte findet, Weltfrieden und Glück erlangt, dann ist so eine Benefizgala, wo den Beteiligten vor lauter Gutheit das Wasser in den Augen steht und wo der Speichel in Strömen fließt, sicher keine schlechte Inspiration. Karmapunkte sammeln und so.
Am Abend dann Essen in einem Lokal für etwas bessere Leute außerhalb von Wien. Meine Schwiegermutter hat einen Geburtstag, den es zu feiern gilt. Für gewöhnlich lässt man zu solchen Anlässen einen durchschnittlichen Mittelklassewagen in der Küche irgendeines Nobelrestaurants. Und ich muss zugeben, obwohl ich mir selbst nie einen solchen Gourmettempel leisten würde – meistens schmeckt es tatsächlich beeindruckend.
Diesmal beeindruckt das Lokal der Wahl mit der Mitteilung in der Speisekarte, dass einmal im Monat nach original antiken römischen Rezepten gekocht wird. (Ha, ein Zeichen! Die Römer haben schließlich den hl. Jakob geköpft.) Heute leider nicht. Schade, ich hätte gerne gewusst, was man fachgerecht isst, wenn man Gladiatoren dabei zusieht, wie sie mit Schwertern Gedärme umrühren, während mir eine germanische Sklavin Luft zufächert.
Die Enttäuschung verblasst aber neben der grenzenlosen Begeisterung über die sagenhaft unfreundliche Chefin. Tadellose Optik, Stil »Internatsoberin«. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass man als Gast ausgesprochen ungebeten ist. Dass man einen Tisch für acht Personen reserviert hat, ist ihr unendlich egal. Ihre Stimme hat die Lautstärke und die Bestimmtheit einer Antiterroreinheit am Megafon (»Ergeben Sie sich, das Haus ist umstellt!«) und ihre Hantigkeit wird nur mehr von ihrer augenscheinlichen Eitelkeit übertroffen. Am Weg zur Toilette hängen gut einsehbar Urkunden und Fotos mit niederösterreichischen Lokalpolitikern. Ein recht bekannter Architekt, der