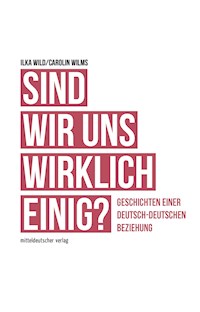
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
30 Jahre Wiedervereinigung – was uns Deutsche eint, was uns trennt Eigentlich scheint die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte zu sein. Doch wie weit sind die beiden Teile Deutschlands drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung wirklich zusammengewachsen? Warum wird immer noch auf OST oder WEST abgestellt, als handle es sich um schwerwiegende Vorerkrankungen, auf die Rücksicht zu nehmen ist? Das (ost-)deutsch-(west-)deutsche Autorinnenduo Ilka Wild und Carolin Wilms spürt den alltäglichen Herausforderungen der Wiedervereinigung in ebenso unterhaltsamen wie informativen Texten nach. Durch fundiertes Faktenwissen und die persönlichen Beobachtungen der beiden Journalistinnen ist ein sachliches und dennoch empathisches Zwischenfazit entstanden – beide sind durch langjährige Lebens- und Arbeitserfahrung jeweils in Ost und West geprägt. Anhand von Themenkreisen wie Mauerfall, Alltag bis Berufswahl, Karrieremöglichkeiten und – ganz aktuell – COVID-19-Pandemie zeigen die Autorinnen die regionalen Unterschiede auf, die aufgrund der verschiedenen Sozialisationen bis heute nachwirken oder allmählich verschwimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Buch findet das generische Maskulinum dort Verwendung, wo nicht explizit zwischen den Geschlechtern unterschieden werden soll.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek registriert diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten im Internet unter https://dnb.de.
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage
© 2021 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale) www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-521-9
Vorwort
Wie habt ihr das gemacht? – How did you guys do that? Diese Frage stellten uns ausländische Freunde, Kollegen, ja Taxifahrer auf der ganzen Welt, wenn es um die deutsche Wiedervereinigung ging. Von außen betrachtet scheint die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte zu sein. Aber welche Antwort sollten wir geben? Besonders, wenn wir uns gar nicht sicher sind, ob das Land zusammengewachsen ist?
Und so haben wir – Ilka Wild aus Thüringen und Carolin Wilms aus Bremen – begonnen Alltagsbeobachtungen nachzuspüren, wie die früheren „Klassenfeinde“ nach 30 Jahren mit der Situation des „doppelten Lottchens“ umgehen.
Wir blickten genauer auf die Situationen, die uns in eben diesem Alltag auffielen, und stellten fest, dass vieles – so auch Missverständnisse – oft sinnbildlich für das Ganze steht. Zunächst haben wir uns auf eine Zeitreise begeben und uns an die Ereignisse in Ost und West erinnert, die letztlich die „Verbrüderung“ begleiteten: Das Kapitel „Wahnsinn“ zeichnet nach, was synchron im Osten los war, als der Westen noch ahnungslos schlummerte.
Dabei wurde uns klar, dass der Osten den Westen schon immer besser kannte, weil das andere Deutschland vielleicht nicht gerade Sehnsuchtsort war, dafür aber Jacobs Kaffee und Meinungsfreiheit hatte, die man im Osten eben nur im West-Fernsehen gesehen hatte. Dass ein Einfamilienhaus, wie es die Familie Schuhmann in einer ZDF-Serie bewohnte, nicht der westdeutsche Standard war, merkten viele erst, als die Realität nach der Wende zubiss.
Also versuchten wir, vor allem den Osten zu erklären: Ilka Wild als geborene Ossi mit West-Erfahrung und Carolin Wilms als zugezogene Wessi.
Als nach der Flüchtlingskrise Pegida in Dresden aufmarschierte, Ausländer und Journalisten in Chemnitz angegriffen wurden und große Stimmengewinne der AfD bei Bundes- und Landtagswahlen im In- und Ausland für Entsetzen sorgten, schien sich die Kluft abermals zu vergrößern. Wir Journalistinnen mit Sitz in Leipzig fragten uns um so mehr: Verstehen wir uns?
In den Kapiteln, die wir gemeinsam und einzeln geschrieben haben, wollen wir Wissen zusammentragen, um einen Beitrag zum deutsch-deutschen Zusammenwachsen zu leisten:
Was etwa Heimat für jede von uns bedeutet, beschreiben wir im gleichnamigen Kapitel.
Warum das Interesse am Osten bei manchen Wessis so verhalten ist, fragt sich Ilka Wild in „Arm, aber trotzdem nicht sexy“. In welcher Weise hallt die Diktatur noch nach? War es damals schöner? „Ostalgie, verlass mich nie“ heißt ein Kapitel, in dem sich Ilka Wild wundert, warum die seinerzeit verhassten DDRProdukte heute eine solche Renaissance erfahren. In „Schmuddelecke Diktatur“ schreibt Carolin Wilms, dass sie die Skrupellosigkeit derer abstößt, die früher ihre eigenen Mitbürger ausspioniert und gequält haben, sich aber heute munter unter das Volk mischen. Dass auch das Erinnern in beiden deutschen Staaten über viele Jahre ein anderes war, und was das mit unserem Geschichtsverständnis heute zu tun hat, erläutert Carolin Wilms im Kapitel „Erinnerungskulturen“.
Warum Vornamen heute noch als Kompass taugen, erklärt Ilka Wild, und dass wir eigentlich viel voneinander lernen können, wenn wir die Perspektive des anderen der eigenen gegenüberstellen und dadurch relativieren, beschreibt Carolin Wilms in ihrem Text „Ost-westliche Transzendenz“.
Dabei waren wir nicht immer einer Meinung. Wir haben einiges kontrovers diskutiert und kamen zur Frage: Sind wir uns wirklich einig?
Uns wurde bewusst, dass wir nicht die eine, richtige Antwort haben, vielmehr wird es fast 83 Millionen Antworten geben. Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass, allen Unkenrufen und Spaltungsversuchen zum Trotz, nun eine Einheit entsteht, mit der, bei Licht betrachtet, auch nicht früher zu rechnen war.
Denn die ununterbrochene Diktaturerfahrung von über 50 Jahren sowie die Abschottung durch die Mauer wirken – wen wundert es – auch 30 Jahre später nach. Zwei aktuelle Studien haben zuletzt wieder gezeigt, dass der Osten mit Blick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, Akzeptanz von Diversität und Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland deutliche Unterschiede zum Westen zeigt.
Die Diktatur in der DDR hat sich mit deutscher Gründlichkeit stark auf das tägliche Leben ausgewirkt und manchmal hat es das Regime so sehr übertrieben, dass es unfreiwillig komisch wurde. Um darüber aber wirklich lachen zu können, braucht es Verständnis und Kenntnis über den anderen.
So einfach verwachsen ein System und seine Folgen nicht, Erfahrungen werden an die nachfolgenden Generationen in unterschiedlicher Weise weitergegeben. Auch Millennials tragen das Erbe der Diktatur und die Folgen der Transformation in ihrem Gedächtnis. Aber: Sie haben sie eben nicht in ihrer DNA; die DDR wird irgendwann nur noch etwas sein, das man aus dem Geschichtsbuch oder aus Omas Erinnerungen kennt. Und so haben wir uns herangetastet, haben unsere Beobachtungen und Eindrücke aufgeschrieben und versucht, dahinter zu blicken.
Denn – wenn wir es schon nicht verstehen, wie sollen wir es unseren Freunden in Taiwan und Mexiko erklären können?
Ilka Wild und Carolin Wilms
Leipzig, im November 2020
Inhalt
Einführung
Wie soll es weitergehen?
Wo geht die Reise hin?
Eine Zeitreise
Wind of Change
Wahnsinn! Der Mauerfall
Blühende Landschaften?
1995 bis heute: Der Osten wird ein neues Land
Tägliches Leben
Erinnerungskulturen
Mandy oder Magdalena: Wo der Vorname zum Kompass wird
Vom Wagnis, ein Qualitätsprodukt zu kaufen
Ostalgie, verlass mich nie
Ost-westliche Transzendenz: hüben und drüben
Hausfrau, Mutter, Karrierefrau
Kinder laufen einfach mit
Augen auf bei der Berufswahl!
Karriere im Quoten-Osten
Steht sich der Ossi selbst im Weg?
Unsere Ossis – alles nur eine Frage der Zeit?
Arm, aber trotzdem nicht sexy
Lieber Gott, erhalt mir mein Klischee!
Heimat?
Trautes Heim, Glück allein?!
Heuschreckenplage im Osten
Siedler: Auf zu neuen Ufern – in Ost und West
Reizempfindlichkeit: Subventionitis im Osten damals und heute
Vorsicht, Propaganda!
„Fidschi“ & Co. in einem Land von Welt
Altlasten gestern und heute
Wie wollen wir über die DDR sprechen?
Schmuddelecke Diktatur
Die Sprache der DDR
Wenn die Stimmen flöten gehen
Aktuelles
Corona, Corona
Glossar
Die Autorinnen
Wie soll es weitergehen?
Von Carolin Wilms
Einige Zeit bevor wir nach Leipzig zogen, hatten wir im USBundesstaat Michigan gewohnt. Meine zweite Tochter kam dort zur Welt. In Amerika fühlte ich mich nicht ansatzweise so fremd wie später in Leipzig: Außer der Sprache, der Zeitverschiebung und der Notwendigkeit, von Celsius in Fahrenheit und von Metern in Yard umzurechnen, war eigentlich in Michigan alles wie zu Hause: leben und leben lassen. Die Menschen waren offen, es schlug uns kein Neid oder keine Missgunst entgegen, sondern eher freundliche Gleichgültigkeit.
In Leipzig hingegen, in meinem eigenen Land, fühlte ich mich zeitweise wie eine Außerirdische, die irgendwo im All falsch abgebogen war. Während mich in den USA die Leute nett fragten, woher ich kam und was mich an diesen Ort verschlagen hatte, erlebte ich in Leipzig zunächst eisige Ablehnung. Offenkundig war klar, dass ich aus dem Westen kam und irgendwie sollte ich dafür büßen. Besonders offensichtlich wurde das beim Autofahren. Wir hatten damals zwei Fahrzeuge mit Leipziger Kennzeichen zur Verfügung: einen verkratzten Toyota und einen Firmenwagen von einer deutschen Premiummarke. Ich fuhr jeden Tag dieselbe Strecke, je nach Umstand mit dem einen oder dem anderen Fahrzeug. Fuhr ich mit dem Toyota, geschah Folgendes: Die anderen Verkehrsteilnehmer ließen mich vor; als ich mich einmal verfahren hatte, klopfte sogar eine Frau an die Scheibe und fragte, ob sie mir helfen könne; ein Mann machte mich an der Ampel stehend darauf aufmerksam, dass meine TÜV-Plakette abgelaufen war. Alle waren freundlich. Ich war mit meinem Auto offenbar ein automobiler Underdog und damit eine von ihnen. Fuhr ich aber mit der vermeintlichen „Bonzen-Karre“, hatte ich keine Freunde mehr auf der Straße: Keiner ließ mich vor, man schnitt mich, wo immer es ging, und helfen wollte mir schon gar keiner. Die Wahl des Autos fiel somit nicht schwer, aber der schale Beigeschmack des mehr als offenkundigen Sozialneids meiner neuen Mitmenschen machte mich nachdenklich.
Diese Befindlichkeit konnte ich auch bei einer Autorenlesung von Holger Witzel in einer Leipziger Buchhandlung erleben, bei der dieser aus seinem Buch „Schnauze Wessi“ vorlas. Die Veranstaltung war bis auf den letzten Platz ausverkauft, und die intendierten Schenkelklopfer entfalteten ihre volle Wirkung: Der Wessi wurde angepasster dargestellt als es alle Ossis im Kollektiv jemals waren. Ich fand seine Sicht der Dinge teils erfrischend, andererseits fragte ich mich nach mehreren Kapiteln und beim Betrachten der Anwesenden, warum etwa die Frauen in Hamburg nicht zum Friseur gehen sollten? Ist ein gepflegtes Äußeres wirklich von Nachteil, über das er sich glossierend äußerte? Mulmig wurde mir zumute, als sich die innere Dynamik der zumeist älteren Zuhörer dahingehend entwickelte, dass sie den Autor baten, ihre Lieblingskapitel vorzulesen, in denen es polemisch um die Selbstgerechtigkeit und den Egoismus des Wessis ging. Der Autor schien den Leipziger Zuhörern aus der Seele zu sprechen.
Nun ist Satire eine Kunstform, deren Grenzen Jan Böhmermann mit seiner Klage gegen Angela Merkel ausgetestet hat und gleichzeitig müssen wir alle unser Geld mit irgendwas verdienen. Das scheint Herrn Witzel mit diesem Genre als nettes Zubrot zu gelingen und es ist Teil unserer demokratischen Rechte. Wenig hilfreich finde ich, dass beim historisch einmaligen Unterfangen, dem Zusammenwachsen der beiden ehemaligen Teile Deutschlands, absichtlich Salz in die Wunden gerieben wird. Wie ein Schmiss, der statt still und leise zu verheilen, absichtlich entzündet wird, um prominenter zu wirken, als er bei Licht betrachtet ist. Aus meiner Sicht hatte die Lesung dem Prozess der inneren Vereinigung einen Bärendienst erwiesen und zu einer lang unterdrückten Eruption von Gefühlen bei den „Unterdrückten und Missverstandenen“ geführt. Ironischerweise erinnerte sich in diesem emotionalen Überschwang keiner der Zuhörer an die alte Weisheit aller Gebrauchtwagenverkäufer: Jeden Morgen steht ein Blöder auf! Der Verkäufer will nicht recht haben, sondern Geld verdienen.
Als Journalistin, die von eigenem Augenschein und O-Tönen lebt und inkognito in den Reihen saß, brachte ich am Ende nicht mehr die nötige Neutralität auf und ging, während tosender Applaus den Autor bedachte. Ich kam mir vor wie im falschen Film.
Wie soll das weitergehen, fragte ich mich. Wie revanchistisch soll das noch werden?
In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert. Fahrzeuge von Premiummarken sind mittlerweile in Leipzig allgegenwärtig. Die Porschedichte nimmt es mit Stuttgart-Zuffenhausen locker auf. Obwohl mir die eigene Erfahrung mit einem solchen Fahrzeug fehlt, stelle ich mir vor, dass die Fahrer nicht mehr in der Weise ausgegrenzt werden, wie ich es vor über zehn Jahren noch erlebt hatte. Schließlich gibt es zwei große Automobilhersteller im Norden Leipzigs, die viele gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen haben, und so die Menschen in der Region an der Prosperität dieser Industrie teilhaben.
Es geht auch in anderen Wirtschaftszweigen voran. Wissenschaftler, Gründer und Künstler sind in Leipzig dicht auf dicht beieinander. Das macht den besonderen Reiz dieser Stadt aus, die trotz der über 600.000 Einwohner wie ein Dorf wirkt, dabei aber jung und dynamisch ist: Die Stadt ist im Kommen, strahlt auf die Region aus und zieht magnetisch neue Menschen an. Sie ist noch eine zarte Pflanze, mit der man behutsam umgehen muss, damit sie weder niedergetrampelt wird, noch beim ersten Sturm umknickt. Die Arbeitslosigkeit hat mit knapp 6,5 Prozent im März 2019 den niedrigsten Stand seit 1991 erreicht. Das ist sicher kein Grund, um die Hände in den Schoß zu legen und alles schön zu reden: Nicht alle partizipieren von dem Boom, der Leipzig zu „Hypzig“ werden ließ. Die große Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die über 58 Jahre alt sind, taucht in der Arbeitslosenstatistik nicht auf.
Viele Menschen finden heute noch die von der Treuhand veranlasste Deindustrialisierung Ostdeutschlands unverhältnismäßig, finden, dass ihr dadurch verursachter Arbeitsplatzverlust ungerechtfertigt sei und ihre Lebensleistung nicht ausreichend gewürdigt werde. Einige sehen in der Wiedervereinigung ein „unfriendly take over“, wie es im Investmentbanking üblich ist: Filetstück rausschneiden und der Rest kommt in die Wurst. Sie verstehen nicht, warum außer den minimalen Relikten von grünem Pfeil und Ampelmännchen, keine einzige ostdeutsche Einrichtung übernommen wurde. Sie fragen sich, warum haben die Westdeutschen den Sinn von Polikliniken nicht erkannt. So falsch kann es nicht gewesen sein, stellen sie heute teils mit Genugtuung fest, da genau dieses Konzept wieder diskutiert wird. Warum hat es keine neue Hymne gegeben, die Ausdruck von Neuem für alle Deutschen gewesen wäre? Warum wurde ein x-beliebiges Datum für den Feiertag der Deutschen Einheit gewählt, das in keinem Bezug zu den historischen Vorgängen steht? Einzig die Hauptstadt änderte sich für die Westdeutschen.
Das bewegt trotz des ökonomischen Aufschwungs die Gemüter und wird manchmal laut gefordert, manchmal hinter vorgehaltener Hand gesagt. Mitunter werden diese Befindlichkeiten befeuert durch Plattitüden, die die meisten zwar als solche erkennen, während bei anderen die Saat aufgeht. Zur Leipziger Buchmesse 2019 erschien ein Buch von einer Politikerin, die zwischenzeitlich als Lobbyistin scheinbar weniger Erfolg gehabt hatte und die Partei wechselte – Antje Hermenau. Die als Frau der ersten Stunde an den damaligen Runden Tischen und als späteres Mitglied des Bundestages in vieles Einblick nehmen konnte, das anderen verborgen blieb. Sachsentümelnd und polemisch bedient sie in ihrem Buch Gedanken, dass etwa die Wessis auch „keinen Plan haben“ und dass mit dem Geld, das für die Integration der Migranten ausgegeben wird, hervorragende Internetverbindungen bis zur letzten sächsischen Milchkanne verlegt werden könnten; erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt.
Es lese sich wie eine Abrechnung, schrieb ein Leser der Leipziger Volkszeitung in einem Leserbrief zu diesem Buch, ohne Optionen aufzuzeigen, wie ein Miteinander gelingen könne. Ein anderer nannte es gar eine primitiv und diskriminierend formulierte Lektüre.
Anders als über die berufssächsische Verfasserin habe ich im Podcast der Wochenzeitung Die Zeit vom 14. Februar 2019 in einem Gespräch mit der Leipziger Autorin und Journalistin Jana Hensel gestaunt, als sie auf die Frage, was sie beruflich gemacht hätte, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, antwortete, dass sie genau dasselbe machen würde wie heute. Dass kritische Berichterstattung in der gleichgeschalteten DDR-Staats-propaganda nicht möglich war und zu Berufsverboten und Zuchthausstrafen geführt hat, ist bekannt. Eine solche Aussage verklärt die Situation, in der sich Andersdenkende in der DDR befunden haben.
Und wieder frage ich mich, wie das weitergehen soll? Die eine peitscht auf, die andere spielt die mangelnde Meinungsfreiheit in der DDR runter.
Bei allen Ungerechtigkeiten, die die Kommission zur Aufarbeitung der Tätigkeit der Treuhand aufdecken soll, darf nicht aus dem Blick verloren werden, was alles erreicht wurde.
Für beide Teile Deutschlands war es die erste Wiedervereinigung, beim nächsten Mal wäre man schlauer, könnte einer einwenden, aber Gift entsteht erst durch seine Dosis: Daher wäre es für das Zusammenwachsen wichtig – allen Befindlichkeiten zum Trotz – das Positive zu sehen, was bisher erreicht wurde und den Blick nach vorn zu richten. Welches andere Land hat in diesem Hinblick etwas Vergleichbares vorzuweisen? Dieser Prozess war und ist nicht ohne Schwierigkeiten und Rückschläge möglich. Wenn sich die Menschen eher auf das Verbindende als auf das Trennende konzentrieren und nicht mit „Besatzer“-Begriffen die Glut schüren, wird das Gemeinsame in den Vordergrund gerückt.
Während früher die Unterschiede zwischen Bayern und Hamburg mit zahl- und achtlosen Witzen bedacht wurden, wird heute gern auf den Klischees des Ostens rumgeritten: Alle Ossis sind arbeitslos und rechts. Der Gag-Schreiber ist mit diesen Themen auf der sicheren Seite, die Lacher sind garantiert. Aber der Vergleich zu den alten BRD-Witzen hinkt.
Als ich in Nürnberg studierte, fragte mich mein oberbayrischer WG-Bewohner, wie das eigentlich sein könne, dass ich als Bremer Nutznießerin des Länderfinanzausgleichs, überhaupt ein Stimmrecht bei der Bundestagswahl haben könne. Wie sich zeigte, hatte nicht nur ich den Eindruck, dass er dämlich war, denn er fiel durch seine letzte Prüfung, aber befremdlich fand ich diese Denke schon. Der Spruch „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ mag vielleicht in einigen Familien funktionieren, innerhalb eines Landes aber sicher nicht. Den Ostdeutschen vorzuhalten, dass man so viel Geld in ihre Bundesländer gepumpt hat und sie mit ihren neuen Bürgersteigen endlich zufrieden und dankbar sein sollen, ist nicht nur unsensibel, sondern nicht zielführend. Wie bei Montessori ist Hilfe zur Selbsthilfe, eins der besten Konzepte überhaupt. Der Aufbau Ost war eine Selbstertüchtigung und sollte keine endlose Alimentierung werden. Die finanzielle Unterstützung läuft bald aus und das ist auch gut so. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle kam im März 2019 in seiner Studie „Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall“ etwa zu dem Schluss, dass die Produktivität des Ostens, der im Westen um 20 Prozent nachhängt, und zwar deswegen, weil der Arbeitsplatzerhalt staatlich subventioniert ist.
Und die Studie der Bertelsmann Stiftung „Monitor Nachhaltige Kommune“ aus dem Jahr 2018 ergab, dass die Armutsquote in Ludwigshafen und im Ruhrgebiet zugenommen, dafür aber in Städten wie Erfurt, Chemnitz und Rostock merklich abgenommen hat. Vielleicht verschiebt sich die Fokussierung für Wirtschafts- und Sozialhilfe nun auf diese Regionen im Westen und der Osten kann jetzt, auf eigenen Füßen stehend, den Westen unterstützen. Dann hören Neid, Bezichtigungen und Unterstellungen vielleicht von ganz allein auf und „Schnauze“-Bücher haben ausgedient.
Wo geht die Reise hin?
Von Ilka Wild
Ich habe große Teile meines Studiums auf Taiwan verbracht und dort einige Jahre gearbeitet. Die Insel im südchinesischen Meer nennt sich offiziell „Republik China“ und ist der Gegenentwurf zum großen kommunistischen Festland. Hier herrscht offiziell Marktwirtschaft, die kommunistische Propaganda ist weit weg. Durch die Seestraße von Taiwan geht noch immer eine Trennlinie, ähnlich wie eine solche durch die beiden deutschen Staaten ging. Das wird, je nach politischer Ausrichtung, von Taiwanern verflucht oder begrüßt. Sollte es jemals zu einer faktischen Wiedervereinigung kommen (offiziell gibt es keine zwei chinesischen Staaten, nur zwei unterschiedliche Interpretationen davon), wird das überlegene System eines sein, das sich selbst kommunistisch nennt. Für die Taiwaner heute ist das ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario.
1989 wäre ein solcher Ausgang für das vereinte Deutschland undenkbar gewesen. Ich stelle mir vor, wir hätten die Möglichkeit des Siegs des Kommunismus über ganz Deutschland 1989 einmal diskutiert: Kaum ein Ostdeutscher hätte das für realistisch oder gar erstrebenswert gehalten. Hätte es so viele Anhänger des alten Systems im Osten Deutschlands gegeben, wie es in manchen Diskussionsrunden heute scheint, hätte es im Osten einen Bürgerkrieg gegeben und keine Friedliche Revolution. Der Konsens unter den damaligen DDR-Bürgern, dass das alte System wegmusste, war so groß, dass es glücklicherweise ohne große Gegenwehr in sich zusammenfiel.
Das SED-Regime hatte nicht nur das Land heruntergewirtschaftet, es hatte seine Bürger systematisch überwacht und bevormundet – das waren die eigentlichen Gründe für den System-Kollaps. Auch wenn es in den Monaten, die auf den Mauerfall folgten, anders erschien: Die DDR-Bürger kämpften nicht dafür, Bananen einkaufen zu können oder Levis-Jeans, sie gingen für Bürger- und Menschenrechte auf die Straße. Gingen das Risiko ein, von der Stasi in Visier genommen zu werden oder im Betrieb Ärger zu bekommen, falls sie beim Demonstrieren gesehen wurden.
Man hat sich die Freiheit und das neue System mehr oder weniger hart erkämpft. Die Friedliche Revolution von 1989 ist eine Leistung, die man würdigen muss – in Ost und West. Das geschieht, meiner Meinung nach, heute viel zu wenig. Die erkämpften Rechte nimmt man gern als selbstverständlich hin. Ich glaube, dass viele es verschmerzen könnten, wenn es von heute auf morgen keine Bananen mehr zu kaufen gäbe. Aber ich stelle mir den Aufschrei vor, wenn man von heute auf morgen seine fünf neuen Bundesländer nicht mehr verlassen dürfte. Und einen Antrag stellen müsste, um nach Polen in den Urlaub zu fahren. Dass man Übernachtungsgäste in der eigenen Wohnung in ein Hausbuch bei einem ‚Hausvertrauensmann‘ eintragen müsste. Oder wenn die Kinder nicht studieren dürften, weil diese oder man selbst nicht in eine bestimmte Partei eintreten will. All diese Erniedrigungen waren Normalität in einem Unrechtsstaat, der von manchen heute verklärt wird.
Diese neuen Rechte und Freiheiten haben natürlich eine Kehrseite. So wie sich die Ostdeutschen ein Westdeutschland vorstellten, wie sie es aus dem Westfernsehen kannten, und wie sie sich dementsprechend das vereinte Deutschland gewünscht hatten, wurde es meist nicht. Besonders in den ersten Jahren gingen viele wirtschaftlich durch ein Tal der Tränen. Und einige haben den Systemwechsel, materiell gesehen, nie für sich nutzen können. Besonders tragisch ist das für diejenigen, denen es ohne eigene Schuld nie gelungen ist, nach der Wende wirtschaftlich auf die Füße zu kommen: Wenn man im Osten einen Beruf gelernt hatte, der von heute auf morgen nicht mehr gebraucht wurde oder wenn ganze Industrielandschaften plötzlich brach lagen – wie sollte es dann weitergehen, besonders für Leute, die den Großteil ihres Berufslebens schon hinter sich hatten. Sollten nun alle den Arbeitsplätzen hinterherziehen und den Osten verlassen? Von den 14.000 DDR-Betrieben unter Treuhand-Verwaltung wurden 4.000 geschlossen, Hunderttausende Jobs im Osten gingen verloren.
Doch die allermeisten haben den Systemwechsel genutzt, das Beste daraus gemacht und sich eine neue Existenz aufgebaut. Zwar ist vieles im Osten noch nicht mit dem Westen vergleichbar, das Lohnniveau hinkt noch immer hinterher und die Vermögen und Bankguthaben sind deutlich kleiner. Doch in der DDR wäre der Wohlstand immer sehr viel kleiner gewesen. Das sieht man daran, wie bescheiden der Luxus selbst in der Wandlitz- Siedlung war – die SED-Führung lebte auf dem miefigen Niveau der westdeutschen Mittelklasse.
So gibt es heute einige Ostdeutsche, die finanziell sehr erfolgreich sind und viele, die ein gutes oder mittleres Einkommen haben.
Trotzdem höre ich immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit über die Situation im vereinigten Deutschland, selbst bei erfolgreichen Ostdeutschen wie Beamten, Ärzten, Unternehmern: Viele stimmen in einen fast larmoyanten Kanon ein. Sie empfinden, dass ihre Lebensleistung in der ehemaligen DDR nicht wertgeschätzt wird und über die DDR nur abfällig gesprochen wird. Dass Ost-Themen immer nur angesprochen werden, wenn es um rechtsradikale Auswüchse geht oder um sonstige Klischees, die man dem Osten so schön zuordnen kann. So mancher denkt manchmal wehmütig zurück an die späten 1980er Jahre, an die belebten Städte und die vielen jungen Menschen dort. Heute sind zahlreiche Regionen des Ostens überaltert, oft ist die Bevölkerung um 20 Prozent und mehr geschrumpft, weil die Jungen keine Perspektive in Gera, Rostock oder Finsterwalde sahen. Viele Ostdeutsche fragen sich, wer die Schuld dafür trägt, dass es nicht geklappt hat mit den „blühenden Landschaften“. Vielen fällt in diesem Zusammenhang nur die Treuhand ein.
Wie meine Co-Autorin Carolin Wilms sehe ich eine von einigen Ostdeutschen, oft aus dem linken Lager, geforderte Wahrheitskommission, die die Aktivitäten der Treuhand ‚aufarbeiten‘ soll, sehr kritisch. Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Kommission einen großen Beitrag zur Zufriedenheit der Ostdeutschen mit ihrer Rolle im vereinigten Deutschland leisten kann, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es so einfach wäre. Klar, Ungerechtigkeit sollte offen angesprochen werden. Doch ich denke, damit müsste man ganz woanders anfangen, denn das Problem scheint deutlich komplexer zu sein und die Treuhand ist nicht der Schlüssel allen Übels.
Das erste Übel war, dass die DDR-Bürger 40 Jahre lang in einer sozialistischen Diktatur gelebt haben, mit allem was dazu gehört: Überwachung im Großen und Kleinen, Indoktrination, Willkür, Bedrohung der eigenen Person oder von Nahestehenden, Bevormundung. Das Schlimme war: Die meisten hatten sich irgendwann daran gewöhnt. Wie sich die meisten im Dritten Reich an die Schrecken der Nazi-Diktatur gewöhnt hatten. Man hat sich darin eingerichtet, man ist mit dem Strom geschwommen. Die Alltäglichkeit der Erniedrigung konnten die Menschen kaum anders ertragen, als sich damit zu arrangieren. Joachim Gauck hat in einem Fernseh-Porträt von einer „Erziehung der Gefühle“ gesprochen, als er einen seiner Söhne am Bahnhof gen Westen verabschiedete, da dessen Ausreiseantrag genehmigt worden war. Jeder in der DDR wusste, was das bedeuten konnte: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie für Jahre, Jahrzehnte getrennt war, war äußerst hoch. Und trotzdem verabschiedeten sie sich kühl und gefasst, nicht tränenreich und verzweifelt, wie es eigentlich einer solchen Trennung entsprochen hätte. Erziehung der Gefühle. So etwas bringt nun mal eine Diktatur hervor, genauso wie ein großes Maß an Unmenschlichkeit und Kälte.
Mir fehlt in der derzeitigen Diskussion, dass man sich diese Dinge noch einmal vor Augen hält, dass man sie klar benennt. Denn nur so werden, nach meinem Empfinden, die Vorgänge im Osten verständlich. Spreche ich Ostdeutsche, die heute im Rentenalter sind, darauf an, spüre ich ein gewisses Widerstreben, darüber zu reden. Diese Generation hat einen großen Teil ihres Berufslebens in der DDR verlebt. „Es war halt so“, höre ich oft, mal resignierend, mal trotzig. Manchmal spüre ich sogar einen gewissen Stolz: Wir haben es durch diese Zeit geschafft, mit Mut, mit möglichst viel Rückgrat, manchmal mit Härte. Erziehung der Gefühle.
Ich glaube, es bringt nichts, sich nur an den Westdeutschen abzuarbeiten. Es ist unbestritten, dass es in der Wendezeit und danach Konflikte mit Wessis gab, dass man sich, oft berechtigt, aber oft auch unberechtigt, von ihnen ungerecht behandelt fühlte und eine Besatzer-Mentalität gespürt hat. Es ist vielleicht einfacher, da es ein klar zuzuordnendes Feindbild gibt: die, die aus dem Westen kamen. Es lenkt auch wunderbar davon ab, dass wir uns in vieler Beziehung wichtigen Problemen noch immer nicht ausreichend gestellt haben, wie der Aufarbeitung unserer DDR-Diktatur und der Unmenschlichkeiten, die tagtäglich von unseren Mit-Ossis an uns begangen wurden.
Es ist an der Zeit, sich das einmal bewusst zu machen und die alltägliche Menschenfeindlichkeit offen anzusprechen, die in der DDR herrschte. Es ist eben nicht normal, sich gegenseitig auszuspionieren. Dass wir in der DDR nicht sagen durften, was wir gerade lesen. Dass die Kinder im Kindergarten gefragt wurden, wie denn die „Eins“ im Ersten Programm bei den Nachrichten im Fernsehen aussieht, um festzustellen, ob die Familie zu Hause Westfernsehen schaute. Dass es ein Problem war, wenn man konfessionell gebunden war oder auch sonst von der sozialistischen Gesellschaftsnorm abwich. Denn das ist, meiner Meinung nach, einer der Schlüssel für die Schieflage, die heute im Osten noch herrscht. Man kann bis heute dem kalten Hauch der Diktatur im Osten noch immer ein bisschen nachspüren. Auf Ämtern, in Schulen, in der Verwaltung, in Krankenhäusern. Immer dort, wo Menschen eine gewisse Machtposition über andere haben, findet man noch viel zu häufig Verhaltensweisen vor, die an die ehemalige DDR erinnern. Der Ton dem Bürger, dem Patienten, auch manchmal dem Kunden gegenüber ist oft äußerst rau, egal, ob derjenige vor dem Tresen aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Wenn bis heute darüber hinweggesehen wird, wenn wir uns dagegen nicht erwehren, wenn wir nicht klar machen, dass wir solche Verhaltensweisen nicht tolerieren, wird das Missempfinden im Osten bleiben. Das setzt aber auch voraus, dass man noch einmal deutlich macht, dass das systematische Kleinmachen der Bürger in der DDR Unrecht war und kein zu tolerierendes Verhalten. Ich konnte es vor ein paar Jahren kaum glauben, dass zwei demokratische Parteien im Rahmen von Koalitionsverhandlungen nach einer Landtagswahl ernsthaft darüber stritten, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei oder nicht, und damit erniedrigendem Verhalten gegenüber Mitbürgern Vorschub leisteten. Eine Mentalität des „Das war nun mal so, so macht man das eben“ auch auf dieser Ebene wird das Miteinander unter den Menschen im Osten des Landes nicht verbessern. Aber das Aufstehen gegen eine solche Mentalität muss aus den Reihen der Ostdeutschen kommen, das können die Westdeutschen nicht für uns tun. Vielleicht braucht es eine wirkliche ostdeutsche „#Me-Too“-Bewegung.
Wind of Change
Von Ilka Wild und Carolin Wilms
Ilka Wild
Ich bin kein Fan der Scorpions, aber es gibt einen Song, der die Stimmung in der DDR im Jahre 1989 beschreibt wie kein anderer: ‚Wind of Change‘.
Schon im Jahr 1988 begann es. Es war etwas im Gange. Man spürte es in der Schule, auf Familienfeiern oder sogar im Zugabteil. Man sprach über Verbotenes, man diskutierte Missstände, es brannte den Leuten unter den Nägeln. Manchmal brach es aus ihnen heraus, und man merkte, dass sie erst später darüber nachdachten. Dann blickte man sich verstohlen an, verschwörerisch. Besonders, wenn das Gespräch mit wildfremden Leuten aufkam, war es nicht ungefährlich. Doch anders als in den Jahren zuvor hatten viele Menschen ihre Angst abgelegt oder waren zumindest weniger vorsichtig. Natürlich hatte das Ganze mit den Vorgängen in der Sowjetunion zu tun: Gorbatschow hatte bereits Mitte der 1980er Jahre mit seiner Perestroika Politik begonnen. Und auch das konnte man in der DDR spüren. Über das Westfernsehen erfuhren wir von Sacharows Rehabilitation und konnten das kaum glauben. Und auch das gesellschaftspolitische Magazin Sputnik aus der UdSSR, das in der DDR verkauft wurde, brachte Artikel, die man sich kaum traute zu lesen, so kritisch waren sie. Dieser ‚Wind of Change‘ war wohl genau das, was in dem gleichnamigen Lied beschrieben wurde. Die Rockband The Scorpions aus Hannover durfte im August 1989 in Moskau auftreten, die dortige Stimmung inspirierte die Band zu dem Song: In Russland änderte sich etwas.
Carolin Wilms
Auch im Westen nahm man die Veränderungen in Russland genau wahr und schöpfte Hoffnung: Das Wettrüsten und die nukleare Bedrohung hatten in den späten 1980er Jahren beängstigende Formen angenommen. Als Gegenentwurf dazu gab es im Westen eine sehr aktive Friedensbewegung. Die Menschen und vor allem die Jugendlichen waren politisch engagiert. NATO-Doppelbeschluss, Stationierung von Marschflugkörpern mit Atomsprengköpfen waren Themen, die im Westen nicht nur am sonntäglichen Kaffeetisch diskutiert wurden, und es gab – vereinfacht gesagt – zwei Lager: Die eher Konservativen wollten sich bis zu den Zähnen bewaffnen und aufrüsten, die Jungen wollten „Petting statt Pershing“.
„Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!“ stand auf den Aufnähern, die auf unsere Parkas genäht waren. Der Look der Friedensbewegung war unverwechselbar: lange Haare, selbst gestrickte Pullis, Räucherstäbchen und Jute-Beutel. An eine militärische Konfrontation mit der DDR hatten dabei die wenigsten gedacht. Das Feindbild war die UdSSR. Mit Gorbatschow konnte man endlich etwas hoffnungsvoller gen Osten blicken. Dennoch schien bei den unmittelbaren Nachbarn im Osten – in der DDR – alles beim Alten geblieben zu sein: Die Opa-Fraktion mit Hut und falschem Gebiss nahm weiterhin die albernen Stechschritt-Paraden ab.
Und so war es größtenteils auch. Es gab in der DDR keine umwälzenden Veränderungen wie in Russland. Den Wandel konnte man nur minimal spüren: Etwa die Tatsache, dass der erwähnte russische Sputnik noch bis zu seinem Verbot im November 1988 gekauft und die kritischen Artikel darin von jedem gelesen werden konnten. Andere Minimal-Ausschläge am gesellschaftlichen Seismografen waren das Outing von Homosexuellen, womit man sich in den DDRJugend-Magazinen beschäftigte. So klein oder manchmal banal die Veränderungen auch waren: Es gab eine gewisse Öffnung. Es gab beispielsweise Platten von Michael Jackson zu kaufen. Zumindest, wenn man das Glück hatte, eine zu ergattern: Die sozialistische Mangelwirtschaft konnte die große Nachfrage nach derlei Produkten nicht im Entferntesten decken, und so bildeten sich lange Schlangen, falls es überhaupt einmal etwas zu kaufen gab, das irgendwie aus dem Westen kam. Die Platten von Künstlern aus dem Westen wurden in Lizenz von einem volkseigenen Betrieb hergestellt, die Qualität des Plattencovers war so dürftig, dass man auf den ersten Blick sah, dass es sich um ein DDR-Produkt handelte. Dennoch war jeder glücklich, der eine solche Platte sein Eigen nennen konnte.
Die DDR-Führung passte jedoch peinlich genau darauf auf, dass es nicht zu westlich zuging. Und somit musste es für Trends, die aus dem Westen kamen, aber die herrlich unpolitisch waren, ihre eigenen, teilweise peinlichen, DDR-Namen geben. So gab es die Bezeichnung Pop-Gymnastik für Aerobic, die DDR-Variante des Hamburgers hieß Grilletta und der ostdeutsche Hotdog war die Ketwurst, eine Kombi-nation aus Ketchup und Wurst.
Dieser Öffnung im unpolitischen Leben stand eine unerbittliche Haltung gegenüber allen Kritikern des Systems entgegen, ebenso gegenüber all denjenigen, die die DDR verlassen wollten. Und dies sogar bis in die unmittelbare Vorwendezeit hinein: Ein Freund unserer Familie äußerte sich im Sommer 1989 am Frühstückstisch in seinem Betrieb zum Thema Ungarnflüchtlinge sinngemäß so: „Ich hau dann auch bald ab, ist eh fast keiner mehr da!“ Obwohl scherzhaft gemeint, führte diese Äußerung dazu, dass er, drei Wochen später, als er seinen Jahresurlaub in der damaligen ČSSR antreten wollte, an der Grenze abgefangen wurde: Er saß bis November 1989 im Stasi-Gefängnis. Dieser Freund hat nach der Wende nicht Fuß fassen können und war viele Jahre arbeitslos.
Es war eine indifferente Stimmung, die schwer zu beschreiben ist, an die sich aber viele Ossis erinnern können: Ungefähr 18 Monate vor dem Fall der Mauer lag etwas in der Luft. Einerseits hoffnungsvoll, andererseits bedrohlich. „Es wird etwas passieren.“ Das ist der Satz, der für viele Ostdeutsche charakteristisch in dieser Zeit gewesen sein mag. Und man wusste nicht, ob es in eine positive oder eine negative Richtung ging. Schließlich gab es die Vorfälle am Platz des Himmlischen Friedens in Peking – dort war man mit Panzern und scharfer Munition gegen oppositionelle Studenten vorgegangen.





























