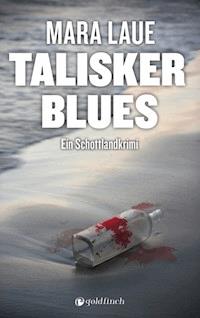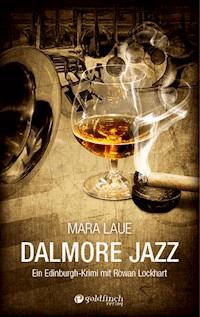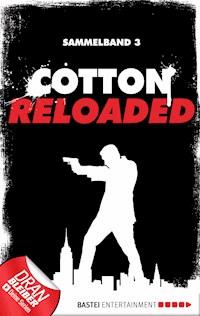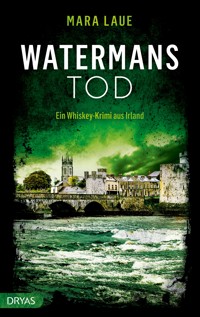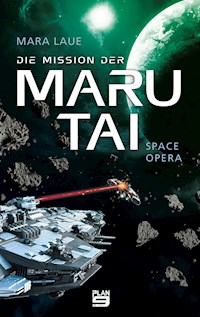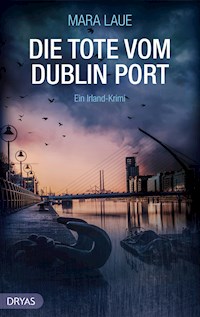Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edinburgh-Krimi mit Rowan Lockhart
- Sprache: Deutsch
Ein schlechtgehendes Büro für Privatermittlungen, eine kürzlich erfolgte Scheidung und obendrein ein undurchsichtiger Ex-Söldner als Mieter - Rowan Lockharts Neustart in Edinburgh ist nicht einfach. Da kommt ihr der Brief von Captain Finn Macrae gerade recht, in dem er sie mit der Überwachung seiner Frau beauftragt. Doch bevor Rowan mit ihm Kontakt aufnehmen kann, ist Macrae tot: Selbstmord. Er soll militärische Geheimnisse verraten haben. Obwohl die Beweise für seine Schuld erdrückend sind, beginnt Rowan nachzuforschen und sticht damit in ein Wespennest - mit gefährlichen Folgen. Ein Schottland-Krimi aus dem nicht immer ungefährlichen Edinburgh für Fans klassischer Detektiv-Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
SINGLETON SOUL
Ein Edinburgh-Krimi mit Rowan Lockhart
von Mara Laue
Vorbemerkung: Alle im Roman genannten Orte sind authentisch. Sofern es sich um die Adressen von nichtöffentlichen Gebäuden handelt, wurden jedoch die Hausnummern aus rechtlichen Gründen frei erfunden. Des Weiteren sind alle Handlungen und Personen fiktiv. Das gilt besonders für die Mitglieder der 52nd Infantry Brigade. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und Ereignissen wären Zufall.
Ein Glossar der im Roman verwendeten Ausdrücke und ihrer Aussprache aus dem Scots und dem Japanischen befindet sich am Ende des Buches, ebenso wie das Zusatzkapitel "Distelblume und Bambuszweig
EINS
Donnerstag, 23. August 2012
Sanft schimmerte der kleine Rest des Singleton rotbraun am Grund der meergrünen Flasche. Das Glas daneben war leer. Die männliche Leiche saß schlaff im Sessel. Am Boden lag eine SIG Sauer P226, ganz in der Nähe der rechten Hand des Toten, die über der Armlehne hing. Detective Inspector Bill Wallace stand neben der Wohnzimmertür und ließ den Raum auf sich wirken, ohne den Leuten von der Spurensicherung im Weg zu stehen. Die Verteilung von Blut, Knochenpartikeln und Gehirnmasse an der Wand hinter dem Sessel passte zu dem Bild, dass der Mann sich den Lauf der Waffe in den Mund gesteckt und abgedrückt hatte. Lediglich der aufgeschraubte Schalldämpfer war ungewöhnlich, widersprach aber nicht unbedingt dem augenscheinlichen Selbstmord.
Die fast leere Flasche Singleton und das Glas auf dem Tisch neben dem Toten sprachen ebenfalls für Selbstmord. Der Mann hatte sich erst genug Mut angetrunken und war dann zur Tat geschritten. Zwar war kein Abschiedsbrief vorhanden, aber nicht jeder Selbstmörder hielt es für nötig, irgendjemandem seine Gründe zu erklären. Viele setzten voraus, dass ihre Angehörigen schon wüssten, warum sie diesen Schritt getan hatten. Und wenn nicht, war es den Toten wohl sowieso egal.
Bill aber nicht. Er fragte sich bei jedem Selbstmord, mit dem er es zu tun bekam, wieso der Tote keinen anderen Ausweg gesehen hatte. Ohne Abschiedsbrief, der einen Grund nannte, konnte er nur raten. Wenn der Tote sich wie in diesem Fall zu Hause umgebracht hatte, gab ihm oft die Einrichtung des Hauses einen mehr oder weniger subtilen Hinweis. Spuren von Armut, Vernachlässigung, Arbeitslosigkeit oder Einsamkeit sprachen Bände. Oder die Reaktionen der Angehörigen verrieten ihm etwas.
In diesem Fall jedoch zeigte sich Bill kein noch so kleiner Hinweis. Das Gegenteil war der Fall. Auszeichnungen in einer Vitrine verrieten, dass Captain Finn Macrae seinem Land im Namen Ihrer Majestät in den vergangenen dreißig Jahren treu und tapfer gedient hatte. Wappen und Clanwimpel der Macraes an der Wand über dem Kamin zeigten, dass er ein traditionsbewusster Mann gewesen war. Sah man von der Schweinerei ab, die die Bluttat verursacht hatte, war zumindest das Wohnzimmer sauber aufgeräumt und zeigte kein Anzeichen von Vernachlässigung.
Bill warf einen Blick durch die offene Tür in den Nebenraum, wo Sergeant Annie Armstrong die Witwe befragte, die ihren Mann bei ihrer Rückkehr vom Einkaufen tot aufgefunden hatte. Sie wirkte überraschend gefasst. Das konnte daran liegen, dass sie noch nicht richtig begriffen hatte, dass ihr Mann nicht mehr lebte. Oder auch an einer traditionellen asiatischen Erziehung, die ihr diktierte, unter allen Umständen die Contenance zu wahren. Es bestand aber auch die Möglichkeit, dass sie und ihr Mann sich auseinandergelebt oder zerstritten hatten. Vielleicht war sie sogar froh über seinen Tod. Was auch immer. Jeder gewaltsame Tod war einer zu viel. Ihn aufzuklären war Bills Job.
Er ging in den Nebenraum, das Esszimmer, an das sich die Küche anschloss, abgetrennt durch eine Schiebetür. Die Taschen mit den Einkäufen, die Mrs Macrae mitgebracht hatte, standen ordentlich nebeneinander auf dem Tisch. Ein Bild, das auf den ersten Blick nicht passte. Bill sah sich um. Ging zur Schiebetür und warf einen Blick in die Küche. Kein Nebeneingang, zumindest nicht in der Küche und auch nicht im Esszimmer. Die Frau musste also in jedem Fall mit ihren Einkäufen durch das Wohnzimmer gegangen sein, in dem ihr toter Ehemann lag, um die Sachen hier abstellen zu können. Bill hatte noch nie gehört, dass eine Ehefrau, die beladen nach Hause kam und ihren Mann tot im Wohnzimmer fand, erst die Taschen in einem Nebenzimmer abstellte, bevor sie die Polizei rief. Jeder normale Mensch würde sie beim Anblick einer Leiche vor Schreck oder Entsetzen oder beidem einfach dort fallen lassen, wo er stand.
Die Frau sah auf, als Bill zu ihr trat. Tiefschwarze Augen wie Abgründe, in denen sich das durch das Fenster scheinende Licht der Sonne spiegelte. Wie zwei Mandeln in einem Gesicht von einer Farbe wie Honigcreme. Glänzendes Haar wie Rabenflügel, das eng an ihrem Kopf lag und akkurat und wie mit dem Lineal geschnitten auf Kinnlänge endete. Perfekt gezupfte Augenbrauen und fein geschwungene Lippen, deren Farbe an reife Pfirsiche erinnerte. Ihre Schönheit musste Macrae bezaubert haben.
Der ungerührte Ausdruck ihres Gesichts störte diesen Eindruck jedoch.
Bill neigt den Kopf. „Mrs Macrae, mein Beileid zu Ihrem Verlust.“
Sie stand auf, verneigte sich und murmelte etwas in einer Sprache, die er nicht verstand, ehe sie in fast akzentfreiem Englisch hinzufügte: „Ich danke Ihnen, Sir.“
„Ich bin Inspector William Wallace vom CID Edinburgh, vom Criminal Investigation Department. Ich weiß, wie furchtbar und wie bedrückend die Situation für Sie sein muss, Madam, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Fühlen Sie sich in der Lage, sie zu beantworten? Wenn nicht, hat das Zeit.“
Sie senkte den Kopf. „Bitte, fragen Sie.“ Ihre Stimme klang angenehm melodisch. Bill fragte sich, aus welchem Land die Frau stammte.
„Falls Sergeant Armstrong Ihnen schon dieselben Fragen gestellt hat, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich sie wiederhole.“
Wieder neigte sie den Kopf. „Bitte, fragen Sie.“
„Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Hause gekommen und haben Ihren Mann gefunden.“
„Ja.“
„Und woher kamen Sie?“
„Ich habe eingekauft.“ Sie deutete auf die Tüten und Taschen.
Er nickte. „Sie sind mit den Einkäufen ins Haus gekommen?“, vergewisserte er sich.
„Ja.“
„Können Sie mir sagen, was genau Sie getan haben, als Sie Ihr Haus betreten haben?“
„Das habe ich schon gefragt, Sir, und Mrs Macrae hat mir die Frage beantwortet.“ Sergeant Armstrong klopfte mit dem Kugelschreiber auf ihren Notizblock.
Bill ging nicht darauf ein. „Mrs Macrae?“
Sie faltete ihre Hände im Schoß und blickte zu Boden. Sie vermied es, Bill oder Annie Armstrong anzusehen. „Ich habe die Haustür aufgeschlossen, bin durch die Diele ins Wohnzimmer gegangen und habe – meinen Mann gesehen. Tot. Ich habe die Polizei gerufen.“
Bill war die kurze Pause nicht entgangen, die sie gemacht hatte. Aber auch das konnte viel oder gar nichts bedeuten. Er war jedoch überzeugt, dass es nicht an mangelnder Sprachkenntnis lag, denn ihr Englisch hatte nur einen kaum hörbaren Akzent.
„Mrs Macrae, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie, als Sie Ihren toten Mann sahen, zuerst die Einkäufe hier abgestellt und dann die Polizei gerufen.“
„Ja.“ Sie hob den Blick. „Ist das wichtig?“
Er lächelte beruhigend. „Jedes Detail kann wichtig sein. Gibt es Anzeichen dafür, dass während Ihrer Abwesenheit außer Ihrem Mann noch jemand im Haus gewesen ist?“
Ihre Augen weiteten sich. „Sie glauben nicht, dass es Selbstmord war?“
„Dafür gibt es bis jetzt keine Hinweise. Aber da Ihr Mann keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, müssen wir jede Möglichkeit in Betracht ziehen, bis wir die Todesursache zweifelsfrei geklärt haben.“ Er blickte sie aufmerksam an. „Hatte Ihr Mann Feinde?“
Wieder senkte sie den Blick. „Ich weiß von niemandem.“
Bill wartete, ob sie noch etwas sagen wollte, aber sie schwieg. „Mrs Macrae, wissen Sie einen Grund, warum Ihr Mann sich das Leben genommen haben könnte?“
Schweigen. Sie saß vollkommen reglos, als wäre sie eine Statue. Nur ihr Brustkorb hob und senkte sich. Ein klares Ja.
„Bitte, Madam, antworten Sie mir. Wenn es etwas gab, finden wir es sowieso heraus.“
„Ich weiß nichts.“
Aus Erfahrung wusste Bill, dass es keinen Zweck hatte, in jemanden zu dringen, der sich so abgeschottet hatte wie Mrs Macrae. Deshalb ließ er ihre Lüge vorläufig auf sich beruhen.
„Madam, Ihr Haus ist gegenwärtig ein Tatort. Das heißt, dass Sie nicht mehr darin wohnen können, bis unsere Ermittlungen abgeschlossen sind. Haben Sie Verwandte oder Freunde, bei denen Sie vorübergehend unterkommen können?“
Sie schüttelte den Kopf. „Meine Mutter lebt zwar hier in Edinburgh, aber ihre Wohnung ist viel zu klein. Ich möchte sie nicht belästigen.“
In ihrer Stimme schwang ein Hauch von Bitterkeit mit. Oder war es Ärger? Vielleicht würde Bill es in einem späteren Gespräch herausfinden.
„In dem Fall werden wir Sie in einem Hotel unterbringen. Sergeant Armstrong wird Ihnen helfen, ein paar Sachen zu packen und Sie hinfahren.“ Er nickte Armstrong zu. „Ich halte so lange Ihren Notizblock, Sergeant.“
„Ja, Sir.“ Sie reichte ihm den Block und stand auf. „Kommen Sie bitte, Mrs Macrae. Zeigen Sie mir Ihr Schlafzimmer, dann packen wir ein, was Sie mitnehmen möchten.“
Bill wartete, bis die beiden Frauen das Zimmer verlassen hatten, ehe er Armstrongs Notizen las. Mrs Macrae hieß mit Vornamen Jin-Hee – wie immer man das aussprach – und stammte aus Korea. Sie war mit Macrae seit knapp zwei Jahren verheiratet und arbeitete als Lehrerin an einer Musikschule. Wie Armstrong gesagt hatte, hatte sie sie bereits gefragt, was sie getan hatte, als sie nach Hause gekommen war. Armstrong hatte notiert: „M. gefunden, Tüten i. Nebenzi. abgest., Polizei anger., auf deren Eintreffen gewartet. I. d. Zwischenz. nichts getan, nur gesessen + gewartet.“ Dahinter stand ein großes Fragezeichen.
„Nur gesessen + gewartet“, das musste nicht unbedingt die Wahrheit sein. Daran hegte offensichtlich auch Sergeant Armstrong Zweifel. Aber das würde sich herausstellen. Armstrong kam mit Mrs Macrae zurück. Bill hielt ihr den Notizblock hin.
„Sir, die haben offensichtlich getrennte Schlafzimmer“, flüsterte Armstrong ihm zu, als sie ihn entgegennahm. „Ich weiß nicht, ob Mrs Macrae die britische Staatsbürgerschaft besitzt. Wenn nicht, könnte es sein, dass sie und ihr Mann eine Scheinehe geführt haben.“
Bill nickte. „Wir prüfen das. Hat die Frau ihren Pass eingesteckt?“
„Nein, Sir.“
Dann hatte sie wohl nicht vor, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Trotzdem sollte man sie im Auge behalten. „Bringen Sie sie in unserem üblichen Hotel unter, Sergeant, und sagen Sie ihr, dass sie sich zu unserer Verfügung halten soll. Wenn sie sich dazu in der Lage fühlt, bringen Sie sie anschließend aufs Revier und nehmen Sie ihre Aussage zu Protokoll. Ansonsten soll sie morgen früh um neun vorbeikommen.“
„Ja, Sir.“ Armstrong verließ mit Mrs Macrae das Haus. Bill blickte ihnen nach, ehe er ins Obergeschoss ging und sich die Schlafzimmer ansah. Es gab noch viel zu tun.
Die Frau rümpfte die Nase. „Also, die Küche ist ein bisschen klein. Selbst für eine Einbauküche sollte der Kühlschrank größer sein. Und ein Gefrierschrank fehlt völlig. Die Ausstattung ist überhaupt ziemlich dürftig. Auch beim Rest der Wohnung. Da kommt man sich ja vor wie in einer Kaserne.“
Rowan Lockhart bewahrte ein gleichmütiges Gesicht. „Die Ausstattung ist ganz bewusst auf das Nötigste beschränkt, damit mein künftiger Mieter sich den Rest nach seinem Gusto einrichten und es sich mit seinen eigenen Möbeln so heimelig wie möglich machen kann.“
Die Frau ignorierte den Einwand. „Also, dieser Hinterhofzugang – als wäre man ein Dienstbote.“ Sie blickte Rowan herausfordernd an. „Also, da müssten Sie mir schon bei der Miete entgegenkommen.“
Rowan lächelte liebenswürdig und verneigte sich leicht. „Da ist nichts zu machen. Sumimasen. – Ich bedaure“, fügte sie hinzu, als ihr bewusst wurde, dass sie den japanischen Ausdruck benutzt hatte. Sie deutete zur Tür.
Die Frau rauschte ohne ein Wort hinaus, die Treppe hinunter und verließ das Haus mit schnellen Schritten. Rowan widerstand dem Impuls, die Tür hinter ihr zuzuknallen. Sie seufzte, kehrte in ihr Büro im Erdgeschoss zurück und schaltete die Musikanlage ein. Bereits die ersten Töne von Dionne Warwicks Stimme, die „Some Changes Are For Good“ sang, entspannten sie. Soul hatte schon immer diese Wohlfühlwirkung auf sie gehabt. Rowan genoss es, ihre Lieblingsmusik endlich wieder hören zu können, wann sie wollte und so lange sie wollte. Nicht zu vergessen: so laut sie wollte. Sie schloss die Augen, ließ sich von der Musik tragen und blendete für eine kostbare Weile alles andere aus.
Leider drängten sich die Sorgen nur allzu schnell wieder in ihr Bewusstsein. Mieter für die möblierte Wohnung im Obergeschoss zu finden, war nicht so leicht, wie sie gedacht hatte. Die Frau vorhin war der sechste Versuch gewesen, seit sie heute Morgen das Schild „Möblierte 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten“ ins Fenster zur Straße geklebt hatte.
Aber es ging nicht mehr anders. Sie brauchte Geld, wenn auch nicht so dringend, dass sie den Erstbesten als Mieter genommen oder sich eine nörgelnde Zicke aufgehalst hätte, deren Manöver, die Miete zu drücken, mehr als offensichtlich waren. Die Wohnung im Obergeschoss hatte sie nach dem Kauf des Hauses fast ein Jahr lang selbst bewohnt. Ihr Detektivbüro hatte sie im Erdgeschoss auf der linken Seite eingerichtet und in dem riesigen Zimmer auf der rechten Seite, das die Vorbesitzer als Wohnzimmer für ihre achtköpfige Großfamilie benutzt hatten, das kleine Dojo, in dem sie die altehrwürdige Kampfkunst des Togakure-ryu und Selbstverteidigung unterrichtete.
Da sie es sich noch nicht leisten konnte, einen Mitarbeiter einzustellen, der ihr in der Detektei assistierte, kollidierte der Unterricht ab und zu zeitlich mit einer Observation. Nicht alle Schüler hatten dafür Verständnis, wenn der Beginn einer Stunde nach hinten verschoben oder sie vorzeitig abgebrochen werden musste. Aber die Ermittlungsarbeit hatte Priorität, sie brachte mehr Geld ein als der Unterricht. Als Ergebnis hatten sich einige der Schüler komplett abgemeldet, bei den anderen war es wohl nur noch eine Frage der Zeit. Doch einen schlechten Ruf in der Kampfsportszene zu bekommen, konnte sie sich nicht leisten. Deshalb war sie vom Gruppenunterricht zum Einzelunterricht mit flexibel vereinbarten Stunden übergegangen. Seitdem war sie permanent knapp bei Kasse.
Also hatte sie das Dojo in den großen Raum im Keller verlegt, den die Vorbesitzer als Partyraum benutzt hatten, ihre Wohnung im Erdgeschoss eingerichtet und das Schild ins Fenster geklebt in der Hoffnung, bald jemanden für die kleine Wohnung zu finden. Doch das war gar nicht so einfach.
Der erste Anwärter hatte einen zwielichtigen Eindruck gemacht. Der zweite wollte nur die Hälfte der Miete zahlen, die Rowan verlangte. Die dritte wollte mit ihrem Freund einziehen und war schwanger. Rowan hatte weder etwas gegen wilde Ehen noch gegen Kinder, aber gegen den penetranten Haschischgeruch, der an der Kleidung der beiden haftete. Nummer vier war eine indische Familie mit vier Kindern, wirklich nette Menschen, die sie gern als Mieter gehabt hätte. Aber die Wohnung war für sechs Personen einfach zu klein. Nummer fünf war eine frisch von ihrem Mann getrennte Frau, der sie verfolgt hatte und gewaltsam zurückzuholen versuchte, noch ehe sie mehr getan hatte, als Rowan ihren Namen zu nennen. Nummer sechs – die Zicke.
Nun ja. Rowan hatte gewusst, dass ihre Rückkehr nach Edinburgh nicht einfach werden würde. Nicht nur, weil zehn Jahre in Japan sie geprägt und ihrer Heimat entfremdet hatten. Völlig neu anzufangen, war nicht leicht. Erst recht nicht, da sie nicht geplant hatte zurückzukommen. Sie hatte zusammen mit Doro alt werden wollen. Aber es war anders gekommen.
Sie nahm die handlange Welsfigur aus weißer Jade, die neben ihrem Rechner stand, und strich mit den Fingerspitzen über die Oberfläche. Jede Schuppe war naturgetreu ausgearbeitet. Rowan hatte das Gefühl, dass der Wels sie mit seinen steinernen Augen traurig ansah. Wahrscheinlich vermisste er seinen Zwilling. Doch den hatte sie in einem Bankschließfach gelagert. Doros Abschiedsgeschenk. Sie ahnte, dass es ihn eine harte Auseinandersetzung mit seinen Eltern gekostet hatte, ihr die Jadewelse zu überlassen. Sie waren alte Erbstücke der Nobushis, seit Generationen im Familienbesitz. Rowan hatte bei den Nobushis von Anfang an einen schweren Stand gehabt. Eine gaijin, eine Ausländerin, war Doros Eltern für ihren einzigen Sohn zunächst nicht gut genug gewesen. Wahrscheinlich würden sie ihr niemals verzeihen, dass sie Doro verlassen hatte.
Doro dagegen hatte es nicht nur als seine Pflicht erachtet, es war ihm auch ein Bedürfnis gewesen, ihr die Heimkehr zumindest finanziell zu erleichtern. „Als Dank für die zehn wunderbarsten Jahre meines Lebens“, hatte er gesagt und ihr zum Abschied die Zwillingswelse geschenkt – wohl wissend, dass sie, wenn es hart auf hart käme, mindestens einen davon würde verkaufen müssen. Einzeln war jede Figur um die hunderttausend Pfund wert. Für das Paar könnte ein guter Auktionator eine halbe Million rausschlagen.
Sie würde sie allerdings nur im äußersten Notfall verkaufen. Sie hatte in Japan zusammen mit einer Partnerin ein eigenes Sicherheitsunternehmen aufgebaut, das gut lief und sich einen hervorragenden Ruf erworben hatte. Von einem Teil ihrer Ersparnisse hatte sie das Haus in der 32B Blackford Avenue angezahlt und sich die ersten Monate über Wasser gehalten. Den Rest des Kaufpreises finanzierte sie über eine Hypothek, die sie monatlich abbezahlte. Wenn nichts dazwischenkam, gehörte das Haus in dreizehn Jahren ihr.
Sie brauchte als Privatdetektivin ein eigenes Büro in einer ordentlichen Gegend. Immerhin verschaffte es ihr einen Vorteil für ihre Ermittlertätigkeit, dass sie eine Ausbildung bei der Scottish Police vorweisen konnte. Das Diplom hatte sie gerahmt gegenüber der Bürotür an die Wand gehängt, wo es jedem sofort ins Auge fiel. Trotzdem reichte das Geld, das sie verdiente, hinten und vorne nicht. Bevor sie aber einen der Jadewelse verkaufen würde, hatte sie noch einige andere Optionen. Zum Beispiel die Vermietung des Obergeschosses.
Sie stellte den Wels an seinen Platz und strich zärtlich über sein Maul. Eigentlich sollte sie die Figur im Safe aufbewahren. Andererseits käme kein Einbrecher, der sich nicht zufällig mit japanischen Antiquitäten auskannte, auf den Gedanken, dass der Fisch, der auf den ersten Blick wie eine Plastikfigur wirkte, eine sechsstellige Summe wert war. Ganz abgesehen davon, dass ein Einbrecher erst einmal die mit Sicherheitsschlössern und Alarmanlagen gesicherten Türen und Fenster hätte überwinden müssen, ohne den Alarm auszulösen. Das war zwar nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.
Durch das Fenster nahm sie eine Bewegung im Vorgarten wahr. Der nächste Interessent. Stoppelkurzes Haar, das rötlich schimmerte, aufrechte Haltung, dynamische Bewegungen – der Mann war beim Militär, wenn Rowan sich nicht täuschte. Sie ging zur Tür, noch ehe er geklingelt hatte.
Als sie öffnete, straffte er sich und nickte ihr knapp zu. „Guten Morgen, Ma’am. Rory Lennox. Ich interessiere mich für die Wohnung, falls sie noch frei ist. In Edinburgh sind die guten Wohnungen immer schnell weg.“
Schotte und eindeutig von hier, wie sie am Scots mit dem gerollten R hörte und daran, dass er „Edinbrah“ sagte.
„Ja, die ist noch frei. Kommen Sie rein. Ich bin Rowan Lockhart.“ Sie führte ihn durch den Flur zur hinteren Tür. „Die Wohnung hat einen eigenen Eingang. Ums Haus herum durch den Garten.“ Sie zeigte auf die Kellertür. „Hier geht es zum Keller, der gemeinsam genutzt wird. Waschküche, Trockenraum und so. Sie hätten aber auch noch einen Abstellraum da unten.“
Sie ging ihm voran die Treppe hinauf, die in einen schmalen Flur führte, auf dessen rechter Seite die beiden Wohnräume lagen, auf der linken Küche und Bad. Sie zeigte ihm diese zuerst. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen fanden sie seine Billigung. Auch das Wohnzimmer gefiel ihm, ebenso das Schlafzimmer. Die spartanische Einrichtung störte ihn nicht. Vom Militär war er sicherlich eine noch spärlichere Ausstattung gewohnt.
„Das ist genau das, was ich suche. Wie hoch ist die Miete?“
„Vierhundert Pfund.“
Er zuckt nicht mal mit der Wimper. „Okay.“
Rowan atmete auf.
„Bevor Sie zustimmen, mich als Mieter zu nehmen, sollten Sie eines wissen: Ich war Söldner. In ein paar Jahren werd ich zu alt für den Job sein, außerdem hab ich sowieso keine Lust mehr dazu. Ich will mir hier in der alten Heimat den hoffentlich ruhigen Rest meines Lebens einrichten. Bin gerade aus dem Ausland zurück.“
Rowan war sich nicht sicher, ob sie einen Söldner unter ihrem Dach haben wollte, Ex oder nicht. Immerhin hatte sie mit ihrer Vermutung ins Schwarze getroffen, dass er beim Militär gewesen war. „Und warum sagen Sie mir das, Mr Lennox?“
Er grinste flüchtig. „Weil einen die Vergangenheit immer irgendwann einholt und solche Dinge früher oder später rauskommen.“ Er hob abwehrend die Hände. „Keine Sorge, Ma’am. Meine einzige ‚Vergangenheit‘ ist mein Beruf. Ich hab keine unerledigten Angelegenheiten im Gepäck. Meine Akte ist sauber. Ich will nur, dass Ihnen von Anfang an bewusst ist, wer ich bin und was ich war. Mit anderen Worten: An dem Geld, mit dem ich meine Miete bezahle, klebt Blut. Wenn auch nicht das von Unschuldigen, darauf hab ich immer geachtet. Falls Ihnen das was ausmacht, nehme ich es Ihnen nicht übel. Wenn Sie die Wohnung lieber jemand anderem geben wollen, ist das okay.“
Er blickte sie ruhig an. Rowan versuchte abzuschätzen, was für ein Mensch er war. Er konnte ihr viel erzählen. Seine Behauptung, dass er sauber war, mochte stimmen, konnte aber auch eine Lüge sein. Andererseits hätte er ihr nicht zu sagen brauchen, dass er Söldner war, wenn er etwas zu verbergen hätte. Außerdem wirkte er nicht wie ein Gewalttäter, obwohl er den Hauch von etwas Dunklem ausstrahlte. Aber eben nur einen Hauch. Und wenn sie sich vorstellte, sich noch wer weiß wie viele Bewerber ansehen zu müssen, die ihr den letzten Nerv raubten mit ihren Ansprüchen, ihren quengeligen Forderungen oder ihren Versuchen, um die Miete zu feilschen, erschien ihr der Mann fast wie ein Geschenk.
„Ich halte es mit dem alten Vespasian: Geld stinkt nicht. Wenn Sie mir versprechen, die Miete pünktlich zu zahlen und nicht allzu oft Partys bis in die Nacht zu feiern, können Sie einziehen.“ Sie zog die Schlüssel aus der Hosentasche und hielt sie ihm hin.
„Keine Sorge. Ich bin nicht der Partytyp und pflege meinen Verpflichtungen nachzukommen. Sobald ich mich eingerichtet habe, werden Sie kaum bemerken, dass ich da bin.“ Er nahm die Schlüssel und steckte sie ein.
Rowan machte eine Kopfbewegung zur Treppe. „Sie können gleich den Vertrag unterzeichnen, wenn Sie wollen.“
Sie führte ihn ins Büro und schob ihm den vorgefertigten Mietvertrag hin. Er las aufmerksam jedes Wort, ehe er den Vertrag unterschrieb und Rowan die Miete in bar auf den Tisch legte. Einschließlich eines Abschlags für die Nebenkosten.
Rowan grinste, schrieb eine Quittung aus und reichte ihm die Hand. „Willkommen zu Hause, Mr Lennox.“
„Danke.“ Sein Händedruck war kurz und fest.
Nachdem er ihr Büro verlassen hatte, nahm Rowan das Schild aus dem Fenster. Falls sie Rory Lennox nicht wieder rauswerfen musste, war die monatliche Hypothekenzahlung gesichert. Als sie das Geld einsteckte, atmete sie auf.
Sie setzte sie sich an den Schreibtisch und sah die Post durch. Die Stromrechnung, Rechnungen für Versicherungsprämien, Telefonrechnungen – Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. Dazwischen als Postwurfsendung eine Einladung zu einer Vernissage, Reklame. Eine Einladung ihrer Schwester Eileen zu ihrer Verlobung am übernächsten Samstag. Handschriftlich, auf einem von einem Block abgerissenen Blatt und beinahe im Telegrammstil. Sie nannte nicht mal den Namen ihres künftigen Verlobten. Wahrscheinlich sollte Rowan nur anwesend sein, damit Eileen ihrem Zukünftigen und seinen Eltern eine intakte Familie vorspielen könnte, worauf das Postskriptum hindeutete: Rowan sollte sich „dem Anlass entsprechend gefälligst ordentlich kleiden“.
Sie warf die Einladung in den Papierkorb. Sollte Eileen nachfragen, würde sie einen dringenden Auftrag vorschützen, der eine Observation bis in die Nacht erforderte. Für solche Spielchen war sie sich zu schade. Glückliche Paare ertrug sie auch noch nicht wieder. Und außerdem wollte sie ihren Eltern nicht über den Weg laufen, am allerwenigsten ihrer Mutter. Sie hatten von Anfang an ihre Ehe mit Doro missbilligt und sie ihr mit drastischen Worten auszureden versucht. Ihre Eltern hatten sogar mit Enterbung gedroht – nicht dass sie irgendwelche Reichtümer zu vererben hätten. Schließlich hatten sie den Kontakt zu Rowan abgebrochen, als sie nach Japan gezogen war, und waren nicht mal zur Hochzeit gekommen.
Als sie nach ihrer Rückkehr zum ersten Mal wieder zum sonntäglichen Familienessen gegangen war, um ihren Willen zur Versöhnung zu zeigen, hatte ihre Mutter, noch als sie in der Tür stand, gesagt: „Gott sei Dank bist du endlich vernünftig geworden und hast nicht noch mehr von deinen besten Jahren in diesem schrecklichen Land vergeudet. Es ist noch nicht zu spät, dir einen guten schottischen Mann zu suchen. Das hättest du von Anfang an tun sollen.“
Rowan hatte sich umgedreht und war gegangen. Sie und Doro hatten einander geliebt, verdammt, und Rowan hatte Japan lieben gelernt. Es gab dort eine Menge, das sie hier vermisste. Die Kirschblüte, die Steingärten, die Bambuswälder, ihre Arbeit – und Doro.
Sie schüttelte die Gedanken ab und nahm den letzten Brief zur Hand. Er war erheblich dicker als die anderen, fast schon ein kleines Päckchen, und handschriftlich adressiert. Da er keine Briefmarke und keinen Poststempel trug, war er offenbar von einem Eilboten oder vom Absender persönlich in ihren Briefkasten geworfen worden. Als sie ihn öffnete, fielen drei Bündel Hundert-Pfund-Noten heraus. Sie zählte die Scheine. Dreitausend Pfund. Wer schickte ihr so viel Geld?
Sie faltete den beigefügten Brief auseinander, zwei Bögen, mit dem Computer geschrieben. Absender war ein Mann namens Finn Macrae, Captain der 52nd Infantry Brigade. Er schrieb, dass er sich nach gründlichen Recherchen über die in Edinburgh ansässigen Privatermittler für Rowan entschieden hätte, weil sie in dem Ruf stand, gründliche und saubere Arbeit zu liefern und absolute Diskretion zu wahren. Auf die käme es ihm besonders an. Er hege den Verdacht, dass seine Frau ihn betrüge und brauche dafür Beweise. Das Bargeld sei als Honorar für den gesamten Auftrag gedacht. Zusätzlich anfallende Spesen würde er vergelten, sobald er von Rowan einen Abschlussbericht erhalten habe. Er erwarte ihren ersten Zwischenbericht am nächsten Mittwoch unter der angegebenen Postfachadresse, welche die der Garnison der Zweiundfünfzigsten in den New Barracks des Edinburgh Castle war.
Rowan lehnte sich zurück. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Nach ihrer beruflichen Erfahrung mit untreuen Ehepartnern brauchte sie keine Woche, um die Untreue zu beweisen, falls sein Verdacht zutraf. Macrae würde vielleicht schon am Mittwoch ihren Abschlussbericht erhalten. Sie verstand absolut nicht, warum er ihr so viel Geld schickte, ohne vorher überhaupt mit ihr gesprochen zu haben. Und vor allem, ohne sich zu vergewissern, dass sie den Auftrag auch annahm.
Die folgenden Sätze seines Briefes lieferten eine Erklärung: Macrae wollte nicht, dass seine Frau ahnte, dass er sie beschatten ließ, weshalb er auf eine persönliche Kontaktaufnahme mit Rowan im Vorfeld verzichtete. Das Bargeld diente dazu, dass keine Abbuchungen für die Detektei auf seinem Konto auftauchten und die Ehefrau misstrauisch machten.
Dem Brief war ein Foto seiner Frau beigelegt. Rowan verspürte einen kleinen Stich, als sie sah, dass die Frau Asiatin war. Ob Doro sich inzwischen eine neue Frau genommen hatte? Seine Eltern hatten ihn wahrscheinlich dazu gedrängt. Aber wenn dem so wäre, hätte er ihr das mitgeteilt. Sie legte das Foto zur Seite.
Seine Frau Jin-Hee sei Koreanerin, schrieb Macrae, und er erst seit zwei Jahren mit ihr verheiratet. Am Anfang sei es die große Liebe gewesen und war es von seiner Seite aus immer noch. Aber schon kurz nach der Hochzeit hätte seine Frau begonnen, sich emotional von ihm in einer Weise zurückzuziehen, die ihn immer mehr zu dem Schluss kommen ließ, dass ein anderer Mann im Spiel sein musste. Da seine Arbeit in der Administration der Brigade ihn zu sehr beanspruche – das war wahrscheinlich der Grund für ihr Fremdgehen – konnte er sich nicht persönlich darum kümmern. Deshalb der Auftrag an Rowan. Sollte sie ihn nicht annehmen können, erwarte er die Rücksendung des Geldes an dasselbe Postfach. Es folgten noch ein paar Details über seine Frau und ihren gewöhnlichen Tagesablauf. Der Brief schloss mit der inbrünstigen Hoffnung Macraes, dass er sich irre und sein Verdacht sich nicht bestätige.
Das hoffte Rowan in seinem Interesse auch. Doch aus ihrer beruflichen Erfahrung wusste sie, dass eine solche Hoffnung fast immer vergeblich war. Sie sah auf die Uhr. Bevor sie sich auf die Lauer legte und Jin-Hee Macrae beschattete, musste sie sich erst einmal ein Bild vom Haus der Macraes machen, um den günstigsten Standort herauszufinden, an dem sie nicht auffiel. Sonst könnte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei rufen, und das wäre nicht nur der Beschattung abträglich, sondern auch Rowans Ruf. Aber sie hatte zu Hause ihr eigenes Anzen-Unternehmen geführt, eine Sicherheitsfirma, deren Hauptaufgabe darin bestanden hatte, Personenschutz für die Frauen ausländischer Staatsgäste zur Verfügung zu stellen. Sie kannte sich mit dem unauffälligen Ausspähen eines Umfeldes und Überwachung in jeder Hinsicht bestens aus.
Der Trick dabei bestand erstens darin, vorher alle möglichen Punkte zu entdecken, von denen aus ein Attentat möglich wäre, ohne dass die Anwohner bemerkten, dass Rowan und ihre Leute sich umsahen. Trick zwei: Sie und ihre Mitarbeiter mischten sich teilweise unter die Leute, so unauffällig, dass ein etwaiger Attentäter sie nicht als Sicherheitsleute identifizieren konnte. Andere Menschen zu beschatten, ohne selbst bemerkt zu werden, war ihre Spezialität.
Seltsam, dass Japan für sie nach über einem Jahr immer noch der Ort war, an dem sie sich zuhause fühlte. Sie hatte damals Jahre gebraucht, um sich dort einzuleben, nicht nur weil ihre Schwiegereltern ihr am Anfang bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Gefühl gegeben hatten, ein störender Fremdkörper zu sein. Japan war faszinierend und exotisch, wunderbar und doch völlig anders als Schottland. An manche Dinge hatte sie sich nie gewöhnen können, etwa an die überfüllten Züge und den rohen Fisch, den es in allen Varianten zum Essen gab. Gar nicht zu reden von der Etikette, die jede Geste und jedes kleine Wort für jede denkbare Situation regelte. Es gab sogar Ausdrücke im Japanischen, die ausschließlich Frauen gebrauchten. Umgekehrt galt es als unhöflich und vulgär, wenn eine Frau stattdessen die „Männersprache“ benutzte. Sie hatte so oft Heimweh nach Edinburgh gehabt. Jetzt war sie wieder da – und hatte Heimweh nach Japan. Verrückt.
Sie schüttelte diese Gedanken ab, schloss das Geld im Safe ein und legte eine neue Akte für den Macrae-Fall an. Anschließend verließ sie das Haus und fuhr nach Merchiston zur Polwarth Terrace 11D, wo Macrae sein Haus hatte. Sie parkte den Wagen um die Ecke in der East Castle Road und nahm eine Einkaufstüte mit ein paar Konserven aus dem Kofferraum, die sie immer zur Tarnung dabeihatte. Mit der deutlich sichtbaren Tüte im Arm ging sie in einem Tempo, als wäre sie zielstrebig auf dem Weg zu einem bestimmten Ort, die Straße entlang. Das Bewusstsein der meisten Menschen nimmt nur das wahr, was es zu sehen erwartet. Eine Frau mit einer Einkaufstüte fiel um diese Tageszeit nicht auf.
Sie sah die Polizeiwagen schon von Weitem. Ein kurzer Blick auf die Nummer des Hauses, an dem sie vorbeiging, und die Anzahl der anderen Häuser bis zur Menschentraube, die sich vor dem blau-weißen Absperrband gebildet hatte, verrieten ihr, dass es das Haus der Macraes sein musste. Verdammt, was war da passiert? Sie mischte sich unter die Schaulustigen und versuchte, an den breiten Rücken einiger Männer vorbei etwas zu sehen. Doch bis auf viele Polizisten in Uniform, Zivil und weißen Plastikanzügen, die Spuren sicherten und dafür sorgten, dass die Leute hinter der Absperrung blieben, konnte sie nichts erkennen.
Ein Sarg wurde herausgetragen.
„Oh mein Gott! Das ist doch nicht etwa die Frau vom Captain?“, sagte Rowan wie zu sich selbst, aber so laut, dass die Leute um sie herum es hören konnten.
Ein älterer Mann mit Pfeife im Mund fühlte sich bemüßigt, ihr zu antworten. „Naw, ist wohl der Captain selbst.“ Er musterte sie von oben bis unten. „Kannten Sie ihn?“
„Was man so kennen nennt.“ Sie hob die Einkaufstüte an. „Ich liefere Einkäufe aus.“
Der Mann sog an seiner Pfeife und blies den Rauch aus. „Ich glaub nicht, dass er die noch braucht. Und die Polizei lässt Sie sowieso nicht rein.“
Das erwartete Rowan auch nicht. Aber jetzt hatte sie einen guten Grund, noch eine Weile hierzubleiben. Was war hier passiert? Da die Polizei in so großer Zahl vor Ort war, konnte sie ausschließen, dass Macrae, wenn er es denn war, eines natürlichen Todes gestorben war. In jedem Fall war ihr Auftrag damit hinfällig. Mist! Was sollte sie nun mit dem Geld tun?
Ein Polizeibeamter in Zivil kam aus dem Haus und sprach mit einem Uniformierten. Rowan erkannte ihn sofort. Bill Wallace hatte sich kaum verändert, seit sie ihn vor elf Jahren zuletzt gesehen hatte. Er hatte sie nach ihrem letzten Aufenthalt in Edinburgh, wo sie die letzten Dinge geregelt hatte, bevor sie für den geplanten Rest ihres Lebens nach Japan verschwand, zum Flughafen gebracht, sie umarmt und ihr alles Gute gewünscht. Sie hatte nicht erwartet, ihn jemals wiederzusehen. Doch eigentlich hätte sie damit rechnen müssen, dass früher oder später einer ihrer Fälle sie wieder zusammenführen würde.
Die Art, wie er sich bewegte, war immer noch dieselbe. Und wie früher hatte er die Angewohnheit, sich zweimal mit der Hand von vorn nach hinten durch das Haar zu fahren, bevor er eine Entscheidung traf. Billy Braveheart. Erinnerungen wurden wach, begleitet von einem Gefühl der Wehmut. Da seine Eltern ihn wie viele andere Söhne des Wallace-Clans nach dem schottischen Nationalhelden William Wallace benannt hatten, bekam er wie nahezu alle anderen William Wallaces seit dem Film mit Mel Gibson den Spitznamen „Braveheart“. Dass sie ihn ausgerechnet heute wiedersah...
Sie versuchte, seine linke Hand zu sehen, um zu erkennen, ob er einen Ehering trug. Wahrscheinlich ja. Die Frauen waren schon früher hinter ihm her gewesen. Bill besaß ein angenehmes Wesen, einen tiefgründigen Humor und eine Art, mit Menschen umzugehen, dass man gern mit ihm zusammen war. Nachdem er sich in seinem Traumberuf etabliert hatte, hatte er bestimmt eine Familie gegründet. Rowan war sich sicher, dass sie genau sagen konnte, wie Mrs Wallace sein musste: geradlinig, zupackend, eigenständig und vor allem klug genug, ihm seine kleinen Freiheiten zu lassen. Zum Beispiel den Besuch im Pub einmal die Woche und sein Glas Singleton zum Feierabend.
Bill warf einen Blick auf die Schaulustigen. Sie wusste, was ihm in diesem Moment im Kopf herumging. Falls es sich um Mord handelte – worauf seine Anwesenheit hindeutete –, überlegte er, ob der Täter in der Menge stand. Falls es kein Mord war, versuchte er, anhand des Gesichtsausdrucks der Leute zu erahnen, wer ihm vielleicht Informationen geben könnte, die ihm weiterhalfen. Seine Augen wurden groß, als er Rowan sah. Er nickte dem Beamten zu, mit dem er gesprochen hatte, und kam lächelnd auf sie zu.
„Ah, ist Zeit zu verschwinden“, stellte der Mann mit der Pfeife fest. „Wenn die Polizei erst mal anfängt, Fragen zu stellen, wird man die so schnell nicht wieder los.“
Er ging hastig davon. Andere Umstehende folgten seinem Beispiel. Bill beachtete sie nicht. Er schlüpfte unter dem blau-weißen Absperrband hindurch, blieb vor Rowan stehen und musterte sie von oben bis unten.
„Row? Bist du es wirklich?“
Seine Stimme klang noch genauso, wie sie sie in Erinnerung hatte, warm, dunkel und melodisch.
Sie lächelte. „Nein, ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht und gekommen, um dich heimzusuchen.“
Er lachte über den alten Scherz, den es gab, seit sie als Schulkinder in einer Aufführung von Dickens’ „A Christmas Carol“ mitgespielt hatten, Bill als Ebenezer Scrooge und Rowan als Weihnachtsgeist. Eine denkwürdige Aufführung, da sie beide ganz spontan ihre Figuren auf eine sehr eigene Weise interpretiert hatten, die nicht immer Dickens’ Textvorlage entsprach. Mrs Inglewood, ihre Lehrerin, war entsetzt gewesen. Die Zuschauer hatten dagegen vor Lachen unter den Stühlen gelegen, als Rowan „Scrooge“ mit Fußtritten in den Hintern vor sich hergetrieben und auf diese Weise zum Mitkommen gezwungen hatte. Wobei sie ihm wortreich aufgezählt hatte, was für ein Idiot er war und jedes Wort mit einem Tritt begleitet hatte. Oder als sie ihm eine Kopfnuss verpasst und unverblümt gesagt hatte, dass seine Geliebte eine weise Entscheidung getroffen hätte, Scrooge in den Wind zu schießen, da es bessere Männer als ihn an jeder Straßenecke des Kingdoms gäbe.
Bill fasste sie bei den Schultern und drückte sie, als müsste er sich davon überzeugen, dass sie Substanz besaß und kein Geist war. Kein Ehering oder Verlobungsring an seiner Hand. Er umarmte sie kurz, aber fest, ehe er sie auf Armeslänge von sich weg hielt und ansah. „Row, was machst du hier?“
Sie hob die Einkaufstüte an. „Hab hier was zu tun.“ Nicht gelogen und es widersprach auch nicht ihrer Behauptung vor dem Mann mit der Pfeife. Der war zwar gegangen, aber andere hatten auch mitgehört. Sie wollte niemanden provozieren, sich einzumischen und mit boshafter Genugtuung ihre Lüge auffliegen zu lassen. Davon abgesehen hatte Bill es nicht verdient, dass sie ihn anlog; erst recht nicht bei ihrer ersten Begegnung seit elf Jahren.
„Zu tun? Ist – Hidoro auch hier?“
„Nein. Ich...“ Sie schüttelte den Kopf. Er wollte mehr wissen, das sah sie ihm an. „Ich bin zurück. Allein.“
„Oh. Ist mit deinen Eltern was passiert? Ist jemand...“
„Der Familie geht es gut“, beruhigte sie ihn. „Ich bin einfach wieder da. Was ist hier eigentlich los?“
Er grinste. „Tut mir leid, Row, das darf ich dir nicht sagen, das weißt du doch.“ Er warf einen Blick zum Haus, ehe er sie wieder ansah. „Hast du heute Abend Zeit? Wir könnten uns im Guildford Arms treffen. So wie früher.“
„Aber gern.“ Sie lächelte und stellte fest, dass sie sich schon jetzt darauf freute, mit ihm in Erinnerungen zu schwelgen und zu erfahren, wie es ihm inzwischen ergangen war. Trotz der Jahre in Japan, während der Schottland für sie immer mehr in den Hintergrund getreten war und in denen sie keinen Kontakt mehr zu Bill gehabt hatte, spürte sie einen Hauch der alten Nähe zu ihm. „Um sieben?“
Er nickte. „Das passt gut. Bis heute Abend. Cheerio, Row.“
„Cheerio, Bill.“
Bill ging zum Haus zurück. Bevor er es betrat, drehte er sich noch einmal um und winkte ihr zu. Rowan winkte zurück und ging anschließend zu ihrem Wagen. Sie war sich sicher, dass sie heute Abend erfahren würde, was hier passiert war. Bill mochte in der Öffentlichkeit als der korrekteste Polizist auftreten, den es gab, aber wenn er mit ihr unter vier Augen war, würde er reden. Bis heute Abend konnte sie noch ein paar Dinge erledigen.
Sie fuhr nach Hause. Als sie den Wagen vor dem Haus parkte, hielt ein Taxi hinter ihr, aus dem Rory Lennox ausstieg. Er bezahlte den Fahrer und holte zwei prall gefüllte Seesäcke aus dem Kofferraum, die er sich auf die Schultern lud. Rowan hielt ihm die Gartentür auf.
„Danke, Ma’am.“
„Sie können vorn mit mir durchkommen. Dann müssen Sie nicht hinten rum reingehen.“
Er nickte. Rowan schloss die Haustür auf und wollte ihn eintreten lassen. Er ließ ihr mit einem Nicken den Vortritt. Sie hatte sich immer noch nicht wieder daran gewöhnt, dass in Schottland die Höflichkeit gebot, den Frauen den Vortritt zu lassen. In Japan war es umgekehrt. Sie ging durch den Flur und schloss die Tür auf, die den hinteren Bereich des Hauses von ihrem trennte.
Lennox blieb stehen. „Hab gesehen, dass Sie da im Keller einen feinen Trainingsraum haben, Ma’am. Hätten Sie was dagegen, wenn ich ihn ab und zu mitbenutze? Gern auch gegen Gebühr.“
„Solange ich darin keinen Unterricht abhalte, können Sie ihn benutzen, wann Sie wollen. Auch ohne Gebühr.“
Er blickte sie ausdruckslos an. „Darf ich fragen, was Sie unterrichten?“
„Selbstverteidigung für die Allgemeinheit und Togakure für einige handverlesene Schüler.“ Sie grinste. „Dass ich Kampfkunst unterrichte, sollte Ihnen die Einrichtung des Dojos längst verraten haben.“
Er grinste ebenfalls. Für einen Moment. „Das hat sie.“ Er zögerte kurz. „Hätten Sie vielleicht Bettzeug, das Sie mir leihen können?“ Er hob die Seesäcke an. „Mein ganzer gegenwärtiger Besitz. Ich werde mir in den nächsten Tagen ein paar Dinge zukaufen. Es ist Ihnen doch recht, wenn ich mich sozusagen ausbreite?“
Sie nickte. „Sie haben die Wohnung gemietet, Sie können sich darin ausbreiten, wie Sie wollen. Solange Sie sie nicht demolieren.“
Er schüttelte den Kopf. „Hab ich nicht vor.“
„Ich bringe Ihnen gleich das Bettzeug.“
„Danke, Ma’am.“
„Und sagen Sie nicht immer ‚Ma’am‘ zu mir. Dann komme ich mir so alt vor.“
Er grinste. „Keine Sorge, Ms Lockhart, das sind Sie noch lange nicht.“
Sie nickte ihm zu. „Wenn Sie sonst noch was brauchen, scheuen Sie sich nicht zu fragen.“
„Mache ich.“ Er sah sie nachdenklich an. „Scheint Ihnen tatsächlich nichts auszumachen, dass ich Söldner war.“
„Haben Sie das erwartet, obwohl ich Ihnen die Wohnung vermietet habe?“
Er wiegte den Kopf. „Menschen sind manchmal seltsam. Ich habe gelernt, mit allem zu rechnen.“
Das hatte sie auch, nachdem ihre Lebensplanung schon zweimal eine ganz andere Wendung genommen hatte, als sie gedacht hatte. „Wir haben alle unsere Vergangenheit, Mr Lennox. Ich werde Ihnen Ihre ganz sicher nicht vorhalten. Mal ganz abgesehen davon, dass sie mich nichts angeht.“ Sie blickte ihn aufmerksam an. „Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass Sie was Bestimmtes auf dem Herzen haben.“
Er sah ihr sekundenlang in die Augen, ehe er den Kopf schüttelte. „Ich möchte nur sichergehen, dass ich eine Weile bleiben kann. Idealerweise lange genug, um zur Ruhe zu kommen. Falls Ihnen also inzwischen irgendwelche Zweifel gekommen sein sollten...“
„Ganz und gar nicht. Wie ich schon sagte, solange Sie nicht die ganze Zeit Partys feiern oder randalieren, können Sie bleiben, so lange Sie wollen.“
„In Ordnung.“ Er tippte sich grüßend an die Stirn und stieg die Treppe hinauf.
Rowan ging in ihr Büro. Lennox war ein merkwürdiger Typ, aus dem sie nicht so richtig schlau wurde. Eigentlich brauchte sie keine lange Unterhaltung mit jemandem, um ihn beurteilen zu können. Sie besaß nicht nur als Ermittlerin eine gute Beobachtungsgabe und Intuition. Ihre zehnjährige Kampfkunstausbildung hatte beides noch mehr geschärft, ebenso wie all ihre Sinne. Schließlich gehörte nicht nur die Entwicklung körperlicher Fähigkeiten, sondern auch das Trainieren der geistigen und spirituellen Fähigkeiten zum Togakure-ryu.
Trotzdem fiel es ihr schwer, Lennox einzuschätzen. Er wirkte, als wäre er nicht ganz in dieser Welt. Wenn er wie sie mehrere Jahre fern seiner Heimat verbracht hatte, war es kein Wunder, dass er deplatziert wirkte, irgendwo dazwischen und nirgendwo zu Hause.
Verdammt, sie fühlte sich doch auch immer noch fremd. Und die Telefonate mit Doro und die Briefe, die sie sich schrieben – manchmal sogar Haikus und Senryus in schönster Kalligrafie –, trugen auch nicht dazu bei, dass sie wieder mit Herz und Seele in Schottland zu Hause war. Wie sollte sie? Japan war in ihre Seele gedrungen wie Doro in ihr Herz. Beide würden für immer darin sein. Schottland bekam den Rest. Und der war gegenwärtig nicht annähernd so groß, wie Rowan sich das wünschte.
Wie so oft hatte sie das Gefühl, einen großen Fehler begangen zu haben, indem sie Doro und Japan verlassen hatte. Sie holte das handgeschöpfte Papier, Tuschestein und Pinsel aus der Schublade, rührte die Tusche an und schrieb ein Senryu, nur drei Zeilen zu fünf, sieben und wieder fünf Silben. Mit der linken Hand. Doro würde erkennen, dass sie es mit links geschrieben hatte, obwohl sich die Kanji-Schriftzeichen nur subtil von denen unterschieden, die sie mit rechts schrieb. Über die auf den ersten Blick unverfänglichen Worte hinaus würde der Gebrauch der linken Hand ihm sagen, wie es um sie stand. Wenn er das Senryu las, würde er sie in Gedanken in die Arme nehmen und trösten.
Sie vermisste ihn so sehr. Aber es gab keinen Weg zurück, nachdem sie ihre Wahl getroffen hatte. Eine Wahl, die sie hatte treffen müssen, weil sie keine Japanerin war und niemals wirklich eine hätte sein können. Dazu steckte Schottland zu tief in ihr. Doch das hatte sie erst in dem Moment begriffen, in dem sie sich hatte entscheiden müssen.
Als eine Träne auf das Papier tropfte und den letzten Pinselstrich verwischte, wurde ihr bewusst, dass sie weinte. Sie wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Es hat keinen Sinn zu weinen, denn Tränen ändern nichts – eines der Mantras in der Nobushi-Familie, das sie wie so viele andere verinnerlicht hatte. Tränen mochten keinen Sinn haben, aber sie erleichterten einem das Leben manchmal ungemein. Vor allem die Seele.
Sie faltete das Papier mit dem Senryu sorgfältig zusammen, nachdem die Tusche getrocknet war, steckte es in einen Umschlag und schrieb Doros Adresse darauf. Sie würde ihn nachher auf dem Weg zum Guildford Arms in den Briefkasten werfen. Bevor sie noch deprimierter wurde, schaltete sie Musik ein – „Whisper In The Dark“. Dann nahm sie die Mappe, in der sie Macraes Brief abgeheftet hatte, und las ihn noch einmal durch. Macrae war tot und der Auftrag damit hinfällig. Eigentlich müsste sie das Geld seiner Witwe zurückgeben, die schließlich seine gesetzliche Erbin war. Aber wäre das klug?
Das musste sie nicht jetzt entscheiden. Am besten, sie wartete ab, was Bill heute Abend zu berichten hatte. Danach würde sie wissen, was sie tun sollte.
Bill blickte sich noch einmal am Tatort um. Im Moment gab der nichts mehr preis, was ihm hätte weiterhelfen können. Das Team von der Spurensicherung war fleißig bei der Arbeit und würde das auch noch eine ganze Weile bleiben. Er war hier überflüssig. Also zurück zum Revier. Selbstmord oder nicht, es gab eine Menge zu tun. Zum Beispiel Macraes Hintergrund zu überprüfen. Auch ein Selbstmord hat einen Grund, und es war Bills Pflicht, ihn herauszufinden.
Sergeant Armstrong kam zurück. „Ich habe Mrs Macrae im City Hotel untergebracht, Sir. In einem ordentlichen Zimmer, das...“
„Ich nehme an, Sie haben ihr noch ein bisschen auf den Zahn gefühlt.“ Bill sah Armstrong auffordernd an.
„Ja, Sir. Meine Vermutung, dass es sich bei den Macraes um eine Scheinehe gehandelt haben könnte, trifft nicht zu. Mrs Macrae ist britische Staatsbürgerin. Das war sie schon ungefähr ein Jahr, bevor sie ihren Mann geheiratet hat. Sie lebt seit über acht Jahren im Land und kam mit ihren Eltern als Flüchtling aus Nordkorea. Den Job als Musiklehrerin hat sie aber erst nach ihrer Heirat mit Macrae bekommen.“
Keine Information, die ihm weiterhalf. Eine laute Stimme ließ ihn zum Eingang blicken. „Wer ist hier verantwortlich?“
Drei Männer in Armeeuniform standen in der Tür und blickten sich suchend um. Redcaps – Mitglieder der Royal Military Police. Verdammt, waren die schnell. Woher wussten sie von Macraes Tod?
„Das bin ich. Detective Inspector William Wallace. Was kann ich für Sie tun?“
Der Älteste der drei kam zu ihm und salutierte. Bill unterdrückte den Impuls, das ebenfalls zu tun.
„Major Kenneth Gallagher, Royal Military Police. Ich habe die Anweisung, Captain Finn Macrae zu verhaften.“ Er sah sich um. Sein Blick blieb auf dem blutverschmierten Sessel haften. „Wo ist er?“
„In der Gerichtsmedizin. Sie kommen zu spät, Major. Mr Macrae wurde heute Mittag tot aufgefunden.“
Gallagher spreizte die Beine schulterbreit und legte die Hände zusammengefaltet auf den Rücken in perfekter At-ease-Haltung. „Tot. Wie?“
„Kopfschuss durch den Mund ins Gehirn. Vermutlich mit seiner eigenen Pistole.“
Gallagher sah an ihm vorbei und betrachtete die Blutspuren an der Wand hinter dem Sessel, in dem Macrae gefunden worden war.
„Selbstmord?“
Bill wiegte den Kopf. „Das wäre möglich. Nach der Autopsie wissen wir mehr. Darf ich fragen, was der Captain sich hat zuschulden kommen lassen?“
„Sie dürfen.“ Gallagher hatte offensichtlich nicht die Absicht, ihm zu antworten. Stattdessen sah er sich weiter um.
„Kommen Sie, Major. So viel werden Sie mir doch wohl sagen dürfen. Ich finde es sowieso heraus. Wir stehen doch alle auf derselben Seite.“
Gallagher sah ihm kurz in die Augen. Bill lächelte gewinnend.
Schließlich nickte der Major. „Er wird beschuldigt, geheime Militärinformationen ins Ausland verkauft zu haben.“
Bill stieß überrascht die Luft aus. „Das wäre Hochverrat.“
„Sie sagen es. In Anbetracht dessen scheint mir Selbstmord recht wahrscheinlich zu sein.“
Das sah Bill genauso. Auch wenn man für Hochverrat nicht mehr gehängt wurde, wie es noch bis 1998 ausschließlich für dieses Verbrechen theoretisch möglich gewesen wäre, hatte ein Verräter mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu rechnen. Von dem ganzen Medienrummel und der damit einhergehenden Schmach gar nicht zu reden. Je nachdem, was für ein Mann Macrae gewesen war, passte es durchaus, dass er sich dem Prozess durch Selbstmord entzogen hatte.
„Wo ist seine Frau? Wir müssen sie befragen.“
Bill hob abwehrend die Hände. „Mrs Macrae ist Zivilistin.“
Gallagher nickte. „Sie könnte mit der Sache zu tun haben.“
„Weshalb? Weil sie aus Nordkorea stammt?“
Wieder sah der Major ihm unbewegt in die Augen, aber sein Zögern verriet ihn.
„Sagen Sie nur nicht, Macrae soll ausgerechnet an Nordkorea verraten haben.“
„Möglicherweise. Also wo ist sie?“
Bill zögerte. Die Frau mochte ihm unsympathisch sein, aber rechtfertigte das, sie der MP auszuliefern? Besonders im Hinblick auf die Tatsache, dass die Royal Military Police kein Recht hatte, Zivilisten zu befragen. „Wir haben sie in einem Hotel untergebracht. Ob Sie sie allerdings befragen dürfen, darüber sollten Sie mit unserem Detective Chief Superintendent Màire Murdoch sprechen. Sie wird das entscheiden.“
Gallagher, der immer noch in At-ease-Haltung vor ihm stand, kniff die Augen zusammen. „Sie wissen, dass die Military Police auch das Recht hat, Zivilisten festzunehmen, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, dass sie in ein Verbrechen involviert sind, selbst wenn das nicht unbedingt einen Bezug zum Militär hat.“
Bill nickte. „Das ist mir bewusst, Major. Das gilt aber nur für den Fall, dass kein nicht-militärischer Polizist greifbar ist, um die Festnahme vorzunehmen. Sie haben nicht das Recht, ohne Weiteres eine Zivilistin zu befragen. Nicht einmal, wenn sie tatsächlich ein Verbrechen begangen hätte.“ Er hob eine Hand, als Gallagher etwas sagen wollte. „Wenn ich Sie recht verstanden habe, gibt es keine Beweise dafür, dass Mrs Macrae an dem Verrat ihres Mannes beteiligt war.“
Gallagher presste kurz die Lippen zusammen. „Nein. Bis jetzt nicht.“
„Wie gesagt: Sprechen Sie mit Chief Superintendent Murdoch. Major, wir müssen die Frau sowieso befragen. Wenn sich dabei etwas für Sie Relevantes ergibt, sehe ich keinen Grund, die Informationen nicht mit Ihnen zu teilen. Oder Sie an der Befragung teilnehmen zu lassen, wenn die Chefin das gestattet.“
Man sah Gallagher an, dass ihm das nicht gefiel. Schließlich nickte er. „In Ordnung. Kann ich einen Blick in seine Unterlagen werfen? Ich brauche auch seinen Computer.“
„Gern, Major.“ Bill hielt ihn mit einer Handbewegung zurück, als er in Macraes Arbeitszimmer gehen wollte, das dem Wohnzimmer gegenüber lag. „Nachdem wir hier fertig sind und alles ausgewertet haben, was für den Fall relevant ist. Das hier ist immer noch ein Tatort. Wenn wir was finden, das für Sie interessant ist, stelle ich Ihnen einen Bericht zusammen. Mit Erlaubnis der Chefin bekommen Sie auch die Beweismittel.“
Gallagher wusste, dass er sich vorerst damit begnügen musste. Er nickte knapp. „Schicken Sie die Sachen zum New Barracks Block beim Castle. Wir sind dort untergebracht, bis die Sache geklärt ist.“ Er reichte Bill eine Visitenkarte. „Ich freue mich, von Ihnen zu hören, Inspector.“
Er salutierte, machte auf dem Absatz kehrt und wies seine Leute mit einer Kopfbewegung an, ihm zu folgen. Bill atmete auf, als er das Haus verlassen hatte.
„Ich mag den Kerl nicht“, stellte Sergeant Armstrong fest. „Ein arroganter Arsch. Pardon, Sir.“
„Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Allerdings steht er unter verdammtem Druck, falls sich die Anschuldigungen gegen Macrae bewahrheiten sollten.“ Bill schüttelte den Kopf. „Mit so was habe ich nicht gerechnet.“
„Das erklärt in jedem Fall den Selbstmord, Sir.“
„Ja, wahrscheinlich. Kommen Sie, fahren wir zurück zum Revier und informieren die Chefin, bevor Gallagher auftaucht. Sonst kriegen wir eins aufs Dach, weil wir sie nicht vorgewarnt haben.“
Während sie zum Revier fuhren, dachte Bill über seine unerwartete Begegnung mit Row nach. Was hatte sie damit gemeint, dass sie zurück sei? Er wagte kaum zu hoffen, dass es das bedeutete, was er vermutete.
Heute Abend würde er Gewissheit erhalten.
ZWEI
Bill betrachtete kritisch sein Spiegelbild und fuhr noch einmal mit dem Kamm durch seine dunklen Locken. Er erinnerte sich, dass Row seine Locken schick gefunden hatte. Er erinnerte sich noch sehr genau an alles, was Row betraf.
Kaum war er nach der Begegnung mit ihr wieder im Büro gewesen, hatte er sofort alles über sie in Erfahrung gebracht, was die Datenbanken hergaben, auf die er Zugriff hatte. Erleichtert hatte er festgestellt, dass sie nicht nur wieder in Edinburgh wohnte, sondern offensichtlich dauerhaft bleiben wollte; andernfalls hätte sie wohl kaum ein Haus gekauft. Dass sie geschieden war, hatte in ihm einerseits unbändige Freude ausgelöst, wofür er sich andererseits geschämt hatte. Es hätte mit ihnen beiden alles anders kommen sollen, wäre anders gekommen, wenn er damals nicht so ein Feigling gewesen wäre und einen Riesenbammel vor seiner eigenen Courage gehabt hätte.
Er und Row waren als Nachbarskinder zusammen aufgewachsen. Sie hatten gemeinsam die Gang von der linken Seite der Loaning Crescent angeführt und so manches Mal die Gang von der rechten Seite der Straße siegreich verdroschen. Unter anderem deshalb hatte er sie von Anfang an „Row“ genannt; nicht nur als Abkürzung ihres Namens, sondern auch in der Bedeutung des Wortes als „Krawall“ und „Prügelei“ – für beides war Row jederzeit gut gewesen. Sie waren zusammen zur Schule gegangen, hatten gemeinsam gebüffelt und das Lernen im Sommer zugunsten von Badeausflügen und weitaus verboteneren Dingen unter den Tisch fallen lassen. Sie hatten in Kincardine das Scottish Police College besucht und zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Bill hatte nie einen besseren Kumpel gehabt als Row.
Nur eines waren sie nie gewesen: ein Paar.<1 Und das war seine Schuld. Er erinnerte sich noch genau an den Moment, in dem er begriffen hatte, dass Row ihm nicht nur als Kumpel eine Menge bedeutete. An einem Abend in ihrem letzten Studienjahr waren sie nach einem Absacker im College Pub noch eine Weile im Park um Tulliallan Castle spazieren gegangen, in dem das College untergebracht war. Das hatten sie schon oft getan. Vielleicht hatte es daran gelegen, dass Bill nicht mehr ganz nüchtern gewesen war, vielleicht auch daran, wie das Mondlicht auf Rows kastanienbraunem Haar schimmerte. Warum auch immer, mit einem Mal war ihm bewusst geworden, dass sie nicht nur ein Kumpel war, sondern auch eine Frau. Eine Frau von wilder Schönheit wie die Highlands.
In diesem Moment hatte er begriffen, dass er bis ans Ende seiner Tage mit ihr leben wollte. Er hätte sie küssen, sie zumindest umarmen, ihre Hand halten oder irgendwas tun sollen, um ihr zu zeigen, dass er sie begehrte. Dann wäre alles anders gekommen. Aber er hatte den Moment verstreichen lassen und in den darauf folgenden Tagen – Wochen, um ehrlich zu sein – zu lange herauszufinden versucht, ob seine plötzlich erwachte Liebe zu ihr nicht eine whiskygenerierte Illusion war.
Denn in dieser Zeit war Hidoro Nobushi im Rahmen eines Austauschprogramms ans College gekommen. Der Japaner und Row hatten sich auf den ersten Blick ineinander verliebt und waren von da an unzertrennlich gewesen. Es hatte Bill eine Menge Selbstbeherrschung gekostet, mit keiner Geste und keinem Blick zu offenbaren, wie eifersüchtig er war und dass er „Doro“ am liebsten zum Mond geschossen und die Rakete auf dem Weg dorthin gesprengt hätte. Stattdessen hatte er sich an die Hoffnung geklammert, dass es sich bei den Gefühlen der beiden nur um ein Strohfeuer handelte, das bald verlöschen würde.
Das Gegenteil war der Fall gewesen. Als Row ihren Abschluss in der Tasche hatte und Hidoro nach Japan zurückkehrte, war sie mit ihm gegangen. Ein paar Wochen später hatte Bill einen Brief mit der Einladung zur Hochzeit der beiden erhalten. Er hatte mit der Behauptung abgesagt, dass er mitten in einem Fall stecke und keinen Urlaub genehmigt bekäme. Später folgten weitere Briefe von Row, die Bill aber immer seltener beantwortete. Er ertrug es nicht, zwischen allen Zeilen zu lesen, wie glücklich sie war. Natürlich gönnte er ihr alles Glück der Welt, keine Frage. Aber es schmerzte ihn zutiefst, dass sie mit einem anderen Mann glücklich war, nur weil er nicht schnell genug reagiert hatte.
Bill hatte geglaubt, dass er irgendwann darüber hinwegkommen würde, hatte sich in Affären gestürzt und in seine Arbeit. Der Schmerz war ebenso geblieben wie die Reue über diese eine verpasste Gelegenheit, die dafür verantwortlich war, dass er in all den Jahren kein einziges Mal wirklich glücklich gewesen war.
Bill drehte sich noch einmal vor dem Spiegel hin und her und fand, dass er akzeptabel aussah. Ordentlich, aber nicht übertrieben herausgeputzt. Der Zeitpunkt war noch nicht gekommen, an dem er ihr offenbaren konnte, was er für sie empfand. Er atmete tief durch, wünschte sich Glück und machte sich auf den Weg.
Das Guildford Arms in der West Register Street war nicht nur ein Pub der gehobenen Klasse mit angeschlossenem Restaurant und als solches eine Touristenattraktion, es war auch Bills und Rows Stammtreffpunkt gewesen, nachdem es ihnen mit achtzehn Jahren erlaubt war, einen Pub zu besuchen und Alkohol zu trinken. Zur Feier ihres achtzehnten Geburtstages – Bill war auf den Tag genau zwei Wochen jünger als Row – waren sie ins Guildford gegangen und hatten begonnen, sich durch das Angebot zu trinken. Im Laufe der folgenden Monate hatten sie der Reihe nach jede Biersorte, jeden Wein und natürlich jeden der exquisiten Single Malts probiert, die der Pub anbot.