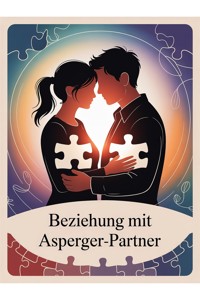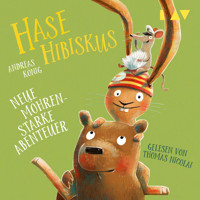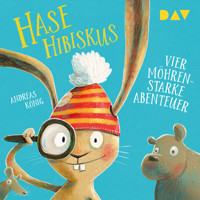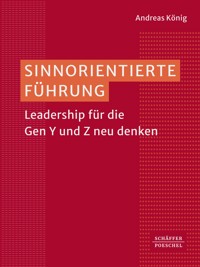
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sinnorientierte Führung ist wegen ihrer intuitiven Logik theoretisch wie praktisch außerordentlich effektiv. Sie hilft Führungskräften zu einer inneren Haltung zu gelangen, die auch in komplexen Situationen besteht und eine klare Orientierung gibt. In der VUCA-Welt sind dies wichtige Voraussetzungen für Handlungsfähigkeit und für eine ethische Ausrichtung des Führungshandelns. Führen auf Sinn hin auszurichten bewirkt außerdem, dass Hierarchie und Macht an Bedeutung verlieren, was diese Führungsphilosophie gerade für das Führen von Mitarbeiter:innen der Generationen Y und Z besonders attraktiv und wirksam macht. Das Buch führt anschaulich und nachvollziehbar in das sinnorientierte Denken ein und dekliniert die neue Führungsphilosophie systematisch für die wichtigsten Führungsfunktionen durch. Damit erwerben junge Führungskräfte praktische Anleitungen für konkretes Entscheiden und Handeln, und erfahrene Führungskräfte gewinnen eine philosophisch und ethisch reflektierte Basis für eine inspirierende Führungshaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumDanksagung1 Einleitung 1.1 Leitfragen und Denkwege1.2 Form und Verarbeitung 1.3 Der rote Faden 2 Sinnorientierte Führung – Einführung und Grundlagen2.1 Überblick 2.2 Grundprinzipien sinnorientierter Führung 2.3 Was ist Sinn? 2.4 Was ist der Sinn einer Organisation? 2.4.1 Der Sinn von einer Organisation2.4.2 Der Sinn in einer Organisation 2.5 Wie können Sinnfindung und Führung vermittelt werden? Zur Führungslogik von Sinn 2.6 Sinnorientierung der Führungskraft 2.6.1 Wer bin ich als Führungskraft – und wozu? 2.6.2 Das eigene Umfeld kennen2.6.2.1 Das organisationale Umfeld 2.6.2.2 Das persönliche Umfeld 2.6.3 Wege zum »Sinn-Bild« von einer Organisation3 Die Führungsbeziehung3.1 Überblick 3.2 Theorien und Modelle von Führung3.2.1 Zum Nutzen von Führungstheorien 3.2.2 Ziele und Funktionen von Führung 3.2.3 Kultur und Organisation als Kontext 3.2.4 Ebenen der Führung3.2.5 Aspekte von Führung in den Theorien3.2.6 Weg-Ziel-Theorie der Führung 3.2.7 Führungsmodell komplementärer Führung 3.3 Führungspersönlichkeit3.3.1 Definition und Kategorien von Führungspersönlichkeiten3.3.1.1 Charismatischer Führungstyp3.3.1.2 Visionärer Führungstyp3.3.2 Führungspersönlichkeit – Zwischenfazit3.3.2.1 Charisma statt Fachkompetenz?3.3.2.2 Sinnorientierung und Führungsperson3.3.3 Einladung zur Reflexion 3.4 Selbst- und Fremdbild ermitteln: Johari-Fenster 3.5 Führungsstile3.5.1 Abriss historischer Stiltheorien3.5.2 Situativer Führungsstil3.5.3 Transaktionale Führung3.5.4 Transformationale Führung 3.5.5 Ethische Führungsstile3.5.6 Führungsstile – Zwischenfazit und Kritik 3.5.7 Theoretische Einordnung sinnorientierter Führung3.5.8 Einladung zur Reflexion 3.6 Motivieren3.6.1 Motivation – was ist das?3.6.2 Motivationstheorien und ihre Kategorien3.6.3 Motivieren – geht das?3.6.4 Zwischenfazit und Kritik3.6.5 Fallbeispiel: Motivation und Sinnorientierung3.6.5.1 Ausgangslage3.6.5.2 Aufgabe3.6.5.3 Diskussion möglicher Interventionen3.6.5.4 Zum Konzept sinnorientierter Interventionen3.6.6 Einladung zur Reflexion3.7 Entscheiden3.7.1 Hilfen für rationales und intuitives Entscheiden 3.7.2 Sinnorientiert entscheiden 3.8 Delegieren 3.8.1 Delegation und Sinnorientierung3.8.2 Einladung zur Reflexion 3.9 Führen, Fragen, Coachen 3.9.1 Persönliches oder direktes Feedback 3.9.2 Gesprächsführung3.9.2.1 Prinzipien und Techniken der Gesprächsführung3.9.2.2 Fragen3.9.3 Coaching 3.10 Sinnorientierung und Führungsperson – Kompetenzanforderungen und Umsetzungen 4 Struktur – Kultur – Organisation 4.1 Überblick 4.2 Führung und Organisation – eine Einführung 4.3 Personelle vs. strukturelle Führung 4.4 Führungshandeln in der Organisation gestalten 4.4.1 Einstellungsprozess4.4.1.1 Stellen planen und beschreiben 4.4.1.2 Auswahlgespräche führen4.4.1.3 Instrumente der Potenzialanalyse planen4.4.1.4 Instrumente der Potenzialeinschätzung auswählen4.4.1.5 Leonardo3.4.54.4.1.6 Zwischenfazit4.4.2 Leistung ermöglichen und erbringen4.4.2.1 Ziele als Basis des Führungsprozesses 4.4.2.2 Ziele formulieren 4.4.2.3 Zielerreichung bewerten4.4.2.4 Ziele vereinbaren4.4.2.5 Zielerreichung prüfen4.4.3 Mitarbeiter beurteilen4.4.3.1 Beurteilung als Teil der Unternehmensführung4.4.3.2 Typen von Beurteilungssystemen4.4.3.3 Beurteilungssysteme nutzen4.4.4 Mitarbeiter entwickeln 4.4.4.1 Systeme der Personalentwicklung nutzen 4.4.4.2 Feedbacksysteme 4.4.4.3 Weitere bildungs- und entwicklungsrelevante Systeme nutzen 4.4.4.4 Organisationale (strukturelle) und direkte (personale) Führungsinstrumente der Entwicklung verbinden4.4.5 Mitarbeiter freistellen4.4.6 Führungserfolg kommunizieren 4.5 Struktur – Kultur – Organisation – Sinn 4.5.1 Was sinnorientierte von ethischer Führung lernen kann4.5.2 Diskursethik4.5.3 Diskursethik und das Cluetrain-Manifest 4.5.4 Trotzdem sinnorientiert führen 5 Führen ohne formelle Macht5.1 Überblick 5.2 Macht und Führung 5.2.1 Macht in der klassischen Führungsforschung 5.2.2 Was ist Macht? 5.2.3 Was ist Führen ohne formelle Macht? 5.2.4 Führen ohne formelle Macht als Leadership-Kompetenz 5.2.5 Einsatzgebiete des Führens ohne formelle Macht 5.3 Idealtypen von Führung ohne formelle Macht5.3.1 Kommentare zur Klassifikation5.3.2 Kritik an der Klassifikation 5.4 Methodenkompetenzen für das Führen ohne formelle Macht 5.4.1 Verhandeln 5.4.2 Überzeugen 5.4.3 Identifizieren mit Werten 5.4.4 Identifizieren mit Emotionen 6 Kritik und ein ungewöhnliches Nachwort6.1 Rückblick 6.2 Kritiken an der sinnorientierten Führung6.2.1 Kritik von außen6.2.1.1 »Keine Zeit«6.2.1.2 »Sinnorientierung ist ein viel zu hohes Ideal«6.2.1.3 »Sinnorientierung bietet zu viel Freiraum für die Trittbrettfahrer«6.2.2 Kritik von innen6.2.2.1 Sinnorientierung – grenzenlos gut?6.2.2.2 Zu viel des Guten6.2.2.3 Wie erhält man die Kraft für das Sinnstreben aufrecht?6.3 Das Unaussprechliche – Nicht von Sinn sprechen6.4 Am EndeZitierte LiteraturÜber den AutorIhre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Haufe Lexware GmbH & Co KG
myBook+
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buchs zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5937-2
Bestell-Nr. 10968-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5941-9
Bestell-Nr. 10968-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5942-6
Bestell-Nr. 10968-0150
Andreas König
Sinnorientierte Führung
1. Auflage, September 2023
© 2023 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärnter
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Danksagung
Das Studieren, Bearbeiten und Unterrichten von sinnorientierter Führung ist seit vielen Jahren mein beruflicher Schwerpunkt. Auf dieser Reise habe ich in Gesprächen, Coachings, Lehrsituationen und natürlich bei der eigenen Führungstätigkeit immer wieder Gedanken, Kritiken und Anregungen aufnehmen dürfen. Hier alle Denkpartner, Kritiker und Inspiratoren zu nennen, ist mir nicht möglich, sodass der Dank für die Zuträge an diese Weggefährten alle gleichermaßen gehen muss.
Besonders hervorheben möchte ich indes einige Menschen, ohne die dieses Buch vermutlich nicht hätte entstehen können.
Mein wichtigster inhaltlicher Sparrings-Partner, Kritiker und Inspirator auf dem Weg, Sinnorientierung über die letzten Jahre hinweg zu erkunden, ist Prof. Dr. Markus Grottke. Dir danke ich für zahllose Gespräche, geduldige Reviews meiner Textversionen, für Deine Verbesserungsvorschläge und Textbeiträge, die geholfen haben, dieses Gedankenwerk entstehen zu lassen.
Ein ganz besonders herzlicher Dank geht an alle meine Kolleginnen und Kollegen aus der SRH-Hochschule in Calw. Die Möglichkeit, mit Euch zu arbeiten, war eine Sternstunde meines Berufslebens, für die ich zutiefst dankbar bin. Bei den Schätzen, die ich in die »Scheune meiner Lebensernte«, wie FranklFrankl, Victor E. sagt, einfahren darf, hat die Zeit mit Euch ganz besonderen und kostbaren Stellenwert. Danke dafür – und für die Erfahrungen, die dieses Buch erst möglich gemacht haben.
Ein weiteres Dankeschön geht an den Schäffer-Poeschel Verlag, und dort insbesondere an meinen Gesprächspartner Dr. Frank Baumgärtner. Sie haben die Bedeutung des Themas erkannt und intern vertreten und damit ganz konkret das Erscheinen dieses Buches mit ermöglicht.
Und dann danke ich meiner Frau Kerstin für ihre unendliche Geduld, wenn es am Rechner mal wieder länger gedauert hat, für die Nachsicht, dass Gedanken oder gar Arbeiten am Manuskript so viele Wochenenden und Ferien eingenommen haben, für das Versorgen, Begleiten und Bestärken während der Jahre, in denen die Erfahrungen, das Wissen und die Schreibarbeit zu diesem Buch entstanden sind. Ohne Dich wäre dieses Buch sicher nicht möglich gewesen.
1 Einleitung
Ich habe in diesem Buch vor, Sie mit sinnorientierter Führung bekannt zu machen, einem besonderen und mit Blick auf die gängige Literatur- und Trainingslandschaft immer noch ungewöhnlichen Ansatz. Spontan wird man sich eine solche Art der Menschenführung so vorstellen, dass das gemeinsame Handeln auf Sinnerfüllung ausgerichtet ist. Im Führungsumfeld ist das keine triviale Aussage, denn darin ist sonst eindeutig ein Diskurs dominant, der Führen auf Ziele und Zielerfüllung hin anlegt. Wir werden zu klären haben, worin die wesentlichen Unterschiede beider Ansätze bestehen und welche Berechtigung ein sinnorientierter Ansatz vor diesem Hintergrund hat.
Die sinnorientierte Führung hat aber das Rad der Führung nicht neu erfunden, sondern setzt nur spezifische und sehr wichtige, weil systemisch wirkende Akzente. So gesehen behandelt das Buch quasi »Leadership unter besonderer Berücksichtigung sinnorientierter Führung«.
Ich werde mich darin bemühen, Ihnen ein Bild von und einen Zugang zu MenschenführungMenschenführung im Allgemeinen zu geben und hernach jeweils untersuchen, was sich unter Bedingungen der Sinnorientierung verändert. Von diesem Vorgehen verspreche ich mir einerseits, dass junge Führungskräfte einen soliden Einstieg in das Führen von Menschen erhalten und dennoch am Ende selbst und bewusst die Wahl treffen können, was aus dem Kanon der Stimmen am besten zu ihnen passt. Erfahrene Führungskräfte können andererseits mit der Gegenüberstellung leichter erkennen, um welche Akzente Sinnorientierung ihr Führungshandeln bereichert. So gesehen lege ich einen Schwerpunkt in meiner Darstellung auf die sinnorientierte Führung als einer Philosophie innerhalb einer viel größeren Führungslandschaft.1
Ich will Ihnen weiter zum einen transparent machen, warum ich Sie mit diesem immer noch außergewöhnlichen Ansatz konfrontiere, statt etwa mit einer Quintessenz gängiger, empirisch gestützter Führungstheorien. Zum anderen muss die Frage beantwortet werden, warum denn dieser Ansatz bisher nicht weitere Verbreitung gefunden hat, wo ihm hier doch so viel zugetraut wird.
Ich habe folgende Gründe für meine Einlassung:
Erstens haben wir mit sinnorientierter Führung eine Führungsweise vor uns, die theoretisch besonders attraktiv ist. Attraktiv bedeutet dabei, dass sie in besonderem Maße schlicht und einfach nachzuvollziehen ist, dass sie als Modell oder Theorie auf wenigen Sätzen beruht, aus denen sich zahllose Handlungsorientierungen ableiten lassen. Sie schafft, was wenig andere vermögen, nämlich mit wenig Worten viel zu bedeuten und zu bewirken. Wir haben also eine effiziente TheorieSinnorientierte Führung, Effizienz hinsichtlich der Aneignung aus Sicht einer immer zeitknappen Führungskraft vor uns.
Einmal verstanden ermöglicht sie Zugänge zu großen Energien mit erstaunlich geringem Führungsaufwand. Betriebswirtschaftlich formuliert stellt sie nach meiner Einschätzung und meinem Erleben also eine Theorie dar, die eine große Menge effektiver Mitarbeiterhandlungen mit einer extrem geringen Menge an Führungshandlungen auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt hin koordinieren kann. So gesehen ist sie effizient aus Sicht der Führungskraft hinsichtlich der Wirkungen, weil ihre Kosten-Aufwand-Relation unschlagbar ist.
Zweitens habe ich sinnorientierte Führung in meiner eigenen Führungstätigkeit als besonders erfolgreich erlebt. Sie ist sozusagen eine besonders effektive Führungsmethode. Das ist gleich doppelt relevant, weil Sie als Leser einerseits von mir als Hochschullehrer erwarten, Ihnen gerade solche Wege aufzuzeigen, die Ihnen ermöglichen, eine gute bzw. noch bessere Führungskraft zu sein bzw. zu werden. Andererseits bildet diese Effektivität auch einen Unterschied zu zahlreichen anderen Führungsansätzen, deren Erfolgswahrscheinlichkeit immer in einer Vielzahl kovarianter Variablen liegt: Führungsperson und -situation, Reifegrade von Mitarbeitern usw.
Sinn hingegen ist immer, unter allen Umständen und für jeden Menschen stärker anleitend als alle anderen Kräfte, vorausgesetzt allerdings, dass die handelnden Menschen sich entschieden haben, sinnvoll zu handeln. Menschen besitzen ja schließlich – wir leben nicht mehr im Paradies – die Fähigkeit, selbst darüber zu entscheiden, was sie als gut und böse, richtig und falsch erkennen und erstreben wollen. Sie können also ebenso sehr sinnvoll wie sinnlos handeln. Und sie können sinnlose Handlungen anderer in sinnvolle Handlungen wenden.
Sinnorientierte Führung ist also anderen Führungsformen meiner Einschätzung nach überlegen, eben weil sie in ihrem Wesen a) schlicht und nachvollziehbar ist, jedoch gleichzeitig mit weniger Führungshandeln mehr Energien und Potenziale von Menschen und Organisationen freisetzen kann als jede andere (EffizienzEffizienz) und b) weil sie zugleich mit dem eigenen Führungshandeln ein wirkungsvolleres Mitarbeiterhandeln bewirken kann und auch unter zahlreichen Umständen tatsächlich bewirkt (EffektivitätEffektivität).
Sinnorientierte Führung wäre aber lediglich eine weitere Führungsmode und -methode, wenn sie einfach nur effizienter und effektiver wäre als andere. Der dritte Grund, Sie mit dieser ungewöhnlichen Theorie zu konfrontieren, liegt in einem weiteren Aspekt, und zwar ihrer ethischen Schönheit. Sinnorientierte Führung ist nämlich – sozusagen von Natur aus – auf ethisches HandelnHandeln, ethisches angelegt. Von dieser Eigenschaft wird später noch zu sprechen sein. Im Moment muss hier genügen, dass Sinnorientierung per se immer nur auf das hin angelegt sein kann, was zumindest zugleich auch zum Nutzen und Wohle der anderen und des anderen dient. Hier hat sie etwas Wichtiges gemein mit einer Schwester in der Familie der Führungstheorien, der dienenden Führung – davon später mehr.
Viertens ist sinnorientierte Führung eine Art der Führung, die auch in Bezug auf die führende Person selbst Erstaunliches bewirkt. Wo andere Führungsmethoden sich darauf beschränken müssen, die führende Person dadurch zu adeln, dass diese mit ihrer Anwendung im besten Fall Ruhm, Rang und Reichweite, Reichtum und Macht erwirbt, vermag sinnorientierte Führung der Führungsperson eine erfüllende Lebensgestaltung und ein erfülltes Leben zu geben, welches sie letztlich von Ruhm, Reichweite, Reichtum und Macht unabhängig werden lässt und damit insbesondere in krisenhaften Zeiten auch robuster und resilienter macht.
Fünftens und letztens hat sinnorientierte Führung den Vorteil, dass ihr grundlegendes Paradigma einem denkenden und bewussten Menschen zumindest in Ansätzen immer schon vertraut ist. Jeder Mensch ist in der Lage, sein Handeln auf Sinnerfüllung hin anzulegen, ohne dass er dafür eigens geschult werden müsste. Die Aufgabe eines Buchs zum sinnorientierten Führen besteht insofern lediglich darin, diese grundlegende Fähigkeit zurück in den Garten des Führens von Menschen zu transferieren, aus dem sie insbesondere Ökonomisierung und reduktionistisches Denken vertrieben haben.
Wenn aber nun sinnorientierte Führung eine derart gut funktionierende und effektive Führungsweise ist, warum wird sie dann nicht in jedem Führungsbuch vorgestellt und in jedem Seminar gelehrt, so könnten Sie zu Recht fragen.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund hat mit der Rezeptionsgeschichte der SinnorientierungSinnorientierung, Rezeptionsgeschichte zu tun. Das Gebäude der Sinnorientierung wurde maßgeblich von Viktor E. FranklFrankl, Victor E. begründet, einem jüdischen Arzt und Psychologen, der im deutschsprachigen Raum eigentlich erst in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen hat. Es lässt sich nur spekulieren, ob die Rezeption Frankls im deutschen Sprachraum deswegen geringer war als etwa im angelsächsischen, weil Kriegs- und Schuldtraumata die Wahrnehmung der Literatur von Holocaust-Opfern erschwert haben.
Ein zweiter Grund hat sicher mit der hegemonialen Grundlage der Führungsausbildungen zu tun, nämlich mit dem schon angesprochenen Paradigma wirtschaftlichen bzw. wirtschaftswissenschaftlichen Denkens (und solcher Art ist auch das allermeiste Führungsdenken). Das ist sehr gut für Zielgestaltung, Effektivität und Kontrolle usw. Aber in Bezug auf Fragen der Ethik, NachhaltigkeitNachhaltigkeit und v. a. der »Menschgemäßheit« bewirkt es ein Totalversagen, zumindest sofern es – wie häufig – reduziert gedacht wird. Wäre das anders, müssten wir nicht etwa über den Klimawandel nachdenken.
Ein dritter und zentraler Grund für das Fehlen der sinnorientierten Führung in der gängigen Lehr- und Trainingslandschaft ist hingegen ein ganz anderer. Er ergibt sich aus der Schönheit dieses Ansatzes und aus seiner ethischen Orientierung. Sinnorientierte Führung ist nicht möglich, ohne zutiefst menschlich zu sein und so auch aufzutreten. Sinnorientierte Führung stellt bedingungslose Anforderungen an die ReflexionReflexion seiner selbst, an die Fähigkeit, sich mit dem eigenen Ego wie mit Schicksalsschlägen würdevoll zu konfrontieren. Das schließt Qualitäten ein, die Ausbildung und Beruf in aller Regel weder anstreben können noch wollen. Sie werden ganz sicher im Laufe der Lektüre diese Grenzen kennenlernen und zu entscheiden haben, ob Sie sie überqueren wollen oder nicht.
An dieser Stelle erlauben Sie mir die Nebenbemerkung, dass dieser Rubikon der Hinwendung zur Sinnorientierung auch eine Gefahr birgt. Es gibt nämlich kein Zurück mehr. Wenn Sie begonnen haben, sinnorientiert zu denken und zu handeln, werden Sie schon aus Sinnhaftigkeit heraus ein im besten Fall rein zweckmäßiges Handeln nur noch insoweit akzeptieren, als es gelegentlich zu den lästigen Pflichtaufgaben zählt, aber nicht mehr dann, wenn es als Selbstzweck daherkommt. Was hier noch abstrakt klingen mag, mündet im Berufsleben unter Umständen schnell in essenzielle Entscheidungen.
Lassen Sie mich noch einmal auf den vierten Grund für die Vorstellung der sinnorientierten FührungSinnorientierte Führung, transformative Wirkung zurückkommen, nämlich ihre Fähigkeit, das eigene Leben der Führungsperson zu verändern und zu erfüllen. Ich habe Ihnen oben dargelegt, warum ich mich für einen bestimmten Ansatz der Führungslehre entschieden habe. Ich habe Ihnen aber noch nicht aufgezeigt, wozu ich das getan habe. Neben meiner persönlichen Überzeugung von Schönheit und Nutzen dieses Ansatzes ist nämlich das Motiv vorrangig, dass diese Lehre – und im Vorgriff auf spätere Ausführungen können wir sie hier schon eine Führungsphilosophie nennen – dazu beitragen wird, Sie selbst als Menschen und Ihre (künftige) Führungstätigkeiten so zu beeinflussen, dass Sie durch Ihr Wirken dazu beitragen, Ihre Organisationen und in der Folge Ihre Gesellschaft zu verbessern. Das ist kein realistisch erreichbares Ziel, denn daran müsste ich und müsste ein solches Werk scheitern. Das ist vielmehr unsere Berufung als Führungskräfte, unabhängig davon, ob wir sie erreichen können – und es ist meine persönliche Aufgabe als Hochschullehrer und Coach im Umgang mit diesem Thema, wenn er denn eben sinnvoll sein soll. Es liegt nun an Ihnen, ob Sie sich dieser Aufgabe verschreiben wollen oder nicht.
Aus dieser Entscheidung folgt eine Reihe von Konsequenzen. Erstens verändert das die Art und Weise, wie wir lernen. Zweitens legt Ihnen schon dieser Lernpfad allein eine hohe Verantwortung auf. Sofern Sie sich entschließen, sich auf dieses Projekt einzulassen, können Sie sich nicht mehr in die gewohnte Komfortzone eines Lesers zurückziehen. Unser gemeinsamer Lernpfad beinhaltet vielmehr, dass ich Ihnen meine Erfahrungen, Positionen und Haltungen als eine Folie bereitstelle, vor der Sie Ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen prüfen können. In der Selbstreflexion und kritischen Auseinandersetzung im Lektüreverlauf wird sich dann zeigen, ob aus dem Prozess für Sie mögliche neue Orientierungen entstehen oder nicht.
An Ihnen als Mensch und als (werdende) Führungskraft bin ich zutiefst interessiert und daran, mit Ihnen zusammen neue Fragen zu stellen, deren Antworten Entscheidungen und Handlungen verändern können und verändern sollen.
Erlauben Sie noch zwei Bemerkungen zum Schluss, zuerst zur Abgrenzung, also zur Frage, was ich hier nicht behandle. Von den vielen Auswahlen und Einschränkungen sind zwei besonders hervorzuheben. Sie betreffen zum einen die Rolle der sinnorientierten Führung in der DigitalisierungDigitalisierung und zum anderen ihre Einbettung und Umsetzung auf Organisationsebene. Während sich der zweite Aspekt von den oben genannten Einschränkungen her verbietet (vgl. auch Prämisse (2c) in Kap. 1.1), hätte der erste thematisch gesehen durchaus Platz in diesem Werk. Aber er würde auch das Miteinbeziehen neuer Kontexte und Diskussionen erfordern, die nicht nur viel Raum bräuchten, sondern auch ein im doppelten Sinne neues Themenfeld eröffnen würden. Das Thema der digitalen Umsetzung sinnorientierter Führung bleibt daher einer weiteren, bereits in Arbeit befindlichen Publikation vorbehalten.
Die zweite Bemerkung betrifft den Untertitel. In ihm geht es ausdrücklich um zwei Generationen von Menschen als Zielgruppen, nämlich die Generation YGenerationen, Generation Y (Jahrgänge 1980–2000) und die Generation ZGenerationen, Generation Z (Jahrgänge ab 2000). Die Fokussierung ist dadurch motiviert, dass das hier aufzustellende Gedankengebäude für diese Generationen besonders attraktiv zu sein scheint, wenn man den gängigen Zuschreibungen glauben darf, dass diese Menschen explizit nach dem Sinn ihrer Arbeit fragen. Falls dieser subjektive Eindruck stimmt, dann wäre die Philosophie sinnorientierter Führung eine, mit der diese Generationen a) besonders gut geführt werden könnten und b) in der Folge auch selbst gern würden führen wollen.
Unabhängig davon gilt, dass Sinnfragen keine Generationsanliegen sind, allenfalls sind es die Neigungen, derartige Fragen im Arbeitskontext auch offen zu formulieren, was möglicherweise frühere Generationen weniger getan haben. Wichtig ist in jedem Fall, dass diese Zuschreibungen spekulativ sind, solange sie nicht empirisch belegt sind. Wichtig ist weiter, bei allen Aussagen über Generationen zu bedenken, dass es sich um sehr abstrakte und pauschale Konstrukte handelt. Es werden sich also beim Transfer der Aussagen auf konkrete Vorgesetzte, Mitarbeiter usw. so viele Kongruenzen wie Inkongruenzen finden lassen.
1.1 Leitfragen und Denkwege
Sie sollen die Lektüre nicht beginnen müssen, ohne zu wissen, von welchen Fragen hier die Rede ist und welcher Art das Denken in dieser Arbeit ist, die – für die akademisch interessierten Leser – in die Gruppe der theoriebildenden Arbeiten gehört.
Eine – nicht abschließende – Liste wichtiger Leitfragen für angehende wie für erfahrene Führungskräfte in diesem Buch sieht folgendermaßen aus:
Welche klassischen Theorien zur FührungFührungstheorie gibt es – und was davon muss ich als angehende Führungskraft mindestens wissen bzw. inwiefern finden sich entsprechende Systematiken in meinem Führungshandeln wieder?
Welche Instrumente und Praktiken sind für mich hilfreich auf dem Weg zur angehenden Führungskraft bzw. welche helfen mir, ein weiteres Niveau von Meisterschaft zu entwickeln?
Welches Potenzial bringe ich selbst für eine Führungsaufgabe mit? Und will ich überhaupt führen – und wenn ja, wozu, woraufhin will ich führen bzw. führe ich tatsächlich?
Wo steht die sinnorientierte Führung im Umfeld der FührungstheorieFührungstheorien?
Was ist Sinn überhaupt, woraus entsteht Sinn und was ermöglicht ihn?
Was bewirkt Sinn bei Menschen und Organisationen und was wird in der Organisation mit sinnorientierter Führung anders?
Was macht sinnorientierte Führung aus und wie kann man sie ermöglichen bzw. einführen?
Was bedeutet DigitalisierungDigitalisierung für MenschenführungMenschenführung, Digitalisierung; welche Aufgaben und Herausforderungen kommen zur Führung hinzu?
Wie stehen Digitalisierung und Sinnorientierung zueinander; wie lässt sich sinnorientierte Führung in Digitalisierung umsetzen?
Der Denkweg dieser theoriebildenden Arbeit lässt sich kurz mit folgenden Zielen (1), Prämissen (2) und Operationen (3) beschreiben:
Ziele:
Das grundlegende Bestreben des Buches ist es, das Werk von Viktor FranklFrankl, Victor E. bzw. genauer seine Konzeption des Sinns (erneut)2 auf das Führen von Menschen zu transferieren.
Zwar ordnet sich das Vorhaben methodisch gesehen als theoriebildend ein; Hauptanspruch und -fokus liegen aber in der konkreten Befähigung von Führungskräften.
Prämissen
Der Anspruch dabei ist erstens, die sinnorientierte Führung wirklich konkret und handhabbar zu machen; sie muss also in Begriffen, Funktionen und Modellen der Führung verortet werden können.
Gleichzeitig muss sich zweitens ein sinnorientiertes Führen den theoretischen und empirischen Ansprüchen klassischer Führungslehre stellen und sich an ihnen messen oder zumindest in seinem Wirkungsanspruch mit ihnen vergleichen lassen.
Drittens muss der Transfer so erfolgen, dass er für eine konkrete Führungsperson anwendbar und umsetzbar ist, woraus sich die Fokussierung auf die personale Führungsebene statt auf eine organisationale ergibt.
Operationen
Dazu braucht es zuerst naheliegenderweise eine Einführung in einige ausgewählte Grundlagen des Frankl’schen Denkens sowie die begrifflichen Transfers auf die Situation von Führung und Organisation (vgl. Kap. 2).
Für den Transfer wird weiter eine Systematik benötigt, entlang derer das FranklFrankl, Victor E.’sche Denken auf die Führung übertragen werden kann.
Die vorgenannten Prämissen führen dazu, dass das sinnorientierte Führen zuerst entlang ausgewählter klassischer Theoriegebiete eingeordnet wird (vgl. Kap. 3.2 bis 3.5).
Im Weiteren werden seine Relevanz und Bedeutung für ausgewählte zentrale Führungsaufgaben dekliniert (vgl. Kap. 3.6 bis 3.10).
Die gedankliche Integration in Führungsprozesse und -instrumente leistet das Kap. 4. Anhand eines Lebenszyklusmodells werden hier (vgl. Kap. 4.4) Aspekte sinnorientierter Führung in konkrete Prozesse der Mitarbeiterführung übersetzt.
In Zusammenhang mit der Differenzierung von personeller vs. struktureller Führung (vgl. Kap. 4.3) ist hier der Grenzgang zu suchen, welche Empfehlungen an Führungskräfte ergehen können, auf Formen struktureller Führung Einfluss zu nehmen, ohne dabei die Ebene der Organisationsentwicklung zu beschreiten, die mit Prämisse (2c) ausgeschlossen worden war. Weitere und systematische Schnittstellen dieser Art werden in Kap. 4.5 ausgeleuchtet.
Kap. 5 nimmt eine methodische Sonderrolle ein, weil er das sinnorientierte Führen in seiner enthierarchisierenden, auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung hin wirkenden Fähigkeit auf jene Kontexte der Menschenführung überträgt, die ohne formelle Macht auskommen müssen. Zum einen, so wird behauptet, stellen diese Kontexte die »Königsklasse« der Führung dar, weil sie methodisch besonders anspruchsvoll sind. Zum anderen wird in dieser speziellen Organisationsart ein besonders zukunftsträchtiger Anwendungsbereich des Führens verortet. Auch hier werden die Prämissen bzw. Ansprüche aus (2) durchexerziert und das Kapitel mit methodischen Hinweisen bzw. Kompetenzbildungsvorschlägen versehen.
Eine hauptsächlich am Konzept bzw. an der Führungsphilosophie (1a), weniger an der Denkmethode und dem Theoriebildungsanspruch (1b) orientierte Kritik bildet den Hauptgegenstand des abschließenden Kap. 6.
1.2 Form und Verarbeitung
Der Aufbau des Werkes ergibt sich aus der gerade erläuterten Methodik. Aus der Zielsetzung (1a), Führungskräfte anzusprechen und konkret zum Handeln zu befähigen, sowie aus der Natur der Sache selbst ergibt sich, dass das Werk eine direkte persönliche Ansprache kennt, die sonst nicht unbedingt Kennzeichen wissenschaftlicher Texte ist. Hier aber geht es, soweit denn in einem Buch möglich, um einen Dialog, und es geht um Ihre Befähigung zur Arbeit mit dem Sinn, so Sie dies denn wollen.
In der Folge enthält das Buch außer der persönlichen Ansprache immer wieder auch Einladungen zur Reflexion bestimmter Aspekte (»Fragen an Sie: …«) sowie zur leichteren Bearbeitung Hervorhebungen zentraler Argumente, die in Kästen mit Merksätzen abgehoben dargestellt sind. Als weiteres Element, um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern, finden Sie unter anderem Beispiele, die jeweils eingerückt in den Text eingefügt sind.
Da das Ansinnen des Buches auch das Einordnen sinnorientierte Führung in klassische Theorien und Forschungszusammenhänge ist (vgl. oben (2b)) wird immer wieder auf einschlägige Literatur, v. a. Führungshandbücher, verwiesen. Der Einfachheit halber und aus Qualitätsgründen wird hier als Referenzwerk und stellvertretend für die zahlreiche weitere Handbuchliteratur das Werk von Lippmann, Pfister und Jörg (2019) herangezogen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch das grammatisch korrekte generische Maskulinum verwendet. Diese Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung; gemeint sind potenziell alle Menschen.
1.3 Der rote Faden
Bevor wir mit der Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fragen beginnen, lassen Sie uns einen Moment lang darüber nachdenken, wie die Reise in den folgenden Abschnitten strukturiert sein soll. Das vor Ihnen liegende Werk folgt einer bestimmten Logik, die sich aus der spezifischen Natur unserer Sache ergibt. Folgende Grafik soll veranschaulichen, in welcher Weise die zu besprechenden Themen in Beziehung zueinander stehen:
Abbildung 1:
Der rote Faden (eigene Grafik)
Die Pronomina in der (stehenden) LemniskateLemniskate vertreten natürlich jeweils Akteure und Instanzen aus dem Führungsumfeld. Wenn Sie sich bei dieser Benennung zufällig an das großartige Werk von Martin BuberBuber, Martin (Buber 1962) erinnert fühlen, dann liegen Sie ganz richtig und wissen auch schon etwas über eine wichtige Inspirationsquelle der hier vorzustellenden Führungsphilosophie.
Zuoberst vertritt das Pronomen ER die oberste Instanz des Führungszusammenhanges, so wie ich ihn hier verstehe und vertrete, und das ist natürlich der Sinn, auf den das Führen ausgerichtet ist. »Ich« meint die Führungskraft, aus deren Sicht wir den Zusammenhang wahrnehmen. »Sie« bezieht sich auf die Kunden, Abnehmer, Klienten, Patienten usw., für die wir arbeiten. Die weiteren Pronomina sind wohl selbstverständlich (vgl. dazu auch Tabelle 1). Mit den Pronomina sind gleichzeitig Fragen verbunden, die den Einsatz dieses Schaubildes für Reflexions- und Gesprächszwecke erleichtern sollen:
Akteur
Legende
Leitfrage
ER
Der Sinn. Sinn vs. Zweck und Ziel; absoluter Sinn, individueller und kollektiver Sinn des Handelns.
Wozu tun wir es?
Ich
Wer ich bin, wie ich geworden bin und was mein Beitrag zur Organisation (als Führungskraft) ist.
Wer bin ich, was trage ich bei?
Sie
Die Kunden, Partner, Lieferanten, Angehörigen rund um das, was wir tun. Die Menschen, für die wir tun, was wir tun.
Für wen tun wir es?
Es
Unser(e) Produkt(e), Leistung(en), der Gegenstand, auf den wir als Organisationsangehörige gemeinsam bezogen sind.
Was tun wir für unsere Kunden, Abnehmer …? Was ist unser Beitrag, was unsere einzigartige Leistung?
Du
Mitarbeiter, Kollegen.
Mit wem leisten wir, leiste ich meinen Beitrag?
Wir
Die Organisation als Kultur und Gemeinschaft; die Quelle der Identifikation und Rollenzuweisende.
Als wer tun wir es?
Tabelle 1: Legende zur LemniskateLemniskate, Legende (»roter Faden«)
Den einzelnen Akteuren und Instanzen lassen sich nun alle Gegenstände, die wir in diesem Werk streifen werden, zuordnen. Unter »Sinn« gilt es zunächst zu erarbeiten, was wir darunter verstehen können und müssen. Wir kennen den Begriff alle, müssen uns aber doch über den gemeinsamen Bedeutungsumfang verständigen und vor allem klären, was genau er nun mit Führung zu tun hat. Das erfolgt in Kap. 2.
Nur Menschen können Sinn erfragen und erstreben; als »Träger« von Sinn kommt also als Erstes (in unserem Zusammenhang) die Führungskraft ins Bild, die sinnorientiert führt (»Ich«). Sinn jedoch kommt nicht aus uns selbst und allein, sondern erst aus dem Bezug auf jemand und etwas anderes. Das »Sie« ist daher untrennbar mit dem Sinn unseres Führungs- und organisationalen Handelns verbunden. Erst aus dem »Sie« – in Verbindung mit dem »Es«, was den Gegenstand unseres Handelns und Strebens erfasst – kann ein Sinn entstehen. Insofern erlaubt die Abbildung die doppelte Leseweise sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen diesen.
Die LemniskateLemniskate bildet gleichzeitig zwei Bewegungsrichtungen an, in denen Verbindung geschehen kann; beide beginnen und enden jeweils bei der Ausrichtung auf den Sinn des gemeinsamen Handelns. Die obere Hälfte der Lemniskate ist konstitutiv mit dem Sinn verbunden, die untere mit der Organisation und der Führung. In der oberen Hälfte sind die großen Orientierungen angelegt wie Vision, Strategie, Zielbildung usw., in der unteren die Prozesse, die Kultur und soziale Gemeinschaft der Organisation.
Thematisch steht »Ich« dann für alles Wissen um die Führungsperson selbst und für ihre Zugänge zum Sinn. Da sind viele Fragen an unsere Haltungen, Überzeugungen und Grundfesten, Geschichte und Erfahrungen enthalten. »Sie« steht in der Organisation für alles Wissen rund um unsere Kunden; im Blick auf Führung ist hier außerdem unser Führungsergebnis gemeint: Was liefern wir, was ist unser »OutcomeOutcome« oder »Deliverable« für die Rechtfertigung der organisationalen Existenz? Was genau erhalten die Kunden von mir/uns?
Der konkrete Input, unser Leistungsausweis, was wir konkret tun, wird in »Es« erfasst. »Es« meint unsere Aufgabe und unseren Auftrag, auf den hin all unser Handeln in der Organisation bezogen ist. Deswegen steht das »Es« als Fluchtpunkt der gemeinsamen Arbeit im Mittelpunkt.
Im unteren Kreis schließlich geht es um die typischen Fragen, wie wir unser Tun koordinieren, unsere Prozesse gestalten, um das »Es« zu erzeugen. Im »Du« sind aus Führungsperspektive sämtliche Fragen der FührungsbeziehungFührungsbeziehung angelegt. Wie führe ich Dich, was sind meine Gestaltungsmittel für die Führungsbeziehung? Im »Wir« sind dann die Fragen nach der Organisationsgestaltung angelegt. Das umfasst sowohl Fragen organisationaler Strukturen wie auch nach Kultur und Gemeinschaft.
Sie können nun alle Kapitel und Abschnitte den einzelnen Stationen der Reihe nach zuordnen. Eine sehr grobe Übersicht sieht folgendermaßen aus:
Kap.
Akteur
Inhalt
1–2
ER
Einführung in Sinnorientierung; sinnorientierte Führung
2
Ich
ReflexionReflexion der Führungskraft
2
Sie
Ausrichtung auf unsere Kunden und Frage nach unserem Beitrag
2
Es
Mein/unser konkreter Beitrag zur Rechtfertigung unserer Existenz als Organisation. Was ist besonders, einzigartig, was ist unser Auftrag?
3
Du
Wer sind die anderen, mit denen ich arbeite und wie ist meine (Führungs-)Beziehung zu ihnen gestaltet? Hierunter gehören auch Gegenstände wie Führungsinstrumente und -prozesse.
4–5
Wir
Führen findet in organisationalen Rahmen statt, die (mit-)gestaltet werden müssen, um erfolgreich sein zu können. Hier geht es um Fragen der Strukturen und Prozesse und um Macht.
Tabelle 2: Roter Faden der Kapitel
Die Grafik aus Abbildung 1 finden Sie im Text außerdem in verkleinerter Form – wie neben diesem Absatz – mit einer kleinen Lupe über einzelnen Instanzen wieder. Die verkleinerte Grafik steht bei Überschriften von Kapiteln, die bestimmte Ausschnitte beleuchten, und dient als sog. »Advance Organizer«, also als visuelles Instrument der Orientierung bei der Lektüre.
1 Ein typisches Führungshandbuch geht den umgekehrten Weg und stellt Führung in psychologischer Sicht im Allgemeinen dar – und widmet der Sinnorientierung als solcher genau eine Seite (vgl. Lippmann, Pfister und Jörg 2019, 200).
2 Frühere Ansätze dazu finden sich etwa bei Merath 2012; Rödel 2020; Schwarz und Wyssen 2013; Vogelmann 2008; Wehrlin 2014; Pircher-Friedrich 2019; Berschneider 2003; Brohm 2017; Ahrendt und Nikolaus 2020; Böckmann 1996; Busse 2019; Bruch und Berenbold 2017; Fintz 2014; Jung 2020. Die Werke sind von Tiefgang, Fundierung, thematischer Ausrichtung und Anwendbarkeit her breit gefächert; eine schlüssige, systematische und konkrete Umsetzbarkeit in der Personalführung lassen die meisten indes meist vermissen.
2 Sinnorientierte Führung – Einführung und Grundlagen
2.1 Überblick
In diesem Kapitel wird das Konzept sinnorientierter Führung ausgebreitet, gegen ausgewählte andere mögliche Führungskonzepte abgegrenzt und sein Wirkungsanspruch skizziert. Die zentralen Fragen der Sinnorientierung stellen hohe Ansprüche an die eigene Persönlichkeit, gewähren im Gegenzug jedoch eine ebenso hohe Authentizität in der Führungsrolle und eine robuste Resilienz im VUCA-Alltag. Die Analyse und Verortung der eigenen Führungsrolle im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungshaltungen ermöglicht, den eigenen Beitrag realistisch zu erkennen und zugleich visionär zu gestalten.
Bezogen auf den »roten Faden« (vgl. dazu oben Kap. 1.3 und die Grafik hier auf dieser Seite) behandelt dieses Kapitel notwendigerweise zuerst die Frage nach dem Sinn. Irgendwie wissen wir alle, was das ist – aber dann doch oft nicht genau genug, um es in eigenen Worten ausdrücken zu können, wie das oft bei den »großen Begriffen« der Fall ist. Auch braucht es für die Themenerarbeitung ein gemeinsam geteiltes Wissen über diesen Leitbegriff.
Außerdem ist der konkrete Zusammenhang von Sinn(-orientierung) und Organisation ja durchaus erklärungsbedürftig. Die Leitidee des Abschnitts ist deswegen, das Konzept der Sinnorientierung auszubreiten. Im Vorfeld müssen einige Begriffe, Theoreme, Grundlagen geklärt werden. Entsprechende Fragen und Übungen laden Sie hernach jeweils zur Reflexion der beiden Ebenen (Selbst, Organisation) ein.
Das Kapitel beleuchtet nacheinander, was Sinn an sich ist (Kap. 2.3), was Sinn in einer Organisation ist (Kap. 2.4) und wie mit den spezifischen Eigenarten von Sinn in einer Organisation umzugehen ist (Kap. 2.5). Dazu müssen wir selbst als Führungskräfte mit Sinn umgehen und uns ihm nähern können. Dass eine solche Annäherung an Sinn(-orientierung) nichts Esoterisches ist, zeigen die Abschnitte unter Kap. 2.6, denn sie versuchen, diese Annäherung pragmatisch zu gestalten.
Wichtig ist, sowohl für sich selbst als auch für die eigene Organisation (oder Teile davon) formulieren zu können, was unter Sinn zu verstehen ist. Die Arbeit mündet dann folglich auch in der Beschreibung des »Sinn-Bildes«, das die Kreuzung individueller und organisationaler Sinnaspekte mit Kriterien aus der Sinnorientierung (Wertigkeit, Strahlkraft usw.) ist.
Vorweg muss gesagt sein, dass das Thema damit nicht erschöpft sein kann. In der einen oder anderen Weise werden uns Begriffe und Zusammenhänge in späteren Abschnitten wieder begegnen. Das entspricht aber auch der Natur der Sache: Eine Annäherung an Sinn geschieht nicht einmal und ist dann erfüllt und erledigt; sie bleibt ein fortwährender, situativ ausgelöster und konkreter Prozess.
2.2 Grundprinzipien sinnorientierter Führung
In der Einleitung habe ich sinnorientierte FührungSinnorientierte Führung, Grundprinzipien als »theoretisch schön« beschrieben und behauptet, dass sie mit wenigen Sätzen viel bewirken kann. In der Wissenschaft ist eine einfache und kurze Form der Theoriebildung der ausführlichen und komplexen stets vorzuziehen, solange denn beide zumindest das gleiche Ergebnis zeitigen können. Die Einfachheit der Sinnorientierung wird ebenfalls später noch zu vertiefen sein, weil an ihr ein wichtiger Aspekt der Sinnorientierung hängt, nämlich das, was FranklFrankl, Victor E. als das zutiefst Humane bezeichnet. Sinn ist urmenschlich.
Wenn beide Aussagen (Einfachheit; Aspekt des Menschseins) über Sinn richtig sind, dann müssten Sie sinnorientiert arbeiten können, auch ohne dieses Buch gelesen zu haben. Tatsächlich ist sinnorientiertes Handeln jedem Menschen immer schon möglich, aber die Übertragung auf eine organisationale Wirklichkeit im Allgemeinen und die Führungsaufgabe im Speziellen und ganz besonders die systematische Übersetzung von Sinnorientierung für den Kanon der Führungsaufgaben ist eine Arbeit, die geleistet werden will. Diesen Schritt nimmt Ihnen diese Lektüre ab.
Als eine Form der gemeinsamen Erinnerung an das, was wir alle über Sinn wissen, und zugleich als Versuch, die theoretische Einfachheit der Führung mit SinnorientierungSinnorientierung, Leitsätze zu zeigen, möchte ich Ihnen folgende Leitsätze oder Prinzipien vorstellen.
Als sinnvoll erleben wir, was größer als das Eigene und stets auf das andere oder den anderen bezogen ist (»Für wen oder was ist das gut?«).
Daraus folgt: Sinn ist größer als und erschöpft sich nicht in Zweck (»Purpose«) und erst recht nicht in Zielen.
Sinn wird vom Ende her gedacht (»Wozu führt das?«).
Sinnvoll ist unter mehreren Auswahlmöglichkeiten stets diejenige, welche am nachhaltigsten ist, also den größten, am längsten anhaltenden und den meisten Menschen nutzenden Effekt zeitigt (»Was dient allen am besten?«).
In Situationen der Unentscheidbarkeit beschreibt Sinn stets die Handlungsoption, die unter allen möglichen Umständen (im Sinne der vorgenannten Sätze) greifen kann (»Was dient unter allen möglichen Umständen am ehesten dazu?«).
Sinn wird immer freiwillig angestrebt. Nur der Handelnde selbst kann entscheiden, was sinnvoll ist (»Wozu ruft mich diese Situation?«).
Daraus folgt: Man kann Sinn nur finden, nie vorgeben.
Die ersten fünf Sätze (in der Wissenschaft heißen solche Sätze »Basissätze einer Theorie«) beschreiben sinnvolles Handeln an sich. In Klammern habe ich dahinter Fragen formuliert, mit denen Sie die Basissätze gleich auf Ihr eigenes Handeln anwenden können.
In Bezug auf Führungshandeln können Sie mit diesen Fragen erarbeiten, wohin geführt wird oder werden sollte. Eines bleibt indes hier noch etwas über sinnvolles Führen zu sagen. Für das Führen von Menschen, also das koordinierte Ausrichten der Handlungen anderer (i. e. der Mitarbeiter), muss noch ein weiterer Satz hinzutreten, nämlich die zweite Folge aus Basissatz 5:
Sinnvolles Handeln anderer zu ermöglichen, erfordert entsprechende Freiräume für deren Entscheiden und Handeln (»Welche Strukturen sind nötig/muss ich schaffen, damit wir sinnorientiert arbeiten können?«).
Eigentlich beschreiben diese Basissätze nicht viel mehr, als die gängige Alltagserfahrung zum Umgang mit Sinn beinhaltet; ihr Inhalt ist hinlänglich bekannt, wenn auch vielleicht nicht immer so explizit formuliert. Sie können auf dieser Grundlage nun beginnen, eigenes (künftiges) Führungshandeln zu befragen. In der Auseinandersetzung mit Eigenschaften und Folgen eines so ausgerichteten Tuns wird sich möglicherweise auch schon andeuten, wo Inkongruenzen, Konflikte und Widersprüche zu einem Führungshandeln liegen, das nicht sinnorientiert ist. Dem werden wir in der gemeinsamen Reflexion noch nachgehen.
Zuvor aber müssen wir noch einen Zwischenstopp einlegen. Oben haben Sie fünf Fragen an sinnvolles (Führungs-)Handeln gefunden. Im Umkehrschluss folgt daraus: Sinnorientiert führen kann man erst, wenn man sich selbst Fragen zu Sinnhaftigkeit gestellt hat. Die Hintergründigkeit dieses Schlusses wird uns im Buch noch oft beschäftigen. Im Moment resultiert daraus folgende einfache Frage an Sie.
Fragen an Sie: Was ist sinnvoll?
Bevor Sie in die Lektüre eintreten, nehmen Sie sich am besten in Ruhe einen Moment Zeit, um kurz und noch unbeeindruckt von den folgenden Ausführungen für sich selbst zu überlegen, was für Sie sinnvoll ist. Wann erleben Sie eine Handlungsmöglichkeit als sinnvoll?
Ein erster Hinweis dazu: Das Sinnvolle lässt sich daran erkennen, dass es einen Eindruck totaler Stimmigkeit erzeugt.
2.3 Was ist Sinn?
Bei einer Einführung in die sinnorientierte Führung muss zunächst die Frage gestellt werden, was genau wir hier unter SinnSinn, Begriffsklärung verstehen wollen. Für die Antwort schauen Sie mit mir vor allem in das Werk eines Wissenschaftlers, der diese Frage wie kein Zweiter geprägt hat, und zwar Viktor Emil FranklFrankl, Victor E..3
FranklFrankl, Victor E. war Professor für Psychologie an der Universität in Wien und Überlebender von vier Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Nach seiner Befreiung aus dem KZ und seiner Rückkehr nach Wien fand er seine ganze Familie ermordet vor, musste sein Leben völlig neu aufbauen und mit dem eigenen Trauma wie mit dem seiner völligen Entwurzelung leben lernen. Frankl bestritt dennoch zeit seines Lebens die Kollektivschuld der Deutschen und setzte sich im Gegenteil für Vergebung und Verständigung ein (vgl. Frankl 2022, 111 f.; 2013, 99).
In seinem Fach gelangte er als Gründer der sogenannten dritten Wiener Schule der Psychologie zu Bedeutung, weil er sich zum einen von der trieborientierten (Tiefen-)Psychologie Sigmund FreudsFreud, Sigmund und zum anderen von der individualpsychologischen und stark auf Machtfragen orientierten Psychologie Alfred Adlers absetzte. Beiden warf er vor, dass sie den Menschen lediglich dort betrachten und begreifen, wo er seine Defekte und tiefsten Schatten hat (vgl. Frankl 2015b, 19, 59 ff.; 2015a, 37 ff.). Frankl wollte den Menschen – auch und gerade nach seinem Überleben der Konzentrationslager – von dort aus verstehen, wo er seine größten Leistungen vollbringt und wo er sich selbst überschreitet, weswegen er von seiner Schule der Logotherapie auch gern als einer HöhenpsychologieHöhenpsychologie sprach – im Gegensatz zur Tiefenpsychologie der anderen Schulen. Als Auslöser und Kraftquelle für diese herausragende menschliche Fähigkeit machte Viktor Frankl den Sinn aus und schrieb dem Menschen im übertragenen Sinne sogar ein SinnorganSinnorgan zu, nämlich das Gewissen (vgl. z. B. Frankl 2015a, 30).
FranklFrankl, Victor E. befasste sich auch in seiner Forschung, seinen empirischen Arbeiten als Arzt, Psychologe und Therapeut sowie in seinen Publikationen immer wieder mit der Kant’schen Frage, was der Mensch ist. Sie werden im Laufe der weiteren Lektüre dieses Abschnitts sehen, dass diese Frage gerade für uns Führungskräfte von wesentlicher Bedeutung ist.
Aber kehren wir von der Person, die den Begriff und sein Umfeld geprägt hat, zu unserem Leitbegriff des Sinns zurück. Zuerst müssen wir dann festhalten, dass Sinn hier nicht genau das Gleiche wie in der Alltagssprache meint. In der Alltagssprache meint »SinnSinn, Begriffsklärung« oft so viel wie Bedeutung, Nutzen, Zweck. Das sind zwar bereits wichtige Bedeutungsebenen des Begriffs, aber Frankl hat ein tieferes Verständnis der Bedeutung des Sinnbegriffs entwickelt.
Für FranklFrankl, Victor E. sagt Sinn stets etwas über einen Bezug von etwas auf etwas anderes aus. Ein Motiv, ein Gedanke verweist über etwas anderes hinaus auf Drittes, nicht nur auf mich, meinen Nutzen, meine Bedürfnisse, sondern auf etwas, das größer ist als ich (vgl. Frankl 2013, 26).
»… dass der wahre Sinn in der Welt gefunden werden muss und nicht innerhalb des Menschen oder seiner Psyche, so als ob es sich dabei um ein geschlossenes System handelte.«4
An dieser Stelle müssen wir dann auch gleich die Unterscheidung einführen, die besonders im Unternehmensumfeld wichtig ist, nämlich die zwischen Ziel – ZweckZweck – und Sinn. Als Führungskräften ist uns zielorientiertes Denken bestens vertraut. Wir konkretisieren unsere ZieleZielformulierung in smarten Formulierungen und drücken unsere erwarteten Leistungen in Kennzahlen aus. Schon deutlich seltener fragen wir uns nach dem Zweck unseres Tuns. Wenn die Ziele und angestrebten Ergebnisse selbst nicht das Ende sind, sondern es noch etwas danach gibt, was wäre das dann? Anders formuliert: Wozu wollen oder müssen Sie denn die vereinbarten Ziele und Ergebnisse erreichen?
Diese Frage ist schon nicht mehr so trivial und bringt auch gestandene Top-Führungskräfte ins Grübeln, wenn sie mehr als die eingeübten Marketing-Slogans hersagen wollen. Im Zweifelsfall können wir bei einem Unternehmen immer sagen: Der Zweck der Zielerreichung besteht darin, Profite zu erwirtschaften, möglichst hohe vielleicht, um deswegen als »Nummer eins« im Marktsegment gelten zu können.
An dieser Stelle kann man gut zwischen Sinn und ZweckZweck unterscheiden. Ein Zweck unternehmerischer Tätigkeit kann sein, möglichst viel Geld zu verdienen. Aber niemand würde sagen, dass er darin seinen Sinn erkennt. Denn während der Zweck eine operative Ebene des Nutzens und der Weiter- oder Wiederverwendung bezeichnet, gibt der Sinn eine höhere Ebene an. Unser Tagwerk könnten wir zufrieden abschließen, wenn wir den angestrebten Zweck erreicht hätten. Vermutlich wollte aber keiner von uns sein Leben beschließen und sich dabei sagen können, er hätte seinen Zweck erreicht (z. B. Geld verdient zu haben).
Als Sinn brauchen wir etwas anderes, müssen wir etwas anderes haben, das sich nicht auf der gleichen Ebene finden lässt wie das, womit wir in unserem Handeln praktisch umgehen. Dieses »Mehr«, diese Überschreitung, kann verschieden begründet oder motiviert sein, und zwar durch Vernunft, durch Ethik, spirituell und religiös. FranklFrankl, Victor E. erkennt in dieser Sinnorientierung des Menschen eine existenznotwendige Gegebenheit. Sinn ist die »Conditio humanaConditio humana« – die Grundbedingung dafür, überhaupt Mensch zu sein (vgl. z. B. Frankl 2015a, 84 f.).
Während Sigmund FreudFreud, Sigmund fand, dass der Mensch seelisch krank sei, wenn er nach dem Sinn fragt, erkannte FranklFrankl, Victor E., dass genau das Gegenteil wahr ist. Erst dann, wenn der Mensch nach dem Sinn fragt, legt er seine eigentliche wesentliche Qualität frei und wird Mensch, so wie nur er es sein kann (vgl. z. B. Frankl 2015a, 26 f.). Dem Menschen, so Frankl weiter, wohnt immer und unter allen Umständen ein SinnbedürfnisSinnbedürfnis, gar ein Wille zum Sinn inne (vgl. z. B. Frankl 2013, 101). Ein Beweis ist in der Umkehrung gut zu erkennen: Nämlich immer dann, wenn wir Menschen ihren Sinn wegnehmen oder zerstören, werden sie körperlich oder seelisch krank oder beides.
FranklFrankl, Victor E. dachte den Menschen als mit einem »SinnorganSinnorgan« ausgestattet (vgl. z. B. Frankl 2015a, 30), was er natürlich nicht anatomisch, sondern psychologisch meinte. Dieses Sinnorgan verortete er im Gewissen, das wiederum der Ort ist, an dem der Mensch mit sich selbst über seine Taten spricht oder gelegentlich auch mit einer anderen Instanz. Hier rechtfertigt sich der Mensch für sein eigenes Handeln – vor einem moralischen Kodex, der aus der eigenen Vernunft stammt, oder vor einer höheren Ordnung, wenn er gläubig ist. Wichtig ist dabei, dass Sinnorientierung möglich ist – ganz unabhängig davon, ob der betreffende Mensch religiös ist oder nicht. Auch ein wirklich atheistischer Mensch ist auf Sinn ausgerichtet und braucht diesen ebenso wie ein gläubiger Mensch.
Sinn ist für Frankl Grundlage für Handlung, für das »In-der-Welt-Sein« des Menschen, für seine Eigenschaft als tätiger Mensch und dessen aktives Leben, also für eben die Rolle, mit der ein Mensch am Leben und der Welt teilnimmt. Und was würde diese Eigenschaft besser erfüllen als das Führen von Menschen?
Sinn ist darüber hinaus auch das Ergebnis einer stillen und tiefen ReflexionSelbstreflexionSelbstreflexion, denn Sinnsuche und -findung sind nur mit Hinwendung, Einsicht und Nachdenken möglich.
FranklFrankl, Victor E. arbeitete als Arzt, Psychologe und Therapeut viel mit seelisch kranken Menschen; einer seiner Arbeitsschwerpunkte war der Umgang mit suizidalen Patienten. Gerade im Kontakt mit ihnen stellte sich die Frage, wie denn Sinn zu finden sei. Als Wege dahin hatte Frankl vor allem menschliche Werte erkannt, die sowohl Schaffens- als auch Erlebenswerte sein können, also das Werk eines Menschen und sein Erleben und Lieben einschließen können. Darüber hinaus erkannte Frankl, dass Haltung und Einstellung eines Menschen wichtige Sinnquellen sind (vgl. Frankl 2015b, 28 f.; 2015a, 33).
Die Frage, wie SinnfindungSinnfindung gelingen kann, ist auch deswegen so schwer, weil sie eben immer dem einzelnen Menschen gestellt ist. Es gibt keine Musterlösung, und wer immer Ihnen eine allgemeingültige Antwort verkaufen will, ist ein Scharlatan. Sinn, und das ist für unsere Aufgabe hier eine echte Herausforderung, kann nie gegeben, kann nie verordnet, sondern immer nur gefunden werden.
Sinn lässt sich als individuelle Einsicht charakterisieren, die angesichts eines einzigartigen Zusammentreffens von Personen, Ressourcen und Zukunftsprojektionen entsteht (Frankl 1977, 171, 177). An anderer Stelle beschreibt Frankl diese Situation als die Frage, die das Leben in einem bestimmten Augenblick an den Menschen richtet und die nur von diesem einen konkreten Menschen beantwortet werden kann (vgl. Frankl 2015b, 26). Noch einmal: Sinn kann nicht vorgegeben, sondern nur gefunden werden, und er muss stets individuell aus Neue gesucht werden.
Merksatz:
Sinn kann verstanden werden als die Frage, die das Leben in einem bestimmten Augenblick an einen bestimmten Menschen richtet und die nur von diesem einen konkreten Menschen beantwortet werden kann.
Gleichzeitig kommt dem Sinn bei Frankl etwas Absolutes zu5: Sinn bedeutet, die Antwort auf die momentane konkrete Frage des Lebens zu finden und damit dasjenige Handeln für eine Situation zu finden, welches exakt zu dieser Situation gehört. Dieser SinnSinn, Absolutheit ist für Frankl immer vorhanden, auch wenn er nicht gefunden wird – eine Tatsache, die sich erhellt durch die Erfahrung, dass Sinn oft erst im Nachhinein und mit langem zeitlichem Abstand in einer konkreten Situation erkannt wird.6 Wenn Sinn immer vorhanden, wenn auch nicht immer erkannt ist, dann ist Sinn auch unabhängig von uns vorhanden. Diese Qualität des Sinnbegriffs ist ebenfalls von Bedeutung für unsere Arbeit und Reflexion von Führung. Frankl benutzt in diesem Zusammenhang verschiedentlich den Begriff des Über-Sinns, womit er sich auf jene Sinndimension bezieht, von der man nicht weiß und die man auch nicht rational verstehen kann, eben weil sie sich in einer höheren Verstehensebene entfaltet (vgl. z. B. Frankl 2013, 267 f., 273 f.; 2015a, 104; Frankl und Lapide 2005, 118).
Ein Sinn, der unabhängig von uns vorhanden ist, greift nämlich immer auch über uns hinaus, ist also größer als wir selbst und unabhängig von uns. Das ist deswegen so bedeutsam für das Führungshandeln, weil wir damit wissen, dass es diesen Bezug auf etwas Größeres gibt und dass unser Handeln in diesem Bezug steht. An uns ist es nun, zu erkennen, welcher das ist. Außerdem legitimiert dieser Gedanke sogleich die Einordnung der sinnorientierten Führung in die ethischen Führungsstile, mit denen wir uns später noch zu befassen haben.
Merksatz:
SinnSinnfindung ist ein wesentlich menschliches Kennzeichen. Er ist immer individuell, kann nicht verordnet, sondern nur gefunden werden, muss stets verantwortet werden vor sich selbst und dem Leben und hat als Instanz das eigene Gewissen.
Sinn ergibt sich bei FranklFrankl, Victor E. immer aus den je konkreten Lebenssituationen (vgl. z. B. Frankl 2015b, 26), übertragen auf die Führung also aus der konkreten Arbeitssituation. Sinn kann immer, muss aber keinesfalls immer gefunden werden, eine Erfahrung, die jeder wohl an sich selbst und dem eigenen Leben bereits vollzogen haben dürfte. Diese Tatsache bietet eine Erklärung dafür, warum Menschen gelegentlich auch sinnlose Handlungen vollziehen bzw. sinnlose sinnvollen Handlungen vorziehen. Menschen können sich also auch durchaus gegen den Sinn entscheiden. Die Tatsache allein, dass Menschen sich gegen Sinnhaftigkeit entscheiden, stellt den Sinn an sich wie auch seinen Wert und seine Bedeutung ebenso wenig infrage, wie das unethische Verhalten von Menschen Wert und Bedeutung von Ethik infrage stellt oder unvernünftiges Verhalten die Kraft und Klarheit von Vernunft oder der Gesetzesbruch das Gesetz.
Bei FranklFrankl, Victor E. hat die Absolutheit des Sinns noch eine weitere Implikation: Wenn SinnSinn, Machbarkeit immer da ist und prinzipiell auch gefunden werden kann, dann ist er notwendigerweise auch immer machbar (vgl. Frankl 2022, 38, 88; 2020, 13). Was nicht umsetzbar ist, ist auch nicht sinnvoll. Nur aus den wirklich vollziehbaren Handlungen ergibt sich Sinn, sonst würde er ja eben nicht existieren, wenn er quasi nur »theoretisch« möglich wäre oder ganz besondere Voraussetzungen benötigte. Diese Implikation ist für das Führen folgenschwer, denn sie mutet dem Führenden zu, auszuloten, was konkret machbar ist, und die Vision auch darauf zu beschränken, ohne dadurch deren weitreichenden Charakter zu beschneiden!
Wir können zusammenfassen: Sinnorientierung ist immer individuell und persönlich für jeden Menschen und in der Organisation für jeden Mitarbeiter. Sie ist definiert durch die eigenen Erfahrungen, welche den Horizont bilden, vor dem der jeweilige Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz, sein Leben wahrnimmt. Angesichts dessen ist Sinnorientierung für ein Gelingen wesentlich angewiesen auf ein stilles und tiefes Befragen meiner selbst, was die gegebene Situation von mir will. Diese Aufgabe gehört auf die Ebene der Selbstführung. Sinnorientierung ist zum anderen angewiesen auf ehrlichen und offenen Dialog dort, wo es um das Führen anderer Menschen geht. Erst im Dialog lässt sich klären, wie sich die individuelle Frage des Mitarbeiters nach dem Wozu beantworten lässt und wie sich die Antwort mit denen anderer Stakeholder orchestrieren bzw. austarieren lässt.
Zuletzt muss der Sinn-Begriff noch abgegrenzt werden gegen einen engen semantischen Verwandten, und zwar den schon angesprochenen Begriff der Bedeutung.7 Das ist im Kontext unseres Themas deswegen besonders wichtig, weil »Bedeutung« durchaus Leistung und Wirkung von Führung sein kann und oft auch sein soll. Führungskräfte wollen oftmals Bedeutendes schaffen, Landmarken setzen, etwas hinterlassen. Insofern es dabei um das Schaffen von etwas geht, haben wir einen typischen Sinnzugang im Frankl’schen Sinne vor uns.
Die Begriffe von Sinn und Bedeutung sind benachbart; sie brauchen und bedingen sich gegenseitig, haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Zu den Gemeinsamkeiten zählt, dass beide von dem sprechen, was bedeutsam ist, was das wirklich Wichtige, der Kern, das Wesen ist, das, was über alles andere herausragt und es bestimmt. Gemein haben beide weiter, dass in diesem »eigentlich Gemeinten« etwas Vorgegebenes und an sich Vorhandenes bezeichnet wird. Die Begriffe unterscheiden sich darin, dass Sinn keinen Plural und auch keinen Komplexitätsgewinn (»einfacher Sinn«, »komplexer Sinn« usw.) kennt. Sinn existiert in der Einzahl, und er braucht auch keine Alternativen. Unterschiedlich in beiden Begriffen ist weiter, dass die Bedeutung eine kollektive Verpflichtung kennt, die dem Menschen vorgängig und für ihn verpflichtend ist.
Auch der Sinn (als Absolutum) ist dem Menschen vorgängig, aber anders als bei der Bedeutung ist der Mensch stets frei, zu entscheiden, ob er einen Sinn als den seinen, den für eine bestimmte Handlung intendierten, annimmt oder nicht. Sprachliche und auch symbolische Bedeutung implizieren als mentale Konstrukte keine Freiheit und deswegen auch keine Verantwortung; sie sind gegeben und gesetzt, und man kann nur noch entscheiden, ob man sich ihrer bedient oder nicht. Sinn hingegen kennt durchaus Freiheit und deswegen auch Verantwortung.
Der letzte Gedanke benötigt eine Vergewisserung vor möglichen Missverständnissen. Selbstverständlich kann jeder Mensch selbst wählen, was und wen er »bedeutsam« findet und z. B. als Vorbild, handlungsanleitend usw. hernehmen will oder auch nicht. In dieser Wahl ist er frei. Er kann wählen zwischen verschiedenen »Bedeutungsträgern« oder sich sogar selbst solche schaffen. Aber er ist nicht frei in der Entscheidung, wie der Begriff der Bedeutung (in Bezug auf etwas Konkretes) angefüllt wird. Ein »bedeutender Ort der deutschen Geschichte« mag mir persönlich gleichgültig sein, aber er hört deswegen nicht auf, ein bedeutender Ort zu sein. Ich kann deswegen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Aussagen darüber machen, was Menschen aus meiner (Sub-)Kultur wohl bedeutsam finden und was nicht. Was sie hingegen sinnvoll finden, darüber kann ich höchstens spekulieren. Bedeutung hat immer Teil an und ist per se Teil von Diskursen, die auch regulieren, was Bedeutung erhält. Anders beim Sinn. Der Sinn, den ich selbst nicht wahrnehme und nicht ergreife, ist für diese Welt verloren, weil Sinn immer nur in der individuellen Realisierung entsteht und existiert.
2.4 Was ist der Sinn einer Organisation?
In der Leitfrage der Überschrift dieses Abschnitts sind eigentlich zwei Fragen versteckt, die ich der Reihe nach beantworten will. Zuerst geht es im folgenden Abschnitt um die Frage, was der Sinn einer Organisation, eines Unternehmens sein kann und was darunter zu verstehen ist.
2.4.1 Der Sinn von einer Organisation
Sinn, von einer OrganisationDie Frage nach dem Sinn einer Organisation ist sehr ungewöhnlich – obwohl auch nicht völlig einzigartig. Immerhin hat bereits mindestens ein anderer Ansatz der Organisationsentwicklung, nämlich die sogenannte horizontale Führung, eine ähnliche Leitfrage gestellt. Bekmans leitende Frage lautete (Bekman 2010): Können Organisationen eine Seele haben?
Zunächst werden Organisationen in der klassischen BWL überhaupt nicht mit der Frage nach ihrem Sinn beschrieben; die Frage käme den allermeisten Betriebswirten mindestens seltsam, wenn nicht esoterisch vor. Typischerweise haben Organisationen zuerst einmal Ziele, bei einem professionellen Management haben sie dann auch Strategien, Visionen und Missionen. Die Sinnfrage ist für sie neu, stellt sich jedoch mit zunehmender Vernetzung immer stärker. Die an Führungskräfte gerichtete Frage danach erzeugt typischerweise meist erst einmal eine Schweigepause zum Nachdenken.
Die sinnorientierte Führung ist theoretisch betrachtet ein Führungsstil und zugleich ein Programm der Organisationsentwicklung. Indem sie neue Fragen stellt und damit neue Horizonte eröffnet, bringt sie gleich im nächsten Schritt auch Anforderungen an neue Strukturen und Prozesse mit sich, denn schließlich brauchen Sinnfindung und -stiftung auch entsprechende Möglichkeitsbedingungen. Die sinnorientierte Organisationsentwicklung wird in Teilen im Kap. 4 unten behandelt, reicht aber noch weiter in die Unternehmensgestaltung und Unternehmensführung hinein und muss daher an anderer Stelle ausgebreitet werden.
Ich will stattdessen die Fragen des organisationalen Sinns zurückbeziehen auf die Führungsaufgabe. Anders ausgedrückt, möchte ich gern die Frage aufwerfen, wie eine Führungskraft in einem gegebenen organisationalen Rahmen an der Sinnfrage arbeiten kann, ohne dass bereits die Organisation insgesamt eine entsprechende Wendung vollzogen hat. Genau dies wird ja in der Mehrheit der Fälle so gegeben und auch Ihr vermuteter Anwendungsfall sein.
Beispiel:
Führen wir uns zur Veranschaulichung ein Beispiel vor Augen: Ein Unternehmen hat die Aufgabe, Haushaltsgeräte herzustellen und zu verkaufen. In der Produktion müssen Teile montiert und geprüft werden, was nicht unbedingt immer eine anspruchsvolle und reizvolle Aufgabe sein muss. Denkbar ist, dass eine Mitarbeiterin am Fließband dieser an sich vielleicht wenig anspruchsvollen Tätigkeit nachgeht, dies aber dennoch gern tut, weil der Sinn für sie nicht in der unmittelbaren Montage des Gerätes besteht, sondern vielmehr darin, sich über die Arbeitsstelle eine persönliche Unabhängigkeit und einen Beitrag zum Familieneinkommen zu generieren.
Das bedeutet, dass das direkte Ziel einer Tätigkeit von seinem Sinn unabhängig sein kann. So wäre also denkbar, dass Menschen in einer Organisation Tätigkeiten ausführen, deren Sinn mit der Organisation und ihrem direkten Zweck gar nichts zu tun hat.
Auf dem Weg zum Sinn in der Organisation ist die Frage nach ihrem ZweckZweck ein erster Schritt. Im Rückgriff auf das gerade vorgestellte Beispiel können wir dann sagen, dass ein Unternehmen die Aufgabe und das Ziel haben kann, Haushaltsgeräte herzustellen und damit Gewinne zu erwirtschaften, als Zweck aber beispielsweise definiert haben kann, mit seinen Geräten das Hauswirtschaften einfacher, bequemer und damit das Leben der Käufer angenehmer zu machen. Das ist immerhin schon eine andere Qualität als die reine Absicht auf Gewinn und Ertrag.