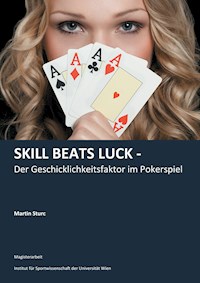
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit vielen Jahren wird weltweit darüber diskutiert, ob es sich bei Poker um ein Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel handelt. Wenngleich sich die Judikatur in besonderem Maße mit dieser Thematik auseinandersetzt, und dabei von einem kausalen Zusammenhang zwischen den Spielkomponenten (Glück/Geschick) und dem Spielresultat ausgeht, hält sich die Sportwissenschaft als Vertreter der Geschicklichkeitsspiele diesbezüglich bedeckt. In vorliegender Arbeit wird aufgezeigt, dass – entgegen der juristischen Definition – nicht der absolute Glücksanteil des Spiels, sondern der relative Geschicklichkeitsvorteil eines Spielers, das akkurate Maß für die Kategorisierung von Spielen sein muss. Durch eine spieltheoretische und spielpraktische Analyse des Pokerspiels wird der Vorteil ("Edge"), den ein Akteur aufgrund seiner geschickten Spielweise erhalten kann, quantitativ erhoben und auf das Kräfteverhältnis der Teilnehmer umgelegt. Das "Competitive Edge Model" liefert schließlich eine neue Methode, um über die Anzahl an Spielwiederholungen ein repräsentatives Spielergebnis sicherzustellen und damit die unterschiedlichen Fähigkeiten der Spielteilnehmer auch im Endresultat zum Ausdruck bringen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu"
Jürgen Wegmann, deutscher Fußball-Profi
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 SPIELTHEORIE
2.1 D
IE
E
LEMENTE EINES
S
PIELS
2.2 D
IE
K
LASSIFIKATION VON
S
PIELEN
2.2.1 K
OOPERATIVE VS.
N
ICHT
-
KOOPERATIVE
S
PIELE
2.2.2 N
ULLSUMMENSPIELE VS.
S
PIELE MIT VARIABLER
A
USZAHLUNG
2.2.3 S
TATISCHE VS.
D
YNAMISCHE
S
PIELE
2.2.4 E
INMALSPIELE VS.
W
IEDERHOLTE
S
PIELE
2.2.5 S
PIELE MIT VOLLKOMMENER VS.
U
NVOLLKOMMENER
I
NFORMATION
2.2.6 D
IE
K
LASSIFIKATION VON
P
OKER
2.3 D
ER RATIONALE
S
PIELER
2.4 D
ER
N
UTZEN EINES
S
PIELERS
2.4.1 D
AS
M
AXI
M
IN
-K
RITERIUM
2.4.2 D
ER
E
RWARTUNGSWERT
2.4.3 D
ER
E
RWARTUNGSNUTZEN
2.4.4 D
ER
N
UTZEN IM
P
OKERSPIEL
2.5 D
IE
S
TRATEGIE EINES
S
PIELERS
2.6 D
IE
D
ARSTELLUNG VON
S
PIELEN
2.6.1 D
IE
N
ORMALFORM
2.6.2 D
IE
E
XTENSIVFORM
2.7 L
ÖSUNGSKONZEPTE
2.7.1 G
LEICHGEWICHT IN DOMINANTEN
S
TRATEGIEN
2.7.2 N
ASH
-G
LEICHGEWICHT
2.8 S
PIELTHEORETISCHE
A
NALYSE VON
P
OKER
2.8.1 T
OY
G
AME
1: D
IE
V
ALUE
-B
ET
2.8.2 T
OY
G
AME
2: D
IE
B
LUFF
-B
ET
2.8.3 T
OY
G
AME
3: D
ER
C
ARD
R
EMOVAL
E
FFEKT
(AKQ-G
AME
)
2.8.4 T
OY
G
AME
4: D
IE
B
ETSIZE
2.8.5 T
OY
G
AME
5: K
ONZEPT DER
E
QUITY UND
P
OT
O
DDS
2.8.6 H
EADS
U
P
N
O
L
IMIT
T
EXAS
H
OLD
´
EM
P
USH
/F
OLD
3 SPIELPRAXIS
3.1 U
NTERSUCHUNGEN ZUM STRATEGISCHEN
V
ERHALTEN REALER
A
KTEURE
3.1.1 D
AS
A
LLAIS
-P
ARADOXON
3.1.2 D
AS
U
LTIMATUM
-S
PIEL
3.1.3 D
AS
E
LLSBERG
-P
ARADOXON
3.1.4 D
AS
Z
IEGENPROBLEM
3.1.5 D
AS
T
AUSENDFÜßLERSPIEL
3.2 B
ESCHRÄNKT
R
ATIONALES
V
ERHALTEN
3.2.1 E
NTSCHEIDUNGEN ALS KOGNITIVER
P
ROZESS
3.2.2 E
NTSCHEIDUNGEN ALS EMOTIONALER
P
ROZESS
3.3 O
PPONENT MODELING UND EXPLOITIVE STRATEGIEN
3.3.1 S
PIELERTYPEN
3.3.2 B
EST
R
ESPONSES
3.4 S
PIELPRAKTISCHE
A
NALYSE VON
P
OKER
3.4.1 S
PIELERTYPEN IN
P
OKER
3.4.2 E
XPLOITING FEHLERHAFTE
B
LUFFING
-
UND
C
ALLING
-F
REQUENZEN
3.4.3 E
XPLOITING
M
ISTAKES IM
AKQ-G
AME
3.4.4 E
XPLOITING
S
TUPID
M
ISTAKES IM
AKQ-G
AME
3.4.5 E
XPLOITING
M
ISTAKES BEI
H
EADS
U
P
N
O
L
IMIT
T
EXAS
H
OLD
´
EM
P
USH
/F
OLD
3.5 K
RÄFTEVERHÄLTNIS,
S
PIELERGEBNIS
& K
ATEGORISIERUNG VON
S
PIELEN
3.6 C
OMPETITIVE
E
DGE
M
ODEL
4 ZUSAMMENFASSUNG
5 AUSBLICK
LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ANHANG
1 Einleitung
Der Sport kann als Mutter aller Geschicklichkeitsspiele verstanden werden. Es geht um Wettkampf, Leistungsvergleich und schließlich um die Frage, wer der beste Athlet von allen ist. Ein Akteur, der aufgrund seines Talents und/oder seiner erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (physischer und/oder psychischer Natur) geschickter ist als seine Gegner, nimmt automatisch die Favoritenrolle ein und kann erwarten zu gewinnen. Ein ungeübter Akteur hingegen geht als Außenseiter ins Rennen und kann letztlich nur hoffen, als Sieger vom Platz zu gehen. Letztgenannte Ausgangslage findet sich auch bei Glücksspielen wieder. Hier ist die Vorherbestimmung als "Underdog" jedoch auf die Spielregeln zurückzuführen. Diese sind nämlich stets zu Ungunsten des Spielteilnehmers ausgelegt und verdammen ihn schließlich dazu, langfristig zu verlieren, sofern ihm Fortuna nicht zur Seite steht. Bei Geschicklichkeitsspielen hingegen ist nicht fehlendes Glück sondern in erster Linie mangelndes Geschick verantwortlich für eine Niederlage.
Bereits seit vielen Jahren wird sowohl in Österreich als auch auf internationaler Ebene darüber diskutiert, ob es sich bei Poker um ein Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel handelt. In Brasilien beispielsweise, dem Austragungsland der FIFA Weltmeisterschaften 2014 und der Olympischen Sommerspiele 2016, wurde Poker bereits als Sport anerkannt. In Österreich hingegen wird Poker vom Gesetzgeber als Glücksspiel definiert.1 Zudem änderte die Österreichische Bundes-Sportorganisation im Jahr 2011 ihre Statuten und sprach sich darin gegen die Aufnahme von Denkspielen aus. Dies ist umso überraschender, weil die internationale Bewegung eine andere Richtung einschlägt: Im Rahmen der Generalversammlung des Weltsportverbandes SportAccord wurde am 19. April 2005 die International Mind Sports Association (IMSA) gegründet, welche die Positionierung des Denksports sowohl gesellschaftlich als auch institutionell festigen möchte, und darüber hinaus das Ziel verfolgt, mit den "World Mind Sports Games" eine Denksport-Großveranstaltung in die olympische Bewegung zu integrieren. Zu den Gründungsmitgliedern der IMSA zählen der internationale Schach-, Bridge-, Go- und Dame-Verband, und auch die International Federation of Poker soll in den kommenden Jahren als Mitglied aufgenommen werden.
Um nun die Eigenschaften des Pokerspiels zu untersuchen, wird nicht – wie dies im Glücksspielgesetz (fehlerhaft) gefordert wird – der absolute Glücksanteil des Spiels unter die Lupe genommen, sondern der Fokus auf den relativen Geschicklichkeitsvorteil eines Spielers gelegt. Diese Herangehensweise ist zwar aus juristischer Sicht nicht legitim, weil hier die Abgrenzung zwischen Glücks- und Geschicklichkeitsspiel dahingehend erfolgt, dass eine der beiden Komponenten für das Zustandekommen des Spielergebnisses überwiegt. Die Sinnhaftigkeit dieser Definition muss jedoch in Frage gestellt werden, weil sie in Bezug auf anerkannte Geschicklichkeitsspiele nicht haltbar ist. Zufallselemente, die mit der Glücksspieleigenschaft eines Spiels in Zusammenhang gebracht werden, können nämlich auch im Sport maßgeblich das Endergebnis beeinflussen. Man denke beispielsweise an den Aufwind beim Skispringen, den Netzroller beim Tischtennis oder die Fehlentscheidung des Schiedsrichters beim Fußball.
Vielmehr muss daher die Frage gestellt werden, ob es einem Spieler grundsätzlich möglich ist, durch den Einsatz seiner "Skills" einen Vorteil gegenüber seinen Mitstreitern zu erlangen. Wenn diese Prämisse erfüllt ist, muss es sich zwangsläufig um ein Geschicklichkeitsspiel handeln, denn ein "geschickter" Spieler wird einem "ungeschickten" Akteur immer überlegen sein. Ob das Spielergebnis dann auch repräsentativ dem Kräfteverhältnis der Teilnehmer gegenüber ist, muss gesondert betrachtet werden. Für die Klassifizierung eines Spiels darf dies jedoch keine Relevanz haben.
Um den relativen Geschicklichkeitsvorteil im Pokerspiel zu erheben und damit die Daseinsberechtigung von Poker als Mind Sport zu erörtern, wird in dieser Arbeit dem sog. Skill-Faktor auf den Grund gegangen.
In diesem Kontext ergeben sich folgende Fragestellungen:
Wie ist das Pokerspiel strukturell aufgebaut?
Welche Strategien sind spieltheoretisch optimal?
Wie verhalten sich reale Akteure in der Spielpraxis?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus suboptimalen Verhaltensweisen?
Wie kann der relative Geschicklichkeitsvorteil quantifiziert werden?
Als Methode wurde ein theoretisch-analytischer Ansatz gewählt. Zunächst wurde das Fachgebiet der Spieltheorie herangezogen, um die Spieleigenschaften von Poker zu ergründen und optimale Spielstrategien zu definieren. Anschließend wurden empirische Befunde zum Entscheidungsverhalten realer Personen in strategischen Situationen untersucht. Auf Basis der Theorie zu beschränkter Rationalität wurden schließlich für die von der Spieltheorie abweichenden Verhaltensmuster Erklärungsansätze herausgearbeitet. Die Kategorisierung von Spielweise und Spielstärke erfolgte durch Einbeziehung von Forschungsergebnissen aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend auf ein vereinfachtes Pokerspiel per Computer-Simulation angewandt. Die Ergebnisse wurden schließlich verwendet, um vom erwarteten Spielergebnis auf das Kräfteverhältnis der Akteure, respektive den relativen Geschicklichkeitsvorteil eines Teilnehmers, zu schließen.
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Spieltheorie und bildet die Basis für weiterführende Analysen in dieser Arbeit. Es wird auf verschiedene Charakteristika von Spielen eingegangen, der rationale Akteur und dessen Nutzen im Spiel beschrieben sowie seine strategischen Handlungsalternativen aufgezeigt. Nach einer Erläuterung zur grafischen Darstellungsform von Spielen werden Lösungskonzepte präsentiert und diese schließlich auf vereinfachte Pokerspiele angewandt. Im zweiten Kapitel werden Divergenzen der Spieltheorie zur Spielpraxis aufgezeigt und der Entscheidungsprozess von realen Personen aus kognitiver und emotionaler Perspektive beschrieben. Es folgt eine Kategorisierung von Spielertypen und die Vorstellung von Spielstrategien, die auf eine fehlerhafte Spielweise der Kontrahenten ausgerichtet sind. Nach einer spielpraktischen Analyse der Pokervariante "No Limit Texas Hold´em" wird abschließend der Bezug zum Spielergebnis hergestellt und dabei verdeutlicht, dass der relative Geschicklichkeitsvorteil eines Akteurs das relevante Maß für die Abgrenzung zwischen Glücks- und Geschicklichkeitsspielen sein muss.
Bei der Erstellung der Arbeit wurde großer Wert darauf gelegt, dass auch Personen, die mit dem Pokerspiel nicht vertraut sind, den Inhalten gut folgen können und Schritt für Schritt an die Komplexität des Spiels herangeführt werden. Aber auch Leser, die sich bereits seit Jahren mit dem Pokerspiel auseinandersetzen, sollen an dieser Arbeit Gefallen finden, denn es wird strukturiert und detailliert in die Tiefe der Materie eingetaucht.
1 § 1 GSpG: (1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. (2) Glücksspiele im Sinne dieses Bundesgesetzes sind insbesondere die Spiele Roulette, Beobachtungsroulette, Poker, Black Jack,… und deren Spielvarianten.
2 Spieltheorie
Der Mathematiker John von Neumann und der Wirtschaftswissenschafter Oskar Morgenstern gelten als Begründer der Spieltheorie. In den 1950er Jahren brachten sie mit "The Theory of Games and Economic Behaviour" ein fundamentales Standardwerk heraus, welches nachhaltig zahlreiche Wissenschaftsdisziplinen prägen sollte. Die moderne Spieltheorie findet Anwendung im Bereich der Ökonomie, Politik, Soziologie, Psychologie, Biologie und zahlreichen anderen Lehr- und Forschungsgebieten.
Seit jeher beschäftigt sich die Spieltheorie auch mit verschiedenen Gesellschaftsspielen, weil diese aufgrund der genau definierten Regeln und klaren Zielsetzungen der Teilnehmer ideale Voraussetzungen für spieltheoretische Analysen bieten. Erste Untersuchungen in der Literatur bezogen sich dabei auf Schach (Zermelo, 1913) und Poker (Borel, 1938).
In den letzten Jahren wurde vor allem auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz mit Gesellschaftsspielen geforscht. Das berühmteste Beispiel liefert wohl der von IBM entwickelte Schachcomputer "Deep Blue", welcher 1997 erstmals den amtierenden Weltmeister bezwingen konnte (Campbell, Hoane & Hsu, 2002). Des Weiteren findet man interessante spieltheoretische Abhandlungen zu Dame (Schaeffer & Lake, 1996), Go (Müller, 2002), Bridge (Frank, 1996) und Poker (Billings, 1995).* Das Pokerspiel rückte nicht nur durch dessen gestiegene Popularität in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses, sondern auch aufgrund der besonderen Eigenschaften des Spiels:
The game of poker ist logistically simple yet strategically complex, and offers many properties not exhibited by chess, checkers, and most other well-studied games. Most importantly, poker is a non-deterministic game with imperfect (hidden) information. Handling unreliable or incomplete information is a fundamental problem in computer science, and poker provides an excellent domain for investigating problems of decision making under conditions of uncertainty. (Billings, 1995, S. 1)
Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, scheint vor allem die Abgrenzung zur Entscheidungstheorie von Interesse zu sein. Diese beschäftigt sich nämlich ausschließlich mit Situationen, in denen gegen eine unbeeinflussbare Wahrscheinlichkeitsverteilung gespielt wird, wie dies beispielsweise bei Roulette der Fall ist. Zahlreiche Methoden und Ergebnisse der Entscheidungstheorie wurden daher aus der Untersuchung von Glücksspielen gewonnen.
Die Spieltheorie betrachtet dagegen keine Glücksspiele, sondern strategische Spiele, die allerdings auch Zufallselemente enthalten können. Als strategisches Spiel wird jede Entscheidungssituation bezeichnet, in der mehrere vernunftbegabte Entscheider Einfluss auf das Resultat haben und ihre eigenen Interessen verfolgen. (Rieck, 2009, S. 36)
Nachdem das Spielergebnis bei einer strategischen Interaktion von den Wahlhandlungen aller beteiligten Akteure abhängt, muss sich jeder Spieler auch Gedanken über das Verhalten seiner Gegner machen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass auch die Gegenspieler Erwartungen in Bezug auf das eigene Verhalten bilden und daraufhin ihre Strategien entsprechend ausrichten.
Ziel der Spieltheorie ist es schließlich, durch eine detaillierte Analyse der Spieleigenschaften, für jeden Spielteilnehmer eine optimale Strategie zu finden und damit eine Verhaltensempfehlung für Entscheidungssituationen zu definieren. Kann für jeden Akteur eine solche Strategie gefunden werden, gilt das Spiel als gelöst (Lück & Weck, 2008, S. 1)
In den nachfolgenden Kapiteln sollen einleitend die zentralen Elemente eines Spiels vorgestellt und die wichtigsten Charakteristika für eine Klassifikation von Spielen angeführt werden. Im Anschluss wird auf den rationalen Spieler, seinen Nutzen und dessen strategischen Handlungsspielraum eingegangen. Des Weiteren werden die gängigsten Darstellungsformen von Spielen und ausgewählte Lösungskonzepte der Spieltheorie präsentiert, welche anhand anschaulicher Beispiele erläutert werden. Darauf aufbauend werden die strategischen Elemente von vereinfachten Pokerspielen analysiert und schließlich eine Lösung des Zielspiels "Heads Up No Limit Texas Hold´em Push/Fold" präsentiert.
2.1 Die Elemente eines Spiels
Formal betrachtet kann die Charakterisierung eines Spiels auf Basis nachfolgender Elemente zurückgeführt werden (Lück & Weck, 2008, S. 2):
Die Menge der Spieler
gibt an, wie viele Akteure sich aktiv am Spiel beteiligen. Wenn der Spielverlauf zu irgendeinem Zeitpunkt vom Zufall abhängt, spricht die Spieltheorie von einer Entscheidung der "
Natur
" und skizziert dies als Pseudospieler. Zu derartigen Situation kommt es beispielsweise bei allen Würfel- und Kartenspielen.
Die Strategiemenge
, die jedem Spieler zur Verfügung steht, repräsentiert die Handlungsalternativen in jeder Entscheidungssituation. Nach einer spieltheoretischen Analyse wählt der Akteur schließlich eine Aktion aus der Strategiemenge aus, und zwar jene, die ihm den größten Nutzen bringt.
Die Auszahlungsfunktion
ist abhängig von den tatsächlich gewählten Strategien aller Spieler und dem daraus resultierenden Spielverlauf. Das Spielergebnis wird schließlich über den sog.
Payoff
angegeben. In einem Spiel wie Schach kann dieser beispielsweise drei Ausprägungen haben: Sieg, Niederlage, Unentschieden.
2.2 Die Klassifikation von Spielen
In Anlehnung an Jerger (2006, S. 11) werden nachfolgend die fünf wichtigsten Charakteristika von Spielen vorgestellt. Jedes beliebige Spiel kann schließlich durch eine Kombination dieser Merkmale klassifiziert werden:
2.2.1 Kooperative vs. Nicht-kooperative Spiele
Bei nicht-kooperativen Spielen wird angenommen, dass sich die Spieler bei der Wahl ihrer Strategie nur an den eigenen Payoffs orientieren und sich nicht für die Auszahlung der anderen Spieler interessieren. Bei kooperativen Spielen hingegen besteht die Möglichkeit, dass sich einzelne Spieler untereinander absprechen und Koalitionen bilden, um dadurch ihren Nutzen zu maximieren. Dies ist allerdings nur dann zu erwarten, wenn sich daraus potentielle Vorteile für alle beteiligten Spieler ergeben und sich die Payoffs der Akteure relativ zu einer Situation ohne Kooperation erhöhen.
2.2.2 Nullsummenspiele vs. Spiele mit variabler Auszahlung
Eine besondere Form der nicht-kooperativen Spiele bildet die Klasse der sog. Nullsummenspiele. Hierbei addieren sich die Auszahlungen aller Spieler auf Null bzw. einen konstanten Wert. Mit anderen Worten: Des einen Verlust ist des anderen Gewinn. Die Payoffs der Spieler verhalten sich reziprok zueinander, d.h., damit ein Spieler eine höhere Auszahlung erhalten kann, muss sich gleichzeitig die Auszahlung von zumindest einem Gegenspieler verringern. Eine variable Auszahlung tritt hingegen in der Regel bei kooperativen Spielen auf, weil die Akteure keine entgegengesetzten Interessen verfolgen und sie die Spielausgänge auch nicht zwangsläufig entgegengesetzt beurteilen. Hierbei ist es möglich, dass zwei oder mehr Spieler von einer Zusammenarbeit profitieren und dadurch eine variable Auszahlung entsteht.
2.2.3 Statische vs. Dynamische Spiele
In statischen Spielen wählen die Akteure ihre Strategie simultan, d.h., sie treffen ihre Entscheidung gleichzeitig. Dies impliziert, dass die Spieler über das Verhalten ihrer Gegner nur Erwartungen bilden, nicht aber deren Entscheidung als gegeben annehmen können. Im Gegensatz dazu erfolgen die Spielzüge bei dynamischen Spielen sequentiell, d.h., die Akteure treffen ihre Entscheidung in einer logischen Reihenfolge nacheinander. Bei solchen rundenbasierten Spielen wird der Spielverlauf wechselseitig durch die gewählte Strategie der Gegner bestimmt und es besteht die Möglichkeit, die eigene Aktion an die Wahlhandlungen der Gegner anzupassen. Entscheidend ist jedoch nicht die physische zeitliche Reihenfolge der Spielzüge, sondern vielmehr der Umstand, ob bei einer Entscheidung von Spieler A dieser die Entscheidung von Spieler B beobachten konnte oder nicht. Hat Spieler B bereits entschieden, was aber von Spieler A nicht beobachtet werden konnte, ist dies äquivalent zu einem simultanen Zug beider Spieler (Pasche, 2007, S. 49). Theoretisch könnte man jedes dynamische Spiel in ein statisches Spiel umwandeln, indem man die Akteure zwingt, ihre Strategie bereits vor Beginn des Spiels festzulegen (Chen & Ankenman, 2006, S. 102).
2.2.4 Einmalspiele vs. Wiederholte Spiele
Wird ein Spiel nur einmal durchgeführt, handelt es sich um ein sog. One-Shot-Game. Die Akteure haben entsprechend keine Informationen übereinander. Sie wissen lediglich dass sie – gemäß der spieltheoretischen Vorgabe – auf einen rationalen Spieler treffen. Bei wiederholten Spielen, sog. Repeated Games, wird ein und dasselbe Spiel mehrfach hintereinander durchgeführt. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit, Präferenzen der Gegner in Erfahrung zu bringen und selbst eine gewisse Reputation aufzubauen. Es entstehen folglich neue strategische Möglichkeiten. Die Lösung von wiederholten Spielen muss daher nicht notwendigerweise einer immer gleichen Abfolge der Lösung des Einmalspiels entsprechen.
2.2.5 Spiele mit vollkommener vs. unvollkommener Information
Von einem Spiel mit vollkommener oder perfekter Information spricht man, wenn alle relevanten Informationen jedem Akteur zu jedem Zeitpunkt des Spiels zur Verfügung stehen. Dazu zählen unter anderem sämtliche Informationen zum bisherigen Spielverlauf (sog. Spielstatus), das Wissen über die jeweiligen Handlungsalternativen der Akteure und über alle möglichen Auszahlungen im Spiel. Ein prototypisches Beispiel hierfür ist Schach. Fehlt irgendeinem Spieler zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels ein Teil dieser Informationen, handelt es sich um ein Spiel mit unvollkommener Information. Dies ist beispielsweise bei Poker der Fall (siehe Kapitel 2.2.6). An dieser Stelle sei erwähnt, dass statische Spiele per Konstruktion eine gewisse Informationsunvollkommenheit aufweisen, weil hier die Entscheidungen der Akteure simultan gefällt werden und der einzelne Spieler daher nicht weiß, welche Strategie der Gegner gewählt hat. Er kann daher über den aktuellen Status des Spiels nicht zur Gänze informiert sein (Rieck, 2009, S. 150).
Um die Informationslage der Akteure noch zu konkretisieren, wird nachfolgend eine weitere Einteilung für Spiele mit unvollkommener Information unternommen. Diese berücksichtigt Zufallselemente des Spiels sowie die Verteilung der spielrelevanten Informationen:
Vollständigkeit vs. Unvollständigkeit der Informationen
Häufig wird der Verlauf eines Spiels durch zufällige Ereignisse beeinflusst. Dies ist insbesondere bei Würfelspielen (durch Würfeln) und Kartenspielen (durch Mischen) der Fall. Der Zufall repräsentiert in der Spieltheorie das stochastische Element, der persönliche Spieler hingegen steht für das strategische Element (Rieck, 2009, S. 124). Durch den Einfluss des Zufalls kann es sein, dass eine gewählte Strategie bei ansonsten identischem Spielverlauf zu einem unterschiedlichen Spielergebnis führt und sich die Auszahlungen der Spieler entsprechend verändern (Lück & Weck, 2008, S. 3). Das Ergebnis eines Spiels mit Zufallselementen hängt damit teilweise auch von Einflussfaktoren ab, die man selbst nicht kontrollieren kann.
Man spricht von einem Spiel mit unvollständiger Information, wenn die Natur als Pseudospieler einen Zug macht, bevor der erste Akteur eine Entscheidung trifft, und dieser Zufallszug von mindestens einem Spieler nicht beobachtet werden kann. Dadurch ist mindestens ein Akteur nicht vollständig über den bisherigen Spielverlauf informiert.
Sicherheit vs. Unsicherheit (Risiko)
Ein Spiel mit Unsicherheit liegt vor, wenn an mindestens einer Stelle des Spiels die Natur als Pseudospieler einen Zug macht, nachdem ein Spieler eine Entscheidung getroffen hat. Diese Kategorisierung bringt zum Ausdruck, dass es häufig Situationen gibt, in denen man sich für eine bestimmte Handlung entscheidet, deren Konsequenzen aber nicht völlig absehbar sind.
Wenn über die Eintrittswahrscheinlichkeit der Umweltzustände überhaupt nichts bekannt ist, wird diese Situation mit Unsicherheit oder Ungewissheit beschrieben. Sind hingegen die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände bekannt, spricht man von Risiko. Einige Autoren sind der Auffassung, dass jede Form stochastischer Unsicherheit als Risiko behandelt werden kann, weil auch bei Ungewissheit stets die Möglichkeit besteht, subjektive geschätzte Wahrscheinlichkeiten zu verwenden (Rieck, 2009, S. 170).
Symmetrische vs. Asymmetrische Informationen
In einem Spiel sind die Informationen symmetrisch verteilt, wenn ein Spieler in jeder Entscheidungssituation über genau die gleichen Informationen verfügt wie alle anderen Spieler auch. Dies ist nicht der Fall, wenn die Akteure sog. private Informationen besitzen, d.h. über spielrelevante Informationen verfügen, die nicht allen Spielern zur Verfügung stehen. Diese Informationsvorsprünge einzelner Spieler führen zu einem Vorteil bei der Entscheidungsfindung und können einen erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf und schließlich auf das Spielergebnis haben (Lück & Weck, 2008, S. 3).
2.2.6 Die Klassifikation von Poker
Bei Poker wird – wie in jeder anderen Sportart auch – gegeneinander um den Sieg gespielt. Die Teilnehmer verfolgen entgegengesetzte Interessen und auch die Spielausgänge werden entsprechend kontrovers beurteilt. Darüber hinaus bedingt der Gewinn eines Spielers den Verlust eines oder mehrerer anderer Spieler in gleicher Höhe. Die Auszahlungen der Akteure addieren sich damit auf Null. Es handelt sich daher um ein nicht-kooperatives bzw. kompetitives Nullsummenspiel.
Des Weiteren erfolgen die Spielzüge in einer zeitlichen bzw. logischen Reihenfolge, d.h. nachdem ein Spieler eine Aktion ausgeführt hat, kommt der nächste Spieler an die Reihe. Dieser hat nun die Möglichkeit auf das Verhalten seines Gegenübers zu reagieren und entsprechend eine (Gegen-)Strategie zu wählen. Daher ist Poker ein dynamisches Spiel.
Formal betrachtet muss jede gespielte Runde beim Pokern als Einmalspiel identifiziert werden, weil sich gewisse Faktoren (z.B. die Anzahl der Chips pro Spieler oder die Reihenfolge, welcher Akteur den ersten Spielzug durchführt) ändern und daher streng genommen nicht ein und dasselbe Spiel mehrmals hintereinander wiederholt wird (Miltersen & Sorensen, 2007, S. 2). Es erscheint jedoch sinnvoll, diesen Umstand mit sog. Zustandsvariablen zu beschreiben, die sich je nach Spielverlauf verändern und den adaptierten Status des Spiels zum jeweiligen Zeitpunkt charakterisieren (Fudenberg & Tirole, 1991, S. 502). Die Struktur und Idee des Spiels bleibt nämlich von diesen Veränderungen grundsätzlich unberührt. Der modifizierte Zustand hat lediglich Auswirkungen auf die Strategiemenge der Spieler, was jedoch wiederum allen Akteuren bekannt ist. Aus diesen Überlegungen heraus kann Poker als wiederholtes Spiel klassifiziert werden.
Nachdem beim Pokerspiel gleich zu Beginn, bevor es zur ersten strategischen Aktion eines Spielers kommt, die Karten randomisiert ausgeteilt werden und daher die Natur als Pseudospieler bereits einen Zug ausführt, handelt es sich um ein Spiel mit unvollständiger Information. Auch im späteren Spielverlauf, nachdem die Akteure bereits eine Entscheidung getroffen haben, werden Karten ausgeteilt. Damit treten weitere zufällige Ereignisse auf, die außerhalb der Kontrolle der Spieler liegen. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser stochastischen Elemente liegt jedoch aufgrund der endlichen Anzahl an Karten objektiv vor. Es handelt sich daher um ein Spiel mit Risiko. Darüber hinaus sind die Informationen asymmetrisch verteilt, weil jeder Spieler nur seine eigenen Karten kennt und keinerlei Information über das Blatt seiner Gegner hat. Poker lässt sich daher als Spiel mit unvollständiger und asymmetrischer Information unter Risiko bzw. als Spiel mit unvollkommener Information einstufen.
Bei Poker handelt es sich in seiner Endform um ein nicht-kooperatives Nullsummenspiel mit unvollkommener Information, welches dynamisch und wiederholt gespielt wird. In den nachfolgenden Kapiteln werden auch simplifizierte Pokerspiele, sog. Toy Games, vorgestellt, welche zum Teil auch als Spiel ohne Risiko modelliert sind.
2.3 Der rationale Spieler
Die Spieltheorie geht mit der sog. Rational-Choice-Annahme davon aus, dass Menschen Nutzenmaximierer sind und stets versuchen jene Ergebnisse in einem Spiel herbeizuführen, die aus ihrer Sicht der individuellen Bewertung mit dem größtmöglichen Nutzen verbunden sind. Der Nutzen eines Ereignisses ist stets quantifizierbar, wenn auch nicht notwendigerweise in monetären Einheiten. Die Ziele der Akteure können egoistischer, altruistischer oder sonstiger Natur sein (Gutjahr, 2009, S. 7).
Der Nutzen eines Akteurs wird über die Payoffs am Ende eines Spiels repräsentiert und die verschiedenen Spielausgänge werden gemäß den möglichen Auszahlungen in eine ordinale Reihung gebracht (Jerger, 2006, S. 15). Im Sport wird beispielsweise die Auszahlung "Sieg" höher bewertet als die Auszahlung "Niederlage". Auf Basis dieser wohldefinierten Präferenzordnung wird schließlich die Verhaltensweise in Entscheidungssituationen und damit die Strategie der Spielteilnehmer bestimmt (Rieck, 2009, S. 168).
Nachdem jeder Spieler nach individuell wünschenswerten Spielausgängen strebt, wird unterstellt, dass dieser seine Strategie auch entsprechend rational wählt: "Als rational kann ein von Vernunft bestimmtes und logisch ableitbares Verhalten eines Spielers bezeichnet werden. Rationale Spieler können grundsätzlich zwischen schlechter und besser unterscheiden und sich ebenso widerspruchsfrei danach verhalten" (Rieck, 2009, S. 41).
Die Annahme zur vollständigen Rationalität der Spielteilnehmer wird in der Spieltheorie als "common knowledge" bezeichnet. Jeder Akteur weiß also, dass auch seine Gegner dem Rationalitätspostulat unterliegen, und ist sich zudem bewusst, dass auch diese wissen, dass man das weiß, usw. Weiterer Bestandteil des gemeinsamen Wissens ist die Kenntnis über die genauen Regeln des Spiels (Jerger, 2006, S. 44).
Ein rationaler Spieler kann sich zudem in jeder Entscheidungssituation an alle Informationen, über die er früher verfügte, insbesondere auch an seine eigenen Spielzüge, erinnern. Anders gesagt: Er vergisst nichts, was er schon einmal wusste. Die Spieltheorie geht daher bei der Modellierung eines rationalen Spielers von einem perfekten Erinnerungsvermögen (sog. Perfect Recall) aus.
In Realität kann natürlich nicht von einem derart idealisierten Spieler mit uneingeschränktem Wissen ausgegangen werden. Im Gegenteil: Die Spieler verfügen in der Regel über unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche oft erst den Reiz eines kompetitiven Wettstreits ausmachen. Die Theorie der "Bounded Rationality" beschäftigt sich mit der eingeschränkten Rationalität von Spielern und deren Auswirkung auf das Entscheidungsverhalten, welches im Kapitel zur Spielpraxis noch ausführlich behandelt wird.
2.4 Der Nutzen eines Spielers
Um die Bewertung von Spielausgängen zu veranschaulichen, sei nachfolgend eine einfache Entscheidungssituation unter Unsicherheit vorgestellt:
Abb. 1: Entscheidungssituation unter Unsicherheit
Verglichen werden die Auszahlungen zweier Lotterien. Lotterie A ergibt im günstigsten Fall eine Auszahlung von 1.000 und im schlechten Zustand der Welt eine Auszahlung von 100. Lotterie B ist dagegen weniger sensitiv gegenüber der Natur. Hier steht eine Auszahlung von 700 (gut) einem Payoff von 500 (schlecht) gegenüber.
Die Beurteilung dieser Situation kann nun auf Basis verschiedener Überlegungen erfolgen. Jerger (2006, S. 18) stellt hierfür drei verschiedene Varianten vor:
2.4.1 Das MaxiMin-Kriterium
Das MaxiMin-Kriterium wählt eine äußerst pessimistische Herangehensweise. Ausgehend von der Annahme, dass der Gegenspieler (in diesem Fall die Natur) einen selbst immer möglichst schlecht stellen möchte, optimiert man über diesen "worst case". Man wählt also jene Alternative, die im schlechtesten Fall am Besten ist. Anders ausgedrückt: Man sucht das maximale Minimum.
Bezugnehmend auf das obige Beispiel würde man vom schlechten "Zustand der Welt" ausgehen und Lotterie B wählen, weil diese mit einer Auszahlung von 500 einen höheren Payoff verspricht als Lotterie A mit einer Auszahlung von 100.
Die Bewertung kam jedoch ohne Berücksichtigung von Informationen zustande, welche man intuitiv für relevant erachten würde. Dies wären:
Alle Auszahlungen in anderen als dem schlechtesten Zustand
Jegliche Wahrscheinlichkeit, mit denen der gute oder schlechte Zustand eintritt
Diese Bestandteile finden bei der Beurteilung mittels Erwartungswert Berücksichtigung.
2.4.2 Der Erwartungswert
Lotterie A:





























