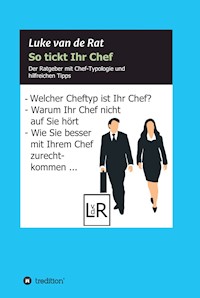
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Immer Ärger mit dem Chef. Das kennt jeder! Aber was tun? Dieser Ratgeber gibt auf eine humorvolle und detailreiche Art einen Überblick über verschiedene Cheftypen, ihre Eigenarten und die besten Wege, mit ihnen klar zu kommen. Luke van de Rat hat in seinem Leben viele Chefs in vielen Situationen erlebt und noch mehr über Chefs mit anderen gesprochen. Profitieren Sie von seiner Erfahrung und lernen Sie, Ihren Chef mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. - Authentische, spannende und humorvolle Beschreibung verschiedener Cheftypen - Einfachste Zuordnung zu einer Typologie - Praxisnahe, umsetzbare und konstruktive Tipps zum Umgang mit dem Chef
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Luke van de Rat
So tickt Ihr Chef
Luke van de Rat
So tickt Ihr Chef
Der Ratgeber mit Chef-Typologie und
hilfreichen Tipps
© 2018 Luke van de Rat
Umschlag Illustration: Luke van de Rat
Lektorat: Dore Wilken
Bildrechte der Illustrationen: www.colourbox.de
Bildrechte Logo LvdR: Luke van de Rat
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback978-3-7469-4722-8
Hardcover978-3-7469-4723-5
e-Book978-3-7469-4724-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Das gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Die Cheftypologie – „Mit welchem Cheftyp habe ich es tun?“
1.1 Typ 1: „Der nordkoreanische Diktator“
1.2 Typ 2: „Der große Lügner und Selbstdarsteller“
1.3 Typ 3: „Der ehrgeizige Sklaventreiber“
1.4 Typ 4: „Der harmlose Faulenzer“
1.5 Typ 5: „Der farblose Verwalter“
1.6 Typ 6: „Die Chefin“
1.7 Typ 7: UND: „Der tolle Chef“
Kapitel 2: Die vier wichtigsten Strategien für den Umgang mit dem Chef: „Wie bekomme ich bei meinem Chef, was ich will?“
2.1 Strategien für Typ 1 „Der nordkoreanische Diktator“
2.2 Strategien für Typ 2 „der große Lügner und Selbstdarsteller“
2.3 Strategien für Typ 3 „Der ehrgeizige Sklaventreiber“
2.4 Strategien für Typ 4 „Der harmlose Faulenzer“
2.5 Strategien für Typ 5: „Der farblose Verwalter“
2.6 Strategien für Typ 6: „Die Chefin“
2.7 Strategien für Typ 7: „Der tolle Chef“
Kapitel 3: Erklärungsansätze – Wie ticken Unternehmen und die, die darin arbeiten?
3.1 Warum haben Chefs einen so großen Einfluss im Unternehmen?
3.2 Das Unternehmen als Biotop
Kapitel 4: Allgemeine Tipps für das Leben mit der Arbeit
4.1 Tipps zur Eigenbehandlung von „Chefpsychosen“
4.2 Grundlegende Tipps für ein gesundes Arbeitsleben
Und wie geht es jetzt weiter?
Vorwort
Die Arbeit macht rechnerisch ca. 40 Prozent der Wachzeit eines in Deutschland lebenden Menschen aus. Wir verbringen gefühlt mehr Zeit mit dem Chef und den Kollegen als mit der eigenen Frau/dem eigenen Mann, der Familie, den Kindern oder Freunden.
Allein das sollte Grund genug dafür sein, dass die Arbeit ein positiver Teil des eigenen Lebens ist. Wenn es gut läuft, sollte sie den Menschen erfüllen.
Da das Leben aber kein Wunschkonzert ist, lassen sich diese Vorstellungen sicherlich nicht immer und überall umsetzen. Oft zwingen finanzielle oder andere Bedingungen viele dazu, einen Job zu machen, der nicht ideal für sie ist.
Aber warum klagen so viele Menschen über ihre Arbeit? Warum erlebt man an öffentlichen Plätzen – der Zug ist dafür ideal – immer wieder die Situation, dass sich Kollegen oder auch Unbekannte sehr negativ über ihre Arbeit äußern? Und warum spielt bei dieser Kritik der Chef meistens die Hauptrolle?
Wie bei der Regierung, über die auch gerne gelästert wird, trägt der Chef in einer Firma die Hauptverantwortung. Er hat sich „freiwillig“ dafür gemeldet, die Entscheidungen zu treffen. Insofern ist es logisch, dass ihm auch Missstände angelastet werden.
Aber es scheint mehr dahinterzustecken. Denn oft geht es gar nicht um die Entscheidung des Chefs an sich, sondern um die Art und Weise: die Art der Kommunikation, die Art des Umgangs etc. Menschen beschäftigen sich sehr intensiv damit, in welcher Art mit ihnen umgegangen wird. Und ihr Vorgesetzter läuft zusätzlich in einem besonderen Wettbewerb, da an ihn besondere Anforderungen gestellt werden. Es handelt sich schließlich um die Führungskraft, der man Mitarbeiter anvertraut hat und die eine entsprechende Verantwortung für sie trägt. Insofern dienen Chefs sicherlich auch als Projektionsfläche für viele andere Themen.
Wenn Chefs nun aber so eine Bedeutung und einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter haben, dann macht es sicherlich Sinn, zu verstehen, wie der eigene Chef tickt und wie man am besten mit ihm umgeht. So entstand die Idee zu diesem Buch!
Über die Jahre meines Berufslebens und die verschiedenen Stationen lernte ich eine ganze Reihe von Führungspersönlichkeiten sehr intensiv kennen. Mein Interesse für das Thema Führung sowie meine Aufmerksamkeit und Sensibilität schärften meine Sinne für das Auftreten von Chefs. Es waren in der Regel Männer, nur vereinzelt Frauen. Darüber hinaus habe ich, wie wahrscheinlich jeder arbeitende Mensch, unzählige Gespräche mit Freunden, Bekannten und Kollegen über Chefs geführt. Das war für mein Buch sehr hilfreich, gerade auch für das Thema „Frauen in Chefpositionen“.
Aus diesen vielen Beispielen habe ich nun eine Typologie abgeleitet, die es möglich machen soll, den eigenen Chef einem oder mehreren dieser Typen zuzuordnen, diesen dadurch besser zu verstehen und auch besser mit ihm umgehen zu können. Die beschriebenen Typen 1 bis 5 und 7 sind dabei Grundtypen, die sowohl für einen Mann als auch für eine Frau als Chef gelten können. Typ 6 beschreibt nochmal die Besonderheiten einer Frau als Chefin.
Für Mitarbeiter spielt es sicherlich eine Rolle, ob sie als Frau oder als Mann ihrem Chef gegenüberstehen. Trotzdem zeigen meine ausführlichen Gespräche mit Betroffenen, dass die Eigenarten und Verhaltensweisen der Chef-Grundtypen sich sehr ähnlich auf weibliche und männliche Mitarbeiter auswirken.
Zur besseren Lesbarkeit habe ich Bezeichnungen von Personen nur in der männlichen Form verwendet. Selbstverständlich sollen sich Leserinnen ebenso angesprochen und durch diese Vereinfachung keineswegs diskriminiert fühlen.
Kapitel 1: Die Cheftypologie – „Mit welchem Cheftyp habe ich es tun?“
Verstehen Sie, wie Ihr Chef tickt und Ihnen wird vieles klar! Sie wer- den entspannter mit dem Chef umgehen und Ihr Arbeitsleben wird erheblich leichter
In diesem Kapitel habe ich anhand vieler Beispiele eine Typologie für „Chefs“ entwickelt. Ich versuche, sie jeweils so realitätsnah wie möglich zu beschreiben. Der Gedanke dahinter: Erkennen Sie Ihren Cheftyp und verstehen Sie, wie er tickt. Das nimmt den meisten Menschen schon ein gerüttelt Maß an Unzufriedenheit.
Was ist notwendig, um den eigenen Chef zu durchschauen? Eigentlich gar nicht viel! Wie so oft hängt es an der nötigen Aufmerksamkeit. Insbesondere kleine Details sind wichtig, die sich dann zu einem großen Ganzen zusammensetzen.
Die Arbeitsbeziehung Chef – Mitarbeiter als eine besondere Form der sozialen Beziehung entsteht aus dem Zusammenspiel des Erlebens und Verhaltens des jeweils anderen. Und das passiert auf vielen verschiedenen Beziehungsebenen: verbale und nonverbale Kommunikation, Wortwahl, Stimmlage, Gestik, Mimik, Körpersprache und vieles mehr.
Erst nach vielen Jahren wurde mir klar, dass Menschen generell – aber eben auch Chefs – bei vielem, was sie zum Beispiel einen Mitarbeiter fragen „getarnte Ich-Botschaften“ senden. Damit ist gemeint, dass sie eigentlich gar nicht etwas fragen, sondern ihre eigene Meinung, ihre eigene Situation oder Ansicht beschreiben, manches Mal sogar Hilferufe aussenden – aber eben getarnt, nicht offen und klar erkennbar.
Hintergrund: Der Begriff „Ich-Botschaft“ stammt aus der Kommunikationsforschung und beschreibt eine konstruktive Form des Dialoges oder auch der Konfliktaustragung. Statt dem Gegenüber Vorhaltungen zu seinem Handeln zu machen und das in „Du-Botschaften“ zu senden („Du machst immer, Du sagst immer …“) und ihn damit anzuklagen, hilft die „Ich-Botschaft“ dem Sender dabei, die Situation aus der eigenen Perspektive zu beschreiben. Die Ich-Botschaft bezieht sich auf mich und meine Wahrnehmung. Sie klagt den anderen nicht an, sondern beschreibt meine Reaktion auf sein Verhalten. Klingt gut!
Bei der von mir beschriebenen „getarnten Ich-Botschaft“ wendet der Sender nun aber einen Trick an. Die Ich-Botschaft wird nicht klar gesendet, sondern in Beschreibungen, Fragestellungen oder Behauptungen verpackt, damit sie neutraler erscheint und nicht mit dem Absender (hier dem Chef) in Verbindung gebracht wird. Diese Tarnung macht es dem Empfänger, also dem Mitarbeiter, solange er diesen Trick nicht durchschaut, schwer, die wirklichen Absichten des Chefs zu begreifen.
Ein Beispiel: In einer Diskussion über die Zukunft des eigenen Unternehmens fragte mich der Chef, ob das Unternehmen nicht viel zu klein und provinziell für eine bestimmte moderne Kundengruppe sei. Ich antwortete voller Überzeugung „Nein“ und erklärte meine Einschätzung, wo das Unternehmen heute steht und wohin es sich entwickeln könnte. Ich hatte aber die eigentliche Botschaft gar nicht verstanden! Der Chef war selbst der festen Überzeugung, dass das Unternehmen so sei! Und noch viel schlimmer: Er traute es sich gar nicht zu, das zu verändern oder wollte es am Ende vielleicht auch gar nicht.
Wenn man also im Zusammenspiel mit dem eigenen Chef detaillierter auf seine „getarnten Ich-Botschaften“ achtet, wird man besser die Beweggründe, Ängste oder Motive des Chefs verstehen und sich darauf einstellen können. Dabei ist es eine Möglichkeit, den eigenen Chef einem der folgenden Typen zuzuordnen.
Warum nervt der eigene Chef? Sicherlich hat sich jeder diese Frage schon einmal gestellt. Und dabei geht es nicht um einen schlechten Tag, wenn jemand mal schlechte Laune hat. Nein – es geht um Grundlegenderes, das uns selbst auf Dauer ärgert.
Diese Frage sollte beantwortet werden, bevor wir uns mit den verschiedenen Typen von Chefs beschäftigen. In meiner langjährigen Erfahrung mit zahlreichen Chefs habe ich viele „Nervfaktoren“ kennengelernt. Die wichtigsten Sieben führe ich hier auf.
1.Der Chef weiß alles besser, hört nicht zu, macht sein Ding
Ein Mitarbeiter auf einer bestimmten Stelle und mit ausreichend Berufserfahrung sollte wissen, worauf es bei der Arbeit ankommt und wie die Aufgaben am besten erledigt werden.
Der Chef nimmt das allerdings nicht wahr oder will es nicht akzeptieren. Bis in das kleinste Detail weiß er Dinge besser, korrigiert die Mitarbeiter ständig, gibt detaillierte Vorgaben, wie etwas zu erledigen ist. Schlimmer noch: Er hört den Mitarbeitern nicht zu, nimmt keine Rücksicht auf Vorschläge und Ideen. Er macht eben sein Ding – das nervt!
2.Der Chef traut dem Mitarbeiter nichts zu, die Mitarbeiter werden gegängelt
Meist aus Kontrollwahn bzw. Misstrauen nehmen Chefs ihre Mitarbeiter nicht für voll. Sie trauen dem geübten und erfahrenen Mitarbeiter trotz langjähriger Praxis nicht zu, dass er die Aufgabe abarbeitet oder dass er in der Lage ist, Probleme selbstständig zu lösen.
Das führt dazu, dass dem Mitarbeiter nur kleine Arbeitspakete zugeteilt werden. Nach Abarbeitung des Paketes und entsprechender Kontrolle wird das nächste Paket zugeteilt. Was diese Art von Chefs auch gerne macht: Augen und Ohren ständig und überall zu haben und sich in jede Sache einzumischen. Das nervt tierisch! Oder sie übernehmen bestimmte Aufgaben gleich ganz selbst – die vollständige Bloßstellung des jeweiligen Mitarbeiters.
Nüchtern betrachtet kommt es durch dieses Verhalten zu überflüssigen Abstimmungen, Verzögerungen und Unterbrechungen sowie einer zunehmenden Unsicherheit auf Seiten der Mitarbeiter. Sie werden entmündigt.
3.Der Chef hält sich nicht an Verabredungen und Entscheidungen – es fehlt Vertrauen
Ein weiterer Nervfaktor von Chefs ist die „partielle Amnesie“. Damit verbinde ich die Hoffnung, dass dieses Verhalten krankhaft bedingt ist und nicht absichtlich angewendet wird.
Ein Beispiel: Der Mitarbeiter sitzt mit dem Chef zusammen und beide sprechen ein bestimmtes Vorgehen ab. Der Mitarbeiter beginnt absprachegemäß mit der Aufgabe. Am nächsten Tag „erinnert“ sich der Chef nicht mehr an diese Verabredung. Er hat inzwischen etwas anderes beschlossen, die Aufgabe vielleicht sogar jemand anderem gegeben. In jedem Fall steht der betroffene Mitarbeiter blöd da.
Was ist der Grund dafür? Sehr häufig ist es Überforderung: Der Chef hat zu viele Baustellen, verliert den Überblick, vielleicht fehlt es ihm auch (noch) an der nötigen Struktur, seine Absprachen zu dokumentieren.
Seltener kommt es vor, dass ein Chef dieses Verhalten gezielt einsetzt. Das findet sich insbesondere beim Typ „nordkoreanischer Diktator“. Dieser Chef kann so gezielt einzelne Mitarbeiter bloßstellen und vor den Augen der Gemeinschaft demontieren – eine überaus fragwürdige Art!
4.Der Chef hat kein Interesse an den Mitarbeitern
Sehr zum Ärgernis und sogar zur persönlichen Kränkung wird es für Mitarbeiter, wenn sie über die Zeit feststellen, dass der Chef kein wirkliches persönliches Interesse an ihnen hat. Und ich meine hier nicht ein beneidenswertes Betriebsklima, bei dem Chef und Mitarbeiter einen intensiven Austausch betreiben, der weit über die Arbeitsbelange hinausgeht. Das möchte auch nicht jeder. Nein, ich meine die Sorgfaltspflicht eines Vorgesetzten, der sich um das Wohl seiner Mitarbeiter zu kümmern hat. Über rein dienstliche Themen hinaus lassen sich hier noch ausreichend Felder finden, die dazu gehören, wie das Wohlbefinden, die Arbeit mit Kollegen und anderen Abteilungen, die Auslastungssituation und Ähnliches.
Chefs, die kein Interesse an ihren Mitarbeitern haben, beschäftigen sich nicht damit. Ihr Augenmerk ist rein auf die Ableistung der Aufgaben gerichtet. Der Mitarbeiter fühlt sich austauschbar.
5.Der Chef hat seine eigenen Ziele, geht über Leichen
So verhalten sich die karrieregetriebenen Vorgesetzten. Sie haben das eigene Fortkommen, die Beförderung oder die Betrauung mit speziellen Aufgaben und Projekten im Sinn.
Ich habe einen Bereichsleiter kennengelernt, der mich fragte, wohin ich mich beruflich entwickeln möchte. Auf meine Antwort, dass ich dazu keinen genauen Plan hätte und auch nicht wüsste, ob mir eine Vorstandsposition überhaupt Spaß machen würde, war er ganz entgeistert. Er riet mir, mich und meine Aktivitäten sehr stringent auf die Vorstandsposition auszurichten. Wieder eine getarnte Ich-Botschaft! Denn er selbst war auf dem Wege, Vorstand zu werden.
Diese Chefs beurteilen alles danach, wie es ihnen hilft, ihr Karriereziel zu erreichen. Es geht ihnen nur dann inhaltlich um die Sache, um die Lösung eines Problems, wenn sie sich damit bei ihren Vorgesetzten profilieren können.
Themen, die kein Profilierungspotenzial haben, interessieren sie nicht.
Ihr Verhalten macht es für die Mitarbeiter sehr schwierig, denn sie fühlen sich instrumentalisiert. Sie dienen nur dem Zweck, ihren Chef weiterzubringen. Und gerne nutzt dieser Chef die Mitarbeiter aus und überlastet sie mit zu vielen Aufgaben.
Hier ist es für den Mitarbeiter sehr wichtig, sich abzugrenzen, Stopp zu sagen und sich nicht alles aufhalsen zu lassen.
6.Der Chef hängt sein Fähnchen nach dem Wind
Dieses Verhalten kommt häufig vor und ist je nach Intensität auch das akzeptabelste. Es geht um das Standing des Chefs. Diese Chefs haben kein oder nur ein eingeschränktes Selbstbewusstsein: Sie fallen bei Gegenwind um, sie ändern ihre Meinung, wenn sie auf Widerstand stoßen oder wenn einflussreiche Vorgesetzte sie dazu drängen.
Ein Unternehmen ist kein Gesprächskreis auf der Bastmatte, das ist klar. In einem disziplinarischen Verhältnis ist der Vorgesetzte weisungsbefugt und wenn sein eigener Chef den Chef anweist, etwas zu tun, dann muss er es am Ende umsetzen.
Hier geht es eher darum, wie sich ein Chef für die Sache, die eigene Abteilung und seine Mitarbeiter einsetzt. Versucht er, die Interessen der Abteilung und seiner Mitarbeiter durchzusetzen oder geht er in der Regel den Weg des geringsten Widerstandes?
7.Der Chef ist unberechenbar
Die Unberechenbarkeit eines Chefs ist für Mitarbeiter eine der schwierigsten Verhaltensweisen. Wie in jedem sozialen System, lebt auch die Arbeitswelt davon, dass man den anderen einschätzen kann, weiß, was er möchte und was nicht.
Wenn allerdings ein Chef völlig unberechenbar ist, wird dem Mitarbeiter das nicht gelingen. Unberechenbarkeit kann sich in häufigen Änderungen von Entscheidungen oder Einschätzungen äußern. Es kann aber auch die Unberechenbarkeit im persönlichen Verhalten gegenüber Mitarbeitern sein.
Ein Beispiel: Der Chef zitiert seinen Mitarbeiter zu sich und macht ihm in deutlichen und drastischen Worten klar, wie genau auf die Anfrage eines Kunden zu reagieren sei. Er weist den Mitarbeiter mit detaillierten Vorgaben an, was er schleunigst zu erledigen habe. Der Mitarbeiter macht sich sofort an die Arbeit.
Am nächsten Tag hat der Mitarbeiter noch eine Rückfrage zu einem Detail. Er spricht den Chef vorsichtig an, doch dieser ist bester Laune. Der Mitarbeiter will das Detail klären, aber der Chef winkt ab, beschwichtigt, erläutert ihm, warum der Kunde nur so hatte reagieren können und fragt den Mitarbeiter, warum er denn so eine „Welle“ machen würde.
Nachdem wir uns mit den „Nervfaktoren“ von Chefs beschäftigt haben, komme ich nun zur Cheftypologie: Die Cheftypen werden in ihren verschiedenen Aspekten beschrieben. Außerdem versuche ich, über typische Beispiele ein plastisches Bild des Menschen und der Führungskraft zu erzeugen.
Zum besseren Verständnis beschreibe ich die Cheftypen unter folgenden Gesichtspunkten:
1.Auftreten
2.Führungsstil
3.Kommunikation
4.Auswirkungen auf das Unternehmen
Für die einzelnen Typen habe ich einen möglichst plakativen Namen gesucht und mit Hilfe einer Illustration eine Visualisierung dieses Menschen versucht.





























