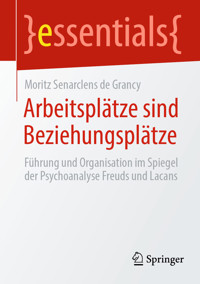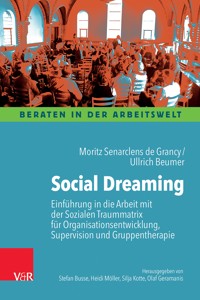
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
Das Phänomen des Traums hat die Menschheit seit jeher fasziniert, zugleich aber auch vor Rätsel gestellt. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, erkannte um 1900 im Traum den "Königsweg" zum Verständnis unbewusster Seelenzustände. Doch erst seit den 1980er Jahren wird der Traum auch als soziales Phänomen aufgefasst und für die Arbeit in Unternehmen und temporären Organisationen genutzt. Ausgehend von den Entwicklungen des britischen Psychoanalytikers W. Gordon Lawrence stellt dieser erste Einführungsband in deutscher Sprache die Methodik und Praxis der sozialen Traummatrix allgemeinverständlich dar und gibt Hintergrundwissen zur Bedeutung von Träumen für komplexe soziale Dynamiken in Gruppen. Er zeigt die wichtigsten Anwendungsbereiche für Social Dreaming in Wirtschaft und Gesellschaft auf und leitet über zu einem kollektivpsychologischen Verständnis von Träumen und ihren Verbindungen zum sozialen Leben in Gruppen und Gesellschaften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Moritz Senarclens de Grancy / Ullrich Beumer
Social Dreaming
Einführung in die Arbeit mit der Sozialen Traummatrix für
Organisationsentwicklung, Supervision und Gruppentherapie
VANDENHOECK & RUPRECHT
Mit einer Abbildung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Moritz Senarclens de Grancy
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-607X
ISBN 978-3-647-99327-0
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Zur Einleitung: Der Traum und sein sozialer Einfluss
Social Dreaming – Ursprung, Zielsetzung und Technik
Zur Entstehung der Sozialen Traummatrix
Aufbau und Organisation der Sozialen Traummatrix
Grundkonzepte von Gordon Lawrence
Matrix als think space
Systemisches Denken in Organisationen
Arbeitshypothesen
Nutzen der Traummatrix
Der Traum, nicht der Träumer
Kunst und kreatives Potenzial
Struktur und Prozess – Die praktische Arbeit mit der Traummatrix
Setting
Hosts
Interventionen
Zugänge zu unbewussten Assoziationsverbindungen
Amplifikationen – Anknüpfungen an Kunst und Kultur
Die Einbeziehung verschiedener Systeme
Social Dreaming als Prozess
Die Eröffnung und Klärung der Aufgabenstellung
Die Social Dreaming Matrix in sieben Schritten
Traumreflexionsgruppen
Illustration: Protokoll einer Traummatrix
Exkurs: Psychoanalytische Hintergrundkonzepte
Freie Assoziation
Präsenz statt Deutung
Containment
Sinn und Zusammenhalt
Abwehrmechanismen
Übergangsraum (Potential Space)
Ungedachtes Wissen
Unbewusstes und Unendliches
Die Traummatrix als Spiegelphänomen
Der Traum als Kategorie des Denkens bei Freud
Social Dreaming in Unternehmen und Organisationen
Lernen, über Träume zu sprechen – Workshops zur Einführung in das Soziale Träumen
Implementierung in Tagungen und Kongresse
Social Dreaming als Inhalt von Fortbildungen
Social Dreaming im Unternehmenskontext
Die Online-Durchführung von Social Dreaming
Perspektiven des Social Dreaming – Abschließende Bemerkungen
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leser/-innen, die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und Schulen übergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene anregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Zur Einleitung: Der Traum und sein sozialer Einfluss
Mit der Sozialen Traummatrix wird das Sprechen über Träume als gemeinschaftliches Denken von Gruppenprozessen erfahrbar, gleichzeitig stellt die Matrix auch einen (Veranstaltungs-)Raum für Teilnehmende. Die Methode stammt von dem britischen Psychoanalytiker Gordon Lawrence, der die Social Dreaming Matrix als eine Form der Entwicklung von Organisationen konzipierte und damit völlig neues Terrain betrat (Lawrence 1998b, S. 123). Zugrunde liegt die Idee, dass es Gruppen in ihrer Entwicklung fördert, wenn es gelingt, das in ihnen vorhandene »ungedachte Wissen« (»unthought known(s)«; Bollas 1987) in Begriffe und Sprachbilder zu überführen. So begann Lawrence Anfang der 1980er Jahre, sich für die Träume von Menschen in Organisationen zu interessieren.1
Die Traummatrix greift die Idee Freuds auf, nach der Träume einen Sinn haben und zum »Ersatz eines anderen Denkvorgangs bestimmt« sind (Freud 1900/1999, S. 100 f.). Sein Hinweis, dass Träume manifeste Gedanken sind, die andere latente Gedanken ersetzen, wirft die Frage auf, wie die Bezüge und Verbindungen zu diesen latenten Gedanken in soziokulturellen Gruppenkontexten geartet sein können. Darauf nimmt Social Dreaming insofern Bezug, als es den Teilnehmenden die Möglichkeit eröffnet, über Träume einen Zugang zu Gedanken, Wünschen, Sorgen aber auch Gefühlen zu finden, die von den Mitgliedern in Unternehmen, Organisationen oder anderen (sozialen) Gefügen geteilt und weitergetragen werden können. Dabei werden die Träume nicht in einem individuellen Setting analysiert, sondern über ein assoziatives Sprechen über sie in der Matrix miteinander in Verbindung gebracht, wie später eingehend erläutert wird.
Tatsächlich führt uns das Sprechen über Träume in Gedankenwelten ein, die auf Umwegen meist mit uns und den Situationen, in denen wir leben und arbeiten, zu tun haben. Wenn der Traum in gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Debatten thematisiert wird, so mag mit ihm die Auffassung eines »Luftschlosses« einhergehen – zwar beeindruckend, jedoch ohne Bezug zur Realität. Tatsächlich aber galt der Traum in der Antike als etablierter Gegenstand der Wissenschaft, der wichtige Informationen über die Zukunft der Menschheit enthielt. Träume wurden als göttliche Botschaften verstanden, denen der Mensch um seines Fortbestehens willen unbedingte Beachtung zu schenken hatte. Diese Auffassung hatte über viele Jahrhunderte hinweg Bestand. Erst Kant, Schopenhauer und die Philosophen2 der Aufklärung spalteten den Traum von der Vernunft ab und ordneten ihn dem Wahnsinn zu, weil in ihm die Logik der Vernunft außer Kraft gesetzt schien. In der Romantik wurde der Traum als ästhetische Kategorie der Erkenntnis rehabilitiert. Friedrich Nietzsche war einer der ersten Vordenker, der die erkenntnisbildende Funktion des Traums erkannte: In »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn« (1873) beklagt er sich, dass der Mensch nicht begreife, welche tiefere Einsicht ihm mit dem Traum gegeben sei, nämlich dass in der Wahrheit nichts anderes als ein bewegliches Heer von Metaphern am Werk sei, das Bestimmung nicht durch sein Verhältnis zur Sache, sondern durch das Verhältnis der Metaphern untereinander gewinne. Damit stellte Nietzsche (noch vor dem Schweizer Linguisten Ferdinand de Saussure) die Behauptung auf, dass unser Bezug zur Wahrheit nicht so sehr mit der Sache an sich zu tun habe, sondern mit dem Verhältnis der Sprachzeichen zueinander, derer wir uns zur Beschreibung des Wahrheitsbezuges bedienen. Um die Bedeutung des Sprechens über Träume verstehen zu können, muss man diese Erkenntnis zusätzlich mit Freuds These koppeln, der zufolge nicht so sehr das Bildhafte des Traumes relevant ist, sondern die Traumerzählung – also wie der Traum sprachlich dargestellt wird. Der Schlaf der Vernunft gebiert eben nicht nur Ungeheuer, wie der spanische Maler Goya nahelegte, sondern vor allem Text. In diesem Sinne produziert die Soziale Traummatrix neue und zusätzliche Sprachzeichen, mit deren Hilfe die Mitglieder einer Organisation über ihre Themen und akuten Situationen gemeinsam nachdenken können. Dieser Effekt erschließt sich auch, wenn man die Bedeutung des Traums in Kultur, Literatur, Kunst und Film mit einbezieht und anerkennt, dass der Traum zu den kulturellen und kollektiven Selbstverständigungsfeldern des Menschen gehört. An diese Tatsache des sozialen Lebens knüpft die Soziale Traummatrix an und eröffnet einen Raum des Sprechens über unsere allnächtlichen Sinnproduktionen.
Insoweit Träume tatsächlich eine das soziale Verständnis fördernde Funktion haben und sie menschheitsgeschichtlich seit jeher ein integrierendes Element der conditio humana waren (Krovoza 2001, S. 223), sollten wir ihnen mehr Aufmerksamkeit zuwenden – gerade in sozialen Zusammenhängen – und die Gelegenheit sollte nicht verpasst werden, sie für die Kulturarbeit in Gesellschaften, Unternehmen, Institutionen und temporären sozialen Verbünden zu nutzen. All diesen verschiedenen Formen von Organisationen ist gemeinsam, dass sie ein kollektiv geteiltes Unbewusstes innehaben. Dieses gleichsam inkorporierte Unbewusste ist historisch gewachsen, das heißt, es hat etwas von der Funktion eines Organisationsgedächtnisses, das alles aufbewahrt, auch wenn die Beteiligten längst nicht mehr daran denken. Auch in der Traummatrix, im Sprechen über Träume, kann das inkorporierte Unbewusste einer Organisation hörbar werden. So träumen Menschen in Rollen von sich selbst als Menschen in Rollen, die in komplexen sozialen Bezügen verankert sind. Das trifft übrigens nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf ganze Gesellschaften zu: Die deutsche Journalistin Charlotte Beradt zeigte in »The Third Reich of Dreams« (1968) auf, dass sich im nationalsozialistischen Deutschland in den Träumen vieler übergreifend die kollektiven Erfahrungen der Gräuel der Nazi-Diktatur zeigten, ohne dass dies explizit formuliert oder den Menschen bewusst war. Ihr gelang es, anhand einer Sammlung von rund dreihundert Träumen nachzuweisen, wie die nationalsozialistische Ideologie nach und nach in die Köpfe der Menschen eindrang und sie infiltrierte: »Die erzählten Träume erweisen sich als verlängerter Arm des Regimes und zugleich als Erkenntnismedium der Struktur totalitärer Herrschaft« (Koselleck 1994, S. 127).
Träume – verstanden als Parallelprozesse sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens – lassen einen weiteren überraschenden Gedanken aufkommen, den Michael so formulierte:
»Dream as parable appears to me to be consistent with the working hypothesis that Lawrence offers for social dreaming programmes. This hypothesis asserts that we must get away from the political process of salvation to a politic of revelation. Most consultancy and action research has used the power of knowledge and expertise to ›save‹ workers from their tribulations. Lawrence has proposed a politics of revelation in which people can interpret their own experience and ›accept the surprise of their revelations‹« (Michael 1998, S. 119).
Anstatt auf die Hilfe von (externen) Beratenden/Supervisoren zu setzen, um das Organisationsleben zu verbessern, so Michaels Vorschlag sinngemäß, sollte man den Mitarbeitenden besser eine eigene Stimme geben, mittels derer sie latente Schwierigkeiten offenbaren können. Zum sozialen Aspekt des Traumphänomens gehört demnach, dass das Sprechen über Träume einem Diskurs Raum gibt, der einer anderen Logik folgt als der Diskurs, der sich in Organisationen für gewöhnlich ausdrückt. Anders gesagt: Sich mit Träumen zu befassen, drängt uns dazu, die bewährten Mechanismen der Sinnerzeugung hintenanzustellen. Vom Traum zu sprechen bedeutet daher, einer Autonomie einen Ausdruck zu verleihen, die unseren Bezug zur Wirklichkeit aufbricht, stört und bestenfalls erweitert. In diesem Sinne kann die Traummatrix wichtige Funktionen für das soziale Miteinander übernehmen: Sie eröffnet die Möglichkeit, sich den unausgesprochenen Dingen des Miteinanders zuzuwenden, ohne dass schon gleich eine bestimmte Erwartung die Richtung und das Ergebnis des Austauschs vorgibt. Das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie in den modernen und dynamischen Gesellschaften Rollenmuster vorgegeben werden: Der Soziologe Richard Sennett beschrieb Ende der 1990er Jahre die Folgen des modernen Kapitalismus unter dem Fokus der Flexibilisierung von Lebensentwürfen und Rollen, der indes auch zu einem Schwinden »langfristiger sozialer Bindungen« und einer zunehmenden »Fragmentierung« flexibler Persönlichkeiten führe (Sennett 1998, S. 78 f.). Entwicklungen dieser Art und der durch sie erzeugte Anpassungsdruck verlangen von uns häufig die Abspaltung weiter Teile unserer Persönlichkeit. Dieser Anpassungsdruck führt dazu, dass die emotionale Erlebnisebene ausgeschlossen wird – und damit das Phantastische, also das, was sich der allgemeinen Logik und der Vernunft nicht unterwerfen lässt. Infolgedessen bleibt vieles, was den Einzelnen ausmacht und was in ihm »schlummert«, unausgesprochen (Lenk 1983) und taucht erst im Traum wieder auf. Vor diesem Hintergrund wollen wir mit der vorliegenden ersten deutschsprachigen Einführung zeigen, wie sich das verborgene Wissen der Träume in die Alltagswirklichkeit von Organisationen zurückholen und einbeziehen lässt.
Die Social Dreaming Matrix bringt, so klang bereits an, einen schöpferischen Umgang mit Träumen in die Mitte von Organisationen und Gesellschaften. Träumen ist gewiss auch unerlässlich für die Ideenentwicklung in think tanks,