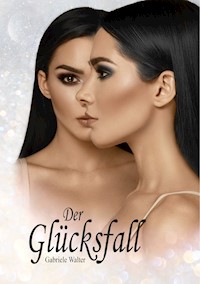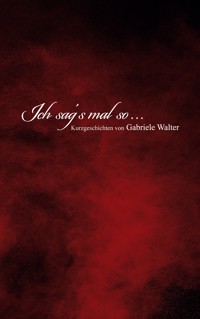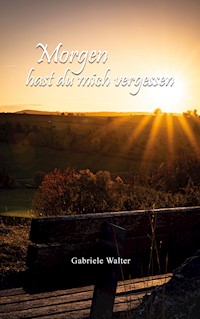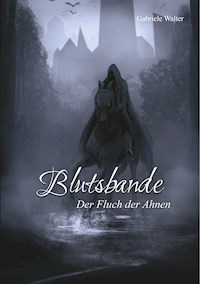Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist still, kalt und leer geworden im Haus am Ammersee, nachdem die erfolgsverwöhnte Schriftstellerin Greta Sander von ihrem geliebten Ehemann auf tragische Weise verlassen wurde. Ihre Welt hat jeglichen Zauber verloren und scheint ohne ihn an ihrer Seite nur noch grau und trostlos. Mit gut durchdachtem Kalkül verfolgt sie nur noch ein Ziel, dieses scheinbar sinnlos gewordene Leben zu beenden. Ein unerwartetes Ereignis vereitelt jedoch bereits den ersten Versuch und auch der zweite bleibt unvollendet. Wird es einen weiteren Versuch geben oder begreift sie, dass ihre Zeit noch nicht abgelaufen ist? Und wie soll sie die schicksalhaften Begegnungen deuten, die sich plötzlich zu häufen scheinen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Im Jahre 1954 wurde sie in Schwäbisch Hall geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Schwäbisch Gmünd. 1973 heiratete sie. 1981 zog die Familie ins Nördlinger Ries.
Bereits als Teenager schrieb sie Kurzgeschichten für ihre Freundinnen. Nach der Schulzeit wollte sie ihren größten Wunsch, Schriftstellerin zu werden, in die Tat umsetzen. Doch das Leben kam dazwischen. Erst Jahre später gelangte sie nach einigen Umwegen in eine Situation, die sie erkennen ließ, dass allein das Schreiben genau das war, was sie schon immer tun wollte. Und so wurde es zu einem wesentlichen Teil ihres Lebens.
Während ihrer jahrelangen beruflichen Tätigkeit als Einzelhandelskauffrau, Ausbilderin und Seminarleiterin durfte sie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kennenlernen und zwischenmenschliche Erfahrungen sammeln, die sich in ihren Romanen widerspiegeln.
Ihre Romane handeln von der Liebe, die stets geheimnisvoll und zuweilen sogar gefährlich sein kann, von Schicksalen, wie sie einem täglich begegnen, und mystischen Ereignissen, die der Verstand mitunter nur schwer erklären kann. Es geht jedoch immer um Frauenschicksale. Starke, schwache, träumende, liebende und mit dem Schicksal hadernde Frauen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 1
In alten Fotos zu kramen, ist genau die richtige Beschäftigung für graue Wintertage wie diesen, denke ich, während ich mich strecke und mühsam den alten, weißen Schuhkarton vom obersten Regal des Schlafzimmerschrankes herunterziehe.
Ein mausgrauer Kaschmirpullover der obenauf liegt, fällt herunter, mir mitten ins Gesicht, und weil ich nicht schnell genug nach ihm greife, auf den Parkettboden.
Ich bücke mich. Magensäure kriecht durch meine Speiseröhre. Auch das ist bald vorbei. Ich schlucke, hebe ihn auf, falte ihn ordentlich zusammen und werfe ihn, entgegen meiner üblichen Korrektheit, schwungvoll wieder zurück.
Das orangefarbene Wort – PHOTOS – das ich irgendwann passenderweise quer über den Deckel des Schuhkartons geschrieben habe, sticht mir förmlich in die Augen und ich erinnere mich an das, was ich dachte, als ich den Karton beschriftete. Nur eine Übergangslösung. Sobald ich Zeit habe, klebe ich die Fotos in entsprechende Alben. Das ist jetzt über dreißig Jahre her. Den Karton hole ich zwar ab und an mal herunter, aber nur um neue Fotos hineinzulegen.
Noch einmal lasse ich meinen Blick durch den Raum schweifen, über die weiß gestrichenen Möbel, all die kleinen Dekorationsstücke, die ich voller Freude aus unzähligen Orten dieser Welt zusammengetragen habe, um sie hier liebevoll zu platzieren. Zuletzt über das Bett, in dem ich sinnlich romantische, zu meist erholsame, aber auch von Sorgen und Kummer belastete, schlaflose Nächte verbracht habe. Das Bett, in dem ich nie wieder liegen werde. Ich atme den süßlich frischen Geruch des Weichspülers, der in der frisch bezogenen Bettwäsche haftet, und den erotisch angehauchten meines Lieblingsparfüms, der wie ein zarter Schleier über allem hängt.
Dieses erdrückende Gefühl der Einsamkeit, das mich während der letzten Tage allzu oft heimgesucht hat, stellt sich auch jetzt wieder ein und schnürt mir die Kehle zu. Mit hängendem Kopf begebe ich mich ins Erdgeschoss. Gebeugt, als trage ich die Last der ganzen Welt, gehe ich die Diele entlang zu meinem Lesezimmer, das mir jahrelang als Büro, jedoch auch als Ort der Erholung und Besinnung gedient hat.
Ich fühle mich leer und ausgebrannt. Immer noch verschleiern Tränen meinen Blick, den ich nun zur vollgestopften Bücherwand lenke. Literatur, während all der Jahre zu Recherchezwecken zusammengetragen. Dann zum antiken Schreibtisch, den der Flachbildmonitor und eine verchromte Tastatur zu entweihen versuchen, was ihnen jedoch nicht wirklich gelingt – mein Arbeitsplatz.
Kaum merklich vor mich hinlächelnd, setze ich mich auf die mit weinrotem Leder bezogene englische Couch. Den Karton stelle ich auf meine Knie und öffne ihn.
Zuoberst liegen die Aufnahmen vom letzten Sommer. Urlaub auf Rügen. Ein Gefühl von Wehmut breitet sich in meiner Brust aus. Wahllos grabe ich etwas tiefer und ziehe einige Fotos heraus. Eines, schon ein wenig verblichen, auf dem meine verstorbenen Eltern zu sehen sind und ein weiteres, auf dem ich mit der bunten Einschulungstüte im Arm vor der alten Schule stehe. Ich erinnere mich noch genau an die lachsfarbene Strickjacke, die ich an diesem Tag trug, und das blumenbedruckte Kleidchen. Das nächste Foto wurde an Ostern vor unserem Haus in Geroldstein geschossen. Unschwer an meiner rechten Wange zu erkennen, dass ich mir ein ganzes Osterei in den Mund geschoben habe.
„Ha!“ Da ist sie ja, die einzigartige Aufnahme, die mich wie keine andere an meine Kindheit erinnert. Nicht, weil es ein Foto aus jener Zeit ist, das sind andere auch, nein, weil es etwas in meinem Herzen bewegt, das mir das Wasser in die Augen treibt, weil es mich traurig stimmt und gleichzeitig zum Lachen bringt. Mit der rosaroten Brille auf der Nase, in deren Gläsern sich ein Teil der Umgebung spiegelt, und dem unmöglichen Haarschnitt, der eher einem Helm denn einer Frisur ähnelt, sehe ich mehr als komisch darauf aus. Mütter sollten ihren Kindern nur dann die Haare schneiden, wenn sie den Beruf des Frisörs entweder erlernt oder zumindest ein besonderes Talent dafür haben. Meine hatte weder das eine noch das andere, dafür aber ein echtes Problem mit meinem Pony. Mehrere Versuche waren nötig, ihn einigermaßen gerade hinzukriegen. Das Resultat – viel zu kurz. Aber das war dann ja mein Problem. Mein einziger Trost bestand in der Gewissheit, dass die Fransen wieder wachsen würden.
Unwillkürlich fahre ich mit den Fingern durch mein langes, volles, wegen der silbergrauen Strähnen mittlerweile schwarz gefärbtes Haar, streiche es aus der Stirn und lächle vor mich hin.
Diese Szene, das was ich hier mache, könnte der Anfang eines neuen Romans sein. Ein Gedankenblitz, den ich sogleich verwundert, überhaupt daran gedacht zu haben, weit von mir schiebe, denn ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Im Grunde habe ich zu nichts mehr Lust, am wenigsten auf das Leben selbst. Ach, Richard! Ich seufze. Alles ist so sinnlos geworden, jetzt da du gegangen bist. Das Haus ist viel zu groß für mich allein und jeder Winkel, jedes noch so kleine Detail erinnert mich an dich. Erneut seufze ich, lege die Fotos zurück und schließe den Karton. Wozu habe ich den Kasten überhaupt runtergeholt? Etwa weil ich irgendwo im hintersten Winkel meines Gehirns annahm, in alten Erinnerungen zu kramen könnte mich von meinem Entschluss abbringen?
Müde erhebe ich mich, begebe mich zur Terrassentür und ziehe die Gardine beiseite. Ein letztes Mal betrachte ich meinen geliebten Garten, der zurzeit verborgen unter einem weißen Tuch aus frisch gefallenem Schnee auf den kommenden Frühling wartet so wie jeden vergangenen Winter.
Wartet? Wartet er wirklich? Liegt brach da, einfach so, lässt den lieben Gott einen guten Mann sein, sinniere ich und senke den Blick, erholt sich und wartet? Zumindest hat es den Anschein. Nun ja, die Pflanzen nutzen diese Ruheperiode, um Kraft zu sammeln, während sie sich gleichzeitig auf das neue Leben vorbereiten, das im Frühling aus ihnen heraussprießen wird. Etwas, das die meisten Menschen in dieser schnelllebigen Zeit verlernt haben. Ja, sinniere ich nickend und werfe, bevor ich mich kläglich lächelnd abwende, einen letzten Blick hinaus, heute ist ein guter Tag zum Sterben.
Ich wende mich dem Glas mit der bronzefarbenen Flüssigkeit zu und den Schächtelchen mit dem todbringenden Inhalt. Schlaftabletten.
Ursprünglich wollte ich mir in der Badewanne die Pulsadern aufschneiden. Allein schon die Vorstellung einer aufgedunsenen Leiche in blutgetränktem Wasser und der Blutlache, die sich unter dem eventuell aus der Wanne hängenden Arm bilden würde, bereitete mir Übelkeit. Zumal ich diesen Abgang auch für allzu dramatisch halte. Außerdem hasse ich es, eine Schweinerei zu hinterlassen. „Das Haus muss ordentlich sein, bevor ich es verlasse. Könnte ja sonst was passieren.“ Jahrelang weigerte ich mich sehr bewusst, diese Philosophie meiner Mutter anzuerkennen und letztendlich sogar anzunehmen. Manchmal machte ich die Betten nicht, bevor ich das Haus verließ. Kissen, die ich im Vorübergehen noch schnell ordentlich aufstellte, warf ich wieder durcheinander und in der Küche blieb oft ein einzelnes Glas oder eine Tasse auf der Spüle stehen.
Unmerklich schüttle ich den Kopf und sehe mich um. Alles ordentlich.
Ich schalte das Radio an, drücke die Open/Close-Taste für das CD-Laufwerk und lege eine CD ein. Einschmeichelnde Musik zum Einschlafen, zum Hinübergehen, muss schon sein. Noch einmal drücke ich auf die Open/Close-Taste, warte bis das CD-Laufwerk wieder geschlossen ist und drücke auf „Play“. Das Violinkonzert von Vivaldi erklingt.
Soll ich jetzt? Suchend sehe ich mich noch einmal um. Habe ich auch nichts vergessen? Verneinend schüttle ich den Kopf, trete an meinen alten Ohrensessel, den ich von Oma geerbt habe, streichle über die Rücken- zur Armlehne und lächle.
Dieser Sessel war außer Kleidung und einigen Schmuckstücken, das Einzige, das meine Oma aus ihrer Heimat hierhergeschleppt hatte, damals, gegen Ende des Krieges. Opa war laut ihrer Aussage ein begnadeter Möbelschreiner gewesen und der Sessel sein Meisterstück. Er hatte ihn Oma zur Hochzeit geschenkt. Und sie wollte ihn keinesfalls den Russen in die Hände fallen lassen. Also packte sie ihn, zwei Koffer – einen mit ihren Sachen, einen mit denen meiner Mutter –, dazu mehrere Wolldecken auf einen Leiterwagen und zog gen Süden. Opa sollte mit diesem Meisterstück, sowie der Krieg zu Ende wäre, einen Neuanfang wagen. Opa kam nicht zurück.
War gar nicht einfach dich durch mein Leben zu schleifen. An den entsetzten Blick aus Richards aufgerissenen Augen, als ich damit ankam und an seinen, wenn auch schwachen Protest, als ich begann das Wohnzimmer umzuräumen, um ihn würdig zur Geltung zu bringen, erinnere ich mich noch allzu gut. Damals lebten wir in einer Dreizimmerwohnung am Rande Münchens. Irgendwie stand das Monstrum immer im Weg.
Erst nachdem Richards Mutter unerwartet und viel zu früh von uns gegangen war, und wir in sein Elternhaus nach Herrsching am Ammersee zogen, fand ich den richtigen Platz für ihn.
Mein lieber Schwiegervater, ein überaus verständnisvoller und weiser alter Mann, verschloss trotz des Glücks, das er über unseren Einzug empfand, nicht die Augen vor meinen Bedürfnissen. Er bestand darauf, mir einen Raum zu überlassen, der mir die Möglichkeit bieten sollte, mich jederzeit zurückziehen zu können, wann immer mir danach zumute sein würde. Selbstverständlich durfte ich ihn ganz nach meinen Wünschen einrichten.
Ich seufze. Ein überaus großherziger Mann. Obwohl er uns mit seinem Dickschädel mitunter ganz schön auf die Palme gebracht hat.
Zu unserem Leidwesen folgte er seiner Frau nach nicht mal einem Jahr. Das Herz. Er konnte es nicht ertragen, ohne seine große Liebe zu leben und da hörte sein Herz einfach auf zu schlagen. Ein altes Herz. Meins ist noch verhältnismäßig jung. Mit vierundfünfzig stirbt man nicht einfach so an gebrochenem Herzen.
Ich verzettle mich und überhaupt, warum denke ich gerade jetzt über diesen Sessel nach …? Es ist der Sessel, in dem ich sterben werde, geht es mir blitzartig durch den Kopf.
Wie um diese Überlegung zu untermauern, setze ich mich hinein. Ich lehne mich bequem zurück, lege meine Arme auf die Lehne, schließe die Augen und atme tief durch.
So viele Gedanken, die ich nicht festzuhalten vermag, jagen mir durch den Kopf. Ich sehe Bilder aus längst vergangener Zeit – Blitzaufnahmen. Erschöpft lege ich meine Hände in den Schoß und schiebe sie, während ich mich vorbeuge, zwischen meine Knie. So bleibe ich eine ganze Weile sitzen, bis meine Gedanken langsamer werden und bei Richard stehen bleiben.
Ja, das Herzklopfen wurde mit den Jahren leiser, aber ich liebte diesen Mann mit jeder Faser meines Herzens. Er fehlt mir so sehr. Seine Kraft und sein nie enden wollender Optimismus. Er war mein Herz und das hat aufgehört zu schlagen. Er war der Faden an dem mein Leben hing und dieser Faden ist nun gerissen.
Ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten und heule tief schluchzend los. Erst nachdem ich mich ein wenig beruhigt und mir die Nase geschnäuzt habe, greife ich entschlossen nach der ersten Packung Schlaftabletten. Eine Tablette nach der anderen drücke ich aus der weißen Folie in das Glas mit altem, französischem Cognac.
Die Dinger sind ziemlich hartnäckig, sie lösen sich nicht so schnell auf, wie ich es erwartet habe. Ich greife nach dem silbernen Teelöffel. Während ich rühre, erinnere ich mich, wie ich einen einfachen Löffel aus dem Küchenschrank wieder in die Schublade zurückgelegt und den silbernen aus der Lederschatulle genommen habe.
Wenn schon Selbstmord – wie heißt noch dieses andere Wort, das die Pathologen dafür benutzen – ach ja, Suizid, also wenn schon Suizid, dann doch wenigstens stilvoll. Unwillkürlich lächle ich. Ja, ich lächle. Was für eine unsinnige Überlegung. Aber so bin ich nun mal, Ästhetin durch und durch. Und da ich nicht weiß, wie meine Leiche zum Zeitpunkt des Auffindens aussehen wird, soll wenigstens das Ambiente stimmen. Ich rühre solange, bis sich die Tabletten fast aufgelöst haben, lege den Löffel beiseite, nehme die nächste Packung, drücke auch diese Tabletten aus der Folie ins Glas und rühre erneut um. Den Vorgang wiederhole ich so lange, bis auch die letzte Packung leer ist und die ausgedrückten Folien neben dem Glas auf dem kleinen Rauchtischchen liegen.
Oh nein. Sieht ziemlich unordentlich aus, stelle ich fest. So kann das nicht bleiben. Seufzend erhebe ich mich. Noch mal in die Küche? Oder bring ich das Zeug gleich in die Garage?
Das weiße Kunststoffmaterial gehört in den gelben Sack und die Schächtelchen in die Papiertonne. Wie zum Trotz begebe ich mich in die Küche und werfe alles in den leeren Mülleimer unter der Spüle. Selbstverständlich habe ich den Küchenmüll entsorgt, um unnötigen Gestank zu vermeiden. Schließlich kann es Tage, je nachdem gar Wochen dauern, bis man mich hier in meiner selbstgewählten Isolation findet. Womöglich beginnt mein Körper durch den Verwesungsprozess bereits zu stinken.
Das kann mir dann auch egal sein, versuche ich diesen unangenehmen Gedanken von mir zu schieben. Doch schon in der nächsten Sekunde grüble ich weiter. Wer wird mich wohl finden …? Auch das kann und wird mir dann egal sein. Basta! Mich fröstelt. Ich kreuze die Arme vor meiner Brust und rubble meine Oberarme.
Langsam wird es kühl im Haus. Nun ja, die Heizung habe ich schon vor immerhin einer guten Stunde ausgeschaltet.
„Richtig, mein Kind, nur nichts verschwenden“, höre ich meine Mutter sagen.
Ach Mama, denke ich, während ich erneut wehmütig vor mich hinlächle, du warst nie verschwenderisch. Hast das wenige Geld, das Papa damals nach Hause brachte, zusammengehalten. Hast dir selbst am wenigsten gegönnt. Und als es dann aufwärts ging, konntest du nicht mehr aus deiner Haut.
Allerdings gab es nie Margarine aufs Brot. Margarine nahm man höchstens, wenn überhaupt, zum Backen. Aufs Brot kam nur gute Butter. Dabei beneidete ich meine Freundin Britta stets um ihr Ramabrot. Ach ja, und für hundert Gramm Schinken hat’s auch immer gereicht. Außer Marmelade und Zuckerrübensirup war Schinken damals der einzige Brotbelag, den ich essen mochte. Eine Mark für hundert Gramm Schinken beim Dorfmetzger Stromberg. Im Konsum gab’s ihn günstiger, aber den mochte ich nicht. Also bekam ich den vom Metzger Stromberg.
Eine Sekunde sehe ich mich in meinem schwarz-rotkarierten Wollkleid, das ständig irgendwo juckte, die leere Henkelkanne schlenkernd, durch die schmale Gasse zum Konsum schlendern.
Konsum, sinniere ich, den Namen gibt’s schon lange nicht mehr. Nicht mehr zeitgemäß, wie so vieles in dieser kurzlebigen Zeit, schnell abgeschafft, verbessert, verschlechtert oder geändert wird, weil es nicht mehr zeitgemäß ist.
Ich fand den alten Namen nicht schlecht. Und letztendlich konnte ja auch der neue den Anforderungen der Zeit nicht Stand halten und musste bald dem nächsten weichen. Na ja, wenn ich’s mir recht überlege, habe ich mir nie wirklich den Kopf darüber zerbrochen. Dafür umso mehr über meinen Lieblingskaugummi. Dubble Bubble! In Gedanken spreche ich den Namen, da wir Kinder damals noch kein Englisch sprachen, immer noch so aus, wie er auf dem Päckchen stand. Wer kennt ihn nicht – zumindest aus meiner Generation, den Kaugummi, mit dem man riesige Blasen machen konnte? Soweit ich mich erinnere, war er umwickelt mit einem kleinen bunten Bildchen, eingepackt in weißes Papier mit aufgedrucktem Logo – ein kräftig rotes Oval, auf dem eine winzige, kornblumenblaue Krone thronte. Ich weiß noch, dass ich ihn stets vorsichtig ausgewickelt habe, um das Bildchen nicht zu zerreißen. Und dann der Kaugummi. Zwei farblose, miteinander verbundene Rippen, sensationeller Geschmack, den ich immer noch, sowie ich daran denke, auf der Zunge schmecke. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich den letzten gekaut habe. Jedenfalls musste ich vor etlichen Jahren feststellen, dass es ihn – zumindest in Deutschland – nicht mehr zu kaufen gibt. Geht’s noch? Die letzten Minuten meines Lebens und ich denke über einen dämlichen Kaugummi nach. Schon seltsam, was sich so im Laufe des Lebens ins Gedächtnis einbrennt und was verloren geht.
Wie auch immer, die Heizung habe ich natürlich nicht wegen meiner ohnehin nicht vorhandenen Sparsamkeit abgedreht, sondern weil eine Leiche in kalter Umgebung entschieden länger frisch bleibt.
So düster wie meine Gedanken ist es mittlerweile auch in der Küche. Ich stelle mich an die Terrassentür, blicke nach oben und betrachte den tiefhängenden, bedrohlich wirkenden, dunkelgrauen Himmel. Vermutlich wird es nicht mehr lange dauern bis Frau Holle ihre Fenster öffnet, um ihre Kissen aufzuschütteln. Schwermütig lasse ich meinen Blick nun über den mit Buchs gesäumten Gemüsegarten schweifen, auf dem noch drei Stängel Rosenkohl stehen, über den Weg zur offenen Obstwiese. Ich betrachte die beiden knorrigen Apfelbäume – alte Sorten. Aus dem „Weißer Matapfel“ hat Richard jedes Jahr Apfelwein keltern lassen. Der „Jakob Fischer“ schmeckt lecker und ich backe damit den besten Apfelkuchen der Welt – hat jedenfalls Richard behauptet. Mein Blick wandert zum schlanken Birnbaum und anschließend zum mächtigen Kirschbaum. Der muss nach der nächsten Ernte unbedingt zurückgestutzt werden. Den Zwetschgenbaum haben wir erst vor drei Jahren gepflanzt. Ich sehe Richard mit dem Spaten das Pflanzloch ausheben und ich sehe mich, wie ich das Bäumchen hineinstelle und wie wir gemeinsam Erde darum anhäufen. Zuletzt betrachte ich den alten Walnussbaum, unter dem ich so manch gutes Buch gelesen habe. Rechts davon, unter weißer Schneedecke verborgen, der erst vor fünf Jahren angelegte englische Rasen, der durch eine Vielzahl von Nadelgehölzen, Sträuchern und den mannigfaltigsten Stauden eingegrenzt ist. Vom Frühling bis in den Spätherbst eine blühende Pracht. Eine Minute starre ich auf unseren, von den dürren Ästen der Kletterrosen umrankten Pavillon. Meine Gedanken versinken erneut in der Erinnerung. Ich sehe mich mit Richard und Fabian darin frühstücken, rieche den intensiven Duft der rosarot blühenden „Gertrude Jekyll“ Rosen. Dann verschwimmt das Bild. Zurück bleibt Leere, gefolgt von unbeschreiblich tiefem Schmerz, der sich stets in meine Eingeweide bohrt, sowie ich mich an solch glückliche Momente erinnere.
All die Erinnerungen, die aus jedem Winkel des Hauses kriechen und förmlich danach lechzen mich zu umgarnen und in trostlose Tiefen zu stürzen – ich kann sie nicht mehr ertragen. Tränen verschleiern erneut meinen Blick. Ich blinzle und schlucke sie hinunter, während ich noch einmal auf den mit feinem Dunst überzogenen Ammersee hinausschaue, der nur wenige Schritte entfernt von meinem Gartentor eiskalt in seinem Bett ruht.
Da geht jemand. Seltsam. Um diese Zeit? Um mich zu vergewissern, dass es bald dunkel wird, werfe ich einen Blick auf die Küchenuhr. Fast fünf. Woher mag die kommen? Die? Schwer zu erkennen. Aber ja, der Statur nach zu urteilen vermutlich eine Frau. Was hat die hier zu suchen? Jetzt bleibt sie stehen, schaut aufs Wasser. Ob sie Kummer hat? Sie bückt sich. Was sucht die denn da? Ah – jetzt richtet sie sich wieder auf. Sie holt weit aus, wie ein Diskuswerfer – mit der linken Hand – Linkshändlerin also. Jetzt wirft sie etwas flach ins Wasser. „Ha!“ Ein Stein flitzt ein, zwei, dreimal hüpfend über den See, dessen Oberfläche lediglich am Ufer gefroren war.
Und wieder bückt sie sich.
„Ach ja“, seufze ich und lächle wehmütig, während sich meine Augen abermals mit Tränen füllen. Wie oft habe ich Fabian und Richard dabei beobachtet. Mussten „Männergespräche“ geführt werden, näherten sie sich stets auf diese Art an. Überhaupt fanden die meistens da unten am See statt.
Es wird Zeit für mich. Ein seltsam bedrückendes Gefühl beschleicht mich. Angst vor dem, was mit mir geschieht – danach? Jetzt nicht darüber nachdenken.
Um mich einigermaßen auf den Tod und das danach auf mich Zukommende vorzubereiten, las ich während der letzten Tage etliche Berichte über Nahtoderfahrungen. Doch ich bin mir dessen Bewusst, dass jeder Tod anders ist. Wie meiner sein wird, steht noch in den Sternen. Und doch stell ich mir vor, dass der Tod mich sanft unter seinen Mantel der Schwerelosigkeit hüllen und durch einen Tunnel aus Licht und Liebe zu meiner Familie bringen wird. Sie werden mich nach Hause geleiten und wir werden wieder glücklich vereint sein. Davon bin ich überzeugt und sollte es nicht so kommen, habe ich zumindest keine Schmerzen mehr.
Das Glas Cognac strahlt mich förmlich an, als ich die Bibliothek betrete. Erschöpft und unendlich müde trete ich an Omas Sessel, um es mir darin bequem zu machen. Ein markerschütternder Schrei hält mich jedoch davon ab. Ich hebe das Kinn, lausche eine Weile angestrengt in die Richtung, aus der ich vermute ihn vernommen zu haben. Kein weiterer folgt.
Nur ein Jubelschrei? Nein, kein Jauchzer, ein Schrei – ein Angstschrei. Ob da jemand Hilfe braucht? Unsinn! Vermutlich nur ein Tier. Manche Vögel geben Laute von sich, da denkt man schon mal, ein Mensch hätte geschrien.
Ich lasse mich in Omas Sessel sinken.
Erneut ein Schrei, der sich eindeutig, obwohl verzerrt, nach „Hilfe“ anhört.
Ich erhebe mich, eile in die Küche und schaue nochmal aus dem Fenster. Doch ich kann nichts erkennen. Der See liegt, bis auf die üblichen Wellenbewegungen gegen den Steg, ruhig und verlassen vor mir. Dennoch öffne ich die Tür und trete, von Besorgnis und nicht zuletzt von meiner angeborenen Neugier gepackt, auf die überdachte Terrasse hinaus. Eisige Kälte schlägt mir entgegen. Ich umklammere meine Oberarme und rubble sie, während mein Blick am Ufer des Sees entlang schweift. Nichts. Alles still. Totenstill. Allerdings …, die Wellen klatschen, dafür, dass es verhältnismäßig windstill ist, doch ziemlich heftig an den Steg. Sollte die Frau etwa … Womöglich hat die geschrien? Irgendwie seltsam ist es schon, gerade noch stand sie hier und kurz darauf … wie vom Erdboden verschluckt. Unentschlossen schüttle ich den Kopf. Die wird doch nicht auf den vereisten Steg gegangen sein?
Das möchte ich jetzt doch genau wissen. Ich blicke auf meine Füße. Da ich nur Strümpfe trage, gehe ich zurück ins Haus. In der Diele schlüpfe ich in meine gefütterten Trekkingstiefel, reiße die Daunenjacke vom Kleiderständer und ziehe sie über, während ich bereits in den Garten laufe, um bessere Sicht zu haben.
Nichts. Die Frau hat sich wohl lediglich ihren Frust von der Seele geschrien und ist längst weiter gegangen.
Ich wende mich ab. Genau in dem Moment, als ich einen Schritt zum Haus zurück mache, höre ich einen weiteren verzweifelten Hilfeschrei. Und diesmal bin ich ganz sicher, dass es sich nicht um den Schrei eines Tieres handelt. So schnell ich kann, laufe ich durch den Garten, öffne das Türchen und laufe zum Ufer. Da sehe ich sie schon – die Hände der Frau, die krampfhaft bemüht sind, sich an den Bohlen hochzuziehen oder sich zumindest festzuhalten.
Das schafft die nie. Mein Gott, was mach ich jetzt? Hilfesuchend blicke ich zum Nachbarhaus, das viel zu weit entfernt steht. Mir wird augenblicklich klar, dass es zu lange dauern würde Hilfe von dort zu holen. Aber wie kann ich …? Ich muss es versuchen.
Die Bohlen sind zwar schneebedeckt, darunter aber vom letzten Eisregen spiegelglatt.
Obwohl ich Stiefel mit griffigen Gummisohlen trage, bewege ich mich vorsichtig. Wäre ja zu komisch, würde ich ausgerechnet beim Versuch, jemandem das Leben zu retten, mein eigenes verlieren. So war das nicht geplant. Ich rutsche, kann mich aber wieder fangen.
„Ich bin gleich bei Ihnen.“
„Helfen Sie mir“, kommt es schwach von unten. „Bitte.“
Ich knie nieder, versuche ihr unter die Arme zu greifen, doch sie hängt zu tief. Dann bekomme ich den Kragen ihrer Jacke zu fassen und ziehe daran.
In dem Moment stößt sie sich von einem der schrägen Querbalken ab, welche die beiden rechts und links des Steges aufrecht im Wasser stehenden Pfosten miteinander verbinden. Sie kommt etwas höher, greift nach den Bohlen, rutscht aber wieder ab. Ich kann sie nicht halten. Erneut sinkt sie ins eisige Wasser.
Oh Gott, hilf mir! Ich schaffe es nicht.
Wieder stößt sie sich von dem Querbalken ab. Diesmal kann ich mit einer Hand die Kapuze ergreifen, mit der anderen fasse ich blitzschnell unter ihren Arm, lasse fast im selben Moment die Kapuze wieder los, packe sie auch mit der anderen Hand und ziehe so kräftig ich kann.
Ihr Kopf kommt zum Vorschein, dann ihr Oberkörper, den sie erschöpft und schwer atmend auf den Bohlen ablegt, während sie sich mit den Beinen weiter gegen die Querbalken stemmt.
Ich zerre an ihr, obwohl ich kaum noch über Kraftreserven verfüge. Doch bevor sie nicht mit ihrem ganzen Körper hier oben liegt, könnte sie wieder abrutschen.
Sie stützt sich mit ihrem Ellbogen ab und hilft mir auf diese Weise, sie vollständig heraufzuziehen.
„Kommen Sie“, sage ich und bücke mich, um ihr aufzuhelfen.
Sie hebt ihr Gesicht und schaut mich mit Augen an, in denen ich Dankbarkeit und Erschöpfung zugleich erkenne. Und noch etwas erkenne ich: Bei der vermeintlichen Frau handelt es sich um einen jungen Mann. Ziemlich jung. Ich schätze ihn auf etwa siebzehn, möglicherweise achtzehn, keinesfalls älter.
Er zittert am ganzen Körper. Die klatschnassen Sachen kleben an ihm und beginnen bereits zu gefrieren.
„Kannst du aufstehen?“, frage ich, duze ihn, ohne darüber nachzudenken, und greife ihm erneut unter die Arme. „Komm, ich helfe dir.“
Sich mühsam aufrappelnd, klammert er sich fest an mich, während er seinen Blick zunächst fragend an mich, dann in Richtung des Hauses lenkt.
Vom Bücken steigt Magensäure in meine Speiseröhre. Dieses verdammte Sodbrennen. „Ich bringe dich in mein Haus. Du musst schnellstens aus den nassen Sachen und du brauchst unbedingt ein heißes Bad.“
Er zittert unaufhörlich, sagt kein Wort, sieht mir in die Augen und nickt verstehend. Obwohl er sich bemüht selbst zu gehen, lockert er seinen Griff nicht.
In der Küche ist es eiskalt. Ich hatte vergessen, die Tür zu schließen.
„Weiter“, sage ich, „gleich nach oben ins Bad.“
Der Junge sinkt erschöpft auf den Badehocker. Wie ein Häufchen Elend sitzt er da und schlottert.
Ich drücke den Stöpsel in den Wannenabfluss und lasse Wasser in die Wanne laufen. Währenddessen überlege ich, ob es nicht besser ist, den Jungen zunächst in lauwarmes Wasser zu stecken. Kurioserweise denke ich dabei an das gefrorene Bratenstück, das ich zum schnelleren Auftauen statt in kaltes versehentlich in heißes Wasser legte.
Aber der Junge ist kein Eisblock. Er fühlt sich nur so an.
Mir fällt ein, dass ich selbst lieber in nicht allzu heißes Wasser steige. Bevor ich den Heißwasserhahn zudrehe, bemerke ich, dass das Wasser längst nicht so heiß ist. Ach ja, ich habe ja die Heizung abgedreht. Ich lasse es laufen, bis es nur noch lauwarm kommt. Während ich mit einer Hand durch das Wasser rudere, um es gut durchzumischen, beobachte ich den Jungen unauffällig aus den Augenwinkeln und hoffe inständig, dass er nicht völlig zusammenbricht. Vermutlich würde bereits ein kleines Anstupsen mit dem Finger genügen, um ihn vom Hocker kippen zu lassen. Möglicherweise wäre es vernünftiger die Rettung zu verständigen.
„So, das genügt“, sage ich, drehe den Hahn zu und richte mich auf. Erneut kriecht diese widerliche Säure durch meine Speiseröhre nach oben. Ich schlucke. Das Brennen bleibt. Noch einmal werfe ich dem Jungen einen kurzen Blick zu und bemerke, wie er sich mühsam seiner Jacke zu entledigen versucht. Ich helfe ihm und ziehe auch noch gleich seinen von Nässe triefenden Pullover über seinen Kopf.
Er lässt es geschehen. Auch als ich vor ihm in die Hocke gehe, um seine Turnschuhe aufzubinden und von seinen Füßen zu ziehen, bleibt er teilnahmslos sitzen.
Die klatschnassen Socken landen im Waschbecken.
„Ich lass dich jetzt allein. Sollte dir das Wasser nicht heiß genug sein …, aber das weißt du sicher selbst“, sage ich, da der Junge immer noch unbeweglich auf dem Hocker sitzt.
Zuvor entnehme ich dem Badezimmerschrank ein Badetuch und ein Handtuch. Beides lege ich auf den Rand des Waschbeckens. „Solltest du noch etwas brauchen, ruf nach mir.“
Da fällt mir ein, dass wir uns noch nicht mal vorgestellt haben. „Ich heiße Greta.“
Er nickt. „Leon. Mein Name ist Leon.“
Da ich nicht weiter in ihn dringen will, dafür ist später noch genügend Zeit, lächle ich ihm nur aufmunternd zu und wende mich ab.
Plötzlich ergreift der Junge meine Hand. „Danke.“
Ein warmes Gefühl beginnt sich in meinem Herzen auszubreiten, doch ich lasse es nicht zu. Ich nicke, schalte noch die Deckenlampe an, da es mittlerweile ziemlich dunkel geworden ist, und verlasse das Bad. Bevor ich die Tür jedoch hinter mir schließe, drehe ich mich noch mal nach ihm um. „Ach, du kannst den Bademantel anziehen, der dort am Haken hängt“, erkläre ich und deute mit meinem Kinn in die entsprechende Richtung.
Eine Weile bleibe ich noch vor der geschlossenen Tür stehen, erst als ich am Plätschern des Wassers höre, dass er in die Wanne steigt, gehe ich weiter.
Inzwischen ist es im Haus noch kälter geworden. Um die Heizung wieder anzuschalten, begebe ich mich in den Keller. Dabei denke ich an mein Vorhaben und frage mich, ob die Tabletten wohl ihre Wirkung bis morgen behalten. Doch schon während ich wieder nach oben steige, entschließe ich mich, sie in den Ausguss zu gießen und am nächsten Tag einige Apotheken abzuklappern, um mir neue zu besorgen. „So ein Mist“, flüstere ich und füge in Gedanken hinzu: Jetzt muss ich auch nochmal aus dem Haus.
Ich hole das Glas aus der Bibliothek, gehe damit in die Küche und starre eine ganze Weile bedauernd auf die rotgoldcremefarbene Mischung. Doch letztendlich schütte ich sie in den Ausguss. Aufatmend! Ich schüttle kaum merklich den Kopf, da ich dieses Gefühl nicht verstehe. Bin ich etwa erleichtert? überlege ich, während ich das Glas in die Spülmaschine stelle.
Verwundert über mich selbst greife ich zum Teekessel, fülle ihn mit Wasser und stelle ihn auf den Herd. Ein heißer Tee mit selbst gemachtem Holundersaft wird dem Jungen guttun.
Was jetzt, frage ich mich, während ich auf das Pfeifen des Teekessels warte. So kann ich den Jungen unmöglich nach Hause schicken. Wo kommt er überhaupt her und vor allem, wie kam er hier her? Mit dem Bus? Vielleicht hat er ja ein Auto, das er in der Nähe geparkt hat? Und wenn nicht? Er kann ja seine Eltern verständigen. Die können ihm dann auch frische Klamotten mitbringen. Ich könnte seine Sachen aber auch in den Trockner stecken. In etwa einer Stunde kann er dann gehen. Allerdings wäre es dann völlig unnötig gewesen, mein „Todeselixier“ wegzuschütten. Was soll’s? Ich habe ja keine feste Verabredung mit Gevatter Tod.
Das laute Knurren meines Magens erinnert mich daran, dass ich seit Stunden nichts gegessen habe. Ich könnte etwas kochen. Etwas Leichtes, überlege ich. Dieses verdammte Sodbrennen bringt mich noch um. Ich lächle kaum merklich. Die Ironie meiner Gedanken ist mir nicht entgangen. Beruhigend streiche ich über meinen Oberbauch. Auch dieses Problem könnte längst beseitigt sein.
Eine leichte Schwäche macht sich bemerkbar und mir wird bewusst, wie sehr mich das Erlebte und die Anstrengung geschafft haben. Dennoch schlurfe ich durch die Küche zur Speisekammer, öffne die Gefriertruhe und entnehme ihr, ohne lange darüber nachzudenken, ein in Folie eingeschweißtes Schweinefilet und einen Beutel mit Champignons. Schweinefilets in Champignonrahmsoße und Nudeln. Das ist schnell zubereitet und da ich statt Rahm stets Milch verwende – wegen des Fettgehalts – ist es auch nicht so schwer. Fette Soßen verursachen bei mir ebenfalls Sodbrennen. Da können Wissenschaftler und Forscher noch so oft behaupten, dass Sodbrennen nicht vom Essen kommen kann. Prompt fallen mir Zwetschgen ein. Roh gegessen machen sie mir gar nichts. Aber mein geliebter Zwetschgendatschi oder Zwetschgenknödel in Butter gerösteten Semmelbröseln gewälzt, mit Zucker und Zimt bestreut, bringen mich fast um.
Der Teekessel pfeift.
Ich gieße den Kräutertee auf. Während er zieht, lege ich das Filet in die Mikrowelle zum Auftauen.
Ob ich mal nach dem Jungen sehe? Nicht, dass er in der Wanne eingeschlafen ist und doch noch ersäuft.
Ich klopfe an die Badezimmertür und rufe: „Junge, alles in Ordnung?“
Er öffnet die Tür.
Ein scharfer Stich fährt mir ins ohnehin wunde Herz. Der Junge trägt Richards blauen Frotteemantel, dem noch immer der maskuline Duft seines Aftershaves anhängt. Als ich ihm das gestattet habe, habe ich nicht bedacht, wie sehr mich der unerwartete Anblick schmerzen könnte. Langsam lasse ich meinen Blick an ihm hinunter schweifen. Ob ich will oder nicht – ich muss lächeln. Sein Anblick ist aber auch zu komisch. Der Bademantel ist entschieden zu weit für ihn, die Ärmeleinsätze hängen über die Schultern des Jungen, wodurch die Ärmel zu lang sind. Wie ich feststellen kann, hat er das Problem bereits gelöst.
„Ein bisschen groß“, stelle ich fest.
Er lächelt verlegen und sieht ebenfalls an sich hinunter. „Ein bisschen.“
„Wie geht es dir jetzt?“, frage ich besorgt.
Noch immer lächelnd, verdreht er die Augen. „Oh, schon viel besser. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wie kam ich bloß auf die bescheuerte Idee, mich auf den Steg setzen zu wollen? Bevor ich zum Sitzen kam, rutschte ich ab und landete im See. Sie können sich nicht vorstellen, wie kalt das Wasser in diesem See ist“, sprudelt es nur so aus ihm heraus.
„Doch das kann ich“, antworte ich und nicke heftig. „Na dann, komm in die Küche. Ich habe Tee aufgebrüht.“
Er nickt zurückhaltend und folgt mir.
Ich nehme eine Tasse aus dem Schrank und stelle sie auf den Tisch in der Erkernische, in der wir aus Gründen der Gemütlichkeit viel lieber saßen, als im großen Esszimmer. Mit der Teekanne in der Hand deute ich auf die Bank.
Er setzt sich.
„Du musst ihn so heiß wie möglich trinken“, erkläre ich und gieße den Tee in die Tasse.
Er nickt abermals.
„Hast du Hunger?“
Wieder nickt er – diesmal heftig. „Und wie“, antwortet er, während er einen Blick zum Herd auf die leere Pfanne riskiert.
„Hey“, sagt er plötzlich, „Sie haben ein tolles Haus. Muss ’ne Stange Geld gekostet haben. Das hat ihr Mann sicher nicht auf dem Straßenbau verdient.“
„Wie kommst du gerade auf den Straßenbau?“, frage ich misstrauisch und vielleicht ein wenig zu heftig.
Er sieht mich betroffen an und gleich darauf an sich herunter.
„Nach dem Bademantel zu urteilen, ist Ihr Mann ziemlich kräftig gebaut und da dachte ich, der Mann kann zupacken. Warum ich ihn ausgerechnet mit dem Straßenbau in Verbindung brachte, weiß ich jetzt auch nicht.“
„Wirklich nicht?“, frage ich skeptisch.
„Nein, bestimmt nicht“, beeilt er sich zu sagen. „Habe ich etwa recht?“
Ich sehe ihn einige Sekunden stumm an, bemerke, wie er seinen anerkennenden Blick durch die Landhausküche schweifen lässt.
„Nein, natürlich nicht“, fügt er hinzu. „Entschuldigen Sie. Sollte ich Sie oder Ihren Mann mit meinem hirnlosen Gerede beleidigt haben, verzeihen Sie mir bitte.“
So ehrlich wie er das sagt, muss ich ihm glauben.
„Wo ist Ihr Mann überhaupt? Ist er noch bei der Arbeit?“
„Bei der Arbeit“, murmle ich vor mich hin, atme einmal tief durch und lächle – zumindest versuche ich es. „Mein Mann hat sich still und leise aus dem Staub gemacht.“
Erstaunt bemerke ich zum ersten Mal bewusst das Quäntchen Wut auf Richard, das sich schon während der letzten Tage in der Leere meines Herzens auszubreiten versuchte. Bisher ist es mir jedoch stets gelungen, diese Wut zu unterdrücken. Verdammter Mistkerl! Hast mich einfach so verlassen, ohne Vorwarnung.
„Oh, das tut mir leid“, murmelt der Junge und senkt, offensichtlich peinlich berührt, das Haupt mit dem noch feuchten, dunklen Haar.
Dem Anschein nach hat er meine Erklärung falsch verstanden. Ich habe jedoch keine Lust den Irrtum aufzuklären. Wozu auch? „Wie bist du eigentlich hierhergekommen?“, erkundige ich mich dagegen, um vom Thema abzulenken.
„Mit dem Bus nach Herrsching und dann gelaufen“, antwortet er knapp.
Ich werfe einen raschen Blick auf die Küchenuhr. Mit dem Bus kann er nicht mehr zurück.
Meine letzte Busfahrt ist zwar Jahre her, aber ich bin sicher, dass der letzte Bus längst weg ist. Ganz sicher ist er es aber wenn die Kleider des Jungen trocken sind.
Seine Kleider. Ich könnte sie eigentlich noch vor dem Essen in den Trockner geben. Nein, wie käme ich denn dazu?
„Möchtest du deine Eltern verständigen?“
Er schüttelt verneinend den Kopf. „Mm.“
„Sie warten sicher auf dich“, dränge ich weiter in ihn. Ich erinnere mich, wie besorgt Richard stets durch die Wohnung schlich, wenn Fabian vergaß sich zu melden und zu spät nach Hause kam. „Du kannst gerne zu Hause anrufen.“
„Nein“, antwortet der Junge energisch, pustet vorsichtig in die Tasse und nippt daran.
„Vielleicht möchte dich jemand abholen?“, bohre ich weiter, in der Hoffnung, mehr von ihm zu erfahren. Gleichzeitig frage ich mich, wozu das gut sein soll, schließlich habe ich nicht vor, mich mehr als unbedingt nötig um den Jungen zu kümmern. Ich wende mich der Mikrowelle zu und nehme das aufgetaute Schweinefilet heraus.
„Hören Sie“, er stellt die Tasse ab, legt aber seine Hände um sie, als wolle er sich daran wärmen, „ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie mich gerettet haben. Aber ich möchte, sofern es Ihnen recht ist, einfach nur diese Tasse Tee trinken und – vorausgesetzt es macht Ihnen wirklich nichts aus – die Nacht in Ihrem Haus verbringen. Morgen sind dann meine Klamotten sicher trocken, dann verschwinde ich wieder aus Ihrem Leben. Wie sagten Sie noch? Heimlich, still und leise.“
„Ich wollte dich nicht ausfragen“, erkläre ich, obwohl ich vor Neugier fast platze. Die Lüge kam mir dennoch glatt über die Lippen. Ich beschließe nicht weiter in ihn zu dringen. Doch die Ungewissheit lässt mir keine Ruhe, schon Sekunden später drehe ich mich nach ihm um und frage: „Aber macht sich denn niemand Sorgen um dich?“
„Nein“, antwortet er knapp, in einem Ton, der mir deutlich macht, dass für ihn das Thema beendet ist.
Das Nudelwasser kocht. Ich streue Salz in den Topf, schütte die Nudeln hinein und schalte die Temperatur etwas zurück. Die Butter in der Pfanne ist mittlerweile geschmolzen. Nachdem die Medaillons von beiden Seiten angebraten sind, würze ich sie mit Salz, Pfeffer, Chili und zum Schluss etwas Ingwer, um dem Fleisch und auch der Soße ein wenig Schärfe zu geben. Ich nehme die appetitlich riechenden Fleischscheiben aus der Pfanne und gebe klein gehackte Schalotten hinein. Der bitter süße Geruch regt nun auch meinen Appetit an. Ich spüre den Blick des Jungen auf meinem Rücken. In eine weitere Pfanne gebe ich blättrig geschnittenen Champignons, die ich stets küchenfertig in der Gefriertruhe habe und beobachte die bereits goldgelben Schalotten.
„Wie alt bist du eigentlich?“
„Was tut das zur Sache?“, fragt er scheinbar entnervt.
„Ich lösche das hier normalerweise mit Sherry ab, solltest du allerdings noch zu jung dafür sein, nehme ich Gemüsebrühe“, erkläre ich.
„Sie können Sherry nehmen. Ich bin fast neunzehn“, antwortet er halbwegs freundlich.
Neunzehn also. So alt wie Fabian, als er verunglückte. Das markante Gesicht meines Sohnes drängt sich in meine Erinnerung. Mein Gott! Er war so verdammt jung, als er starb. Von Gestalt ein Mann, mit noch jungenhaften Zügen im Gesicht, die er durch den starken, genbedingten Bartwuchs zu kaschieren versuchte.
Ich atme einmal tief durch, kippe die Pilze in die Pfanne zu den Schalotten und greife nach der Sherry-Flasche. Es zischt, als ich alles ablösche. Danach gebe ich ein Schälchen Brühe dazu, die ich stets vorrätig in der Gefriertruhe aufbewahre, gieße einen guten Schuss Milch zur Soße und binde das Ganze mit ein wenig Soßenbinder aus der Packung.
„Mmm, das duftet ja fantastisch“, bemerkt der Junge.
Na, das hört sich doch schon wesentlich netter an, denke ich, während ich die Nudeln in ein Sieb gieße, sie gleich darauf in eine flache Schüssel gleiten lasse und anschließend auf den Tisch stelle.
Prompt greift der Junge eine Nudel und schiebt sie in seinen Mund.
Wie Fabian. Fast gelingt mir ein Lächeln. Vermutlich sind in dieser Beziehung alle Kinder gleich.
Während ich auf die Pfanne starre und warte, bis die Soße etwas einreduziert ist, sage ich: „Du könntest schon mal den Tisch decken. Die Teller stehen da oben rechts im Schrank, Besteck findest du in der Schublade neben dem Herd und Gläser auf der gegenüberliegenden Seite, ganz links.“
„Klar“, antwortet der Junge knapp, erhebt sich und tut wie ihm geheißen. Bevor er sich wieder setzt, nimmt er den kleinen dreiarmigen Kerzenständer vom Fensterbrett und fragt nach Feuer.
„Du bist also ein Romantiker“, vermute ich schmunzelnd, ziehe eine Schublade auf und reiche ihm Streichhölzer.
Er lächelt und zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht, aber ich habe’s gern gemütlich“, erklärt er und wirft mir einen kurzen Blick zu. „Irgendwie erinnern Sie mich an meine Mutter“, platzt er plötzlich heraus. „Nicht wegen Ihres Aussehens, meine Mutter ist ein ganz anderer Typ, sie ist blond und auch etwas rundlicher, aber sie geht ebenfalls alles so ruhig und besonnen an. Jeder Griff sitzt, als hätte sie ihn zuvor schon mindestens einmal in Gedanken durchgeführt“, fügte er leise hinzu, wendet sich dann aber schnell ab und zündet die Kerzen an.
„Ach ja?“, frage ich hinter seinem Rücken, lege einen Topfuntersetzer auf den Tisch und stelle die Pfanne darauf ab.
Wir setzen uns.
Er lächelt mich dankbar an und nickt.
Mir fallen die strahlend blauen Augen des Jungen auf, die mich an Fabians erinnern. Allerdings besaß Fabian dunklere und etwas längere Wimpern – die Augen von Richard, die Wimpern von mir. Selbst sein Gesicht mit den jungenhaft ebenmäßigen Zügen ähnelt dem Fabians auf fast gespenstische Weise.
„Greif zu, Junge“, sage ich schnell, um den Gedanken beiseite zu wischen. „Guten Appetit.“
„Danke, wünsche ich Ihnen auch. Mann, habe ich ’nen Kohldampf“, sagt er und lädt seinen Teller übervoll.
Wie Fabian. Ich schüttle unmerklich den Kopf. Sogar das Essen schlingt er ebenso in sich hinein wie Fabian. Fast automatisch öffnet sich mein Mund. Ich kann der Versuchung, schling nicht so zu sagen, nur schwer widerstehen.
Plötzlich sieht er mich an. Kauend fragt er: „Ist was?“
Ich schüttle verneinend den Kopf und beginne ebenfalls zu essen. Ein Abendessen, kommt es mir plötzlich in den Sinn, an dem ich mich, wäre alles wie geplant gelaufen, gar nicht mehr erfreuen könnte.
„Du hast es dir doch nicht etwa anders überlegt“, flüstert eine Stimme in mir. „Nur wegen eines guten Essens. Morgen ist er wieder weg. Es hat sich nichts geändert.“
„Hat es nicht?“, fragt eine andere Stimme. „Das Leben könnte noch die eine oder andere Überraschung für dich bereithalten“, versucht sie, mich zu verführen.
„Sie kochen wirklich gut“, unterbricht der Junge meine düsteren Gedanken. „Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen. Meine Mutter konnte auch gut kochen. Allerdings gab es so etwas Leckeres nur an Sonntagen.“
„Jetzt sprichst du von deiner Mutter, als wäre sie …“
„Gestorben“, vollendet er leise meinen Satz, nickt und legt das Besteck an den Tellerrand. „Gestern. Krebs – Lungenkrebs“, murmelt er.
Ich vernehme den bitteren, von Trauer durchzogenen Unterton in seiner Stimme. Oh Gott! Betroffen schließe ich einen Moment die Augen. Weiß ich doch nur zu gut, wie er sich fühlt. Er tut mir unsagbar leid, wodurch ich mich wiederum entsetzlich hilflos fühle. Was kann ich ihm sagen?
Er wirft einen anklagenden Blick nach oben und fügt etwas lauter hinzu: „Dabei hat sie nie eine Zigarette geraucht.“
Es sieht aus, als wolle er Gott selbst anklagen. Ich lege mein Besteck ebenfalls ab und meine Hand auf seine, obwohl ich weiß, dass nichts ihn trösten kann.
Er schaut mich eine Weile nur stumm an, dann sagt er: „Greta.“
„Hm?“
„Sie kennen mich nicht und meine Mutter haben Sie ebenfalls nie kennengelernt und womöglich sollte ich Sie das gar nicht fragen, aber …, Sie haben mir immerhin das Leben gerettet und man sagt doch sowie man jemandem das Leben rettet, ist man für ihn verantwortlich. Und da ich ...“
Eine Weile ist es still zwischen uns.
„Nun frag schon“, fordere ich ihn auf und lächle ermutigend.
„Würden Sie mich zur Beerdigung begleiten?“, platzt er heraus.
Was habe ich erwartet? Für jede Frage offen, habe ich diese nun wirklich nicht erwartet. Betroffen erkenne ich, wie naiv ich doch bin. Schon an seiner Fragestellung hätte ich erkennen müssen, dass etwas auf mich zukommt das die normale Fürsorge eines hilfsbereiten Mitmenschen bei weitem überschreitet.
„Aber Junge, wie du schon sagtest, ich kannte deine Mutter nicht. Sicher wären dein Vater und deine Familie irritiert, eine Fremde bei der Beerdigung zu sehen.“
„Es wird niemand außer mir anwesend sein. Vielleicht noch Frau Krämer, die Nachbarin, die auf unserer Etage wohnt, eventuell einige ihrer Kollegen. Mutter hat sich gegen eine Traueranzeige ausgesprochen, daher wissen es nur die, denen ich Bescheid gegeben habe. Sie wollte keine pompöse Bestattung.“
Ich bin erschüttert. Bei Richards Beerdigung fand sich fast der ganze Ort auf dem Friedhof ein, seine Angestellten und Geschäftsfreunde. Der Friedhof platzte fast aus allen Nähten.
„Meinen Vater habe ich nie kennengelernt“, erklärt er. „Ob ich Verwandte habe, weiß ich nicht. Mutter hat das Thema Familie stets vermieden. Und wenn ich mal nachfragte, sagte sie nur, meine Großeltern wären liebe Menschen gewesen, die aber viel zu früh verstorben waren und andere Verwandte gäbe es nicht. Irgendwann, meinte sie, würde sie mir von meinem Vater erzählen. Es kam nicht mehr dazu. Keine Ahnung ob er noch lebt oder ebenfalls längst verstorben ist. Bitte begleiten Sie mich.“
Ohne meinen Kopf anzuheben, werfe ich einen kurzen Blick nach oben. Kann es sein, dass hier jemand meine Pläne erbarmungslos zu unterbinden versucht?
„Hast du schon mit dem Rektor deiner Schule gesprochen?“, frage ich, um das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken.
Er betrachtet mich einen Moment befremdet und schüttelt dann verneinend den Kopf. „Ja, ja sicher“, antwortet er entgegen seiner Gestik, fügt dann aber erklärend hinzu: „Nein, um genau zu sein, ich habe im Sekretariat Bescheid gegeben, aber was ist nun …“
Ich weiß, was er sagen will. „Wann ist denn die Bestattung?“, unterbreche ich ihn mit belegter Stimme.
„Mamas Leichnam wird eingeäschert. Sie wollte es so. Die Urnenbestattung findet am kommenden Freitag auf dem Waldfriedhof statt.“
Drei Tage. Das hieße, ich könnte mich frühestens Freitagabend verabschieden. Andererseits, was sind schon drei Tage, wenn ich damit einem jungen, betrübten Menschen beistehen kann? Eine letzte gute Tat. „Na gut“, höre ich mich sagen und denke über Leons Worte nach, über die angebliche Verantwortung, die man für den Menschen übernimmt, dem man das Leben gerettet hat. Ich werde ihn bald genug sich selbst überlassen.
„Ja? Ja, wirklich?“, fragt er sichtlich erfreut und seine blauen Augen beginnen von innen zu leuchten. Er nimmt sein Besteck wieder auf und isst ausgehungert weiter. „Hat Ihr Mann etwa ’ne andere?“, fragt er plötzlich ungeniert, wie es nur die Jugend kann.
Mir bleibt einen Moment die Luft weg und dementsprechend ist wohl mein Gesichtsausdruck.
Der Junge beißt auf seine Unterlippe. „Entschuldigen Sie, das war taktlos von mir.“
Richard und eine andere Frau – lächerlich. Er hatte doch nur seine Arbeit im Kopf. Und er hat mich geliebt.
Natürlich stritten wir auch mal. Ab und an zeigten wir uns sicher gleichgültig dem andern gegenüber. Auf Anhieb fallen mir einige Situationen ein, bei denen ich mich alleingelassen fühlte. Aber auch welche, bei denen ich mehr auf Richard eingehen hätte müssen.
„Ich habe mich vorhin wohl etwas ungenau ausgedrückt“, erkläre ich nun, obwohl ich das noch vor wenigen Minuten für unnötig gehalten habe. „Richard, mein Mann, ist vor zehn Tagen gestorben.“
„Oh!“, sagt er mit vollem Mund, kaut und schluckt. „Ich dachte …, er ...“, stottert er. „Entschuldigen Sie. Das ist mir jetzt aber …“
„Es ging ganz schnell – Herzinfarkt –“, erkläre ich, bevor die Situation noch peinlicher für ihn wird. Doch ich kann nicht verhindern, dass mir Tränen in die Augen steigen. Augenblicklich fühle ich mich der peinigenden Situation ausgeliefert, die seit jenem Tag immer und immer wieder wie ein Film vor meinem geistigen Auge abläuft.
Richard streut Futter ins Vogelhäuschen, lächelt und winkt mir zu. Ich winke zurück. Plötzlich, immer noch das Lächeln auf den Lippen, sackt er in sich zusammen. Panische Angst überfällt mich, während ich zu ihm laufe. Nach einigen sinnlosen Wiederbelebungsversuchen laufe ich in die Küche zurück und rufe den Notarzt. Doch ich weiß längst, dass er Richard nicht mehr helfen kann.
Wie erstarrt stehe ich dabei und schaue zu, wie die Männer versuchen, das Herz meines Mannes zu reanimieren. Doch wie erwartet schüttelt der Notarzt, nachdem er Richards Tod festgestellt hat, nur bedauernd den Kopf. Ich sinke erneut auf die schneebedeckten Marmorplatten der Terrasse und ziehe den leblosen Oberkörper des Mannes, den ich so sehr liebe, auf meinen Schoß. Entgegen meines Wissens drücke ich ihn an mich, dann wieder rüttle ich ihn, um ihn wach zu kriegen. Die Vorstellung, nie wieder in seine strahlend blauen Augen blicken zu können, macht mir Angst. Der Gedanke, seinen Mund nie wieder lächeln zu sehen, ihn nie wieder mit diesem leicht bayerischen Dialekt sagen zu hören, „Schatzl, schau dir des o. Wos braucht der Mensch mehr, als an Menschen, der ihn liebt und an Ort, an den er sich zruckziang konn“, bringt mich an den Rand der Verzweiflung. Ich wiege Richard wie ein Kind in meinen Armen. Erst als der Notarzt mich sanft an die Schulter fasst, vermutlich um mich zu beruhigen, küsse ich ihn ein letztes Mal. Dann lasse ich ihn los.
Der Arzt reicht mir seine Hand und hilft mir aufzustehen. Er sagt: „Kommen Sie, ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung.“
„Nein, ich will nichts“, antworte ich entschieden.
Er zuckt kurz mit den Achseln, gleichgültig, wie mir scheint. Für ihn ist Sterben etwas, das zum Leben gehört – nicht mehr und nicht weniger. Vermutlich wollte er nur, dass ich loslasse, damit die Sanitäter ihre Arbeit beenden können.
Der unsagbare Schmerz, von dem ich schon an jenem Tag wusste, dass ich ihn nicht überleben werde, zerreißt mir fast das Herz. Notwendigerweise reagieren meine Lungen und lassen mich nach Luft schnappen. Erst jetzt bemerke ich, dass ich tatsächlich zu atmen vergessen habe. Verwirrt lächle ich den Jungen an und wische mit der linken Hand die Tränen von meinen Wangen, da er, von mir unbemerkt, meine rechte ergriffen hat.
„Das …“ Der Junge schweigt, drückt nur meine Hand. „Das“, beginnt er erneut, „tut mir sehr leid. Dann fühlen Sie sich im Moment sicher genauso beschissen wie ich.“
Er fragt es nicht, er stellt es einfach fest.
Etwas in mir drängt mich zu antworten, doch ich kann nicht.
Ja, könnte schon sein, überlege ich stattdessen. Ich jedenfalls fühle mich …, ja, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühlt sich ein Mensch, der allein zurückgelassen in einem riesigen leeren Raum steht. Ein Raum ohne eine einzige Tür, die ihm den Zugang zu den Menschen gewähren könnte, die er so sehr liebt und nach denen er sich mit jeder Faser seines Herzens sehnt.
Plötzlich erinnere ich mich an das Glas mit der rotgoldcremfarbenen Flüssigkeit. Das ist meine Tür. Ich räuspere mich, sehe den Jungen kurz an und beuge mich erneut über meinen Teller. „Beschissen, ja, das ist wohl das richtige Wort. Lass uns essen, bevor es ganz kalt wird.“
Wenig später hilft der Junge mir schweigend den Tisch abzuräumen.
„Ich hatte auch einen Sohn“, rutschen mir die Worte über die Lippen, bevor ich es verhindern kann, da ich im selben Augenblick wünsche es nicht erwähnt zu haben. Gleichzeitig, wie unter Zwang, spreche ich weiter: „Er war so alt wie du, als er starb. Verkehrsunfall auf der A8 bei Holzkirchen. Fabian überholte gerade einen LKW, als ihm ein Geisterfahrer entgegenkam. Obwohl der entgegenkommende Fahrer anscheinend bremste, laut polizeilicher Ermittlungen und Fabian wohl noch alles dafür tat, rechtzeitig vor dem LKW einzuscheren, erwischte ihn das andere Fahrzeug am hinteren Kotflügel. Fabians Wagen kam ins Schleudern und wurde vom LKW erfasst. Die Unfallärzte konnten nur wenig für ihn tun. Ein Hubschrauber brachte ihn mit schweren inneren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus. Sie operierten ihn, doch sie sagten, sie könnten nichts mehr für ihn tun. Die Verletzungen an seinem Kopf ... Er wachte nicht mehr auf. Selbst als der Hirntod eintrat, gab ich die Hoffnung nicht auf. Ich konnte ihn nicht gehen lassen. Erst nach weiteren drei Tagen begriff ich, dass nur noch seine menschliche Hülle in diesem Bett lag. Ich stimmte dem Abschalten des Beatmungsgerätes zu.“
Eine Weile starre ich vor mich hin, bis ich bemerke, dass erneut Tränen meinen Blick verschleiern. Ich räuspere mich, schlucke, blinzle die Tränen weg und füge hinzu: „Es gab noch einen weiteren Toten. Den Fahrer eines Wagens, der auf den LKW aufprallte. Seine Frau wurde ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte den Unfall aber überlebt. Deren beide Kinder erlitten Gott sei Dank nur leichte Verletzungen. Der Geisterfahrer brachte sein demoliertes Auto in die Werkstatt. Bis auf einige Schrammen und ein Schleudertrauma kam er mit dem Schrecken davon.“
Der Junge, der gerade den Tisch abwischt, hält in seinen Bewegungen inne und starrt mich wieder eine ganze Weile an. „Ich verstehe, dass Sie den Kerl hassen.“
Ich schließe die Spülmaschine und drehe mich zu ihm um. „Oh, ich hasse ihn nicht – nicht mehr. Er hat uns um Verzeihung gebeten, hat uns erklärt, wie es dazu kam. Vollkommen übermüdet und in Gedanken auf einer ganz anderen Straße. Er hätte nicht mehr fahren dürfen. Es war verantwortungslos von ihm. Als er da im Gericht so schuldbewusst vor uns stand, tat er mir fast leid. Doch ich gebe zu, als Fabian starb, hätte ich diesen Mann am liebsten umgebracht. Er hat mir das Liebste genommen, das ich auf dieser Welt besaß.“
Mir dessen bewusst, was ich eben sagte, lege ich eine Hand auf meine Lippen. Wie komme ich dazu, vor diesem fremden Jungen meine Gefühle zu offenbaren?
Der Junge sieht mich immer noch stumm an, dann sagt er: „Ich kann gut verstehen, was in Ihnen vorging und was Sie nach all den Jahren empfinden.“
„Nein, das kannst du nicht. Das kann nur, wer Ähnliches erlebt hat. Lass uns zu Bett gehen. Ich bin müde.“
„Wenn ich jetzt ins Bett steige, dreh ich mich von einer Seite auf die andere. Kann ich noch ein wenig fernsehen?“, fragt der Junge und macht dabei ein zerknirschtes Gesicht.
„Du machst dir Gedanken, wie es weitergehen soll. Es wird sich alles fügen. Du wirst schon sehen“, versuche ich ihn zu trösten und sage beim Verlassen der Küche: „Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Aber vorher zeige ich dir noch das Gästezimmer.“
Er folgt mir.
„Die Schlafräume befinden sich im oberen Stockwerk des Hauses.“
Ich öffne die Tür zum kleinen, im Landhausstil eingerichteten Gästezimmer. Eine Schubkastenkonsole, über der ein Spiegel hängt, ein zweitüriger Schrank, ein Bett und eine Nachtkonsole stehen darin. Am Fenster hängt eine luftige, weiße Gardine mit winzigen gestickten Blümchen, die von farblich abgestimmten Schals umrahmt wird. Es ist ein helles, gemütliches Zimmer. Aber auf einen Jungen seines Alters muss es ziemlich spießig wirken.
Fabians Räume sind mit modernen Möbeln bestückt, die ihm sicher besser gefallen würden. Aber das sind immer noch Fabians Räume und ich sehe keinen Grund, sie einem Fremden zu überlassen.
„Es ist ja nur für eine Nacht“, höre ich mich entschuldigend sagen.
„Schon in Ordnung. Es ist gemütlich“, antwortet er, fügt dann aber mit unüberhörbar sarkastischem Unterton hinzu: „Und so typisch für die Region.“
Ich lächle und deute auf die Tür neben der Schubkastenkonsole. „Hinter dieser Tür befindet sich ein kleines Bad.“
Er öffnet sie und wirft einen Blick hinein. „Hat jedes Schlafzimmer ein eigenes Bad?“
Ich nicke.
„Sagen Sie, hätten Sie vielleicht auch noch ein T-Shirt für mich?“
„Mal sehen. Geh du schon mal nach unten in die Küche. Du hast sicher die Schiebetür gesehen? Sie führt zum großen Esszimmer mit angrenzendem Wohnbereich. Das Fernsehgerät ist nicht zu übersehen.“
„Passt schon“, sagt er.
Ich begebe mich in unser an das Schlafzimmer angrenzende Ankleidezimmer und nehme eins von Richards T-Shirts und eine gestreifte Schlafanzughose aus dem Schrank – eine, die man am Bund zubinden kann.
Als ich das Wohnzimmer betrete, läuft der Fernseher. Nach wenigen Worten weiß ich, dass es sich um einen Bericht über depressive, suizidgefährdete Menschen handelt. Genau das richtige Thema für mich.
„Ich kann nicht verstehen“, sagt er und wirft mir einen schnellen, fragenden Blick zu, „wie Menschen sich das Leben nehmen können.“
In meinen Ohren klingt das wie Hohn. „Nein? Kannst du nicht?“, frage ich, vermutlich in einem Tonfall, der ihn dazu veranlasst, sich mir erneut zuzuwenden.
„Nein. Kann ich nicht“, antwortet er, während er mit der Vernsteuerung durch die Kanäle zappt.
Wie solltest du auch? Du bist noch so jung, hast dein Leben noch vor dir, weißt nichts von Einsamkeit und der Sehnsucht nach der befreienden Umarmung des Todes.
Erneut wirft er mir einen Blick zu. Seine Augen werden zu schmalen Schlitzen. „Aber Sie scheinen anderer Meinung zu sein?“
„Vielleicht liegt es an meiner Lebenserfahrung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen ihre Schmerzen oder ihre Verzweiflung nicht mehr ertragen können. Außerdem möchten nicht alle Suizidgefährdeten ihr Leben wegwerfen, weil sie glauben mit einer Lebenssituation nicht mehr fertig werden zu können. Die meisten von denen sind sehr krank. Sie leiden unter starken Depressionen, die oftmals mit einer Todessehnsucht einhergehen. Manche sind sogar davon überzeugt, ihrem Leben ein Ende setzen zu müssen. So, wie man eine Arbeit beendet.“
„Davon haben die eben auch berichtet. Aber sie sagten auch, dass solche Leute bei Psychiatern und Psychotherapeuten gut aufgehoben sind.“
„Manchmal. Dabei kommt es wohl auf den Psychiater oder Therapeuten an. Voraussetzung einer solchen Behandlung ist allerdings, dass Angehörige und Freunde die Veränderung im Verhalten suizidgefährdeter Personen rechtzeitig bemerken. Das ist nämlich gar nicht so einfach.“
„Wie auch immer. Ich denke an all diejenigen, die sich das Leben aus Liebeskummer oder Angst vor einer ungewissen Zukunft nehmen, die einfach keine Lust mehr zum Kämpfen haben. Ja, mag sein, dass es mitunter einfacher ist aufzugeben“, sagt er und schüttelt ablehnend den Kopf. „Stellen Sie sich mal vor, alle Menschen die Probleme haben und damit meine ich nicht die kleinen, alltäglichen Sorgen, sondern solche, die man mit all seiner Kraft angehen muss, würden sich das Leben nehmen. Die Friedhöfe würden aus allen Nähten platzen.“
Mir wird plötzlich übel. Richtig übel. Der Junge versucht gerade, ahnungslos wie er ist, mir meinen Selbstmord auszureden. Ich räuspere mich. Was für eine seltsame Fügung. „Meinst du?“, frage ich und wende mich ab.
„Aber ja“, fährt er fort. „Jeder Mensch sollte sein Leben voll auskosten. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stehe vor einem sprichwörtlichen Scherbenhaufen. Meine Mutter tot, ich kann bis Ende des Monats zwar in der Wohnung bleiben, aber dann muss ich raus, weil ich nicht weiß, wovon ich die Miete bezahlen soll.“
„Deine Mutter hat sicher vorgesorgt“, unterbreche ich ihn.
„Davon weiß ich nichts. Sollte ich also kein Stipendium erhalten, kann ich mein Studium an den Nagel hängen, noch bevor es beginnt.“
„Du gehst also aufs Gymnasium?“, frage ich, um ihn vom Thema abzulenken.
„Ja, aufs Max-Planck-Gymnasium. Im Mai beginnen die Abschlussprüfungen.“
„Und weißt du schon, was du studieren möchtest?“
„Jura“, antwortet er spontan, als stünde das bereits seit Jahren fest. „An der Juristischen Fakultät der LMU München.“
„Jura.“ Ich nicke. „Aha. Warum gerade Jura? Es gibt Anwälte wie Sand am Meer und da willst du ausgerechnet Jura studieren? Was willst du nach dem Studium machen? Willst du in so einer Partnerkanzlei die kleinen Fälle übernehmen, bis einer der Partner mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus landet und du endlich deine Chance bekommst, weil gerade kein anderer Staranwalt frei ist?“
„Sie scheinen ja ’ne Menge über diesen Berufsstand zu wissen“, unterbricht er mich.
„Ist es das, was du willst?“, fahre ich fort, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. „Nein. Du willst eine eigene Kanzlei eröffnen. Aber die wirst du dir wohl kaum leisten können. Es sei denn, du kannst den Herren von deiner Bank belegen, dass deine Kanzlei den entsprechenden Gewinn abwerfen wird, um ein für diesen Zweck angemessenes Darlehen zurückzuzahlen. Allerdings bin ich skeptisch, ob dir dann noch genug zum Leben bleibt. Der Beruf des Anwalts wird entschieden überbewertet.“
„Wie kommen Sie darauf, dass ich diesen Beruf wähle um Kohle zu scheffeln?“, fragt er empört.
„Ein Berufener also, der den sozial Schwachen zu ihrem Recht verhelfen will“, bemerke ich spöttisch.
„Und was ist dagegen einzuwenden?“, blafft er mich an.
Meine Arme abwehrend anhebend, zeige ihm beschwichtigend meine Handflächen. „Schon gut“, sage ich, wünsche ihm noch eine gute Nacht und verlasse das Wohnzimmer.
„Verschwinden Sie immer, sobald Ihnen die Argumente ausgehen?“, ruft er hinter mir her bevor ich die Tür zuziehe.
Nein,