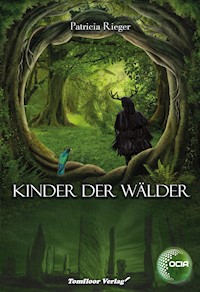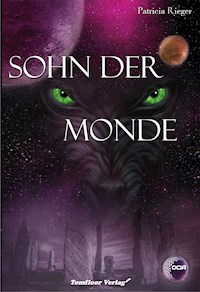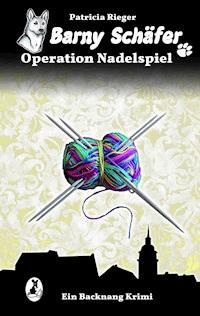Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tomfloor Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Charly schreckte mit einem heiseren Entsetzensschrei hoch. Ihre Haut brannte und ihre Zunge fühlte sich an wie ein dicker Klumpen Schmirgelpapier. Sie nahm sich nicht die Zeit Licht zu machen, sondern rannte auf wackligen Beinen in das kleine, angrenzende Bad, wo sie sich keuchend am Waschbecken abstützte. In der Dunkelheit glaubte sie ein rotes Glühen im Spiegel zu erkennen und ein Gesicht, dessen Haut in Fetzen herunterhing. Ächzend drückte sie den Lichtschalter und starrte voller Panik in den Spiegel. Doch dort war nur ihr eigenes Gesicht, das ihr mit weit aufgerissenen Augen panisch entgegenblickte. Seit dem letzten großen Einsatz der OCIA wird Charly Nacht für Nacht von furchtbaren Albträumen heimgesucht. Als dann völlig überraschend der Mann auftaucht, der ihr in diesen Träumen immer wieder begegnet, wird ihr klar, dass er der Einzige ist, der die Erde vor einer tödlichen Bedrohung schützen kann. Doch dazu muss es ihr zunächst gelingen, sein Leben zu retten und ihn davon zu überzeugen, dass er ein unverzichtbares Mitglied des OCIA-Teams ist. Sohn des Blutes ist der dritte in sich abgeschlossene Einzelband mit 495 Seiten der außergewöhnlichen Urban-Fantasy-Romance-Reihe OCIA Bisher erschienen als Taschenbuch und Ebook im Tomfloor Verlag: Sohn der Monde (Band 1) Kinder der Wälder (Band 2) Sohn des Blutes (Band 3)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Rieger
Sohn des Blutes OCIA
Eine Silberstraße übers Meer
baut der Mond. Da komm ich dir entgegen,
doch ein kurzes Stück nur, deinetwegen,
dass du selbst findest zu mir her.
Alle schlafen. Nur wer träumen kann,
weiß die Erdenschuhe abzustreifen,
nach des Mondenlichtes Strahl zu greifen,
und den Weg zu finden dann und wann.
An der Silberstraße deiner Träume
steh ich oft … Und oft gehst du vorbei,
blickst mich an, als ob ich fremd dir sei,
kehrst zurück in unerschlossne Räume.
Warten muss ich, warten dir zuliebe,
bis du selbst mir entgegenreifst,
selbst des Mondenlichtes Strahl ergreifst. –
Du wärest so allein, wenn ich nicht bliebe.
Ephides
Für meine Schwester, die immer an mich glaubt, selbst wenn ich es nicht tue.
Prolog
Einst war er ein Elitejäger gewesen, ein Angehöriger der höchsten Berufung. Dann war er zum Mörder geworden.
Er hatte sich zum Abtrünnigen gewandelt, zum Gejagten und damit zum Verdammten.
Schließlich war er das Opfer gewesen. Er hatte sein Blut gelassen – und sein Leben. Er war in den Abgrund gestürzt, doch auch dort war es ihm nicht vergönnt gewesen, endlich Ruhe zu finden.
So war er zum Wiedergänger geworden durch den Willen eines anderen, dem er nun bis zu seinem endgültigen Erlöschen verpflichtet war.
Doch so, wie es aussah, musste er nicht mehr allzu lange auf sein Erlöschen warten. Wenn es nach ihm ging, konnte das nicht früh genug geschehen – doch wieder einmal ging es nicht nach ihm, denn da war immer noch diese bindende Verpflichtung.
Dieser eine hatte damals um ihn gekämpft, an ihn geglaubt und sein Blut für ihn gegeben. Und nun schwebten er und seine Angehörigen in tödlicher Gefahr. Und keiner von ihnen wusste davon, sie alle wiegten sich in trügerischer Sicherheit.
Es war ganz einfach eine Frage der Ehre, seiner Verpflichtung nachzukommen.
Also musste er wieder einmal an dieser Existenz festhalten und seine Schuld weiter abtragen. Vielleicht war er danach ja frei von allen Banden. Frei, um sich endlich dem ewigen Schweigen hinzugeben.
1
Das gleißende Licht fiel direkt von oben auf sie herab und verbrannte sie bei lebendigem Leib.
Es gab kein Entkommen.
Die hohen Mauern, die sie umschlossen, warfen keinen Schatten und boten nicht den geringsten Schutz vor dem alles verzehrenden Feuer, das ihre Haut verkohlte und ihr das Fleisch von den Knochen brannte.
Ihr Kopf stand in Flammen, ihr Körper war eine einzige Qual. Durst, brennender Durst und die unbändige Gier, die Zähne in weiches, zappelndes, köstlich feuchtes Fleisch zu schlagen, endlich wieder einmal zu spüren, wie der süße, warme Lebenssaft durch ihre ausgedörrte Kehle rann …
Charly schreckte mit einem Entsetzensschrei hoch. Ihre Haut brannte und ihre Zunge fühlte sich an wie ein dicker Klumpen Schmirgelpapier.
Sie nahm sich nicht die Zeit, das Licht anzuschalten, sondern rannte auf wackligen Beinen in das kleine, angrenzende Bad, wo sie sich keuchend am Waschbecken abstützte. In der Dunkelheit glaubte sie, ein rotes Glühen im Spiegel zu erkennen und ein Gesicht, dessen Haut in Fetzen herunterhing. Ächzend drückte sie den Lichtschalter und starrte voller Panik in den Spiegel.
Doch dort war nur ihr eigenes Gesicht, das ihr mit weit aufgerissenen Augen verstört entgegenblickte.
»Scheiße, schon wieder ein Albtraum«, murmelte sie und übergab sich ins Waschbecken.
Sie sank erschöpft auf den kühlen Boden und legte die Stirn auf ihre Knie. Es dauerte einige Minuten, bis das Zittern nachließ und ihr Magen sich einigermaßen beruhigte. Doch das kannte sie schon.
Seit sechs Monaten quälten sie diese Albträume mit verstörender Regelmäßigkeit. Sie wusste noch ganz genau, wann sie angefangen hatten. Das war in der zweiten Märzwoche gewesen. Sie konnte sich so gut daran erinnern, weil eine Woche später der letzte große OCIA-Einsatz zu Ende gegangen war. Ein Einsatz, an dem sie selbst nicht hatte teilnehmen dürfen, und der ihre besten Freunde in die Welt Hernidion geführt hatte.
Eigentlich hatte es ein relativ kurzer Aufenthalt von drei Tagen werden sollen, doch das Einsatzteam hatte mit einer ganzen Menge unvorhergesehener Probleme zu kämpfen gehabt, die es letztendlich acht Wochen in der fremden Welt festgehalten hatten. Hier bei der OCIA hatten sie schon alle Hoffnung aufgegeben, dass das Team seine Aufgabe erfolgreich durchführen könnte. Doch dann waren ihre Freunde wieder zurückgekehrt, bis auf Sean und Meijra, die sich entschlossen hatten, in Hernidion zu bleiben, um die Entwicklung dort ein wenig im Auge zu behalten und in die richtige Richtung zu steuern.
Und bis auf Veirack, den ebenso unerträglichen wie geheimnisvollen Dreyronen, der sie mit seiner Arroganz mehr als einmal bis zur Weißglut getrieben hatte.
Veirack hatte bei diesem Einsatz sein Leben geopfert, um Tepilit, ein anderes Team-Mitglied, vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.
Bei diesem Gedanken schossen ihr die Tränen in die Augen.
»Was ist nur mit mir los?« Wütend biss sie sich auf die Unterlippe. »Ich konnte den Mistkerl doch noch nicht einmal leiden!«
Er hatte sie wie den letzten Dreck behandelt. Nein, schlimmer, wie schlechte Luft, die es nicht einmal wert war, eingeatmet zu werden.
Veirack war ihr Lehrer in ATF–Abwehr telepathischer Fremdeinwirkung– gewesen.
Er war der einzige Dreyrone, der sich jemals der OCIA angeschlossen hatte, und verfügte über herausragende telepathische Fähigkeiten. Auf Wunsch des Leiters der OCIA, Alastair McLachlan, hatte sich Veirack, der es bis dahin vorgezogen hatte, möglichst isoliert von den Menschen zu leben, im vergangenen Jahr unwillig bereit erklärt, die OCIA-Mitglieder in ATF zu unterrichten. Und das hatte er dann auch getan.
Sie schauderte jetzt noch, wenn sie an seine unkonventionelle Unterrichtsweise dachte. So hatte er seine Schüler telepathisch gezwungen, ekelhafte Dinge zu essen, bis sie es schafften, sich gegen seinen übermächtigen Willen aufzulehnen. Alle seine Schüler bis auf Charly, die er von Anfang an ignoriert und nicht in den Unterricht einbezogen hatte. Sie hatte für ihn lediglich Handlangerdienste erledigen dürfen oder war aus dem Unterrichtsraum geschickt worden.
Bis zuletzt hatte sie nicht herausgefunden, was der Grund für sein merkwürdiges Verhalten gewesen war. Es hatte sie zutiefst verletzt und nagte auch heute noch an ihr.
Doch dann hatte Veirack sich von Tepilit, dem großen, kampfbegeisterten Massai und Charlys liebstem Trainingspartner überreden lassen, ein dreyronisches Physiotraining durchzuführen. Denn Dreyronen waren nicht nur mächtige Telepathen, sondern auch ausgesprochen gefährliche Kämpfer.
Bei dieser Gelegenheit hatte Charly, die selbst eine fanatische Kampfsportlerin war, es endlich einmal geschafft bei dem Dreyronen zu punkten. Veirack hatte es zwar nie zugegeben, aber ihre Übungskämpfe waren immer etwas ganz Besonderes gewesen. Nie hatte sie sich dem fremden, dunklen Dreyronen so nahe gefühlt, wie bei diesen Übungen.
Und dann, gerade als sie angefangen hatte, sich an ihn zu gewöhnen, war er zum Einsatz aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.
Sie fühlte sich seither merkwürdig mutlos und leer. Das Physiotraining machte keinen Spaß mehr, und ihre Nächte wurden durch die grauenhaften Albträume zum reinsten Horrortrip. Sie bekam kaum einen Bissen herunter, und der fehlende Schlaf zehrte an ihren Kräften. Sie, die früher vor Energie nur so gestrotzt hatte, kam sich jetzt manchmal nur noch wie ein Geist vor. Alle ihre Freunde sorgten sich um sie, was ausgesprochen lästig war.
Das Einzige, an dem sie noch wirklich Freude hatte, war ihr Studium der extraterrestrischen Medizin,kurzETM.
Sie hatte ihr erstes Studienjahr als Kursbeste beendet und nutzte jetzt die Semesterferien, um praktische Erfahrung in dem kleinen OCIA-Klinikum zu sammeln, in dem die irdischen und außerirdischen Mitglieder der OCIA behandelt wurden.
Wie jede Einrichtung der OCIA war das Klinikum mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet, die die bekannten Welten zu bieten hatten.
Bei diesem Gedanken heiterte sich ihre Miene etwas auf. Sie hatte es schon immer als Privileg angesehen, zu den wenigen Menschen zu gehören, die von der Existenz der Organisation zur Kontrolle Interversaler Aktivitäten, kurz OCIA, wussten und sogar eines ihrer Mitglieder sein durften. Das ermöglichte ihr die beste Ausbildung, die man sich nur vorstellen konnte.
Anders als die meisten OCIA-Mitarbeiter, die im Laufe ihres Lebens zufällig auf diese geheimnisvolle Organisation gestoßen waren, hatte sie schon ihre gesamte Kindheit zwischen und mit all den Parallelweltlern, die der OCIA angehörten, verbracht.
Ihre Eltern, Henrie und Conni Barnert, waren beide OCIA-Mitarbeiter und hatten sich durch ihre Arbeit kennengelernt.
Charly war mit dem Wissen aufgewachsen, dass es auf der Erde eine Organisation gab, die vor Jahrzehnten im Geheimen von einer Gruppe Wissenschaftler ins Leben gerufen worden war. Ihr Ziel war es, sowohl Menschen als auch Parallelweltler voreinander zu beschützen. Sie verfügte über Technologien, die es ermöglichten, zufällig auf die Erde geratene Parallelweltler aufzuspüren und – unbemerkt von der Menschheit, wieder in ihre eigene Welt zurückzubefördern.
Charly hatte früh gelernt, dass die Erde sich in einem Multiversum befand, in dem unzählige Paralleluniversen zeitgleich nebeneinander existierten, und dass es zwischen diesen immer wieder zu Überlappungen kommen konnte. Eine solche Überlappung führte dann zu einer Erschütterung des gesamten Raum-Zeitgefüges, was wiederum einen sogenannten zufälligen Interversalsprung zur Folge haben konnte. Dabei gerieten immer wieder Parallelweltler aus anderen Universen in diese Welt und sorgten hier – wenn man Glück hatte, nur für Verwirrung oder für die Entstehung neuer Mythen. Es konnte aber auch schlechter laufen, und die Parallelweltler stellten eine Gefahr dar. Die Aufgabe der OCIA war es, dies zu verhindern.
Als OCIA-Mitarbeiter erhielt man eine Ausbildung, die den jeweiligen Neigungen und Fähigkeiten am besten entsprach. Zusätzlich konnte man sich für die nicht immer ungefährliche Arbeit bei den Einsatzleuten ausbilden lassen, was Charly getan hatte. Allerdings musste man mindestens 20 Jahre alt sein, um zu einem Einsatz zugelassen zu werden. Und da sie erst im letzten Monat zwanzig geworden war, hatte sie zu ihrem Ärger noch keinen Einsatz in einer Parallelwelt miterlebt. Aber das sollte sich jetzt hoffentlich bald ändern.
Sie war wild entschlossen, zum nächsten Einsatzteam zu gehören, egal wohin der Einsatz führte. Schließlich hatte sie all die Jahre eifrig darauf hingearbeitet. Sie hatte jede neue Erkenntnis über die bisher bekannten Parallelwelten verschlungen und unermüdlich an ihren kämpferischen Fähigkeiten gearbeitet. Ohne angeben zu wollen, gehörte sie mittlerweile zu den besten Kämpfern der OCIA. Und ihr Studium der extraterrestrischen Medizin war ein weiterer Bonus.
Allerdings würde Alastair sie nie im Leben zu einem Einsatz zulassen, solange sie so müde und erschöpft war. Sie musste unbedingt etwas dagegen tun.
Frustriert fuhr sie sich durch ihre kurzen, verstrubbelten braunen Haare.
»Diese Albträume müssen weg. Ich muss einfach mal wieder eine Nacht lang durchschlafen können. Und am besten fang ich gleich damit an.«
Ein kurzer Blick aus dem Fenster zeigte ihr, dass es nicht einmal dämmerte. Ihr blieben also noch ein paar Stunden, wenn sie jetzt schnell einschlief. Allerdings konnte sie sich im Moment beim besten Willen nicht überwinden, wieder ins Bett zu gehen. Die Erinnerung an den scheußlichen Traum war einfach noch zu frisch.
»Ich hole mir jetzt erst einmal ein schönes Glas warmer Milch. Oma sagt immer, das hilft hundertprozentig gegen Schlafstörungen«, murmelte sie.
Da ihre Eltern die meiste Zeit mit ihren Forschungsprojekten in den abgelegensten Winkeln aller möglichen Welten beschäftigt waren, hatte sie, seit sie das Schulalter erreicht hatte, die Ferien überwiegend bei ihrer Großmutter in Deutschland verbracht. Seit sie studierte, zog sie es jedoch vor, auch in den Ferien bei der OCIA in Auckland, Neuseeland zu bleiben. So sehr sie ihre Oma liebte, aber hier in Auckland war doch entschieden mehr los als in dem kleinen Kaff, in dem Oma Barnert lebte.
Schnell spülte sie sich den Mund aus und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Sie streifte ein weites Shirt über ihr Nachthemd und schlüpfte in eine Jogginghose. Dann stürmte sie aus ihrem Zimmer.
Die Gemeinschaftsküche ihres Wohnheims lag am Ende des Ganges. Jetzt in der Nacht und mitten in den Semesterferien rechnete sie nicht damit, jemandem zu begegnen. Umso erstaunter war sie, als sie die Küchentür öffnete und eine vertraute Gestalt am Tisch sitzen sah.
»Tepilit, was machst du denn hier?«
Der große Massai drehte sich zu ihr um und grinste sie verlegen an. »Dasselbe könnte ich dich fragen. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon.« Mitfühlend sah er sie an. »Wieder einen deiner Träume gehabt, was?«
Sie zuckte mit den Achseln und holte sich die Milchflasche aus dem Kühlschrank, füllte ein Glas und stellte es in die Mikro. Als die Milch die richtige Temperatur hatte, setzte sie sich Tepilit gegenüber und musterte den Freund mit gerunzelter Stirn. »Und was ist mit dir? Auch schlechte Träume?«
Tepilit lachte bitter auf, sodass die schneeweißen Zähne in dem ebenholzschwarzen Gesicht kurz aufblitzten. Dann starrte er wieder trübselig auf das Glas Wasser, das vor ihm stand. »Wenn’s mal so wäre. Dann wäre ich zumindest schon mal eingeschlafen, aber so weit kommt’s bei mir erst gar nicht.«
Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Du hast nie was davon erzählt. Hast du das schon länger?«
»Na ja«, müde strich er sich über die Augen, »genau genommen seit unserem Einsatz. Der Gedanke an das, was da passiert ist, lässt mir in manchen Nächten einfach keine Ruhe. Auch wenn Sean mich damals ordentlich zur Sau gemacht hat, dass ich mich nicht in meinen Schuldgefühlen aalen soll und so.« Zornig sah er auf. »Ich weiß ja selbst, dass ich keine Schuld an dem habe, was mit Veirack passiert ist. Wir hatten keine Chance gegen diese Bestien. Die haben mich ausgeknockt, noch bevor ich überhaupt wusste, dass sie da waren. Selbst Hralfor haben sie überrascht, und das will schon was heißen. Ich hätte nichts gegen sie ausrichten können und es war ganz allein die Entscheidung des verdammten Dreyronen. Er musste ja unbedingt den Helden spielen. Aber trotzdem.« Tepilit schluckte hart und strich sich gedankenverloren über eine gezackte Narbe an seinem Hals. »Es ist kein schönes Gefühl zu wissen, dass jemand für dich gestorben ist.«
»Nein, das ist es sicher nicht«, stimmte sie ihm mit rauer Stimme zu.
Sie hatte sich schon unzählige Male erzählen lassen, was damals bei dem Einsatz passiert war. Es war Tepilits erster großer Einsatz gewesen, und der junge Massai, der gerade mal zwei Jahre älter war als sie, war so stolz gewesen, dabei sein zu dürfen.
Das Einsatzteam war in die Welt Hernidion gesprungen, um dort ein Sprungtor zu schließen, durch das immer wieder mächtige Parallelweltler in diese friedliche Welt wechselten und dort ein schreckliches Blutbad unter den Herniden anrichteten. Sie machten sich dafür ihre telepathischen Fähigkeiten zu Nutze, mit denen sie ihre Opfer lähmten, um sie ungehindert zerreißen und fressen zu können. Die Herniden nannten diese Parallelweltler die Grausamen.
Obwohl die OCIA sich grundsätzlich aus den Angelegenheiten anderer Welten heraushielt, hatte Alastair es diesmal für nötig befunden, in das Geschehen einzugreifen. Es gab beunruhigende Anzeichen dafür, dass diese Bestien kurz davorstanden, einen Weg zu finden, um über das hernidische Sprungtor auch auf die Erde zu gelangen. Also versuchten die Einsatzleute, das Sprungtor zwischen Hernidion und der Welt der Grausamen zu zerstören. Dabei stießen sie auf größere technische Schwierigkeiten. Tepilit, das technische Wunderkind der OCIA, schaffte es schließlich, diese Störungen zu beseitigen. Doch kurz bevor er das Sprungtor verschließen konnte, tauchten zwei Dutzend der Grausamen auf.
Hralfor, Tepilit und Veirack waren zu diesem Zeitpunkt allein am Sprungtor und wurden von der Übermacht der Gegner förmlich überrollt. Tepilit wurde niedergeschlagen, während sich Hralfor mit letzter Kraft gegen sie zur Wehr setzte. Nur durch Veiracks überragende geistige Fähigkeiten gelang es ihnen, die Stellung zu halten, bis der Rest des Einsatzteams eintraf und mit Hilfe der Bewohner Hernidions das Blatt wenden konnte. Als die Grausamen erkannten, dass sie unterlegen waren, nahmen sie einen der Herniden und den bewusstlosen Tepilit als Geisel, um mit ihnen in ihre Welt zurückzuspringen. Charlys Freund schien verloren, als der völlig erschöpfte Veirack in letzter Sekunde all seine verbliebenen Kräfte sammelte, direkt in den beginnenden Weltensprung hineinstürzte und den jungen Massai herausschleuderte. Er selbst wurde mehr tot als lebendig mit den Grausamen mitgerissen.
Nach allem, was die Einsatzleute erzählten, gab es nicht die geringste Chance, dass er überlebt hatte. Er war durch die vorangegangene, gewaltige geistige Anstrengung bereits so geschwächt gewesen, dass er den Weltensprung nicht überlebt haben konnte. Und nach allem, was man von den Grausamen wusste, war das nur gut für ihn.
Tepilit machte sich seither schwere Vorwürfe, dass er das Sprungtor nicht rechtzeitig vor dem Eintreffen der Grausamen verschlossen hatte, und Charly konnte das nur zu gut verstehen. Sie selbst fühlte sich schon elend, wenn sie nur an all die Gemeinheiten dachte, die sie zu Veirack gesagt hatte, wenn er sie wieder einmal besonders herablassend behandelt hatte – und das war ziemlich häufig der Fall gewesen.
Sie hatte ihn für einen gefühllosen, eiskalten Psychopathen gehalten, dem man unter keinen Umständen vertrauen durfte. Immerhin waren es Dreyronen gewesen, deren zufällige Weltensprünge in der Vergangenheit dazu geführt hatten, dass sich die Mythen über Vampire bildeten. Das hatte Veirack noch furchterregender wirken lassen.
Dreyronen waren Bluttrinker und kamen aus der Welt Dreyros, die viel dunkler als die Erde war. Daher vertrugen sie kein direktes Sonnenlicht. Sie schienen nach allem, was Charly über diese geheimnisvolle Rasse herausgefunden hatte, Einzelgänger zu sein und möglichst wenig soziale Bindungen einzugehen. Und wenn Veirack ein typischer Vertreter seines Volkes gewesen war, besaßen Dreyronen außerdem ein stark ausgeprägtes Ehrgefühl – und eine nahezu unerträgliche Arroganz.
Sie verfügten außerdem über gewaltige geistige Fähigkeiten, waren unfassbar stark, pfeilschnell und stellten auch in medizinischer Sicht eine große Herausforderung dar.
Charly, die sich seit über einem Jahr intensiv mit der dreyronischen Anatomie beschäftigte, konnte ein Lied davon singen. Sie hatte in mühsamer Kleinarbeit alle Wissensfragmente, die es bei der OCIA über die Rasse der Dreyronen gab, zusammengetragen und gründlich studiert. Es gab hier nur wenige Personen, die mehr über dieses rätselhafte Volk wussten.
Allerdings nützte ihr dieses Wissen jetzt überhaupt nichts mehr, da der einzige Dreyrone, der je unter den OCIA-Mitarbeitern gelebt hatte, es vorgezogen hatte, sich umbringen zu lassen.
Sie schniefte. Das war ein weiterer Grund für sie, auf Veirack stinksauer zu sein. Wie hätte sie auch ahnen können, dass dieser arrogante, unnahbare Typ so selbstlos sein könnte, dass er sich für einen Menschen opferte? Vor allem, da er ihnen immer wieder deutlich gemacht hatte, dass er Menschen für durch und durch minderwertige Kreaturen hielt, denen auch noch der schwächste Dreyrone in jeder Hinsicht haushoch überlegen war.
Wer wäre jemals auf die Idee gekommen, dass dieser eigenbrötlerische Widerling tatsächlich so etwas wie freundschaftliche Gefühle für irgendeine andere Person entwickeln könnte?
Sie jedenfalls nicht. Ansonsten wäre sie sicher etwas freundlicher zu ihm gewesen. Aber jetzt war es zu spät.
Wütend leerte sie das Glas Milch.
Tepilit, der sie aufmerksam beobachtete, gab ihr einen Stoß.
»Sag mal, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du machst ein Gesicht, als ob du mir gleich eine überziehen willst.«
»Quatsch!« Charly runzelte unwirsch die Stirn. »Ich hab nur nachgedacht. Und diese elenden Albträume versetzten mich auch nicht gerade in strahlende Laune.« Aufgebracht knallte sie ihr Glas auf den Tisch. »Wenn das so weitergeht, kann ich es mir abschminken, beim nächsten Einsatz dabei zu sein. Wenn Alastair mich so sieht, lässt er mich nie zu.«
Tepilit betrachtete sie eingehend mit ebenfalls gerunzelter Stirn und wiegte mitfühlend den Kopf. »Also besonders gut siehst du wirklich nicht aus. Um die Augen eher ein bisschen wie eine Eule.«
»Vielen Dank«, maulte Charly spitz. »Du kannst einen echt so richtig aufbauen, wenn’s einem sowieso schon dreckig geht. Dabei solltest du mich eigentlich am besten verstehen. Du siehst nämlich auch nicht gerade aus wie das blühende Leben.«
»Ach was!« Tepilit winkte ab. »Zwei Stunden Schlaf und mir geht’s wieder prima. Jedenfalls habe ich keine Sorge, dass die mich beim nächsten Einsatz übergehen, wenn dort so ein technisches Genie gebraucht wird, wie ich es bin. Aber bei dir ist das was anderes. Du musst deine Qualitäten beim Einsatz erst noch beweisen.«
Er grinste sie an, als er sah, wie wütend sie ihn anfunkelte. Noch ehe sie Luft holen konnte, zeigte er selbstgefällig auf sich. »Und deshalb hat dieser große Krieger beschlossen, dir ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, wenn’s dann mal wieder so weit ist.« Er lehnte sich gemütlich zurück. »Na, was sagst du?«
Charly schnaubte verächtlich. »Du bist ja so ein eingebildeter Schwachkopf! Als ob ich deine Fürsprache nötig hätte. Und als ob Alastair sich um deine Meinung schert. Pah!«
»Hey, jetzt werde doch nicht gleich so patzig! Sonst verrate ich dir nicht, was für großartige Pläne ich für uns beide habe.«
Sie kniff misstrauisch die Augen zusammen und starrte Tepilit, der sie unerträglich selbstzufrieden betrachtete, eine Weile durchdringend an. Dann siegte ihre Neugier. »Also, dann spuck’s schon aus, bevor du noch dran erstickst.«
Eifrig beugte sich Tepilit wieder vor. »Na gut, weil du es bist. Ich hab mir nämlich gedacht, dass ich jetzt, wo ich zu den Einsatzleuten gehöre, aus dem Wohnheim hier ausziehe und mir ein Quartier für Einsatzteams nehme.«
Sie sah ihn betroffen an. Tepilit war der einzige ihrer Freunde, der noch im Wohnheim wohnte. Sie hatte sich daran gewöhnt, einfach nur den Gang hinunterzulaufen und ihn in seinem Zimmer zu besuchen. Er war immer für sie da, wenn sie ihn brauchte, egal ob es um ein knackiges Kampftraining ging, oder ob sie bei einem Glas Milch ein tröstendes Gespräch brauchte. Und wenn man mal so richtig Spaß haben wollte, war er auch genau der Richtige. Sie würde ihn sehr vermissen. Auch wenn er nur ein paar hundert Meter entfernt wohnte, wäre es doch nicht mehr dasselbe wie bisher.
Wie immer, wenn sie betroffen war, nagte sie an ihrer Unterlippe. »Dann willst du mich hier also einfach so sitzen lassen.«
Tepilit verdrehte genervt die Augen. »Mensch, Charly, sei doch kein solcher Idiot und komm endlich aus deiner Muffelecke raus, sonst überleg ich mir mein Angebot noch! Was meinst du, warum ich dir das erzähle? Du weißt doch, dass die Quartiere der Einsatzleute meistens für ein Team eingerichtet sind, oder? Und ein Team besteht aus zwei Mitgliedern. Na, klingelt da was bei dir?«
Charly sah ihn eine Weile ungläubig an, dann sprang sie aufgeregt vom Stuhl hoch, wobei sie ihr Glas umschmiss.
»Mann, ist das dein Ernst? Du willst, dass wir beide ein Einsatzteam bilden und uns ein Quartier teilen?« Als Tepilit grinsend nickte, verpasste sie ihm einen Stoß gegen die Schulter, der ihn beinahe vom Stuhl fegte. »Warum hast du das nicht gleich gesagt, statt so saudumm um den heißen Brei herumzuquatschen?«
»Was weiß ich, dass du heute so schwer von Begriff bist«, beschwerte sich Tepilit und rieb sich die schmerzende Schulter. »Normalerweise stehst du nicht so auf der Leitung. Mensch, diese Albträume müssen dich ja noch mehr stressen, als ich dachte.«
»Die krieg ich in den Griff«, versicherte sie inbrünstig.
Wenn es klappte, dass sie und Tepilit ein Team bildeten, stiegen ihre Chancen, beim nächsten Einsatz dabei zu sein, gewaltig. Mit dieser erfreulichen Aussicht würden die lästigen Träume nun bestimmt ganz von allein verschwinden.
»Also, dann ist das abgemacht, Partnerin?« Tepilit streckte ihr seine breite Pranke entgegen.
»Abgemacht, Partner!« Sie schlug ein und grinste dabei übers ganze Gesicht. »Aber ich warne dich. Deinen Dreck in Küche und Gemeinschaftsraum kannst du gefälligst selbst aufräumen. Die Masche, von wegen, das Genie muss arbeiten, die zieht bei mir nicht, klar?«
Charly kannte Tepilit seit siebzehn Jahren. Damals war er als knapp Fünfjähriger unter tragischen Umständen zur OCIA gekommen. Seine ganze Familie war durch eine tödliche Infektion ausgelöscht worden, die von einem Parallelweltler eingeschleppt worden war. Alastair hatte dem kleinen Massai mit der OCIA eine neue Familie gegeben, und so waren Tepilit und sie zusammen aufgewachsen. Der Massai war für sie wie ein Bruder. Daher wusste sie nur zu genau, wie es in seinem Zimmer aussah. Sie war zwar auch keine Ordnungsfanatikerin, aber das Chaos, in dem Tepilit lebte, überschritt sogar ihre Schmerzgrenze.
Tepilit verzog gequält das Gesicht. Er sah aus, als wollte er am liebsten einen Rückzieher machen. »Ich wusste, dass du ein harter Brocken bist. Was habe ich mir da nur angetan?«
»Ich denke, wir werden prima miteinander auskommen.« Sie strahlte. »Und vielleicht haben wir ja Glück und bekommen ein Quartier im selben Gebäude wie Hannah und Hralfor.«
Seit Hannah vor zwei Jahren zur OCIA gestoßen war, war sie Charlys beste Freundin.
Hannah war damals von einem Rudel vargérischer Verbannter angefallen worden, die gezielt auf die Erde gewechselt waren, um dort weibliche Beute zu schlagen und nach Vargor zu verschleppen. Hralfor, eine Art vargérischer Grenzwächter, war den Verbannten gefolgt und hatte sie getötet. Als er wieder in seine eigene Welt zurückwechseln wollte, war das Sprungtor blockiert gewesen, und Hannah hatte dem wild aussehenden Fremden Unterschlupf angeboten. Dafür bewunderte Charly die Freundin sehr, da Vargéris nicht gerade zu den harmlos aussehenden Parallelweltlern gehörten. Ihr Auftauchen hatte hier auf der Erde vor Jahrhunderten zu der Entstehung der Mythen über Werwölfe geführt.
Dennoch hatte Hannah sich in ihren fremden Retter verliebt und war mit ihm gemeinsam der OCIA beigetreten.
Die beiden waren mittlerweile eines der schlagkräftigsten Einsatzteams und nahmen an jedem größeren Einsatz teil. Und das, obwohl Hannah ein Jahr jünger war als Charly. Allerdings hatte sie durch ihre Verbindung zu Hralfor einige besondere Fähigkeiten entwickelt, die Alastair veranlasst hatten, bei Hannah eine Ausnahme bei der Altersbegrenzung zu machen.
Charly beneidete ihre Freundin fast ebenso sehr, wie sie sie liebte. Für sie, die als Einzelkind aufgewachsen war, war Hannah genau die Schwester, die sie sich immer gewünscht hatte. Und da Hannah aus einer sehr großen und sehr gastfreundlichen Familie kam und selbst fünf Geschwister hatte, war Charly nun irgendwie auch ein Teil dieser Familie geworden, worüber sie sehr glücklich war. Mit Adrian, Hannahs zweitältestem Bruder war sie sogar ein knappes – und ziemlich turbulentes – Jahr zusammen gewesen, bis sie sich in bestem Einvernehmen wieder getrennt hatten.
Nichts würde sie mehr freuen, als direkt neben Hannah und Hralfor Quartier zu beziehen.
Tepilit schien das genauso zu sehen, denn er grinste breit und warf sich in die Brust. »Was glaubst du, was der große, weise Krieger schon gemacht hat? Er hat die Fühler ausgestreckt und ganz leise Anspruch auf ein Quartier angemeldet, das demnächst frei wird und nicht nur im selben Gebäude ist, sondern sogar noch im Erdgeschoss, direkt gegenüber von Hralfors Bude.«
»Nein!«
Ihre Begeisterung schien ihn vollkommen zufriedenzustellen.
»Also manchmal bist du tatsächlich ein Genie, du großer Krieger!« Charly hüpfte vor Aufregung auf der Stelle. »Und wann können wir umziehen?«
»Ich denke, kurz vor Weihnachten. Dann haben wir auch noch etwas Zeit, uns mental darauf einzustellen.«
»Okay.« Sie wäre zwar am liebsten sofort umgezogen, aber in ein paar Monaten war besser als gar nicht.
Zufrieden setzte sie sich wieder hin und gähnte. Die gute Nachricht hatte den Schrecken des Albtraums vollkommen verdrängt, und jetzt sehnte sie sich nach ihrem Bett. Sie war sicher, dass sie nun den Rest der Nacht durchschlafen konnte.
»Ich glaube, ich hau mich jetzt noch eine Runde aufs Ohr und du solltest das auch tun.«
»Ja.« Tepilit fuhr sich müde durch seine schulterlangen Dreadlocks. »Da könntest du recht haben.«
Sie schnappte sich ihr Glas, und da sie Tepilit etwas schuldig war, nahm sie seins mit, um es in die Spülmaschine zu stellen. Sie wollte ihm gerade eine gute Nacht wünschen, als sein Handy laut zu plärren begann.
»Alter, was ist das denn?« Tepilit zog das Handy aus der Hosentasche.
Sie stellte sich möglichst nah neben ihn. Ein Anruf mitten in der Nacht bedeutete in der Regel jede Menge Aufregung. Tepilits alarmierter Gesichtsausdruck bestätigte ihre Vermutung.
»Ich bin sofort da!«, brüllte er ins Handy und war schon halb aus der Küche herausgestürmt.
»Halt! Was ist los?« Charly rannte hinter ihm her.
»Ein unangemeldeter Sprung aus Hernidion.« Tepilit klang beunruhigt.
Sie schaltete blitzschnell. »Sean und Meijra? Himmel, ihnen ist doch nichts passiert, oder?« Sie rannte im Gleichschritt neben Tepilit durch das Gebäude.
»Keine Ahnung, ich hoffe nicht.« Er wirkte nervös. »Es handelt sich wohl um mehr als zwei Personen und der Sprung soll so schnell wie möglich durchgeführt werden. Es klang ziemlich dringend. Sie brauchen mich, um den Antimac schneller hochzufahren.«
»Ich komme mit.« Ihr Tonfall machte deutlich, dass sie sich auf keinen Fall von ihrem Vorhaben abbringen ließ. Sean und Meijra waren ihre Freunde. Sie konnte vielleicht nicht den komplizierten Antimac bedienen, mit dem es der OCIA möglich war, Sprungtore in die bekannten Parallelwelten zu öffnen, aber sie konnte für ihre Freunde da sein, falls diese sie brauchten. Immerhin war sie angehende Ärztin.
2
Die dunkelste Stunde der Nacht war nahe. Er spürte es in jeder Faser seines gepeinigten Leibes.
Langsam nahmen seine Körperfunktionen wieder ihre Arbeit auf. Neues Leben strömte in die gequälten Glieder und ließ die brennenden Schmerzen noch heftiger aufflammen.
Vorsichtig richtete sich Veirack aus seiner zusammengekrümmten Haltung in eine sitzende Position auf. Nun, da die Dunkelheit in sein Verlies Einzug gehalten hatte, war es nicht mehr erforderlich, seine Haut vor der unerträglichen Helligkeit des grylakischen Tages abzuschirmen. Allerdings war er bisher nicht besonders erfolgreich dabei gewesen, sich zu schützen. Er konnte spüren, wie seine verbrannte Haut am ganzen Körper aufplatzte, während er sich aufsetzte.
Die dünne hernidische Bekleidung gewährte einem Dreyronen, der seit Monaten einem gleißenden 46-Stunden-Tag ausgesetzt war, auf Dauer keinen wirkungsvollen Schutz. Und seinen dichten Umhang hatten ihm seine Widersacher gleich nach dem Weltensprung abgenommen, sobald sie bemerkt hatten, dass noch etwas Leben in ihm war.
Zunächst hatten sie ihn in ein finsteres Verlies gesteckt, weil ihre Rasse die Dunkelheit fürchtete, und sie dasselbe von ihm annahmen. Sie konnten nicht wissen, dass Dreyronen ihre Kräfte aus der Dunkelheit zogen. So schöpfte er, obwohl er sich bei dem vorangegangenen mentalen Kampf körperlich vollkommen verausgabt hatte, allmählich wieder neue Kraft.
Die Grylaken, die ihn regelmäßig aufsuchten, um seine mentale Abwehr zu durchbrechen, wunderten sich, dass er mit jedem Tag kräftiger anstatt schwächer wurde.
Er stellte sie vor eine große Herausforderung, da die geistigen Kräfte seines Volkes denen der Grylaken weit überlegen waren. Sie hatten es noch nie mit einem Gegner zu tun gehabt, dem sie nicht ihren Willen aufzwingen konnten. Und so ließen sie ihn am Leben, um ihn besser studieren zu können.
Sie entzogen ihm jegliche Nahrung, um ihn so weit zu schwächen, dass sie in seinen Geist eindringen konnten. Dank seiner mentalen Barriere wussten sie nicht, dass er von der OCIA einen Vorrat konzentrierten Nahrungsersatzes in Tablettenform gut versteckt in seiner Tunika aufbewahrte.
Auf diese Weise gelang es ihm, mehrere Dekaden zu überstehen. Leider waren die Pillen kein vollwertiger Nahrungsersatz, der ihn auf Dauer kräftigte. Sie taugten gerade einmal dazu, ihn keine weiteren Kräfte verlieren zu lassen, was in seinem geschwächten Zustand absolut nicht ausreichte.
Als seine Vorräte dann aufgebraucht waren, kostete es ihn immer mehr Energie, die Grylaken aus seinem Kopf fernzuhalten. Sie bemerkten das und verstärkten ihre mentalen Angriffe. Einige Gedankenfragmente wurden von ihnen aufgefangen, darunter die Tatsache, dass Dreyronen kein Tageslicht vertrugen.
Zu zwanzigst gelang es ihnen, ihn zu überwältigen und in dieses Verlies zu schleppen. Ein Grylake bezahlte diese Aktion mit dem Leben – und Veirack trank nach Jahren zum ersten Mal wieder das Blut eines frisch geschlagenen Gegners.
Das Blut sicherte ihm trotz des Tageslichts für weitere quälende Tage das Überleben und brachte ihm den mörderischen Hass seiner Widersacher ein. Nun wollten sie ihn nicht länger nur studieren, sondern ihn dabei auch noch möglichst langsam und qualvoll krepieren sehen.
Die Herniden hatten den Grylaken einen durchaus angemessenen Namen gegeben, als sie diese Kreaturen die Grausamen nannten.
Sie legten ihm einen breiten Metallring um den Hals, der mit einer schweren Kette an der Kerkerwand befestigt war, so wie die Menschen einen scharfen Hofhund anbanden. Seine Fessel ließ ihm gerade noch genug Freiheit, um sich in einem Umkreis von höchstens fünf Schritt in dem großen, nahezu kreisrunden Kerkerraum zu bewegen, ohne dabei an die Wand zu gelangen, an der sich die schmale Eingangspforte befand. Die Steinwände waren so hoch und glatt, dass er selbst in bestem Zustand Mühe gehabt hätte, sie zu erklettern. Sie ragten weit in den unbarmherzigen, grylakischen Himmel. Erst bei Anbruch der Dunkelheit schob sich für die Dauer der Nacht eine Steinplatte über das Gemäuer. Am Tag wurde das Verlies wieder zu einem nach oben offenen Turm, der seinem Gefangenen keinen Schutz vor Tageslicht und Witterung bot. Veirack hatte nur vage Vermutungen über die Gründe für diese ungewöhnliche Vorrichtung.
Eine flinke Bewegung neben ihm weckte seine Aufmerksamkeit. Er schärfte seine Sinne, so gut es ihm in seinem erbärmlichen Zustand möglich war. Nach langer Zeit hatte wieder einmal ein Wankari seinen Weg in das Verlies gefunden und schnüffelte nun hungrig an den Gebeinen seines Artgenossen. Veirack spürte, wie sich sein Blick schärfte und seine Jagdaugen ihre Tätigkeit aufnahmen. Das Wankari befand sich in Reichweite seiner Kette.
Ein Sprung, so schnell, dass nur ein dreyronisches Auge ihm folgen konnte, und das Tier zappelte kreischend zwischen seinen Fingern. Fast schon zärtlich legte er die pelzige Kehle bloß und versenkte seine Zähne in das warme Fleisch.
Viel zu schnell beendete das Tier seinen Todeskampf. Er saugte gierig den letzten Tropfen Blut aus dem leblosen Körper, doch sein Durst war nicht annähernd gestillt. Wankaris trugen zu wenig Blut in sich. Aber es musste genügen, um weitere Tage zu überleben, bis sich wieder einmal eines dieser Tiere hierher verirrte.
Ein jämmerliches Winseln erinnerte ihn daran, dass er nicht allein war. Finster blickte er auf das dreckige Bündel, das sich elend zitternd an die Steinwand direkt neben ihm drückte.
Mit einem verächtlichen Schnauben warf er das tote Tier hinüber, und der kleine Grylake fiel heißhungrig darüber her. Angewidert wandte er sich ab und versuchte, die ekelhaften Schmatzgeräusche zu überhören.
Wieder einmal fragte er sich, warum die Grylaken eines ihrer eigenen Kinder zu ihm in den Kerker gesteckt hatten. Sicher nicht, um ihn auszuspionieren.
Als sie das Kind zu ihm gebracht hatten, war der Junge vor Entsetzen völlig starr gewesen. Er hatte sich widerstandslos die Ketten anlegen lassen, die ihn ebenfalls am Hals an die Wand fesselten. Soweit Veirack das mentale Gestammel seiner Gegner verstanden hatte, sollte ihm der Junge als Futter dienen.
Zankor mautate! Das Kind war keine sechs Jahre alt. Welche Untat hätte es schon begehen können, um eine solche Strafe zu verdienen? Und wie wenig wussten diese Kreaturen trotz ihres kurzen Eindringens in seinen Geist von ihm, dass sie glaubten, er würde sich an einem wehrlosen Kind vergreifen? Hatten sie denn nicht das geringste Ehrgefühl in ihren stinkenden Leibern? Oder war das nur eine neue Taktik, um ihn seine Qualen noch stärker erleben zu lassen. Der Geruch des frischen, nahrhaften Blutes direkt in seiner Reichweite, während er ganz langsam verhungerte? Wollten sie womöglich seine Selbstbeherrschung testen?
Wie dem auch sei, er würde ihnen keine Gelegenheit geben, über ihn zu triumphieren. Entweder er starb in Ehren, oder es ergab sich doch noch eine Gelegenheit zur Flucht.
Wenn es nach ihm ginge, würde er sich freudig für den Tod entscheiden. Es war durch und durch ehrlos, sich in ein so elendes Dasein zu schicken, wie er es gerade zu führen gezwungen war. Solange er bei klarem Bewusstsein war, wäre es nur ein kurzer Gedanke und er könnte innerhalb eines Herzschlags all seine Körperfunktionen stilllegen und friedlich entgleiten.
Aber diese Wahl hatte er nicht. Nicht, seit er herausgefunden hatte, dass der OCIA-Einsatz in Hernidion doch nicht das angestrebte Resultat erzielt hatte. Zwar war es ihnen gelungen, das Sprungtor zwischen Hernidion und Grylax zu zerstören, doch dabei hatten sie den Grylaken einen noch viel gefährlicheren Weg geebnet. Und keiner bei der OCIA wusste etwas von der Gefahr, in der die Welt der Menschen schwebte.
Er musste sie warnen, egal was es ihn kostete.
Er schloss die Augen und rief sich das Geschehen bei seiner Ankunft in dieser Welt noch einmal ins Gedächtnis.
Direkt nach seinem unfreiwilligen Weltensprung nach Grylax hatte ihm zwar sein Körper vor Erschöpfung den Dienst versagt, doch sein Geist hatte genug Kraft aufgebracht, um die Gedanken seiner Entführer zu extrahieren.
Die überlebenden Grylaken hatten ihn und einen schwer verletzten jungen Herniden beim Weltensprung mit sich gerissen. Sie waren auf einem weiten, runden Areal angekommen, das ähnlich wie das Verlies ringsum von hohen Steinmauern umgeben war. In der Mitte des Platzes befand sich eine Steinplatte, die er als eine Art Opferstein erkannte. Die dunklen, eingetrockneten Flecken darauf und der Geruch nach altem Blut sprachen für sich. Die Grylaken legten ihn und den Herniden auf diese Platte und öffneten ihnen eine Ader am Hals. Das herausströmende Blut wurde in zwei blasenförmigen Gefäßen aufgefangen. Einer der Grylaken brachte daraufhin ein drittes, bereits gefülltes Gefäß, und er erkannte an dem vertrauten Geruch, dass es mit Tepilits Blut gefüllt war. Die Kreaturen mussten es dem bewusstlosen Massai in Hernidion abgenommen haben, gleich nachdem sie ihn überwältigt hatten.
Beunruhigt bündelte er seine letzten geistigen Kräfte, um den Grund für dieses seltsame Verhalten zu erfahren, und las aus den wirren Gedanken seiner Gegner heraus, dass das Blut für sie der Schlüssel zu fremden Welten war.
Die Grylaken hatten eine Möglichkeit gefunden, mit Hilfe des Blutes fremder Rassen Sprungtore in deren Welten zu öffnen. Grimmig musste er sich eingestehen, dass ihr Vorgehen dabei erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Vorgehen der OCIA aufwies. Denn so wie die OCIA durch die spezifischen bioenergetischen Strahlungsfelder der Parallelweltler in der Lage war, diese wieder in ihre eigene Welt zurückzuschicken, so vermochten es die Grylaken, sich durch das Blut fremder Rassen Zutritt zu deren Welten zu verschaffen.
Die Konsequenz daraus war ebenso logisch wie furchterregend. Durch Tepilits Blut bestand für die Grylaken nun die Möglichkeit, auch in die Welt der Menschen einzudringen.
Er konnte sich nur zu gut vorstellen, welches Grauen sie den mental schwachen Menschen bereiten konnten.
Wie er aus den Gedanken dieser Kreaturen entnehmen konnte, mussten jedoch außer dem Blut noch weitere Bedingungen erfüllt sein, bevor ein Sprung in die fremde Welt möglich war. Es schien sich um eine langwierige Prozedur zu handeln, die eine Menge schwieriger Rituale beinhaltete, was den Menschen einen gewissen Aufschub gewährte. Doch seine Gefangenschaft dauerte nun schon so lange an, dass er jeden Tag mit dem Schlimmsten rechnete.
Innerlich fluchend öffnete er wieder die Augen und fixierte die Wand vor sich, als wollte er sie nur mit der Kraft seines Blickes zum Einsturz bringen.
Es sollte ihm eigentlich völlig gleichgültig sein, ob die schwachgeistige, unterentwickelte Rasse der Menschen in ihr Verderben lief oder nicht. Warum fühlte er sich dann so verantwortlich für ihr Wohlergehen? War es wirklich nur eine Frage der Ehre, weil er eine Schuld bei Alastair McLachlan, dem Leiter der OCIA, abzuzahlen hatte?
Denn es war Alastair gewesen, der ihn vor sechs Menschenjahren mehr tot als lebendig gefunden hatte, nachdem er von seinem eigenen Volk als Verräter gestraft und in den Schlund des Vergessens geworfen worden war. Veirack hatte als Blutopfer gedient und war bei seiner gewaltsamen Ankunft in der Menschenwelt nicht mehr bei Sinnen gewesen. Er hatte in seiner Raserei eine Gefahr für jedes Lebewesen dargestellt. Ein Dreyrone hätte ihn vernünftigerweise sofort getötet.
Doch Alastair war ein Mensch und kein Dreyrone. Er hatte einfach abgewartet, bis die Raserei der völligen Erschöpfung gewichen war. Dann, kurz bevor Veirack in das ewige Schweigen entgleiten konnte, hatte er ihn mit dem Lebensnotwendigsten versorgt. Er hatte freiwillig sein Blut für ihn gegeben und sich damit Veiracks unwiderrufliche und lebenslange Loyalität gesichert.
So war Veirack zu einem Mitglied der OCIA geworden und trug seither durch seine Mitarbeit seine Schuld bei dem obersten Leiter dieser Organisation ab. Darüber hinaus hatte er jeden unnötigen Kontakt zu den Menschen vermieden, bis Alastair ihn ersucht hatte, die OCIA-Mitarbeiter in der Abwehr telepathischer Kräfte zu schulen.
Durch diese Aufgabe hatte er gezwungenermaßen viel Zeit mit diesem seltsamen Volk verbracht, das sich in seinem Verhalten so vollständig von seinem eigenen Volk unterschied.
Während sich Dreyronen nur zum Zwecke der Pflichterfüllung mit anderen abgaben und dabei strengste hierarchische Regeln zu befolgen hatten, schien die Mehrheit der Menschen überhaupt nicht fähig zu sein, ohne ständige soziale Kontakte zu überleben. Und was ihre hierarchischen Strukturen betraf, so wurden sie bei der OCIA – sofern vorhanden – nur äußerst unzulänglich eingehalten. Gleichberechtigung und Teamarbeit wurden dort großgeschrieben, und er hatte sich oft gefragt, warum die OCIA nicht schon längst im Chaos versunken war.
Nach seinen Erfahrungen waren die Menschen übertrieben gefühlsbetont, launisch, unberechenbar, laut, aufdringlich, undiszipliniert und körperlich schwach. Sie verfügten höchstens im Ansatz über mentale Kräfte, glichen dies aber durch nervtötende Sturheit und erstaunliche Improvisationskraft wieder aus. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihn behandelten, als könnte er jemals einer von ihnen werden, hatte ihn mehr als einmal aus seiner gewohnten Ruhe gerissen. All seine Versuche, sich diese Schwachgeister vom Leib zu halten, waren letztendlich im Sande verlaufen. Je mehr Mauern er um sich aufbaute, umso hartnäckiger rannten sie dagegen an. Sie nannten ihn ihren Freund, bis die Mauern Risse bekamen.
Er war unter dem schädlichen Einfluss dieser unterentwickelten Menschen schwach geworden. So schwach, dass er begonnen hatte, etwas für sie zu empfinden. Etwas, das weit über Pflichterfüllung und Ehre hinausging, und für das es in seiner Sprache nicht einmal einen Namen gab.
Er musste sie vor dem drohenden Unheil bewahren.
Er musste hier raus.
Als hätte die Kraft seiner Gedanken etwas bewirkt, hörte er hinter den dicken Mauern seines Kerkers ein leises Schaben. Die kleine Klappe in der schweren Holztür öffnete sich, und eine hässliche Fratze starrte ihn an.
Schonen Junge, warum, erklang eine grunzende Stimme dumpf in seinem Kopf.
Er erkannte, dass es sich bei seinem Besucher um ein weibliches Exemplar handelte. Bisher hatte er es nur mit den Männchen zu tun gehabt.
Interessiert betrachtete er das Gesicht, das ihn angespannt ansah.
Die Grylakenfrau unterschied sich nur geringfügig von den Männern. Ihr Fell war etwas heller und das Gesicht schmaler geschnitten. Sie stank genauso ekelerregend wie der Rest ihrer Brut. Aber sie war gekommen, um mit ihm zu kommunizieren.
Ich töte keine wehrlosen Kinder.
Die Frau zuckte überrascht zurück, als seine Stimme so klar in ihrem Kopf erklang. Sie blickte zu dem Jungen hinüber, der sich so gut wie möglich in seinen Ketten aufgerichtet hatte und sie sehnsüchtig anstarrte. Ihr Blick blieb auf den Überresten des Wankaris hängen, das der Junge noch in den Klauen hielt.
Junge füttern, obwohl Feind!
Es war offensichtlich, dass sie sein Verhalten nicht nachvollziehen konnte. Und wenn er ehrlich war, ging es ihm genauso. Unwillig zuckte er mit den Achseln – noch eine Angewohnheit, die er sich bei den Menschen angeeignet hatte.
Warum bist du hier?
Die Grylakin zögerte kurz, doch nach einem weiteren Blick auf den Jungen fasste sie einen Entschluss.
Fremden retten, wenn Junge schützen.
Veirack atmete zischend ein, doch gleich darauf hatte er sich wieder in der Gewalt.
Warum?
Junge Fleisch von Raxelquatna.
Er warf ihr einen scharfen Blick zu.
Der Junge ist dein Sohn?
Sie dachte eine Weile über seine Frage nach, dann zog sie die Oberlippe hoch und entblößte dabei mehrere Reihen scharfer, dreieckiger Zähne, die hintereinander angeordnet waren.
Axokalimbokal Sohn von Raxelquatna.
Warum wurde er zu mir gesperrt?, fragte er misstrauisch.
Junge wegnehmen, weil strafen Mann. Mann gegen Herrscher.
Veirack ließ sich die Erklärung durch den Kopf gehen. Es ergab Sinn, dass der Junge geopfert wurde, um die Eltern dafür zu strafen, dass sie gegen die Machthaber dieser Welt waren. Vielleicht hatte der Vater sogar zu einer Revolte aufgerufen, die für Unruhen gesorgt hatte. Es war in jeder Welt eine wirkungsvolle Waffe diktatorischer Regierungen, Druck durch die Angehörigen auszuüben, um Loyalität zu erzwingen.
Wie willst du mich retten?
Nervös blickte sie sich um. Ihre Stimme in seinem Kopf klang gedämpft.
Erst Bindungswort geben. Junge mitnehmen und schützen.
Er beugte sich überrascht vor.
Du willst, dass ich den Jungen mit mir mitnehme? Wohin denn?
Welt von Gehörnten. Grylax nicht sicher für Axokalimbokal.
Veirack spürte, wie schwer ihr diese Entscheidung fiel. Gegen seinen Willen begann sich in ihm so etwas wie Hochachtung vor der Frau zu regen. Es fiel ihr schwer, sich von ihrem Kind zu trennen und es in die Obhut eines Fremden zu geben. Dass sie es dennoch tat, zeigte deutlich, in welcher Gefahr der Junge hier schwebte. Dann stutzte er.
Du kannst uns in die Welt der Gehörnten springen lassen?
Sie richtete sich stolz auf, in ihren tiefliegenden Augen loderte eine rote Flamme.
Raxelquatna und Mann herrschen, dann grausamer Xarandoxel kommen. Alles ändern. Schrecken herrschen.
Veirack nickte nachdenklich. Er stand auf, überkreuzte seine Arme vor der Brust und verbeugte sich.
Ich gebe dir mein Bindungswort, dass ich deinen Jungen mit mir nehmen und sein Leben mit meinem Leben beschützen werde, wenn du mir zur Flucht in die Welt der Gehörnten verhilfst.
Etwas von der Anspannung der Frau schien sich zu lösen. Sie grunzte zustimmend.
Rettung vorbereiten. Bereit sein, nächste Dunkelheit.
Sie schickte sich an, zu gehen, als seine Gedanken sie zurückhielten.
Halt, warte! Was ist mit dem Herniden? Wir werden ihn mitnehmen.
Er musste sichergehen, dass sie dem anderen Gefangenen nicht noch weiteres Blut entnahmen.
Die Frau bewegte ihren dicken Stirnwulst.
Gehörnter sterben. Schwaches Opfer, nicht wie Fremder.
Damit schob sie die Klappe wieder zu und verschwand.
Veirack starrte finster auf die Tür, dann wandte er sich so abrupt an den Jungen, dass dieser entsetzt zusammenzuckte.
»Du hast verstanden, was deine Mutter eben gesagt hat?«
Bisher war es ihm nicht gelungen, den Grylaken zur Kommunikation zu bewegen. Er hatte nur starr vor Angst dagesessen. Selbst seine Versuche, sich Zugang zu den Gedanken des Kindes zu verschaffen, waren an dieser Angst gescheitert. Normalerweise wäre es ihm ein Leichtes gewesen, diese Barriere zu durchbrechen, aber die lange Zeit der Gefangenschaft und Auszehrung hatte seine körperlichen und mentalen Kräfte nahezu erschöpft. Doch vielleicht hatte das Auftauchen der Mutter dem Jungen etwas von seiner Panik genommen.
Tatsächlich blinzelte der Junge zögernd mit den Augen. Veirack hatte beobachtet, dass Grylaken mit diesem Blinzeln eine Frage bejahten. Wenn sie dagegen etwas verneinten, kniffen sie die Augen fest zu.
»Dann weißt du, dass ich dir nichts antun werde. Also hör auf, dich so jämmerlich zu benehmen!«
Der Junge riss furchtsam die Augen auf, doch Veirack ließ sich davon nicht beeindrucken.
»Wenn wir gemeinsam von hier fliehen wollen, sollten wir zusammenarbeiten. Dein Name ist Axokalimbokal?«
Erneutes Blinzeln.
»Gut. Mein Name ist Veirack. Wiederhole das!«
Der Junge zögerte so lange, dass er zu fürchten begann, dass Grylaken in diesem Alter der Gedankensprache noch gar nicht mächtig waren. Er wollte sich schon resigniert abwenden, als er eine tastende Berührung in seinem Kopf spürte.
Veirack.
Erstaunt hob er die Augenbrauen. Die kurze Berührung hatte sich eindringlicher angefühlt als jeder mentale Angriff der anderen Grylaken. Der Junge musste über starke geistige Fähigkeiten verfügen. Wenn diese erst einmal fertig ausgebildet waren, würden sie alles in den Schatten stellen, was er bisher bei diesen Kreaturen erlebt hatte.
Es konnte interessant sein, sich näher mit diesem Kind zu beschäftigen. Sollte ihnen die Flucht gelingen, wäre der Junge von großem Nutzen für Alastair. Durch ihn konnten die Wissenschaftler der OCIA mehr über die Grylaken in Erfahrung bringen. Das wäre bei einer Konfrontation mit diesen Kreaturen von unschätzbarem Wert.
Gut, Axokalimbokal. Und jetzt berichte mir über deine Welt! Wenn ich mit dir zufrieden bin, werde ich dir vielleicht auch von der Welt erzählen, in die wir fliehen werden.
So etwas wie Neugier blitzte in den kleinen roten Augen des Jungen auf, und Veirack wusste, dass er gewonnen hatte.
Berichten was?
Fang mit eurem Herrscher an und schildere mir im Anschluss euer Leben.
Und der Junge begann zunächst recht unsicher, dann immer eifriger zu erzählen. Veirack lenkte den Bericht durch knappe Fragen auf die Themen, die ihm wichtig waren. Wenn er das fragmentarische Gestammel des Kindes nicht sinnvoll zusammenfügen konnte, verschaffte er sich behutsam Zugriff zu seinen Gedankenbildern.
Er erfuhr, dass Grylax von einem Herrscherrudel regiert wurde, das aus dreizehn Mitgliedern bestand. Rudelführer war ein Grylake namens Xarandoxel, der vor einiger Zeit die Macht durch einen mentalen Überraschungsangriff auf das damalige Herrscherrudel an sich gerissen hatte.
Seither herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände auf Grylax, bei denen die Anhänger der früheren Regierung erbittert gegen die Befürworter der neuen Regierung kämpften.
Besonders wertvoll war für ihn die Information, dass der Putsch nur durch ein bestimmtes Mittel möglich geworden war, das die mentalen Fähigkeiten der Grylaken lähmte und sie fügsam machte. Es wurde aus dem giftigen Samen der seltenen Zarquottelpflanze gewonnen. Nur wenige Grylaken verfügten über das Wissen, dieses Zarquottel herzustellen. Und diejenigen, die diese Kenntnisse besaßen, hielten sich bedeckt, um nicht zwischen den Fronten aufgerieben zu werden.
Er erfuhr von dem Jungen, dass die Welt Grylax in weiten Teilen mit Wäldern bedeckt war, die den tropischen Regenwäldern der Erde ähnelten. Im Zentrum der hügeligen Dschungelwelt gab es eine weite, baumlose und felsige Ebene, die vor allem von der höheren Kaste der sogenannten Savannengrylaken bewohnt wurde. Die niedrigen Kasten lebten in den Wäldern, wo sie Schutz in und unter den Bäumen fanden, während sich die Höhergestellten gewaltige Steinbauten errichten ließen. Für diese Arbeiten wurden immer wieder Waldgrylaken aus ihren Nestern getrieben und zur gnadenlosen Arbeit an der Steinfestung gezwungen. Viele von ihnen fanden dabei den Tod.
Da sowohl ihre körperlichen als auch ihre mentalen Fähigkeiten denen der Savannengrylaken weit unterlegen waren, hatten die Waldgrylaken keine Möglichkeit, sich gegen diese Sklaverei aufzulehnen. Und das Herrscherrudel bestand ausschließlich aus Savannengrylaken.
Sie hatten nur einen natürlichen Feind, doch den fürchteten sie so sehr, dass sie seinetwegen bei Dunkelheit keinen Fuß aus ihren Steinbauten wagten – den Troxkal, eine gigantische flugfähige Kreatur, die nur bei Nacht jagte. Seine Flügelspannweite betrug über 30 Schritt, und er bewegte sich so lautlos, dass man ihn erst bemerkte, wenn es zu spät war. Er besaß tödliche Krallen, einen messerscharfen Schnabel und war vollkommen unempfänglich gegenüber den telepathischen Kräften der Grylaken.
Veirack konnte nur hoffen, dass ihnen diese Kreatur bei ihrer Flucht nicht begegnete.
Axokalimbokal stand ihm die ganze Nacht Rede und Antwort. Als der grylakische Tag heraufdämmerte, stellte Veirack jedoch seine Fragen ein und bereitete sich auf weitere qualvolle Stunden vor.
Der junge Grylake, der im Laufe der Nacht merklich mutiger geworden war, versuchte die lähmende Stille, in die Veirack verfiel, zu durchbrechen.
Erzählen fremde Welt jetzt.
Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, erwiderte Veirack unwirsch.
Doch Axokalimbokal wollte sich damit nicht zufriedengeben. Fremder Bindungswort geben erzählen fremde Welt.
Zankor mautate, was bist du für ein stumpfhirniger Quälgeist, fuhr Veirack ihn an. Ich werde erzählen, wenn der rechte Moment gekommen ist. Jetzt muss ich meine Kräfte zusammenhalten. Oder willst du mich heute Nacht bei unserer Flucht tragen?
Licht schwach machen Veirack.
Veirack glaubte, eine gewisse Genugtuung aus dieser Feststellung herauszuhören, und starrte den Jungen intensiv an. Dabei ließ er seine Jagdaugen rot aufglühen. Axokalimbokal fuhr erschrocken zusammen.
Selbst wenn Licht mich schwächt, ragen meine Kräfte noch immer weit über deine oder die deines Volkes heraus, Junge. Das solltest du dir gut merken. Und merke dir auch Folgendes: Mein Bindungswort, dich zu schützen, gilt nur, solange du nicht versuchst mich oder meine …, Veirack zögerte kurz, bevor er dieses ihm fremde Wort benutzte, … Freunde zu schädigen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?
Der junge Grylake beeilte sich, mehrmals bestätigend zu blinzeln.
Gut. Dann lass mich jetzt in Ruhe! Ich werde dir schon mitteilen, wann ich zu weiteren Gesprächen bereit bin.
Die Deckenplatte legte bei Tagesanbruch erneut den Himmel frei und die Stunden verstrichen qualvoll langsam.
Während die grylakische Sonne höher stieg und immer mehr an Kraft gewann, spürte Veirack, wie ihm seine Kräfte durch die erbarmungslose Helligkeit mit jedem Herzschlag entzogen wurden. Er kauerte regungslos eng an die Wand gepresst und schirmte seinen Geist so gut wie möglich von seinem gepeinigten Körper ab.
An diesem Tag wurde er dreimal aus seiner Versunkenheit gerissen.
Wie üblich sahen seine Gefängniswärter in regelmäßigen Abständen nach ihm und überprüften seine mentalen Abwehrkräfte. Er hielt ihnen auch heute stand, doch zehrten diese Aktionen so stark an seinen Kräften, dass er zum ersten Mal befürchtete, die Kontrolle zu verlieren. Es war höchste Zeit für eine Flucht. Nach weiteren Tagen in Gefangenschaft hätte er sich ernsthaft mit seinem eigenen Erlöschen beschäftigen müssen. Auf keinen Fall hätte er seinen Feinden Zugang zu seinem Geist gewährt. Das zumindest war er Alastair schuldig, wenn er ihn schon nicht vor der drohenden Gefahr warnen konnte. Sein Wissen über die OCIA in den Händen dieser Kreaturen konnte zu einer Katastrophe für die gesamte Menschheit führen.
Als die Dämmerung nahte und keine weiteren Besuche mehr zu erwarten waren, atmete er erleichtert auf. Begierig sehnte er die heilende Nacht herbei.
Dann schob sich die Steinplatte über die Mauern und sein Kerker füllte sich endlich mit wohltuender Dunkelheit. Er konzentrierte sich darauf, die wichtigsten Körperfunktionen wieder in den Griff zu bekommen.
Die Dämmerung war noch nicht der Nacht gewichen, als ein leises Klirren an der Tür die Ankunft der Grylakin verkündete. Die Pforte wurde vorsichtig geöffnet und die Frau kam hereingeschlichen. Erstaunlich leise für ein so plumpes Geschöpf lief sie zu dem Jungen und fingerte an seinen Ketten herum. Als das Kind frei war, fielen sich die beiden Grylaken grunzend in die Arme und zerwühlten sich gegenseitig das struppige Fell.
Jetzt ist keine Zeit für ein langes Wiedersehen, Frau, fuhr er die Grylakin ungeduldig an. Jeden Moment können die Wachen auftauchen.
Wachen tun, was Raxelquatna sagen.
Die Grylakin hielt triumphierend ein kleines Horn in die Höhe, das an einem Lederband um ihren Hals hing und in dem einige dünne Holzspieße steckten.
Zarquottel machen Wachen Freunde.
Und damit eilte sie zu ihm, um ihm den Halsring abzunehmen. Nachdem sie den Schlüssel in das kleine Schloss gesteckt hatte, sah sie den Dreyronen wachsam an.
Fremder Bindungswort einhalten.
Veiracks Augen blitzten zornig auf.
Ich weiß nicht, ob und welche Ehrbegriffe es bei deinem Volk gibt, aber Dreyronen halten immer, was sie versprechen. Deine Frage beleidigt mich.
Sie blickte ihn starr an, dann drehte sie den Schlüssel um und nahm ihm den Halsring ab.
Kommen!
Ohne sich weiter nach ihm umzusehen, nahm sie den Jungen bei der Hand und eilte aus dem Kerker. Veirack folgte ihnen lautlos.
Vor dem Kerker standen seine Gefängniswärter und blickten ihnen mit glasigem Blick entgegen. Sie rührten sich nicht von der Stelle, als sie an ihnen vorübereilten.
Wie lange hält die Wirkung des Zarquottels an?, wandte er sich an die Frau.
Ganze Nacht, erwiderte sie.
Und werden sie sich danach daran erinnern, was geschehen ist?
Die Grylakin eilte weiter, während sie ihm antwortete.
Raxelquatna befehlen, nichts wissen, wenn aufwachen.
»Wie praktisch«, murmelte er kaum hörbar. Er nahm sich vor, diese Welt nicht ohne dieses Wundermittel zu verlassen. Die Wissenschaftler der OCIA hatten gewiss ihre Freude daran.
Die weitere Flucht verlief ebenso reibungslos, wie sie begonnen hatte. Raxelquatna führte Veirack durch endlose, beklemmend enge und hohe Steinlabyrinthe. Mit Mühe konnte er den nächtlichen Himmel über ihnen sehen. Auch hier waren die Gänge in regelmäßigen Abständen mit Überdachungen aus großen Steinplatten versehen. Soweit er erkennen konnte, war es durch eine komplizierte Konstruktion aus Seilwinden möglich, diese Platten zu bewegen.
Er musste nicht lange darüber nachdenken, weshalb die Grylaken ein so aufwendiges Wegenetz bauten. Ihr schlimmster Feind war der Troxkal mit seiner enormen Flügelspannweite. In engen Mauern konnte die riesige Kreatur nicht manövrieren und somit auch nicht angreifen.
Dennoch schienen sich die Grylaken bei Nacht auch trotz der engen Mauern nicht sicher zu fühlen, denn sie begegneten keinem einzigen von ihnen.
Während sich Veirack mit den Eigenheiten seiner Feinde beschäftigte, nahm er plötzlich schwache, fremde Gedankenströme wahr. Vor ihnen befand sich ein Grylake.
Wie Veirack festgestellt hatte, bestand das gesamte Bauwerk aus einem Gestein, das sämtliche elektromagnetischen Strahlungen und Wellen, also auch Gehirnwellen, absorbierte und umleitete. Die Festung war somit ein strahlungstoter Bereich.
Erst wenn die Grylaken ihm ohne eine trennende Wand gegenüberstanden, konnte er ihre Gedanken auffangen – und umgekehrt. Dieser Umstand hatte es ihm in den vergangenen Monaten überhaupt erst ermöglicht, sich auf Dauer ihrem mentalen Zugriff zu entziehen.
Er wollte Raxelquatna auf die drohende Gefahr vor ihnen hinweisen, als die Frau auch schon stehenblieb und warnend eine Hand hob.
Bleiben warten! Raxelquatna Wache ausschalten.
Leise schlich sie weiter und zog dabei einen der Holzspieße aus dem Horn. Er verfolgte, wie sie zu einer Mauernische lief, aus der er die Gehirnströme empfing. Als sie direkt davor stand, schob sich die massige Gestalt des Wachpostens aus dem schmalen Nischeneingang. Die Grylakin bewegte sich schneller, als er es ihr aufgrund ihres plumpen Körpers zugetraut hätte. Ein kurzer Stich in den Hals und die Gedanken des Grylaken verschwammen, sein eigener Wille erlosch. Die Frau flüsterte ihm ihre Befehle zu, und der betäubte Grylake trat gehorsam zurück in seine Nische, während sie ihn passierten und den Gang verließen.
Er öffnete sich zu dem großen Platz, den Veirack schon von seiner Ankunft kannte. Der Opferstein in der Mitte war in dem flackernden Licht der Fackeln, die ringsum im Mauerwerk angebracht waren, gut zu erkennen.
Raxelquatna blickte nervös in den Himmel, bevor sie eilig auf den Stein zulief. Auch Veirack überprüfte die Umgebung. Der Platz war groß genug, um dem Troxkal die Möglichkeit zum Angriff zu bieten. Doch der violette Himmel, der von dünnen Nebelschleiern verhüllt wurde, schien leer zu sein.
Am Stein angekommen schob die Grylakin ihren Sohn auf den Opferstein und bedeutete Veirack, sich danebenzusetzen. Flink öffnete sie mit einem weiteren Schlüssel eine kleine Luke am Fuß des Steins und holte eine Holzlade aus dem Hohlraum dahinter. Er konnte das Blut durch das Holz riechen. Sein Magen zog sich vor Hunger schmerzhaft zusammen.
Als sie den Deckel der Lade öffnete, sah er, dass darin drei gefüllte Blasen aufbewahrt waren. Grimmig erkannte er das Blut des jungen Herniden, ebenso das von Tepilit, sowie sein eigenes. Als Raxelquatna das Hernidenblut entnahm und die Lade wieder schließen wollte, packte er ihren Arm.
Ich werde auch die beiden anderen Gefäße mit mir nehmen.
Empört blickte sie zu ihm hoch. Blut bleiben Grylax!
Er ließ seine Augen aufglühen und verstärkte seinen Griff um ihr Handgelenk. Es fehlte nur noch ein kurzer Druck, und ihre Knochen wären zertrümmert.
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich euren Überfall auf die Welt meiner Freunde dulden werde?
Als sie die eisige Entschlossenheit in seinem Gesicht sah und den scharfen Schmerz in ihrem Handgelenk spürte, wimmerte sie erschrocken. Er lockerte seinen Griff und deutete auf das Horn an ihrer Brust. Dieses Zarquottel werde ich ebenfalls mitnehmen.
Die Grylakin umfasste das Horn schützend. Nicht geben. Nur noch Rest übrig!
Veirack blieb hart. Du wirst es mir geben. Dafür verspreche ich dir, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dir deinen Sohn gesund wiederzubringen. Was sagst du?
Die Grylakin starrte ihn fassungslos an. Dann flog ihr Blick zu ihrem Kind, und Veirack glaubte, einen Funken Hoffnung darin zu erkennen. Pfeilschnell beugte er sich zu ihr hinunter.
Wir könnten zu einer Einigung kommen. Dein Volk und das Volk meiner Freunde könnten eines Tages ein gegenseitiges Abkommen treffen. Wir könnten euch dabei helfen, die Herrschaft dieses Xarandoxel zu beenden, wenn ihr uns zusichert, unsere Welten in Frieden zu lassen. Was sagst du?
Raxelquatna sah ihn lange an, und erneut verfluchte er seine Schwäche, die ihn daran hinderte, ihre Gedanken zu erkennen. Sie griff nach dem Lederband und zog es sich über den Kopf. Entschlossen hielt sie ihm das Horn entgegen.
Nehmen Zarquottel, Blut und Jungen. Halten Bindungswort. Bringen Axokalimbokal zurück.
So soll es sein. Er nickte ihr kurz zu und streifte das Band über. Jetzt bring uns hier weg, Frau!
Die Grylakin öffnete das Gefäß mit dem Hernidenblut und malte verschiedene Zeichen auf den Opferstein. Sie lief zu einem kleineren Felsen, der mit winzigen, glitzernden Kristallen durchsetzt war und fünf Schritt vom Opferstein entfernt aufgestellt war. Sie beschmierte auch ihn mit dem Blut und sang dabei eine raue, monotone Klangfolge, die in ihm ein dumpfes Vibrieren bewirkte. Das wiederholte sie bei zwei weiteren Felsen, die, wie er erst jetzt bemerkte, ein gleichschenkliges Dreieck um den Opferstein bildeten. Danach kam sie zu ihnen zurück und zeichnete mit dem Blut einen Kreis, in dem sich ein Dreieck befand, auf die Stirn des Jungen.
Dasselbe tat sie bei Veirack. Der Blutgeruch kroch ihm in die Nase und in jede Pore seines ausgehungerten Körpers. Kurz befürchtete er, die Kontrolle zu verlieren und sich heißhungrig auf die Frau zu stürzen. Unter Aufbieten all seiner Kräfte gelang es ihm, die Beherrschung zu bewahren.
Ein dumpfes Grollen lenkte ihn von seinem brennenden Durst ab.