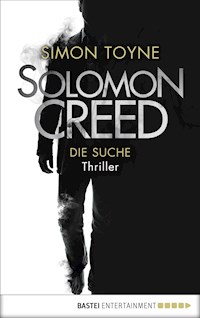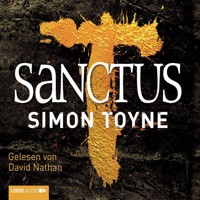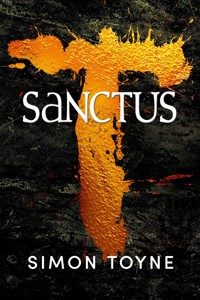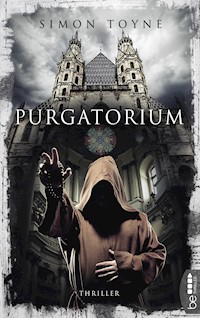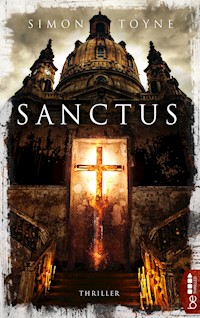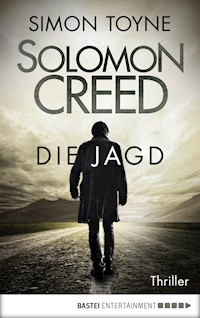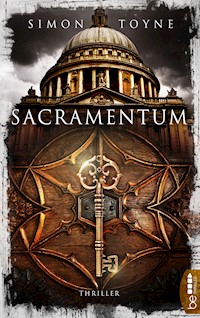
7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Verschwörung auf der Spur: Die Sanctus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Gehetzt. Gejagt. Getrieben.
Kalte, weiße Wände - das ist alles, was die Journalistin Liv Adamsen sieht, als sie erwacht. Wo ist sie? Ihr Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Und was ist das für eine Stimme, die ihr zuflüstert: »Du bist der Schlüssel!« Der Schlüssel wozu?
Was Liv nicht ahnt: Für die Mönche in der verbotenen Festung von Trahpah könnte sie die Rettung vor einer geheimnisvollen Seuche bedeuten. Und für eine einflussreiche Gruppe innerhalb der katholischen Kirche stellt sie eine nie dagewesene Bedrohung dar. Damit ist die Jagd auf Liv eröffnet ...
Das Schicksal der Menschheit liegt in der Hand einer einzigen Frau. Sie ist der Schlüssel. Und ihre Gegner kennen keine Gnade.
Nach dem fulminanten Debüt SANCTUS wird es jetzt noch spektakulärer!
Die SANCTUS-Trilogie: Band 1: Sanctus, Band 2: Sacramentum, Band 3: Purgatorium.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Karte
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
II
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
III
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
IV
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
V
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
VI
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
VII
116
117
118
Epilog
Danksagung
Weitere Titel des Autors
Die SANCTUS-Trilogie:
Band 1:Sanctus
Band 3:Purgatorium
SOLOMON CREED
Solomon Creed – Die Suche
Solomon Creed – Die Jagd
Über dieses Buch
Gehetzt. Gejagt. Getrieben.
Kalte, weiße Wände – das ist alles, was die Journalistin Liv Adamsen sieht, als sie erwacht. Wo ist sie? Ihr Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Und was ist das für eine Stimme, die ihr zuflüstert: »Du bist der Schlüssel!« Der Schlüssel wozu?
Was Liv nicht ahnt: Für die Mönche in der verbotenen Festung von Trahpah könnte sie die Rettung vor einer geheimnisvollen Seuche bedeuten. Und für eine einflussreiche Gruppe innerhalb der katholischen Kirche stellt sie eine nie dagewesene Bedrohung dar. Damit ist die Jagd auf Liv eröffnet …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Simon Toyne arbeitete über zwanzig Jahre lang als Produzent und Regisseur für das britische Fernsehen, bis seine Leidenschaft für spannende Geschichten ihn auf die Idee brachte, selbst Thriller zu schreiben. Das Ergebnis war sein spektakuläres Debüt SANCTUS. Heute erscheinen seine Bücher in 27 Sprachen und in mehr als 50 Ländern. Bastei Lübbe hat die SANCTUS-Trilogie und die SOLOMON-CREED-Reihe veröffentlicht.
Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.simontoyne.net/.
Simon Toyne
SACRAMENTUM
Religionsthriller
Aus dem britischen Englisch vonRainer Schumacher
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Simon Toyne
Titel der englischen Originalausgabe: »The Key«
Originalverlag: HarperCollins Publishers
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © baloon111/iStock/Getty Images Plus; baloon111/iStock/Getty Images Plus; Azure-Dragon/iStock/Getty Images Plus; DavidMSchrader/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2165-3
be-thrilled.de.de
lesejury.de
Für Roxy
I
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind … und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen …
Apostelgeschichte, 2:2-4
1
Al-Hillah, Provinz Babil, Zentralirak
Der Wüstenkrieger starrte durch das sandgestrahlte Fenster. Seine Augen waren hinter einer Schutzbrille verborgen und das Gesicht hinter seiner Kufiya, dem Kopftuch der Beduinen. Alles da draußen war kreidebleich: die Gebäude, der Schutt – ja, selbst die Menschen.
Der Wüstenkrieger beobachtete einen Mann, der auf der gegenüberliegenden Seite die Straße hinunterschlurfte. Auch er hatte sein Gesicht mit einer Kufiya vor dem Staub geschützt. Es gab nicht viele Passanten in diesem Teil der Stadt, nicht solange die Mittagssonne so hoch am strahlend weißen Himmel stand und die Temperaturen die fünfzig Grad überschritten. Aber wie auch immer … Sie mussten sich beeilen.
Irgendwo hinter ihm, in den Tiefen des Gebäudes, war ein dumpfer Schlag zu hören, gefolgt von einem Stöhnen. Der Wüstenkrieger hielt nach Anzeichen dafür Ausschau, dass der Passant etwas gehört hatte, doch der Mann ging weiter und duckte sich dabei in den schmalen Schatten einer von Einschusslöchern übersäten Wand. Der Wüstenkrieger beobachtete ihn weiter, bis er im Hitzeflimmern verschwamm; dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf den Raum.
Das Büro war Teil einer Kfz-Werkstatt in den Außenbezirken der Stadt. Es roch nach Öl, Schweiß und billigen Zigaretten. An der Wand hing ein eingerahmtes Foto, das stolz die schmierigen Papierstapel und Motorteile zu überwachen schien, die jede Oberfläche hier bedeckten. Der Raum war groß genug für einen Schreibtisch und ein paar Stühle, aber auch klein genug, dass die unförmige Klimaanlage die Temperatur auf einem akzeptablen Niveau halten konnte … wenn sie denn funktionierte, und das tat sie im Augenblick nicht. Es war glühend heiß hier drin.
Die Stadt wurde schon seit Monaten von Stromausfällen geplagt, einer von vielen Preisen, die sie für ihre Befreiung zahlen musste. Inzwischen bezeichneten die Menschen Saddams Regime schon als ›die gute, alte Zeit‹. Sicher, dann und wann sind Menschen verschwunden, doch wenigstens hatten wir damals Licht. Es erstaunte den Wüstenkrieger immer wieder, wie rasch die Menschen vergaßen. Er hingegen hatte gar nichts vergessen. Unter Saddam war er ein Gesetzloser gewesen, und das war er auch jetzt unter den Besatzern. Seine Treue galt dem Land.
Ein weiteres schmerzhaftes Stöhnen riss ihn in die Gegenwart zurück. Er machte sich daran, Schubladen zu leeren und Schränke zu öffnen in der Hoffnung, den Stein rasch zu finden, um dann wieder in die Wüste zu verschwinden, bevor die nächste Patrouille vorbeikam. Doch der Mann, der den Stein besaß, kannte dessen Wert offensichtlich. Es war keine Spur von ihm zu sehen.
Der Wüstenkrieger nahm das Foto von der Wand. Ein dicker schwarzer Schnurrbart, wie auch Saddam ihn getragen hatte, verdeckte ein vom Wohlstand fettes Gesicht, und eine weiße Dishdasha, ein traditionelles Männergewand, spannte sich über dem dicken Bauch des Mannes, der seine Arme um zwei grinsende junge Mädchen gelegt hatte. Unglücklicherweise hatten die beiden Kinder das Aussehen ihres Vaters geerbt. Die drei lehnten an dem weißen SUV, der nun im Hof der Werkstatt stand. Der Wüstenkrieger schaute zu dem Wagen hinaus, hörte das Ticken des sich abkühlenden Motors und sah die heiße, flimmernde Luft über der Haube und den kleinen, aber deutlich erkennbaren Kreis im unteren Teil der abgedunkelten Windschutzscheibe. Er lächelte und ging mit dem Foto in der Hand hinaus.
*
Der Arbeitsbereich nahm fast den gesamten hinteren Teil des Gebäudes ein. Dort war es zwar dunkler als im Büro, aber genauso heiß. Neonröhren hingen nutzlos von der Decke, und in der Ecke stand still und stumm ein Ventilator. Ein einzelner heller Sonnenstrahl, der durch ein paar schmale Fenster fiel, die hoch in der Rückwand eingelassen waren, beschien einen Motorblock, der an dünnen Ketten baumelte, die aussahen, als könnten sie dessen Gewicht nicht tragen. Darunter rang der mit Stacheldraht an die Werkbank gefesselte Mann von dem Foto nach Luft. Sein Oberkörper war nackt, und sein behaarter Bauch hob und senkte sich mit jedem gequälten Atemzug. Seine Nase war blutig und gebrochen und ein Auge zugeschwollen. Dort, wo der Stacheldraht die von Schweiß glänzende Haut durchstach, sammelte sich scharlachrotes Blut.
Über ihm stand ein Mann in verstaubtem Overall, das Gesicht ebenfalls hinter Kufiya und Schutzbrille verborgen.
»Wo ist er?«, verlangte der Mann zu wissen und hob einen von Blut glänzenden Kreuzschlüssel.
Der fette Mann schwieg. Er schüttelte nur den Kopf, und in Erwartung neuerlichen Schmerzes beschleunigte sich seine Atmung. Blut und Schnodder blubberten aus seiner Nase und blieben im Schnurrbart kleben. Er kniff sein gesundes Auge zu. Der Kreuzschlüssel wurde noch ein Stück höher gehoben.
Dann betrat der Wüstenkrieger den Raum.
In Erwartung eines weiteren Schlages blieb das Gesicht des fetten Mannes verkrampft. Als der Schlag jedoch ausblieb, öffnete er das Auge wieder und sah die zweite Gestalt über sich stehen.
»Sind das deine Töchter?« Der Neuankömmling hielt das Foto in die Höhe. »Hübsch. Vielleicht können sie uns ja sagen, wo ihr Babba seine Sachen versteckt.«
Die Stimme klang wie Sandpapier auf Stein.
Der fette Mann erkannte sie sofort, und blanke Angst erschien in seinem Auge, als der Wüstenkrieger langsam seine Kufiya abwickelte, die Schutzbrille abnahm und in den einzelnen Sonnenstrahl trat. Seine Augen wirkten fast grau. Der fette Mann bemerkte ihre ungewöhnliche Farbe, und unwillkürlich wanderte sein Blick zu der gezackten Narbe am Hals des Mannes.
»Weißt du, wer ich bin?«, fragte der Wüstenkrieger.
Der Fette nickte.
»Sag es.«
»Du bist Ash’abah. Du bist … der Geist.«
»Dann weißt du auch, warum ich hier bin, ja?«
Wieder ein Nicken.
»Dann sag mir, wo es ist. Oder würdest du es vorziehen, wenn ich dir diesen Motor auf den Kopf fallen lassen und deine Töchter für ein neues Familienfoto herschleppen würde?«
Bei der Erwähnung seiner Familie keimte Trotz in dem Dicken auf. »Wenn du mich tötest, dann wirst du gar nichts finden«, sagte er. »Nicht das, was du suchst, und auch nicht meine Töchter. Ich würde lieber sterben, als sie in Gefahr zu bringen.«
Der Geist legte das Foto auf die Werkbank und holte das Navigationsgerät aus der Tasche, das er von der Windschutzscheibe des SUV abgenommen hatte. Er drückte einen Knopf und hielt es so, dass der fette Mann es sehen konnte. Der dritte von oben war mit dem arabischen Wort für ›Zuhause‹ markiert. Der Geist tippte leicht mit dem Fingernagel darauf, und auf dem Bildschirm erschien die Karte eines Wohnbezirks auf der anderen Seite der Stadt.
Der Widerstand des fetten Mannes war schlagartig gebrochen. Er atmete tief durch, versuchte, so beherrscht wie möglich zu klingen, und erzählte dem Geist, was er wissen wollte.
*
Der SUV rumpelte über das unebene Gelände entlang eines der vielen Kanäle, die die Landschaft östlich von Al-Hillah durchzogen. Die Landschaft war eine atemberaubende Mischung aus kahler Wüste und Flecken von dichtem, tropischem Grün. Sie war als Teil des Fruchtbaren Halbmonds bekannt, das antike Mesopotamien, das Zweistromland. Vor ihnen erstreckte sich ein langes Band aus üppigem Gras und Dattelpalmen zu beiden Ufern des Tigris; der Euphrat lag hinter ihnen. In dem Land zwischen diesen beiden uralten Grenzflüssen hatte die Menschheit die Schrift erfunden, die Mathematik und das Rad, und viele Menschen glaubten, hier habe auch der biblische Garten Eden gelegen; doch niemand hatte ihn je gefunden. Abraham – der Stammvater von gleich drei großen Religionen: Islam, Juden- und Christentum – war hier geboren worden. Und auch der Geist war diesem Land entsprungen, dem er nun treu diente.
Vorbei an einem Palmenhain fuhr der SUV in die kalkweiße Wüste hinaus, die von der erbarmungslosen Sonne zu Beton gebacken worden war. Der fette Mann stöhnte vor Schmerz, doch der Geist ignorierte ihn. Sein Blick war auf den in der Hitze flimmernden Trümmerhaufen fixiert, der allmählich Form annahm. Es war jedoch noch zu früh, um zu sagen, was das war und wie weit entfernt es lag. Was der Geist dort am Horizont sah, hätte durchaus der Bibel entspringen können: gebrochenes Land und ein Himmel wie Pergament.
Je näher sie kamen, desto mehr nahm die Fata Morgana Gestalt an. Das Ding war weit größer, als der Geist erwartet hatte: ein viereckiges Gebäude, zwei Stockwerke hoch, eine verlassene Karawanserei, wo die Kamelkarawanen sich hatten versorgen können, die einst durch dieses uralte Land gezogen waren. Die flachen und glatten Lehmziegel, die seit gut tausend Jahren von der gnadenlosen Sonne gebacken wurden, zerfielen allmählich zu Staub.
Staub bist du, sinnierte der Geist, während er seinen Blick über die Landschaft schweifen ließ, und zum Staub kehrst du zurück.
Als sie näher kamen, waren Einschusslöcher in den Außenmauern zu erkennen. Die Schäden waren neueren Datums, vermutlich von Aufständischen oder auch von amerikanischen beziehungsweise britischen Truppen. Der Geist knirschte vor Wut mit den Zähnen und fragte sich, ob es den Invasoren wohl gefallen würde, wenn Iraker Stonehenge oder Mount Rushmore durchsieben würden.
»Da drüben! Da müssen wir anhalten.« Der fette Mann deutete auf einen kleinen Felshaufen ein paar hundert Meter von der Hauptruine entfernt.
Der Fahrer lenkte den SUV darauf zu und brachte den Wagen schließlich mit knirschenden Bremsen zum Stehen. Der Geist suchte den Horizont ab und sah das Flimmern der Luft, die von der heißen Erde aufstieg, die sanften Bewegungen der Palmwedel und in der Ferne Staubwolken. Vermutlich fuhr dort eine Militärkolonne, doch sie war zu weit entfernt, als dass er sich deswegen den Kopf zerbrochen hätte. Er öffnete die Wagentür und drehte sich zu der Geisel um.
»Zeig’s mir«, flüsterte er.
Der fette Mann stolperte über die knochentrockene Erde, und der Geist und sein Fahrer folgten ihm in den Fußstapfen für den Fall, dass er sie auf eine Mine führen wollte. Drei Meter vor dem Felshaufen blieb der Mann stehen und deutete auf den Boden. Der Geist sah eine leichte Delle in der Erde. »Sprengfallen?«
Der fette Mann starrte ihn an, als hätte er seine Familie beleidigt. »Natürlich«, antwortete er und streckte die Hand nach den SUV-Schlüsseln aus. Er nahm sie, richtete sie auf den Boden, und ein leises elektronisches Klicken war zu hören. Dann kniete der fette Mann sich hin, wischte den Staub beiseite, und eine Falltür kam zum Vorschein. Der Riegel war mit einem Vorhängeschloss gesichert, das man zum Schutz vor Sand und Staub in eine Plastiktüte gewickelt hatte. Der fette Mann wählte einen kleineren Schlüssel vom Schlüsselbund, schloss auf und wuchtete die Falltür in die Höhe.
Sonnenlicht strömte in den Bunker hinein. Der fette Mann stieg auf eine Leiter, die in der Dunkelheit verschwand. Der Geist beobachtete ihn über den Lauf seiner Pistole hinweg. Schließlich schaute der fette Mann wieder nach oben und kniff sein gesundes Auge zum Schutz vor der gleißenden Sonne zu. »Ich werde eine Taschenlampe holen«, sagte er und griff in die Dunkelheit hinein.
Der Geist schwieg. Er krümmte lediglich den Finger um den Abzug für den Fall, dass seine Geisel plötzlich etwas anderes in der Hand hielt. Dann erschien ein Lichtstrahl in der Dunkelheit und erhellte das geschwollene Gesicht des Werkstattbesitzers.
Der Fahrer stieg als Nächster hinab, während der Geist seinen Blick noch einmal über den Horizont schweifen ließ. Die Staubwolke hatte sich weiter wegbewegt, nach Norden, in Richtung Bagdad. Sonst war nirgends eine Spur von Leben zu sehen. Zufrieden, dass sie allein waren, ließ er sich in die dunkle Erde hinab.
Die Höhle war schon in antiker Zeit aus dem Felsen gehauen worden, und sie erstreckte sich mehrere Meter in alle Richtungen. Metallregale, wie man sie auch bei der Army fand, standen an den Wänden. Ihr Inhalt war mit Plastikplanen vor dem Staub geschützt. Der Geist streckte die Hand aus und zog eine Plane beiseite. Das Regal war voller Gewehre, vorwiegend AK-47, die alle gebraucht aussahen. Und darunter standen chinesisch, russisch und arabisch beschriftete Munitionskisten, die mit Geschossen im Kaliber 7,62 mm gefüllt waren.
Der Geist arbeitete sich durch die Regale und zog eine Plane nach der anderen weg. Weitere Waffen kamen zum Vorschein, darunter Artilleriegranaten, und auch dicke Dollarbündel, Taschen voller getrockneter Blätter und weißem Pulver, und schließlich – ganz hinten in der Höhle auf einem eigenen Regal – fand der Geist, was er suchte.
Er zog den Sack näher zu sich heran und spürte den schweren Gegenstand darin. Dann packte er ihn vorsichtig und voller Ehrfurcht aus. Im Inneren befand sich eine flache Schiefertafel. Der Geist hielt sie ins Licht, sodass die Zeichen darauf zu erkennen waren. Mit dem Finger fuhr er über eines davon, einen auf dem Kopf stehenden Buchstaben, ein ›T‹.
Die Waffe noch immer auf die Geisel gerichtet riskierte der Fahrer einen Blick auf das heilige Objekt. »Was steht da?«
Der Geist zog den Sack wieder über den Stein. »Es ist in der verlorenen Sprache der Götter geschrieben«, sagte er, nahm das Bündel und hielt es in den Armen wie ein Neugeborenes. »Es ist nicht an uns, es zu lesen. Wir sollen es nur beschützen.« Er ging zu dem fetten Mann und funkelte ihn an. »Das gehört dem Land«, erklärte der Geist. »Es hätte niemals mit diesen Dingen auf einem Regal landen dürfen. Wo hast du das her?«
»Ich habe es bei einem Ziegenhirten gegen ein paar Gewehre und Munition getauscht.«
»Wie hieß der Mann, und wo kann ich ihn finden?«
»Es war ein Beduine. Ich kenne seinen Namen nicht. Ich war geschäftlich in Ramadi, und er hat den Stein zusammen mit ein paar anderen Sachen verkaufen wollen. Er hat gesagt, er hätte die Tafel in der Wüste gefunden. Vielleicht stimmt es, vielleicht hat er sie aber auch gestohlen. In jedem Fall habe ich ihm einen guten Preis dafür gezahlt.« Er blickte den Geist an. »Und jetzt wirst du sie mir wegnehmen.«
Der Geist wog diese neue Information ab. Ramadi lag eine halbe Tagesfahrt in Richtung Norden. Sowohl während der Invasion als auch während der Besatzung war die Stadt eines der Hauptwiderstandszentren gewesen. Sie war so oft bombardiert und beschossen worden, dass nur noch Trümmer von ihr übrig waren, und nun schien sie verflucht zu sein. Auch hatte dort einst einer von Saddams Palästen gestanden, der inzwischen jedoch restlos geplündert war. Der verstorbene Staatspräsident war ein eifriger Dieb und Sammler der Kunstschätze seines Landes gewesen. »Wie lange ist es her, dass du die Tafel gekauft hast?«
»Ungefähr zehn Tage, während des Monatsmarktes.«
Der Beduine konnte inzwischen sonst wo sein; immerhin standen ihm und seinen Schafen Hunderte von Quadratkilometern Wüste zur Verfügung. Der Geist hielt das Bündel in die Höhe, sodass der fette Mann es sehen konnte. »Wenn du noch mal so was findest, dann schnappst du es dir und gibst mir Bescheid. So wirst du mein Freund … Verstanden? Und du weißt, dass es durchaus nützlich sein kann, mich als Freund zu haben, und als Feind willst du mich sicher nicht.«
Der Mann nickte.
Kurz schaute der Geist ihm in die Augen; dann setzte er seine Schutzbrille wieder auf.
»Was ist mit dem Rest von dem Zeug hier?«, fragte der Fahrer.
»Lass es, wo es ist. Es ist nicht notwendig, dem Mann seinen Lebensunterhalt wegzunehmen.« Er drehte sich zur Leiter um und begann, wieder nach oben zu steigen.
»Warte!«
Der fette Mann schaute ihn verwirrt an. Der Gnadenakt kam völlig unerwartet.
»Der Beduine … Er trägt eine rote Fußballkappe. Zum Scherz habe ich angeboten, sie ihm abzukaufen, aber da war er beleidigt. Er sagte, das sei sein wertvollster Besitz.«
»Welche Mannschaft?«
»Manchester United … die Roten Teufel.«
2
Vatikanstadt, Rom
Kardinalstaatssekretär Clementi nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette, während er wie ein fetter Gott, der an seiner Schöpfung verzweifelte, zu den Touristen auf dem Petersplatz hinunterblickte. Mehrere Gruppen standen unmittelbar unter ihm. Ihre Blicke wanderten ständig zwischen den Reiseführern in ihren Händen und dem Fenster hin und her, an dem Clementi stand. Er war ziemlich sicher, dass sie ihn nicht sehen konnten, zumal seine schwarze Soutane ihm dabei half, mit den Schatten zu verschmelzen. Außerdem suchten sie gar nicht nach ihm. Clementi nahm erneut einen tiefen Zug von seiner Zigarette und schaute zu, wie die Touristen ihren Fehler erkannten und sich zu den Fenstern der päpstlichen Wohnung weiter links umdrehten. Das Rauchen war im Gebäude verboten, doch als Kardinalstaatssekretär hatte Clementi so seine Privilegien, und er betrachtete es auch nicht als sonderlich schlimmen Fall von Amtsmissbrauch, in seinem Privatbüro zu rauchen. Außerdem beschränkte er sich für gewöhnlich auf zwei Zigaretten am Tag, doch heute war das anders. Heute rauchte Clementi schon seine fünfte, und es war noch nicht mal Mittag.
Clementi nahm einen weiteren tiefen Zug, drückte die Zigarette in dem Marmoraschenbecher auf der Fensterbank aus und drehte sich dann wieder zu den schlechten Nachrichten auf seinem Schreibtisch um. Wie er es vorzog, waren die Morgenzeitungen wie die dazugehörigen Länder auf der Weltkarte angeordnet: links die amerikanischen Blätter, rechts die russischen und australischen und die europäischen in der Mitte. Für gewöhnlich unterschieden sich die Schlagzeilen je nach Region, doch wie schon seit über einer Woche waren sie auch heute alle identisch. Und alle zeigten sie das gleiche Bild: die düstere, dolchartige Bergfestung, die allgemein als ›Zitadelle‹ bekannt war, und die in der alten, türkischen Stadt Trahpah lag.
Trahpah war ein Kuriosum in der modernen Kirche, ein antikes Machtzentrum, das zusammen mit Lourdes und Santiago de Compostela zu einem der beliebtesten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche geworden war. Von Menschenhand aus einem steilen, fast senkrechten Berg gehauen stellte die Zitadelle von Trahpah das älteste, noch bewohnte Gebäude der Menschheit dar, und sie war eines der Ursprungszentren der katholischen Kirche. Hinter ihren geheimnisvollen Mauern war die erste Bibel geschrieben worden, und der Glaube war noch weithin verbreitet, dass nach wie vor einige der größten Geheimnisse der Urkirche dort verwahrt wurden. Dabei entsprang ein Großteil des Mysteriums der Tatsache, dass in der Zitadelle das Gesetz des Schweigens herrschte. Niemand außer den Mönchen und Priestern, die dort lebten, durfte den heiligen Berg betreten, und waren sie erst einmal drin, durften sie ihn auch nicht mehr verlassen. Die Instandhaltung der in den Berg gebauten Feste mit ihren Wehrgängen und schmalen Fenstern oblag ausschließlich ihren Bewohnern, und so hatte die Zitadelle im Laufe der Zeit ein halb verfallenes Aussehen angenommen, das der Stadt ihren Namen gegeben hatte, denn Trahpah, ein Wort aus dem Aramäischen, bedeutete ›Verfall‹. Aber trotz ihres Aussehens war die Zitadelle keine Ruine. Tatsächlich war sie in all den Jahrtausenden ihrer Existenz nie erobert worden. Sie hatte ihre uralten Schätze und Geheimnisse bewahrt.
Dann, vor ungefähr einer Woche, war ein Mönch auf den Gipfel des Berges geklettert. Fernsehkameras hatten jede seiner Bewegungen verfolgt, und oben angekommen hatte er mit seinen Gliedmaßen ein Tau geformt – das Symbol des Sakraments, des größten Geheimnisses der Zitadelle – und sich in die Tiefe gestürzt.
Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod des Mönchs war es zu einer weltweiten Welle antikirchlicher Proteste gekommen, die ihren Höhepunkt in einem direkten Angriff auf die Zitadelle gefunden hatten. Der Knall einer Explosion war durch die türkische Nacht gehallt, und ein Tunnel ins Fundament der Festung war zum Vorschein gekommen. Und zum ersten Mal in der Geschichte waren Menschen aus dem Berg herausgekommen: zehn Mönche und drei Zivilisten, allesamt unterschiedlich schwer verletzt. Seitdem beherrschte das Geschehen die Schlagzeilen.
Clementi nahm sich die Morgenausgabe von La Republica, einer der beliebtesten Zeitungen Italiens, und las die Schlagzeilen:
DIE ÜBERLEBENDENDER ZITADELLEHABENSIEDAS GEHEIMNISDES SAKRAMENTSENTDECKT?
Alle Zeitungen stellten die gleiche Frage. Sie nutzten die Explosion als Vorwand, um die alten Legenden über die Zitadelle und ihr berüchtigtstes Geheimnis wieder auszugraben. Und tatsächlich hatte sich das Machtzentrum der Kirche im 4. Jahrhundert nur deshalb nach Rom verlagert, weil sie sich von ihrer geheimen Vergangenheit hatte distanzieren wollen. Seitdem hatte Trahpah sich nur noch um sich selbst gekümmert und sein Geheimnis bewahrt … bis jetzt.
Clementi griff nach einer weiteren Zeitung, einem britischen Boulevardblatt, auf dessen Titelblatt ein leuchtender Kelch über der Zitadelle zu sehen war, und die Schlagzeile dazu lautete:
KIRCHEAUFDEM WEGNACHUNTENWIRDDER ›HEILIGE GRAL‹ DER GEHEIMNISSEENTHÜLLT?
Andere Zeitungen beschäftigten sich mehr mit der gruseligen und morbiden Seite der Geschichte. Von den dreizehn Leuten, die aus dem Berg gekommen waren, hatten nur fünf überlebt; der Rest war seinen Verletzungen erlegen. Es gab jede Menge Bilder, stark überbelichtete Fotos, die über die Köpfe der Sanitäter hinweg geschossen worden waren, die die Mönche in die wartenden Krankenwagen verfrachtet hatten. Die Blitzlichter betonten das Grün der Soutanen und das Rot des Blutes, das aus den rituellen Wunden auf ihren Körpern strömte.
Die ganze Sache war eine einzige große PR-Katastrophe. Die Kirche stand da wie ein verkommener, heimlichtuerischer, mittelalterlicher Kult. Das war an sich schon schlimm, doch im Augenblick hatte Clementi auch so bereits genug um die Ohren; da sollte der Berg seine Geheimnisse besser hüten denn je.
Clementi setzte sich an seinen Schreibtisch. Deutlich spürte er die Last der Verantwortung, die er alleine trug. Als Kardinalstaatssekretär war er der Premierminister des Vatikanstaates und verfügte über weitreichende exekutive Macht in der Kirche, auch international. Normalerweise hätte sich der Rat der Zitadelle um die Situation in Trahpah gekümmert. Wie der Vatikan so war auch die Zitadelle ein autonomer Staat innerhalb eines anderen, ein Staat mit Macht und Einfluss, doch seit der Explosion hatte Clementi nichts mehr vom Berg gehört – gar nichts –, und es war dieses Schweigen und nicht das Geschrei der Weltpresse, das ihn wirklich beunruhigte. Denn dieses Schweigen hieß, dass die gegenwärtige Krise in Trahpah auch ihn betraf.
Clementi griff über die Zeitungen hinweg nach seiner Computertastatur. Sein Posteingang quoll bereits über vom üblichen Tagesgeschäft, doch Clementi ignorierte das. Stattdessen öffnete er einen Ordner mit dem Namen TRAHPAH. Ein Passwortfenster erschien, und Clementi gab es sorgfältig ein. Er wusste, sollte er sich vertippen, würde der Rechner den Ordner sofort sperren, und dann dauerte es mindestens einen Tag, bis ein Techniker ihn wieder freigeschaltet hatte. Ein Stundenglasicon erschien, während die komplexe Verschlüsselungssoftware das Passwort verarbeitete; dann öffnete sich ein weiterer Posteingang. Er war leer – noch immer kein Wort aus der Zitadelle. Ohne Betreff schrieb Clementi:
Gibt’s was Neues?
Er klickte auf Senden und schaute zu, wie die Nachricht vom Bildschirm verschwand. Dann legte er die Zeitungen zu einem ordentlichen Stapel zusammen und ging ein paar Briefe durch, die er abzeichnen musste, während er auf die Antwortmail wartete.
Im selben Augenblick, da die Zitadelle von der Explosion erschüttert worden war, hatte Clementi die Agenten der Kirche mobilisiert und sie angewiesen, die Situation im Auge zu behalten. Er hatte die Aktiva der Zitadelle benutzt, um Distanz zu Rom zu wahren, in der Hoffnung, der Rat der Zitadelle würde sich rasch wieder erholen und mit den Aufräumarbeiten beginnen. In seinem ordentlichen Politikergeist verglich er das mit der Stationierung von Waffen, um einer Bedrohung zu begegnen. Allerdings hatte er sich nie auch nur vorstellen können, dass man irgendwann von ihm verlangen würde, sich selbst dieser Waffen zu bedienen.
Draußen hörte Clementi das Geplapper der Touristen unten auf dem Platz, die die majestätische Peterskirche bestaunten und nur wenig von dem Aufruhr wussten, der hinter ihren Mauern herrschte. Ein Geräusch wie eine Klinge auf Glas verkündete das Eintreffen einer Mail.
Noch immer nichts.Gerüchten zufolge wird auch ein neunter Mönch sterben.Was soll ich mit den anderen tun?
Clementis Hand schwebte über der Tastatur. Er zögerte. Vielleicht würde die Situation sich ja von selbst lösen. Wenn noch ein Mönch starb, dann blieben lediglich vier Überlebende übrig … Doch drei davon waren Zivilisten, die nicht durch ein Schweige- und Gehorsamsgelübde an die Mutter Kirche gebunden waren. Sie stellten die größte Bedrohung dar.
Clementis Blick wanderte zu dem Zeitungsstapel in der Ecke des Schreibtisches. Die Fotos auf den Titelblättern starrten ihn förmlich an – zwei Frauen und ein Mann. Normalerweise hätte die Zitadelle sich rasch und effektiv um sie gekümmert zum Schutz des seit Urzeiten in der Zitadelle bewahrten Geheimnisses. Clementi war jedoch ein römischer Kirchenmann, mehr Politiker als Priester; direktes Handeln war ihm fremd. Im Gegensatz zum Prälaten von Trahpah war er es nicht gewohnt, Todesurteile zu unterzeichnen.
Clementi stand auf und schlenderte wieder zum Fenster, als könne er sich so von der Entscheidung distanzieren.
Im Laufe der letzten Woche waren Lebenszeichen in der Zitadelle zu sehen gewesen: Kerzen waren hinter einigen der hohen Fenster vorbeigetragen worden, und Rauch war aus den Kaminen aufgestiegen. Früher oder später würden sie ihr Schweigen brechen und sich der Welt stellen müssen. Sie hatten sich den Schlamassel selber eingebrockt, und nun mussten sie auch wieder aufräumen. Bis dahin musste Clementi Geduld bewahren, eine möglichst weiße Weste behalten und sich auf die Zukunft der Kirche sowie die wahren Gefahren konzentrieren, die ihr drohten – Gefahren, die nichts mit Trahpah oder den Geheimnissen der Vergangenheit zu tun hatten.
Clementi griff gerade nach der Zigarettenpackung auf der Fensterbank, um seinen Entschluss mit der sechsten Zigarette des Tages zu besiegeln, als plötzlich draußen Schritte auf dem Marmor zu hören waren. Irgendjemand war auf dem Weg zu ihm, und dieser jemand lief viel zu schnell, als dass es sich um einen Routinebesuch handeln könnte. Kurz darauf klopfte es an der Tür, und das verkniffene Gesicht von Bischof Schneider erschien.
»Was ist?« Clementi klang verärgerter, als er beabsichtigt hatte. Schneider war sein Privatsekretär, ein Karrierebischof, der sich irgendwie nie die Finger verbrannte, obwohl er mitten im glühend heißen Herz der Macht arbeitete. Seine Effizienz war tadellos, und dennoch wurde Clementi nicht warm mit ihm. Heute jedoch war nichts von Schneiders aalglatter Fassade zu sehen.
»Sie sind hier«, verkündete er.
»Wer ist hier?«
Doch eine Antwort war nicht nötig. Schneiders Gesicht verriet Clementi alles, was er wissen musste.
Clementi schnappte sich seine Zigaretten und steckte sie in die Tasche. Er wusste, dass er das Päckchen in den nächsten Stunden vermutlich rauchen würde.
3
Trahpah, im Süden der Türkei
Der Regen fiel wie ein Schleier aus dem grauen Himmel und ließ die Luft in der abklingenden Hitze des späten Tages wabern. Er fiel aus Wolken hoch über dem Taurusgebirge, die langsam Richtung Osten trieben, über die Gletscher hinweg und zu der uralten Stadt Trahpah an den zerklüfteten Ausläufern der hohen Berge. Der spitze Gipfel der Zitadelle ragte aus der Mitte der Stadt heraus, und Regen lief die steilen Hänge hinab und in den trockenen Graben zu ihren Füßen.
In der Altstadt kämpften sich Touristen die schmalen Gassen zur Zitadelle hinauf. Sie rutschten auf dem nassen Pflaster aus und schützten sich mit Ponchos, die sie in den Souvenirläden gekauft hatten und die vage an die Soutanen der Mönche erinnerten. Einige machten nur Sightseeing. Sie hakten die Zitadelle einfach auf ihrer Liste von Sehenswürdigkeiten ab. Doch andere hatten diese Reise aus traditionelleren Gründen unternommen. Sie waren Pilger, die hofften, hier ihren Seelenfrieden zu finden, und aufgrund der Ereignisse hatte deren Zahl in letzter Zeit noch zugenommen. Dazu kam, dass es in den vergangenen Tagen weltweit zu gleich mehreren ungewöhnlichen Naturkatastrophen gekommen war: Erdbeben in Ländern, die allgemein als stabil galten; Flutwellen in Ländern, die über keinen Schutz davor verfügten, und Wetterphänomene, die nicht zur Jahreszeit passen wollten, wie auch dieser dichte, kalte Regen im türkischen Spätfrühling.
Die Menschen stiegen weiter den rutschigen Weg hinauf; doch oben erwartete sie nicht der ehrfurchtgebietende Anblick der Zitadelle, sondern nur andere enttäuschte Touristen, die in den Nebel und zu der Stelle starrten, wo der Berg sein musste. Langsam arbeiteten sie sich durch den Schleier vor, vorbei an dem Ort, wo verwelkte Blumen die Absturzstelle des Mönches markierten, und bis zu dem breiten Wall des Grabens. Hier war ihre Reise dann vorbei.
Jenseits des Walles wiegte sich sanft Gras im Wind, wo einst Wasser geflossen war, und dahinter – kaum sichtbar in der nebeligen Nacht – lag der Fuß des Berges. Sein gewaltiger Schatten wirkte auf den Betrachter wie die Silhouette eines riesigen Schiffes, das durch den Nebel unaufhaltsam auf ein Ruderboot zuhielt. An diesem Punkt machten die meisten Touristen rasch kehrt und suchten Zuflucht in einem der zahlreichen Souvenirläden oder Cafés entlang des Grabens. Doch ein paar Geduldige blieben. Sie stiegen auf den niedrigen Wall und beteten: Sie beteten für die Kirche, für den finsteren Berg und für die stummen Männer, die dort schon immer gelebt hatten.
*
Im Inneren der Zitadelle herrschte vollkommene Stille.
Niemand bewegte sich durch die Tunnel. Niemand arbeitete. Die Küche war genauso leer wie der Krater im Herz des Berges. Zusammengeräumte Trümmer und Stützbalken verrieten, wo die Tunnel repariert worden waren, doch diejenigen, die das getan hatten, waren inzwischen weitergezogen. Die Schleuse, die in die große Bibliothek führte, blieb geschlossen, denn nach der Explosion war die Stromversorgung zusammengebrochen und damit auch die Klimaanlage sowie die Sicherheitssysteme im Gewölbe. Gerüchten zufolge wurde die Bibliothek bald wieder geöffnet, doch niemand wusste wann.
Andernorts fanden sich Hinweise darauf, dass der Berg wieder zur Normalität zurückkehrte. In den meisten Arealen war die Stromversorgung wiederhergestellt, und in den Dormitorien waren Gebets- und Studienpläne aufgehangen worden. Am wichtigsten war jedoch, dass man eine Totenmesse organisiert hatte, um den Prälaten sowie den Abt zur Ruhe zu betten, deren Tod den Berg in ein führerloses Chaos gestürzt hatte, wie es noch nie da gewesen war. Jeder Mann im Berg war nun auf dem Weg dorthin, um den Toten die letzte Ehre zu erweisen.
Oder besser … fast jeder Mann.
*
Hoch oben im Berg, in dem Teil, den nur die Sancti betreten durften, die grün gewandeten Hüter des Sakraments, näherte sich eine Gruppe von vier Mönchen dem obersten Absatz der verbotenen Treppe.
Auch sie schwiegen, während sie die dunklen Stufen hinaufstiegen, jeder unter der Last der schweren Bürde, die sie trugen. Das uralte Gesetz, an das sie gebunden waren, war klar und eindeutig: Jeder, der sich ohne Erlaubnis hierher vorwagte, wurde exekutiert, um als abschreckendes Beispiel für all jene zu dienen, die das große Geheimnis des Berges ausspionieren wollten. Oder zumindest war das für gewöhnlich so. Nur waren das keine normalen Zeiten und die vier Männer auch keine gewöhnlichen Mönche.
Ihnen voran ging Bruder Axel. Sein rotbraunes Haar und der ebenso rote Bart passten perfekt zu der roten Soutane, die ihn als Wache auswies. Direkt hinter ihm folgte die schwarz gewandete Gestalt von Vater Malachi, dem Obersten Bibliothekar. Die dicke Brille und der krumme Rücken waren ein Erbe all der Jahrzehnte, die er über Bücher gebeugt verbracht hatte. Als Nächstes kam Vater Thomas, der so viele technologische Neuerungen in der Bibliothek installiert hatte. Er trug den schwarzen Rock eines Priesters. Und schließlich war da noch Athanasius in der schlichten braunen Soutane der Administrata. Mit seinem kahlen Schädel und dem rasierten Gesicht hob er sich deutlich von den anderen Mönchen ab, die allesamt Bärte trugen. Jeder der vier war das Oberhaupt einer bestimmten Gilde … mit Ausnahme von Athanasius, der die Stelle des verstorbenen Abts einnahm. Gemeinsam hatten sie den Berg geführt, seit die Explosion sie der herrschenden Elite beraubt hatte, und gemeinsam hatten sie auch die Entscheidung getroffen, das große Geheimnis zu suchen, dessen Wächter sie nun waren.
Sie erreichten das Ende der Treppe und versammelten sich in der Dunkelheit einer kleinen Höhle. Im Licht der Fackeln sahen sie grob behauene Wände und mehrere schmale Tunnel, die in verschiedene Richtungen führten.
»Wo entlang?« In der engen Kammer wirkte Bruder Axels Stimme irgendwie zu voll. Er war fast den ganzen Weg vorangeeilt und die Stufen hinaufgestapft, als wäre er dafür geboren, doch nun schien er genauso zu zögern wie die anderen auch.
Herauszufinden, was sich in der Kapelle des Sakraments verbarg, war normalerweise der Höhepunkt im Leben eines Mönches, etwas, das nur passierte, wenn man in die elitären Reihen der Sancti erhoben wurde. Doch die vier hatte niemand hierher eingeladen, und instinktiv empfanden sie eine Mischung aus Angst und Faszination.
Axel trat einen Schritt vor und hielt die Fackel in die Höhe. In die Felswand waren Nischen gehauen, und Wachs verriet, wo einst Kerzen gebrannt hatten. Er ließ das Licht seiner Fackel über sämtliche Tunnel wandern und deutete dann auf den mittleren. »Da ist mehr Wachs. Also ist er auch häufiger benutzt worden als die anderen. Dort muss die Kapelle liegen.«
Ohne auf die Bestätigung der anderen zu warten, duckte er sich in den niedrigen Tunnel. Die anderen folgten ihm. Athanasius bildete widerwillig die Nachhut. Er wusste, dass Axel recht hatte. Erst ein paar Tage zuvor hatte er diesen verbotenen Boden bereits allein betreten und die Schrecken gesehen, die sich in der Kapelle verbargen. Nun atmete er tief durch und bereitete sich darauf vor, sich ihnen erneut zu stellen.
Im Licht der Fackeln waren krude Darstellungen von gequälten Frauen an den Wänden zu sehen, und je weiter sie gingen, desto ausgeblichener wurden die Bilder, bis sie schließlich vollständig verschwanden und der schmale Tunnel einer größeren Vorkammer wich.
Instinktiv drängten die Männer sich aneinander, während sie mit ihren Fackeln die Dunkelheit erkundeten. An einer Seite befand sich eine kleine Feuerstelle, ähnlich der eines Schmiedes. Sie war schwarz von Ruß und Asche, doch kein Feuer brannte darin. Davor standen drei runde Schleifsteine auf stabilen Holzgestellen, die von Pedalen angetrieben wurden, und an der Rückwand lag ein großer, kreisrunder Stein mit einem eingemeißelten Symbol, dem Tau. Er war beiseitegerollt worden, und dahinter war ein Durchgang zu sehen.
»Die Kapelle des Sakraments«, sagte Axel und starrte in die Dunkelheit jenseits der Tür. Einen Augenblick lang standen sie alle nur nervös da, als hätten sie Angst, gleich würde sich aus der Finsternis eine Bestie auf sie stürzen. Zum Schluss war es erneut Axel, der den Bann brach. Er trat vor und hielt die Fackel wie einen Talisman vor sich. Das Licht trieb die Dunkelheit zurück. Zuerst waren jenseits der Tür noch mehr erloschene Kerzen zu sehen; dann öffnete sich der Raum nach links, und schließlich sahen die vier, wofür die Schleifsteine draußen gut waren.
Äxte, Hackbeile, Schwerter, Dolche … Die Wände waren von oben bis unten bedeckt damit. Die Klingen reflektierten das Fackellicht. Sie funkelten wie Sterne und trugen das Licht tiefer in die Kapelle hinein, wo ein Gebilde aus der Dunkelheit ragte. Es war so groß wie ein Mann und jedem der vier Mönche so vertraut wie sein eigenes Gesicht. Es war das Tau, das Symbol des Sakraments, oder besser … Das hier war kein Symbol mehr, das war das Sakrament selbst.
Zuerst schien es nur eine schwarze Masse zu sein, doch als Axel näher trat, spiegelte sich das Licht auf der matten Oberfläche, und man konnte erkennen, dass das Ding aus Metallplatten bestand, die von Stahlbändern zusammengehalten wurden. Der Fuß war mit Klammern im Boden verankert. Tiefe Rinnen waren dort in den Felsen geschlagen und führten von dem Tau weg und in die finsteren Ecken des Raums. Eine verwelkte Pflanze wand sich um den unteren Teil des Kreuzes und klammerte sich daran fest.
Die vier Männer traten näher. Das seltsame Ding zog sie magisch an, und schließlich sahen sie, dass die gesamte Vorderseite des Tau, das mit Ketten an der Decke fixiert war, offen stand.
Das Tau war innen hohl und mit Hunderten von langen Nadeln gespickt.
»Ist das das Sakrament?«, sprach Vater Malachi aus, was sie sich alle fragten.
Sie waren mit den Legenden darüber groß geworden, was das Sakrament sein könnte: der Baum des Lebens aus dem Garten Eden; der Kelch, aus dem Christus getrunken hatte, bevor er am Kreuz gestorben war, oder vielleicht sogar das Kreuz selbst. Doch nun, da sie hier standen und sich der Realität dieses makabren Gegenstands in einem Raum voller Klingen gegenübersahen, da tat sich eine immer größer werdende Kluft zwischen ihrem bedingungslosen Glauben und dem Ding dort auf. Und genau darauf hatte Axel gehofft. Das war genau, was er brauchte, um die Zitadelle weg von ihrer finsteren Vergangenheit und hin zu einer strahlenden Zukunft zu führen.
»Das kann es nicht sein«, sagte er. »Da muss es noch etwas anderes geben … in einem der anderen Tunnel vielleicht.«
»Aber das ist die Hauptkammer«, erwiderte Athanasius, »und hier ist das Tau.« Er drehte sich zu dem Ding um, vermied es aber hineinzuschauen, denn dort hingen immer noch die finsteren Erinnerungen an seinen letzten Besuch an den Dornen.
»Es sieht so aus, als wäre da etwas drin gewesen«, bemerkte Malachi. Er trat näher und schaute sich das Tau durch seine dicke Brille an. »Aber ohne die Sancti, die es uns erklären könnten, werden wir wohl nie erfahren, was das alles zu bedeuten hat.«
»Ja, es ist wahrlich eine Schande, dass sie nicht mehr im Berg sind«, erwiderte Axel und drehte sich demonstrativ zu Athanasius um. »Ich bin sicher, wir beten alle für ihre rasche Rückkehr.«
Athanasius ignorierte die Stichelei. Die Sancti waren auf seinen Befehl hin evakuiert worden, eine Entscheidung, die er guten Gewissens getroffen hatte und die er nicht bereute. »Wir haben bislang alles gemeinsam gemeistert«, erklärte er, »und das werden wir auch weiterhin tun. Was auch immer hier gewesen sein mag, jetzt ist es weg – das haben wir alle mit eigenen Augen gesehen –, und nun müssen wir einfach weitermachen.«
Eine Weile standen die vier einfach nur da und starrten das leere Kreuz an, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Schließlich war es Malachi, der das Schweigen brach. »In den ältesten Chroniken steht geschrieben, sollte das Sakrament je aus der Zitadelle entfernt werden, dann wird die Kirche fallen.« Er drehte sich zu den anderen um, und die dicken Brillengläser vergrößerten die Sorge in seinen Augen noch. »Ich fürchte, was wir hier entdeckt haben, kann nur Böses bedeuten.«
Vater Thomas schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Unsere alte Vorstellung von der Zitadelle mag ja ›gefallen‹ sein, wenn man es denn so ausdrücken will; aber das heißt noch lange nicht, dass nun auch das physische Ende von allem gekommen ist.«
»Genau«, erklärte Athanasius. »Die Zitadelle ist ursprünglich gebaut worden, um das Sakrament zu bewachen und zu schützen, doch seitdem ist sie noch so viel mehr geworden. Und nur weil das Sakrament nicht mehr hier ist, heißt das noch lange nicht, dass die Zitadelle keinen Sinn mehr hat. Wenn man eine Eichel vom Fuß einer großen Eiche wegnimmt, dann gedeiht der Baum doch auch noch weiterhin. Vergesst nicht, dass wir zuallererst Gott dienen und nicht dem Berg.«
Axel trat einen Schritt zurück und richtete den Finger zuerst auf Thomas und dann auf Athanasius. »Das ist Blasphemie.«
»Unsere Gegenwart hier ist Blasphemie.« Athanasius deutete auf das leere Tau. »Aber das Sakrament ist fort wie auch die Sancti. Das Alte bindet uns nicht länger. Das ist unsere Gelegenheit. Wir können uns neue Regeln geben.«
»Aber zuerst müssen wir einen neuen Führer wählen.«
Athanasius nickte. »Wenigstens darin stimmen wir überein.«
In diesem Augenblick ertönte ein Geräusch aus den tiefsten Tiefen des Berges und hallte in der Kapelle wider, das Geräusch der beginnenden Totenmesse.
»Wir sollten jetzt lieber gehen und uns zu unseren Brüdern gesellen«, sagte Thomas. »Und ich schlage vor, über das, was wir hier gesehen haben, zu schweigen … zumindest bis wir eine neue Führung haben. Alles andere würde nur Panik erzeugen.« Er drehte sich zu Malachi um. »Du bist nicht der Einzige, der die Chroniken kennt.«
Malachi nickte, doch seine Augen waren voller Angst. Er drehte sich um und warf einen letzten Blick auf das leere Tau, während die anderen bereits den Raum verließen. »Wenn das Sakrament aus dem Berg entfernt wird«, murmelte er leise vor sich hin, sodass die anderen ihn nicht hören konnten, »dann wird die Kirche fallen, nicht der Berg.« Und rasch verließ auch er die Kapelle. Er wollte nicht allein hier bleiben.
4
Zimmer 406, Davlat-Hastenesi-Krankenhaus
Liv Adamsen wachte so unvermittelt auf, dass sie wie ein atemloser Schwimmer nach Luft schnappte. Ihr blondes Haar klebte auf der blassen, nassen Haut, und der wilde Blick ihrer grünen Augen huschte durch den Raum und suchte nach etwas, woran sie sich festhalten konnte, etwas, das ihr half, von dem Albtraum loszukommen. Plötzlich hörte sie ein Flüstern, als wäre jemand nah bei ihr, und auf der Suche nach der Quelle ließ sie ihren Blick durch den Raum huschen.
Es war niemand da.
Das Zimmer war klein. Liv lag auf einem Bett mit Stahlrahmen; in der Ecke stand ein Fernseher auf einem Arm an der Wand, und es gab nur ein Fenster, an dessen weißem Rahmen bereits die Farbe abbröckelte. Die Jalousie war heruntergelassen, doch dahinter strahlte das helle Licht des Tages und warf scharf umrissene Schatten durch die Öffnungen in der Jalousie. Liv atmete tief durch, um sich wieder zu beruhigen. Sie roch Desinfektionsmittel. Es stank nach Krankenhaus.
Und dann erinnerte sie sich.
Sie war in einem Krankenhaus … auch wenn sie nicht wusste, warum oder wie sie hierhergekommen war.
Liv holte noch mehrmals tief Luft. Dennoch dröhnte weiterhin das Herz in ihrer Brust, und das Flüstern in ihren Ohren war nun so laut, dass sie sich unwillkürlich noch einmal im Raum umschaute.
Reiß dich zusammen, ermahnte sie sich selbst. Das ist nur das Blut, das durch deine Ohren rauscht. Da ist niemand.
Wann immer sie einschlief, wartete der Albtraum auf sie: ein Traum von Flüstern in der Dunkelheit, wo Schmerz wie rote Blumen blühte, und über allem ragte ein Gebilde auf, geheimnisvoll und furchterregend … ein Kreuz in Form eines ›T‹. Und da war noch etwas in der Dunkelheit bei ihr, etwas Riesiges und Schreckliches. Liv konnte hören, wie es sich bewegte, doch im selben Augenblick, da dieses Ding aus der Finsternis treten wollte, wachte sie jedes Mal schweißgebadet auf.
Liv lag eine Weile einfach nur da, kämpfte gegen die Panik an und versuchte, sich zu erinnern.
Mein Name ist Liv Adamsen.
Ich arbeite für den New Jersey Inquirer.
Ich habe versucht herauszufinden, was mit Samuel passiert ist.
Plötzlich sah sie das Bild eines Mönches vor ihrem geistigen Auge, der hoch oben auf einem finsteren Berg stand, den Körper zu einem Kreuz geformt. Dann kippte er vornüber und fiel.
Ich bin hierhergekommen, um herauszufinden, warum mein Bruder gestorben ist.
Der Schreck dieser Erinnerung war so groß, dass Liv sich auch wieder daran erinnerte, wo sie sich befand. Sie war in der Türkei, in der antiken Stadt Trahpah. Und das Zeichen, das Samuel geformt hatte – das Tau –, war das Symbol des Sakraments, das gleiche Symbol, das sie auch in ihren Träumen heimsuchte. Nur dass es kein Traum war; es war real. Immer mehr wurde ihr bewusst, dass sie dieses Symbol schon einmal gesehen hatte, irgendwo in der Dunkelheit der Zitadelle … Sie hatte das Sakrament gesehen. Liv konzentrierte sich auf die Erinnerung, zwang sie, Gestalt anzunehmen, doch sie blieb undeutlich wie etwas, das man aus dem Augenwinkel heraus sieht, oder ein Wort, das einem auf der Zunge liegt. Alles, woran sie sich erinnern konnte, war ein Gefühl von unerträglichem Schmerz und von … Eingesperrtsein.
Liv schaute zu der schweren Tür, bemerkte das Schlüsselloch und erinnerte sich an den Korridor dahinter. Sie hatte jedes Mal einen kurzen Blick hinauswerfen können, wann immer die Ärzte und Schwestern in den letzten Tagen gekommen waren.
Wie viele Tage waren das nun schon? Vier? Fünf?
Liv hatte auch zwei Stühle draußen im Flur an der Wand gesehen, auf denen Männer saßen. Einer davon war ein Cop in dunkelblauer Uniform. Liv kannte das Abzeichen nicht. Der andere hatte ebenfalls eine Uniform getragen: schwarze Schuhe, schwarzer Anzug und ein schwarzes Hemd mit einem schmalen weißen Kragen. Die Vorstellung, dass dieser Mann nur wenige Meter von ihr entfernt saß, weckte wieder die Furcht in Liv. Sie wusste genug über die blutige Geschichte Trahpahs, um die Gefahr zu erkennen, in der sie schwebte. Falls sie wirklich das Sakrament gesehen hatte und falls sie das vermuteten, dann würden sie auch versuchen, sie zum Schweigen zu bringen … so wie sie es auch mit ihrem Bruder getan hatten. Auf diese Art hatten sie schon immer ihr Geheimnis bewahrt. Das war zwar ein Klischee, aber es entsprach der Wahrheit: Tote reden nicht.
Und der Priester, der vor Livs Tür Wache hielt, war nicht hier, um mit ihr für ihr Seelenheil und eine rasche Genesung zu beten.
Er war hier, um dafür zu sorgen, dass sie nicht verschwand.
Er war hier, um für ihr Schweigen zu sorgen.
Zimmer 410
Vier Türen weiter lag Kathryn Mann in den gestärkten Laken ihres eigenen Gefängnisses. Ihr dickes schwarzes Haar lag in Locken auf dem Kissen. Kathryn zitterte, obwohl es in dem Krankenhauszimmer geradezu heiß war. Die Ärzte hatten erklärt, sie stünde noch immer unter Schock, eine anhaltende Reaktion auf die Wucht der Explosion, die sie in dem Tunnel unter der Zitadelle überlebt hatte. Auch hörte sie auf dem rechten Ohr nichts mehr, und das linke war schwer verletzt. Die Ärzte hatten gesagt, dass sich ihr Gehör wieder erholen würde, doch wann immer Kathryn sie gefragt hatte, ob das ›vollständig‹ hieß, waren sie ihr ausgewichen.
Kathryn konnte sich nicht daran erinnern, wann sie sich zum letzten Mal so elend und hilflos gefühlt hatte. Als der Mönch auf dem Gipfel der Zitadelle erschienen war und mit seinem Körper das Zeichen des Tau geformt hatte, da hatte sie geglaubt, die uralte Prophezeiung würde wahr:
Und das Kreuz wird fallenDas Kreuz wird sich erhebenDas Sakrament zu befreienAm Beginn der neuen Zeit
Und so war es auch geschehen. Liv hatte die Zitadelle betreten, und die Sancti waren herausgekommen, und nun starben sie, einer nach dem anderen, der uralte Feind, die Hüter des Sakraments. Selbst mit ihrem verletzten Gehör hatte Kathryn mitbekommen, wie immer wieder Notfallteams durch den Flur geeilt waren, wenn ein lautes Heulen einen Herzstillstand verkündet hatte. Und nach jedem Alarm hatte sie die Krankenschwester gefragt, wer da gestorben war, aus Angst, es könnte das Mädchen gewesen sein. Doch jedes Mal hatte es sich nur um einen Mönch gehandelt, der sich vor seinem Schöpfer für seine Taten würde rechtfertigen müssen, und deren Tod war ein Segen. Man hatte Kathryn von Liv getrennt; daher wusste sie nicht genau, was in der Zitadelle geschehen war. Sie wusste noch nicht einmal, ob Liv das Sakrament gefunden hatte; allerdings ließ das Sterben der Sancti sie darauf hoffen.
Doch wenn dies ein Sieg war, dann mit üblem Beigeschmack.
Wann immer Kathryn die Augen schloss, sah sie die blutige, zerschmetterte Leiche von Oscar de la Cruz, ihrem Vater, in einem Lagerhaus am Flughafen. Er hatte den größten Teil seines langen Lebens damit verbracht, sich vor der Zitadelle zu verstecken, nachdem er aus ihr entkommen war und in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte. Doch zu guter Letzt hatten sie ihn erwischt. Er hatte Kathryn das Leben gerettet, indem er sich auf eine Handgranate geworfen hatte, mit der ein Agent der Zitadelle sie und Gabriel hatte töten wollen.
Es war Oscar gewesen, der Kathryn zum ersten Mal von der Zitadelle erzählt hatte, von ihrer finsteren Geschichte und den Geheimnissen, die sie enthielt. Und er hatte sie schon als Kind auch die prophetischen Zeichen gelehrt, die in den Stein gemeißelt waren, und ihr deren Bedeutung eingeschärft. Er war ein liebender Vater gewesen, der einem blauäugigen, kleinen Mädchen düstere Geschichten erzählt hatte, und sie hatte das später mit Gabriel genauso gemacht, von Mutter zu Sohn.
Und wenn diese Prophezeiung sich erfüllt, hatte Oscar ihr immer gesagt, wenn das alte Unrecht wiedergutgemacht ist, dann werde ich dir den nächsten Schritt zeigen.
Kathryn hatte sich oft gefragt, welches geheime Wissen sich wohl hinter diesen Worten verbarg … Und nun würde sie das nie erfahren.
Die Sancti waren gestürzt worden, doch als Folge davon war auch Kathryns Familie vernichtet worden: Erst war ihr Mann getötet worden, dann ihr Vater … Wer war als Nächstes dran? Gabriel saß im Gefängnis und war der Gnade von Organisationen ausgeliefert, denen Kathryn nicht vertraute. Und auch sie hatte den Priester gesehen, der vor ihrer Tür wachte, wieder ein Agent der Kirche, die ihr schon so viel genommen hatte.
Ich werde dir den nächsten Schritt zeigen, hatte ihr Vater gesagt. Doch nun war er tot, ermordet, bevor er sein Lebenswerk hatte vollenden können, und Kathryn sah keinen ›Schritt‹, der sie vor der Gefahr hätte retten können, in der sie schwebte … oder Gabriel oder Liv.
5
Vatikanstadt, Rom
Clementi stürmte so schnell aus seinem Büro, wie seine füllige Gestalt es ihm erlaubte.
»Wann sind sie angekommen?«, verlangte er zu wissen. Sein schwarzer Rock flatterte hinter ihm.
»Vor ungefähr fünf Minuten«, antwortete Schneider und mühte sich, mit seinem Herrn Schritt zu halten.
»Und wo sind sie jetzt?«
»Sie sind in den Konferenzsaal im Gewölbe gebracht worden. Als ich von ihrer Ankunft erfahren habe, bin ich sofort zu Ihnen geeilt, Eminenz.«
Clementi lief an den beiden Schweizer Gardisten vorbei und hoffte, dass Seine Heiligkeit nicht ausgerechnet jetzt herauskommen und fragen würde, warum er es so eilig hatte. Als Kardinalstaatssekretär musste Clementi eng mit dem Papst zusammenarbeiten, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Er musste politische Fragen mit ihm diskutieren und ihm wichtige Dokumente zur Unterschrift vorlegen. Die Akte in seiner Hand enthielt jedoch weder die Unterschrift noch das Siegel des Papstes. Tatsächlich wusste Seine Heiligkeit noch nicht einmal, was sich in der Aktenmappe befand, und Clementi hatte hart dafür gearbeitet, dass das auch so blieb.
Er erreichte das Ende des Flurs, stürmte rasch durch die Tür und zu der schlichten Nottreppe dahinter. »Wissen wir, wer von der ›Gruppe‹ gekommen ist?«
»Nein«, antwortete Schneider. »Der Gardist war sich nicht sicher, und ich wollte ihn nicht bedrängen. Ich hielt es für besser, in Bezug auf die Einzelheiten vage zu bleiben.«
Clementi nickte. Er stieg in die nur schwach beleuchteten Kellergewölbe hinab und grübelte darüber nach, was ihn wohl bei dieser ungeplanten Zusammenkunft erwartete.
Die ›Gruppe‹ war der Name, den er den drei Männern gegeben hatte, um sie zu einer Einheit zusammenzufassen. Es war ein Trick, um so etwas wie Gleichgewicht in ihrem Arrangement zu erzeugen: einer von ihm, einer von ihnen. Aber es hatte nicht funktioniert. Sie waren viel zu mächtig und unterschiedlich, als dass man sie zu einem homogenen Ganzen hätte zusammenfassen können. So sehr Clementi sich auch bemühte, sie waren noch immer genauso individuell und beeindruckend wie damals, als er an sie herangetreten war und ihnen seinen Plan erklärt hatte. Die Gruppe traf sich so unregelmäßig wie möglich und stets im Geheimen, denn das war die Natur ihres gemeinsamen Unterfangens. Angesichts des Kalibers von Leuten, die darin involviert waren, war es schon ein kleines Wunder, dass sie sich überhaupt auf einen Termin einigen konnten, und das nächste Treffen hätte eigentlich erst in einem Monat stattfinden sollen. Doch einer oder mehr von ihnen war hier – jetzt! –, unangekündigt und unerwartet, und dafür gab es nur eine mögliche Erklärung.
»Daran ist die Situation in Trahpah schuld«, sagte Clementi, als sie eine schlichte Metalltür am ersten Absatz erreichten.
Clementi legte seine fleischige Hand auf eine Glasplatte daneben. Ein blasser Lichtstrahl wanderte über seine Handfläche und warf Schatten auf sein Gesicht, das sich in dem polierten Metall der Tür spiegelte. Clementi wandte sich ab. Er hatte sein Äußeres schon immer gehasst. Mit seinem Mondgesicht und dem lockigen Haarkranz – einst blond, jetzt weiß – sah er wie ein aufgeblähter Cherub aus. Ein dumpfes Geräusch kam aus dem Inneren der Tür, und Clementi zog sie auf und eilte in die Dunkelheit hinein, weg von seinem Spiegelbild.
Neonlichter sprangen in dem engen Tunnel an, als er sich durch ihn hindurchbewegte, und die Betonwände wurden von grob behauenem Fels abgelöst, als Clementi den Apostolischen Palast verließ und das Fundament des Turms aus dem 15. Jahrhundert erreichte, der daneben stand. Nach gut zehn Schritten kam er an einer zweiten Tür an, die er öffnete. Dahinter befand sich ein kleiner, fensterloser Raum, dessen Wände mit Regalen vollgestellt waren, auf denen sich Aktenkisten stapelten. Clementi betrat den Raum und drehte sich um.
»Gehen Sie voraus«, sagte er zu Schneider. »Entschuldigen Sie mich, und sagen Sie, ich müsse nur noch rasch ein anderes Meeting zu Ende bringen; dann käme ich sofort. Ich treffe Sie dann in der Lobby, damit Sie mir sagen können, wer genau mich erwartet. Bei so einem wichtigen Treffen will ich wenigstens im Voraus wissen, wer dort ist.«
Schneider verneigte sich, huschte davon und ließ Clementi mit seinen Sorgen zurück. Clementi lauschte den Schritten seines Sekretärs, die in der Ferne verhallten, den Blick auf die gekreuzten Schlüssel des päpstlichen Siegels und die Buchstaben IOR fixiert, die jede Akte in dem Raum zierten. Clementi befand sich in jenem Teil des Turms von Nikolaus V., der an die Ostmauer des Apostolischen Palastes anschloss und nun einem der exklusivsten Finanzinstitute der Welt als Hauptquartier diente. IOR stand für Istituto per le Opere di Religione, das Institut für Religiöse Werke oder kurz: die Vatikanbank. Und die Vatikanbank war nicht nur eines der exklusivsten, sondern auch das geheimste Finanzinstitut der Welt und der Hauptgrund für Clementis Sorgen.
Gegründet 1942, um den gewaltigen Reichtum und die Investitionen der Kirche zu verwalten, besaß die Bank nur wenig mehr als vierzigtausend Kontoinhaber. Diese mussten sich um Steuern keinerlei Gedanken machen, und die Geheimhaltungsstufe der Bank ließ ihre Schweizer Konkurrenz vor Neid erblassen. Dadurch hatte sie einige der reichsten und einflussreichsten Investoren der Welt angelockt; aber sie hatte auch stets für Kontroversen gesorgt.
In den 70er und 80er Jahren war das Institut von dem Financier Michele Sindona missbraucht worden, um Drogengelder der Mafia zu waschen. In der Folge davon hatte man Roberto Calvi, den berühmten ›Bankier Gottes‹, zum Chef der Vatikanbank ernannt, um die gewaltigen Ressourcen der Kirche besser unter Kontrolle zu bekommen. Stattdessen hatte er die Bank jedoch benutzt, um illegal Milliarden von anderen Geldhäusern abzuschöpfen, was die Kirche in ein großes moralisches Dilemma gebracht hatte, als die ganze Sache schließlich aufgeflogen war. Ein paar Wochen später war Calvi tot aufgefunden worden. Die Taschen voll mit Ziegelsteinen und Banknoten hatte er unter der Blackfriars Bridge in London gehangen. Man hatte viel in diesen Ort hineininterpretiert, nicht zuletzt, da Calvi Mitglied einer Freimaurerloge gewesen war, die bezeichnenderweise den Namen ›Black Friars‹ trug; einen Täter hatte man in diesem Mordfall jedoch nie ermitteln können. Doch wie auch immer, in jedem Fall warfen all diese Skandale noch immer ihre Schatten, und Clementi war geradezu besessen davon, die Vatikanbank wieder zu rehabilitieren, zumal er auch noch den perfekten Hintergrund dafür besaß.
Clementi hatte in Oxford nicht nur Theologie, sondern auch Geschichte und Ökonomie studiert und Gottes Hand in allen drei Disziplinen erkannt. Er betrachtete die Ökonomie als eine Macht des Guten, denn sie schuf Wohlstand und linderte so das irdische Leid der Menschen. Die Geschichte hatte ihn aber auch die Gefahren wirtschaftlichen Scheiterns gelehrt. Clementi hatte die großen Zivilisationen der Vergangenheit studiert und sich dabei nicht nur darauf konzentriert, wie sie ihren sagenhaften Reichtum erworben, sondern auch darauf, wie sie ihn wieder verloren hatten. Immer wieder und wieder waren Imperien über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hinweg in immer neue Höhen aufgestiegen, doch nur um genauso plötzlich und rasch wieder zu zerfallen, bis nur noch Legenden und Ruinen übrig geblieben waren. Clementi hatte sich oft überlegt, was wohl aus ihrem Reichtum geworden war. Häufig war er in die Hände von Eroberern gefallen und hatte den Grundstock neuer Reiche gebildet, oft aber auch nicht. Die Geschichte war voll mit Legenden von gewaltigen Schätzen, die einfach verschwunden waren.
Nach seinem Abschluss und dem Beginn seiner Kirchenkarriere hatte Clementi Gott auf die beste Art gedient, die ihm möglich gewesen war. Er hatte all sein Wissen und Können genutzt, um endlich dafür zu sorgen, dass das Geld, das aus den Truhen der Kirche abfloss, auch wieder hereinkam. Er wusste, wo früher der Glaube die Welt beherrscht hatte, regierte nun das Geld, und so war es von äußerster Wichtigkeit, die Kirche zu einem ökonomischen Schwergewicht zu machen, wollte sie ihre alte Macht zurückerlangen.
Je weiter Clementi aufgestiegen war, desto mehr Einfluss hatte er bekommen, und diesen Einfluss hatte er genutzt, um die veralteten Finanzsysteme der Kirche zu überholen, und schließlich war sein Eifer und sein Können mit dem Amt des Kardinalstaatssekretärs belohnt worden. Als solcher hatte er nun auch Zugriff auf das Herzstück des katholischen Finanzwesens: die Vatikanbank.
Seine erste Amtshandlung als Kardinalstaatssekretär war dann auch gewesen, sich einen Überblick über die geheimen Konten der Bank und damit über den Stand der Finanzen des Vatikans im Allgemeinen zu verschaffen. Doch diese Aufgabe hatte er niemandem anvertrauen wollen, und so hatte es ihn fast ein Jahr gekostet, bis er sich durch diesen Sumpf aus Betrügereien und falschen Bilanzen gekämpft und das wahre Bild herausgearbeitet hatte. Und was er dann hatte sehen müssen, hatte ihm den Magen umgedreht. Aufgrund systematischer Korruption und Hunderten von Jahren Missmanagement waren die gewaltigen finanziellen Mittel der über zweitausendjährigen Mutter Kirche so gut wie aufgebraucht.
Billionen von Dollar … einfach weg!
Natürlich besaß die Kirche noch immer Grund und Boden sowie unbezahlbare Kunstwerke, aber sie hatte kein Bargeld – nichts. Die Kirche war de facto bankrott, und aufgrund jahrhundertelanger Konten- und Bilanzfälschung wusste niemand davon, nur er.
Clementi erinnerte sich daran, wie verzweifelt er in jenem Moment gewesen war, als er sich die Konsequenzen vorgestellt hatte, sollte diese Wahrheit je ans Licht kommen. Wäre die Kirche eine Firma, sie hätte Insolvenz anmelden müssen, und ihre Gläubiger hätten sie zerschlagen und die Einzelteile unter sich verteilt. Aber die Kirche war keine Firma, sondern sie erfüllte Gottes Werk auf Erden, und Clementi durfte nicht zulassen, dass sie zum Opfer weltlicher Gier wurde. Also hatte er sich auf das zurückgezogen, worauf die Kirche sich in Zeiten der Not immer zurückgezogen hatte – ihre Unabhängigkeit und Verschwiegenheit –, und so war es ihm gelungen, seine Entdeckung geheim zu halten.