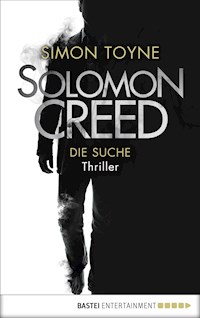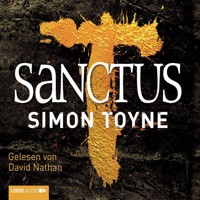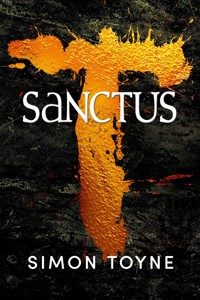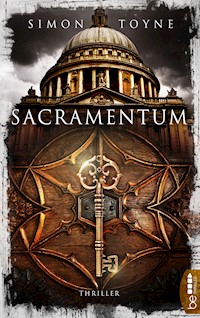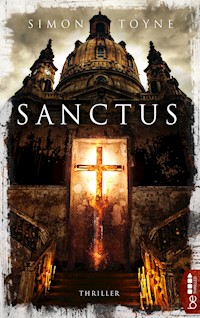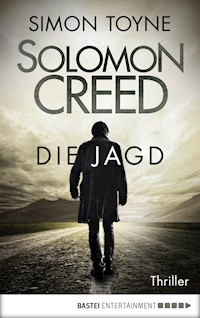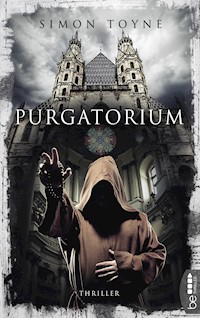
7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Verschwörung auf der Spur: Die Sanctus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
»Actionreich und erfrischend originell.« KATE MOSSE
Ein Virus legt das Hubble Teleskop genau in dem Moment lahm, als es tiefer in den Weltraum blickt als je zuvor, und hinterlässt die Botschaft »Die Menschheit darf nicht weitersuchen«. Ist dies eine Drohung? Oder eine Warnung? Zeitgleich wütet in der verbotenen Festung von Trahpah eine tödliche Seuche, die sich bald ausbreitet.
Von alldem weiß Liv Adamsen nichts. Sie spürt jedoch, dass etwas heraufzieht. Etwas, das sich nicht aufhalten lässt und alles verändern wird. Aber was bedeutet das für die Menschheit: Neuanfang - oder das Ende der Zeit?
Ein Verschwörungsthriller für alle Fans von Dan Brown und APOCALYPSIS. Simon Toynes packende Romane wurden in 27 Sprachen übersetzt und sind in mehr als 50 Ländern erschienen. Neben der SANCTUS-Trilogie hat er die Reihe um Solomon Creed geschrieben.
»Simon Toyne versteht es wie kein Zweiter, rasend schnelle Thriller zu schreiben. Hochspannung pur« The New York Times.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Teil I
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil II
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Teil III
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Teil IV
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Teil V
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Teil VI
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Teil VII
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Epilog
Danksagung
Weitere Titel des Autors
Die SANCTUS-Trilogie:
Band 1:Sanctus
Band 2:Sacramentum
SOLOMON CREED
Solomon Creed – Die Suche
Solomon Creed – Die Jagd
Über dieses Buch
»Actionreich und erfrischend originell.« KATE MOSSE
Ein Virus legt das Hubble Teleskop genau in dem Moment lahm, als es tiefer in den Weltraum blickt als je zuvor, und hinterlässt die Botschaft »Die Menschheit darf nicht weitersuchen«. Ist dies eine Drohung? Oder eine Warnung? Zeitgleich wütet in der verbotenen Festung von Trahpah eine tödliche Seuche, die sich bald ausbreitet.
Von alldem weiß Liv Adamsen nichts. Sie spürt jedoch, dass etwas heraufzieht. Etwas, das sich nicht aufhalten lässt und alles verändern wird. Aber was bedeutet das für die Menschheit: Neuanfang – oder das Ende der Zeit?
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Simon Toyne arbeitete über zwanzig Jahre lang als Produzent und Regisseur für das britische Fernsehen, bis seine Leidenschaft für spannende Geschichten ihn auf die Idee brachte, selbst Thriller zu schreiben. Das Ergebnis war sein spektakuläres Debüt SANCTUS. Heute erscheinen seine Bücher in 27 Sprachen und in mehr als 50 Ländern. Bastei Lübbe hat die SANCTUS-Trilogie und die SOLOMON-CREED-Reihe veröffentlicht.
Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.simontoyne.net/.
Simon Toyne
PURGATORIUM
Religionsthriller
Aus dem britischen Englisch vonRainer Schumacher
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Simon Toyne
Titel der englischen Originalausgabe: „The Tower“
Originalverlag: HarperCollins
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Nomadsoul1/iStock/Getty Images Plus; Artem Kniaz/iStock/Getty Images Plus; daniilphotos/iStock/Getty Images Plus; DavidMSchrader/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2166-0
be-thrilled.de
lesejury.de
Für Stan(Tut mir leid,dass es keine Piraten in der Geschichte gibt.)
TEIL I
Die Götter sind in allem
– Thales von Milet
PROLOG
Der Keller ist dunkel und still.
Eine kniende Gestalt mit nacktem Oberkörper nimmt die Klinge in die rechte Hand und zieht sie über die Haut an ihrer linken Schulter. Sie folgt der Narbe eines früheren Schnitts. Die Klinge ist scharf, und die Narbe öffnet sich spielend leicht. Blut läuft über die Haut und sammelt sich an der Schneide.
»Der Erste«, sagt der Mann mit leiser Stimme in der Dunkelheit. »Im Schmerz verbindet mich dieses Blut mit dem Sakrament. So wie es leidet, so muss auch ich leiden, bis alles Leid ein Ende hat.«
Er legt das Messer von der rechten in die linke Hand und wiederholt den Schnitt an der rechten Schulter.
»Der Zweite«, sagt er und setzt das Ritual fort, das er von einem Krankenhausarbeiter in der südtürkischen Stadt Trahpah gelernt hat, von einem Mann, der alles wortgetreu aufgezeichnet hat, was die sterbenden Sancti in ihrem Delirium und ihrem Schmerz gesagt haben. Das Messer schneidet weiter, lässt alte Wunden bluten und schnitzt das gleiche Muster, das der Mann auf den Körpern der heiligen Mönche gesehen hat. Ein Spion hat sie mit seiner Handykamera festgehalten, nachdem das Leiden der Mönche ein Ende genommen hatte. Diese Muster sind Teil einer Zeremonie, die in der Zitadelle im Herzen von Trahpah über Abertausende von Jahren geheim gehalten worden ist. Die Feinde der Kirche glauben, dass der Tod der Sancti und der Zusammenbruch der Zitadelle das Ende der alten Zeit bedeuten.
Sie irren sich.
Als die Zeremonie vorbei ist, säubert der Mann seine Wunden mit einer Salzlösung. Dann trocknet er sie ab und schließt sie mit Sekundenkleber. Das brennt. Doch der Schmerz schärft seinen Geist. Er weiß um seine Bestimmung. Erst durch Leid erreicht man Erlösung, und erst durch Opfer besiegt man den Feind.
Rasch zieht er sich an und knöpft sein Hemd mit dem hohen Kragen zu, um die Narbe an seinem Hals zu verbergen. Nur sehr wenige kennen den Titel, den er nun führt: Novus Sanctus, Bewahrer der heiligen Flamme.
Aber er ist nicht allein in den Schatten. Da sind noch andere, viele andere wie er, die sich selbst dem geheimen Schutz von Gottes heiliger Mission auf Erden verschworen haben. Sie sind überall, fest verwoben mit der Gesellschaft: Wirtschaftsführer, Politiker, Meinungsmacher. Die Kreuze, die sie um den Hals tragen, sind der einzige Hinweis darauf, dass sie einem höheren Gesetz dienen als dem des Landes, in dem sie leben. Sie sind eine Legion, denn sie sind viele. Sie sind eine Armee. Und sie werden in den Kampf ziehen, wenn der Tag des Jüngsten Gerichts nicht mehr fern ist.
Und diese Zeit ist nun gekommen. Der Mann weiß, dass dem so ist, denn er hat die Zeichen gesehen und den Ruf in seinem Herzen gehört. Gott hat zu ihm gesprochen, und nun wird er ihm antworten.
Der Mann zieht das Jackett an und geht die Treppe in die moderne Welt hinauf wie jemand, der von den Toten auferstanden ist.
Neugeboren.
Erneuert.
Bereit.
KAPITEL 1
Merriweather schaute auf die Monitore.
Etwas stimmte nicht.
Er sah hinter sich. Dabei wusste er ganz genau, dass er alleine im Kontrollzentrum war. Alle anderen waren auf der Betriebsfeier, wie jedes Jahr zu Beginn der Weihnachtsferien. Merriweather war nie der Partygänger gewesen. Er trank nicht, und er mochte auch keinen Smalltalk. Also hatte er sich freiwillig für den Wachdienst gemeldet, um Punkte bei den Jungs von der Flugkontrolle zu sammeln und sich ein wenig Zeit am Rechner zu sichern. Schließlich musste er noch viele Daten für seine Doktorarbeit verarbeiten.
Merriweather beugte sich auf seinem Stuhl vor, legte den Kopf auf die Seite und lauschte dem Surren der Festplatte. Manche Menschen konnten am Klang eines Motors erkennen, was mit ihm nicht stimmte; andere hörten einen falschen Ton bei einem 60-Mann-Orchester raus. Und Merriweather kannte sich mit Computern aus, und der hier klang definitiv falsch. Das Surren war eindeutig nicht mehr im Takt, wie bei einer zerkratzten, alten Vinylschallplatte. Nervös strich Merriweather sich über die Krawatte und überlegte, was er tun sollte. Im Gegensatz zu den anderen Technikern im Goddard Space Flight Center war Merriweather noch von der alten Schule. Er trug jeden Tag Krawatte, Hosen mit Bügelfalte, Hornbrille und eine ordentlich gescheitelte Frisur – genau wie die Helden seiner Kindheit, die Missioncontroller im Houston Space Center der 60er- und 70er-Jahre. Auch mochte er es, wenn alles seinen gewohnten Gang ging. Lief etwas schief, machte ihn das wahnsinnig.
Ein Druck auf eine Taste ließ den Bildschirmschoner verschwinden. Er zeigte das berühmteste Bild des Hubble-Weltraumteleskops, die Säulen der Schöpfung. Das Teleskop wurde von diesem Raum hier kontrolliert. Es umkreiste die Erde sechshundert Kilometer über Merriweathers Kopf. Merriweather ging die Standardcheckliste der letzten Telemetrie durch: Temperatur: normal, Geschwindigkeit: konstant, alle Systeme grün, keinerlei Fluktuation in den Solarwinden. Alles war vollkommen normal.
Merriweather tippte eine Reihe von Befehlen ein, und der große Monitor an der Wand erwachte zum Leben und zeigte ein aktualisiertes Bild des Hauptreflektors. Darauf waren die leuchtenden Wirbel von COSMOS-AzTEC 6 zu sehen, vier Milliarden Lichtjahre entfernt. Es war das am weitesten von der Erde entfernte System, das je beobachtet worden war.
Der Rechner knirschte erneut, und Merriweather zuckte unwillkürlich zusammen. Dann geschah etwas, das er noch nie gesehen hatte. Auf seinem Desktop startete automatisch ein Programm, und ein großes Fenster füllte sich mit Zahlen.
»Ein Virus«, keuchte Merriweather. »Wir haben ein Virus!«
Keine Reaktion. Es war niemand hier.
Ein paar Sekunden lang blieben die Zahlen auf dem Bildschirm; dann verschwanden sie. Merriweather hackte auf der Tastatur herum und schüttelte die Maus. Schließlich drehte er sich mit dem Stuhl herum und rollte zu einer anderen Workstation. Dort war es genauso: Bildschirm eingefroren und keinerlei Reaktion auf irgendwelche Tastatureingaben. Die Rechner surrten und ratterten und pumpten immer mehr digitales Gift in das reine System – was auch immer das für ein Gift sein mochte.
Der Hauptbildschirm flackerte, und Merriweather hob den Blick. Das Bild bewegte sich und löste sich dann langsam auf. Was auch immer ihn ausgesperrt hatte, übernahm nun die Kontrolle über das Steuersystem. Das Teleskop wurde gedreht.
Merriweather griff so ungestüm nach dem Telefon, dass der Hörer auf den Boden fiel. Er zog ihn an der Schnur wieder hoch und hämmerte wie wild auf die Taste, unter der ›Dr. Kinderman – Handy‹ stand. Auf dem Bildschirm löste sich das Bild weiter auf, während das Teleskop sich drehte. Merriweather hörte das Freizeichen, und irgendwo den Flur hinunter erklang ein Marimba-Klingelton im Takt dazu.
Merriweather klemmte sich den Hörer unters Kinn und versuchte jeden Reboot-Befehl, der ihm einfiel. Nichts. Es tutete weiter in seinem Ohr. Merriweather ließ den Hörer auf den Tisch fallen und sprang zum Ausgang.
Draußen im Flur war die Marimba deutlich lauter. Sie kam aus Kindermans Büro. Merriweather klopfte aus Gewohnheit kurz an und öffnete dann die Tür.
Entsetzt riss er die Augen auf. Schubladen waren herausgerissen, überall lag Papier herum, und der ganze Boden war mit Büchern bedeckt. Das Handy lag auf dem Schreibtisch. Es hüpfte leicht umher, als es im Takt des Klingeltons vibrierte. Dann verstummte es, und in der darauffolgenden Stille hörte Merriweather das Rattern der Festplatte in Kindermans Terminal. Vorsichtig betrat er den Raum und watete durch das Papier, bis er den Bildschirm sehen konnte. Was dort stand, ließ ihn erstarren:
DIE MENSCHHEIT MUSS NICHT LÄNGER SUCHEN
KAPITEL 2
Shepherd atmete tief ein und langsam wieder aus. Er versuchte, so lautlos wie möglich zu sein, während er sich den dunklen Korridor voranarbeitete, die Waffe auf die einzige Tür gerichtet. Sie stand leicht offen, und das zersplitterte Holz am Schloss war Beweis dafür, wie oft sie im Laufe der Jahre eingetreten worden war. Irgendwo über ihm rüttelte der Winter von Virginia an den zerbrochenen Fenstern und erfüllte das verfallene Stadthaus mit seinem Flüstern. Draußen waren es zwei Grad unter null, hier drin vermutlich noch weniger, doch Shepherd schwitzte unter seiner kugelsicheren Weste.
Shepherd blieb einen Fuß vor der Tür stehen und lehnte sich an die Wand. Die Gipsplatte und der Türrahmen gaben leicht nach. Sie könnten keine Kugeln aufhalten. Wie er es gelernt hatte, duckte Shepherd sich unter Augenhöhe, nahm den Spiegel von seinem Gürtel und schob ihn in den Spalt.
Tageslicht fiel durch die hohen, schmalen Fenster. Die Umrisse des Raums waren gut zu sehen. In der gegenüberliegenden Wand befand sich eine weitere Tür, und ein Tisch in der Mitte quoll von verschiedenen Gegenständen förmlich über. Dahinter standen ein Mann und eine Frau.
Shepherd lief ein Schauder über den Rücken. Der Mann trug eine Sicherheitsbrille und schien ihn direkt anzustarren. Er sah, wie sich eine Hand um das Gesicht der verängstigten Frau schloss, die er wie einen Schild vor sich hielt. Dann hob er die andere.
Shepherd sprang gerade noch rechtzeitig zur Seite, als Schüsse durch die eisige Stille hallten und Kugeln in die Wand schlugen, hinter der er gekauert hatte. Er rollte sich auf eine neue Position weiter den Gang hinunter und richtete die Waffe auf die Tür. »FBI!«, rief er. »Lassen Sie die Waffe fallen, und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir haben das Gebäude umstellt.«
Das stimmte nicht.
Shepherd war der einzige Agent hier. Er war einer kalten Spur gefolgt, die plötzlich glühend heiß geworden war.
Shepherd hörte Geräusche aus dem Zimmer. Irgendetwas fiel zu Boden; dann entfernten sich schlurfend Schritte. Geduckt rückte Shepherd wieder vor und griff mit der freien Hand nach einer Blendgranate an seinem Gürtel. Er zog den Pin und warf sie durch die Tür.
Die Granate rollte über den Boden, prallte gegen ein Tischbein und detonierte mit einem grellen Lichtblitz, den Shepherd sogar mit geschlossenen Augen sah. Ein harter Knall ließ die Wand beben, und einen Augenblick später war Shepherd durch die Tür.
Doch da war niemand, und die andere Tür stand offen.
Shepherd rannte durch den weißen Magnesiumrauch und warf im Vorbeilaufen einen raschen Blick auf den Tisch: 9-Volt-Batterien, Drahtschneider, ein Lötkolben, Klebeband und Klarsichtbeutel mit Plastiksprengstoff … alles, was man für den Bombenbau benötigte.
Klug wäre gewesen, sich zurückzuziehen und Verstärkung anzufordern, doch der Verdächtige wusste, dass er in die Enge getrieben war. Er hatte geschossen und war geflohen, und das, nachdem Shepherd sich als FBI-Agent zu erkennen gegeben hatte. Der Mann war verzweifelt und somit unberechenbar.
Und er hatte eine Geisel.
Wenn Shepherd auf Verstärkung wartete, dann würde der Verdächtige die Frau vermutlich töten und verschwinden. Doch im Augenblick war er verwundbar. Mit Sicherheit klingelten ihm die Ohren vom Knall der Blendgranate, und seine Augen waren in der Dunkelheit des Kellers so gut wie nutzlos. Shepherd war im Vorteil, aber nur für die nächsten paar Sekunden. Er musste eine Entscheidung treffen.
Shepherd atmete tief durch, richtete die Waffe auf die zweite Tür und ging hindurch. Der Verdächtige stand in der Ecke mit dem Rücken zur Wand. Die verängstigte Geisel hielt er noch immer vor sich.
Shepherd stand breitbeinig da, um den Schutz seiner Weste zu maximieren, hielt die Waffe mit beiden Händen und zielte auf das, was er vom Gesicht des Verdächtigen sehen konnte. Aus den Augenwinkeln schaute er sich im Raum um. Auf dem Boden lag eine Matratze, und daneben stand ein niedriger Tisch. An der Wand hing ein Filmplakat mit einer orangefarbenen Sonne und weißer Schrift. Plötzlich überkam Shepherd eine Erinnerung, und sein Mund war plötzlich wie ausgetrocknet.
Der feuchte Geruch …
… die gleiche Sonne auf dem gleichen Poster …
… ein Raum genau wie dieser …
Shepherd versuchte, die Erinnerung zu verdrängen und sich weiter auf den Verdächtigen zu konzentrieren, doch die Sonne zog ihn immer wieder in die Vergangenheit zurück, unwiderstehlich wie ein schwarzes Loch – zurück an jenen dunklen, dunklen Ort, den zu vergessen er sich so sehr bemüht hatte.
Shepherds Hand begann zu zittern. Der Verdächtige schrie, doch Shepherd konnte ihn nicht verstehen. Dann sah er, wie der Mann die Hand hob. Er hielt etwas darin. Es war eine Art Knopf, der über einen Draht mit dem Sprenggürtel am Hals der Geisel verbunden war.
Hinter den beiden knallte die Sonne auf die Wand wie ein Vorbote der Explosion, die nun bevorstand. Shepherd fühlte sich schwach. Er konnte sich kaum noch zusammenreißen. Seine Welt schrumpfte auf den Lauf der Waffe, und er fokussierte sich auf das Gesicht des Verdächtigen zusammen mit den Worten auf dem Filmplakat.
Apocalypse Now.
Er drückte ab.
Shepherd fing den Rückschlag ab, wie es ihm in Hunderten von Stunden auf dem Schießstand in Fleisch und Blut übergegangen war, und jagte der ersten eine zweite Kugel hinterher. Über den Lauf der Waffe hinweg sah er eine rote Wolke. Dann beobachtete er stumm, wie sowohl der Verdächtige als auch die Geisel langsam zu Boden sanken.
In der darauffolgenden Stille spürte Shepherd, wie ihn auch der letzte Rest an Kraft verließ. Sein Blick wanderte wieder zu der schmelzenden Sonne. Er ließ die Hand fallen, und die Waffe mit dem roten Kolben baumelte an seinem Abzugsfinger. Er spürte noch nicht einmal, wie der Ausbilder sie ihm abnahm, und er bemerkte auch nicht das fluoreszierende Licht, das über seinem Kopf zum Leben erwachte. In seinem Geist war er noch immer dort und starrte auf das gleiche Poster, nur an einer anderen Wand … in dem Raum, wo sie ihn gefunden und sie einander gerettet hatten.
»… Shepherd …!«
Die Stimme kam aus schier unglaublich großer Ferne.
»SHEPHERD … ALLES OKAY MIT DIR?«
Das harte Gesicht von Special Agent Williams schob sich zwischen Shepherd und das Filmplakat und brach so den Bann.
Shepherd blinzelte.
Er nickte.
»Du hast ein paar taktische Fehler gemacht.«
Er nickte erneut.
»Geh zur Nachbesprechung in den ›Biograph‹.« Der Ausbilder schlug ihm mit einer Hand auf den Rücken, die von jahrelangen Schießübungen hart geworden war, und drehte sich zu den beiden Schauspielern um, die bereits wieder aufgestanden waren und sich die rote Farbe von Shepherds Übungsmunition abwischten. Beide hatten einen roten Fleck auf der Stirn, unmittelbar über dem Auge. Beides Todesschüsse.
»Alle wieder auf Position!«, bellte Williams. »Der nächste Kandidat kommt in knapp fünf Minuten!«
KAPITEL 3
Shepherd trat aus der Tür des Stadthauses und geriet sofort in die Fänge eines Westwinds aus der Chesapeake Bay, der die Main Street entlangwehte.
Hogan’s Alley erstreckte sich über zehn Morgen der Navybasis in Quantico. Die Basis war eine typische amerikanische Stadt im Kleinformat. Es gab eine Bank, einen Supermarkt, ein Hotel, eine Tankstelle … eigentlich alles, was Kriminelle sich auch in der echten Welt als Ziel aussuchen würden. Normalerweise hallte hier alles vom Funkverkehr, Brüllen und dem Krachen von Schüssen wider, wenn FBI, DEA und andere Strafverfolgungsbehörden den taktischen Einsatz in urbaner Umgebung übten. Heute war jedoch so gut wie niemand hier. Tatsächlich galt das für die ganze Basis, denn es waren Weihnachtsferien. Shepherd fiel ein ausgestopfter Weihnachtsmann auf, der aus dem oberen Fenster einer Münzwäscherei hing und im Wind schaukelte wie ein Erhängter. Irgendjemand hatte dem Weihnachtsmann mit einem Paintballgewehr auf den Arsch geschossen. So viel zum Thema Weihnachtsgeist.
Zum Schutz vor der Kälte zog Shepherd die Schultern hoch und schaute aus Gewohnheit in den Himmel hinauf. Im Westen war bereits der Abendstern zu sehen, und als Shepherd ihn anblickte, flog ein großer Gänseschwarm über den Himmel. Ihr lautes Quaken ließ ihn innehalten. In der Antike hätte man viel in den Flug der Tiere hineininterpretiert, doch Shepherd wusste, dass das nur Natur war. Und auch was sich dort bewegte, war eigentlich kein Stern, sondern die Venus, deren helles Strahlen Shepherd selbst in den dunkelsten und einsamsten Nächten stets getröstet hatte.
Shepherd bog im selben Augenblick um die Ecke, als die Straßenlaternen flackernd zum Leben erwachten. Am anderen Ende des Blocks fiel Licht aus dem Foyer des ›Biograph‹. Das Gebäude war nach dem Kino in Chicago benannt, wo John Dillinger Mitte der Dreißiger erschossen worden war. Die Schrift über dem Eingang bewarb Manhattan Melodrama mit Clark Gable und Myrna Loy, den letzten Film, den Dillinger je gesehen hatte. Shepherd ging an dem leeren Kassenhäuschen vorbei, durch die Tür und in den Raum, der in dem echten Kino das Foyer gewesen wäre.
Im Klassenzimmer saßen einhundert Schüler in konzentrischen Reihen um einen großen Bildschirm, auf dem eine ganze Reihe audiovisueller Lernhilfen dargestellt werden konnten sowie jeder Feed der zweiundsechzig in der Stadt verteilten Sicherheitskameras. Im Augenblick war der Kellerraum des Stadthauses mit Shepherd mittendrin zu sehen, die Waffe in beiden Händen und auf die zusammengesackten Körper gerichtet. Vor dem Bildschirm stand ein Mann in schwarzem Anzug. Er hatte den Kopf auf die Seite gelegt und starrte das Bild an wie ein Gemälde. »Haben Sie da drin einen Geist gesehen, Shepherd?«, fragte er, ohne sich umzudrehen.
»Nein, Sir. Ich war nur … Ich stand unter großem Druck.«
Der Mann drehte sich um und musterte Shepherd genauso eingehend wie zuvor den Bildschirm. »Man steht in dieser Art von Situation immer unter großem Druck … in jeder einzelnen von ihnen.«
Special Agent Benjamin Franklin war einer der beiden aktiven Agents, die Shepherds Klasse permanent als Berater zugeteilt waren. Ihre Aufgabe war es, jede Lektion um eine praktische Komponente zu bereichern, Fragen zu beantworten und den Frischlingen zu erklären, wie es draußen in der echten Welt zuging. Franklin war einer dieser kantigen, harten Typen, die irgendwie in einer längst vergangenen Zeit festzuhängen schienen, als man Frauen noch Ma’am genannt hatte und Autos vor Chrom nur so strotzten. Sein kurzes blondes Haar lichtete sich allmählich und wurde an den Rändern grau, und seine blassblauen Augen waren eisig, es sei denn, er lächelte. Dann strahlten sie Wärme aus, und genau das war auch jetzt der Fall. »Ich muss Sie mal was fragen, Shepherd«, sagte er. »Wenn Sie noch einmal in so eine Situation kommen, würden Sie dann wieder schießen?« Sein träger Carolina-Akzent verlieh seinen Worten etwas Vornehmes.
Shepherd rief sich die verschwommene Situation noch mal ins Gedächtnis zurück. Als er den Abzug gedrückt hatte, hatte er den Verdächtigen genau im Visier gehabt, und doch war die falsche Person gestorben. »Nein, Sir.«
»Warum?«
»Weil … Weil ich die Geisel getroffen habe.«
Franklin wandte sich vom Bildschirm ab und ging zwischen den Stühlen hindurch auf Shepherd zu. Dabei knöpfte er sich das Jackett zu, und eine alte Stahluhr kam zum Vorschein. »Ziehen Sie die Weste aus, Shepherd, und begleiten Sie mich ein Stück.«
Nach der Helligkeit des Klassenzimmers wirkte die Nacht noch dunkler als zuvor, und der Wind hatte aufgefrischt. Blätter flatterten die Straße hinunter und in Shepherds Gesicht.
»Vor ungefähr zwölf Jahren«, begann Franklin und starrte in den dunklen Wald, als könne er dort die verlorenen Jahre sehen, »war ich Teil eines Sechs-Mann-Teams, das eine Reihe von Banküberfällen an der Grenze zwischen Ohio und Indiana untersucht hat. In jedem Fall war ein einzelner, maskierter Schütze in eine kleine, abgelegene Bank gestürmt, hat sich eine Geisel geschnappt – immer eine Frau – und gedroht, sie zu erschießen, wenn irgendjemand Alarm schlagen sollte. Er hat sich seine Ziele ganz genau ausgesucht, alles Banken, deren Sicherheitstechnik nicht auf dem neuesten Stand war und wo es meist auch keine Überwachungskameras gab. Auch war er nie allzu gierig und nach wenigen Minuten wieder raus. Und er hat die Geisel immer mitgenommen. Beim leisesten Ton würde er sie töten, hat er gesagt.
Wie Sie sich denken können, hat die Lokalpresse die ohnehin schon vorhandene Angst auch noch kräftig geschürt. Aber es gab da etwas, das uns noch weit größere Sorgen bereitet hat: Nicht eine der Geiseln hat sich im Nachhinein bei uns gemeldet. Gut eine Woche lang hatten wir Angst, dass uns irgendein Wanderer oder Jäger anrufen und den Fund der Leiche einer der unglückseligen Bankkundinnen melden könnte. Dann wurde eine weitere Bank überfallen – die dritte in einem Monat –, und diesmal gab es eine Überwachungskamera.«
Franklin dirigierte Shepherd weg von Hogan’s Alley und zu einem Waldweg, der zum Hauptgebäude des Komplexes führte.
»Es lief wie folgt: Eine Frau betrat die Bank und sprach mit dem Wachmann am Eingang. Dann kam der Räuber und entwaffnete den Wachmann, während der noch abgelenkt war. Anschließend schnappte er sich die Frau, ließ sich das Geld geben und verschwand mit seiner Geisel. Als wir diese Aufnahmen mit den wenigen älteren verglichen, die wir hatten, erkannten wir, dass es sich jedes Mal um dieselbe Frau gehandelt hatte. Wie sich herausstellte, war sie keine Geisel, sondern seine Komplizin. Deshalb hat sich auch nie jemand bei uns gemeldet.
Nachdem wir das erkannt hatten, haben wir diese Information an die Banken weitergeleitet, und als die beiden es zehn Tage später in Des Moines noch einmal mit ihrer Masche versuchten, da löste ein Bankangestellter Alarm aus, und kurz darauf erschien die Polizei. Als der Mann sich in die Ecke getrieben sah, versuchte er wieder, seine Geiselnummer abzuziehen. Er würde die Frau töten, sagte er, wenn man ihm nicht sofort ein Auto bringen und ihn frei abziehen lassen würde. Die Cops sagten jedoch: ›Nur zu. Knallen Sie sie ab.‹ Und das bringt uns wieder zu Ihrer Situation zurück. Was wussten Sie im Vorfeld über Ihren Verdächtigen?«
Shepherd steckte die Hände in die Taschen und versuchte, sich zu konzentrieren, doch er fror erbärmlich. »Im Briefing hieß es, der Mann stehe unter Terrorverdacht und werde international gesucht. Er sei ein mutmaßlicher Dschihadist und von al-Qaida in Afghanistan ausgebildet worden.«
»Und nach all dem zu urteilen, was Sie zu dem Thema gelernt und gelesen haben, ergeben sich da Terroristen und andere religiös motivierte Individuen Beamten eines feindlichen Staates, gegen den sie einen ›heiligen Krieg‹ führen?«
»Nein.«
»Genau.«
Der Wald endete, und vor Franklin und Shepherd erhob sich das Quantico Hilton, ein riesiger Betonblock, dessen Fenster an Schießscharten erinnerten. Hier waren die aktiven Teams und die Kriminaltechnik untergebracht. Hier wurden echte Fälle bearbeitet, schmutzige Fälle, die noch nicht gelöst waren, keine nach Lehrbuch glatt gebügelten wie diejenigen, die zur Ausbildung verwendet wurden. Wären da nicht die Schüsse im Wald hinter dem Gebäude gewesen, hätte es genauso gut eine Highschool im Mittleren Westen sein können. Inzwischen war vermutlich der nächste Rekrut im Keller. Shepherd hoffte nur, dass er oder sie es besser machen würde als er. Die Schüsse erinnerten ihn an all den Papierkram, den er später im Briefingraum würde erledigen müssen. Wenn man bei einer Übung die Waffe abfeuerte, musste man einen ganzen Berg von Formularen ausfüllen. Das war mühselig, aber es hatte einen guten Grund: Es verhinderte, dass es den Rekruten allzu schnell im Finger juckte.
»Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Papierkrams«, sagte Franklin, der offensichtlich Shepherds Gedanken gelesen hatte. »Ich werde mit Agent Williams reden. Sie können das hinterher erledigen.«
Hinterher?, wollte Shepherd fragen, doch Franklin hatte schon fast die Glastür des Hauptgebäudes erreicht.
»Vergessen Sie nie, dass Sie ein hoch qualifizierter Agent sind, Shepherd, und das wiederum macht Sie zu einer Bereicherung für Onkel Sam, aber auch zu einem Ziel für Terroristen. Wenn Sie nicht schießen, wird der Terrorist die Bombe vermutlich trotzdem zünden, und dann landen drei Leichen in der Pathologie und nicht nur zwei. Die Geisel stirbt so oder so. Und nach der Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe … Woher hätten Sie wissen sollen, dass die Geisel wirklich eine Geisel war?« Sie ließen die Kälte der Nacht hinter sich und betraten das helle, warme Gebäude. »Sie fragen sich sicherlich, was die Frau überhaupt in diesem Rattenloch von einem Keller zu suchen hatte, und dazu noch bei einem mutmaßlichen Terroristen. Ich verstehe, dass Sie sich darüber ärgern, jemanden erschossen zu haben, der vermutlich unschuldig war – das spricht für Sie –, aber zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Shepherd. Allerdings müssen Sie noch an Ihrer Zielgenauigkeit arbeiten.«
Sie kamen an der Ehrentafel vorbei, die das Atrium beherrschte. In Gold standen dort die Namen aller Lehrgangsbesten seit 1972, dem Jahr der Eröffnung des Trainingszentrums. Shepherd bezweifelte, dass er irgendwann auch seinen Namen dort lesen würde. Er war deutlich älter als die anderen Rekruten, was sich unter anderem in seinen Fitnesswerten niederschlug, und auch seine Schießkünste waren alles andere als überragend. Was er wirklich konnte, und das hervorragend, war leider nicht Teil der fünf Fächer, aus denen sich seine Abschlussnote errechnete. An das, was er einbrachte, hatte man bei der Gründung des FBI noch nicht einmal gedacht.
Die Aufzugtür öffnete sich, und Franklin ging hinein. Er wartete, bis Shepherd sich zu ihm gesellt hatte; dann drückte er den Knopf für die sechste Etage. Shepherds Mund war wie ausgetrocknet. Der sechste Stock war der Führungsriege vorbehalten.
»Sie dürfen da draußen keine Zweifel haben«, fuhr Franklin fort. »Denn wenn Sie in einer derartigen Situation zögern, dann sind Sie tot, oder schlimmer noch: Ihr Partner geht drauf, und Sie tragen das für den Rest Ihres Lebens mit sich rum. In den Handbüchern steht das nicht, aber ich sage Ihnen, wie es ist. Das ist nur zu Ihrem Besten und zu meinem … insbesondere, da wir ab jetzt zusammenarbeiten sollen.«
Die Tür öffnete sich, bevor Shepherd etwas darauf erwidern konnte, und Franklin ging den stillen Flur hinunter. Er blickte auf seine Uhr, während er an den dicken Türen zu den Büros der Abteilungsleiter vorbeiging. Die Büros waren dem Rang nach besetzt. Je niedriger der Rang des Beamten, desto näher saß er am Aufzug. Franklin ging an allen vorbei und hielt geradewegs auf die Tür am Ende des Ganges zu. Shepherd folgte ihm auf dem Fuß. Er fühlte sich wie in der Schule, wenn er ins Büro des Direktors bestellt worden war. Nur hatte er es hier nicht mit einem Schuldirektor zu tun, sondern mit dem stellvertretenden Direktor des FBI. Franklin blieb vor der Tür stehen, schaute ein letztes Mal auf seine Uhr und klopfte dann zweimal.
In der Stille des Flurs klang das Klopfen wie ein Schuss.
»Herein«, sagte eine tiefe Stimme auf der anderen Seite.
Franklin lächelte Shepherd wieder an, doch diesmal war es kein warmherziges Lächeln. Vielleicht war Franklin ja auch nervös, dachte Shepherd. Dann öffnete Franklin die Tür und betrat das Büro.
KAPITEL 4
Assistant Director O’Halloran war ein Mann wie ein Stilett, geschärft im lebenslangen Dienst für das FBI. Alles an ihm war hart und präzise, auch das stählerne Brillengestell und die blassgrauen Augen dahinter, mit denen er Franklin und Shepherd musterte, als sie den Raum betraten. Selbst sein eisengraues Haar schien mit einem Skalpell und nicht mit einem Kamm geteilt worden zu sein. Er saß an demselben makellosen Schreibtisch, hinter dem er auch für den Werbeflyer fotografiert worden war, den Shepherd vor einem Jahr zusammen mit seinen Bewerbungsunterlagen bekommen hatte: derselbe LCD-Monitor, dieselbe Tastatur, dasselbe Telefon und derselbe Fotorahmen. Die einzigen beiden Dinge, die anders waren als in dem Flyer, waren die beiden Aktenmappen auf dem Tisch, die eine schlicht, die andere mit Shepherds Foto auf dem Deckel. Shepherd schlug das Herz bis zum Hals.
»Ihr Lebenslauf ist recht beeindruckend«, bemerkte O’Halloran und tippte mit dem dünnen Finger auf Shepherds Foto. »Abschluss in Mathematik und Informatik an der University of Michigan. M. Sc. in Physik des California Institute of Technology. Eine fast abgeschlossene Doktorarbeit in theoretischer Kosmologie an der Cambridge University … Aber die haben Sie nie fertiggeschrieben, oder? Trotzdem … In der freien Wirtschaft könnten Sie vermutlich eine sechsstellige Summe verdienen, und doch haben Sie sich für ein Beamtengehalt von 46 000 Dollar im Jahr entschieden. Warum?«
Shepherd schluckte unwillkürlich. »Geld ist mir nicht so wichtig.«
»Wirklich? Sind Sie Kommunist?«
»Nein, Sir. Ich bin Patriot.«
»Okay, Mr. Patriot, dann erzählen Sie mir mal von Ihrer Doktorarbeit. Warum haben Sie sie nicht beendet?«
Shepherd schaute auf die Akte und erinnerte sich an die psychologische Untersuchung und die Überprüfung seines Hintergrunds, die Teil des Rekrutierungsverfahrens gewesen waren. Vermutlich stand da alles drin … zumindest alles, was er erzählt hatte. Doch das hier war der stellvertretende Direktor des FBI, also könnten da noch ganz andere Dinge drinstehen … Dinge, von denen Shepherd gehofft hatte, sie geheim zu halten.
»Das steht alles in meiner Akte, Sir.«
O’Halloran schaute Shepherd in die Augen. »Ich möchte es aber von Ihnen hören.«
Shepherds Gedanken überschlugen sich. Er wurde auf die Probe gestellt, und O’Halloran stand viel zu hoch in der Nahrungskette, als dass es um etwas Triviales hätte gehen können. Falls es etwas mit den Teilen seiner Vergangenheit zu tun haben sollte, die Shepherd bei seiner Bewerbung ausgelassen hatte, dann hätte Franklin ihn genauso gut im ›Biograph‹ danach fragen können. Also musste es um etwas anderes gehen. Shepherd beschloss, sich an die Geschichte zu halten, die er bereits erzählt hatte, und hier und da ein paar Informationen hinzuzufügen in der Hoffnung, dass in den nächsten Minuten klar wurde, warum er überhaupt hier war.
»Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben in der akademischen Welt verbracht«, begann er. Das Gleiche hatte er auch schon im Rekrutierungsbüro erzählt. »Das war alles, was ich kannte, aber nicht alles, was ich kennen wollte. Manche Menschen sammeln Wissen um des Wissens willen. Ich hingegen wollte meines einsetzen.«
»Zum Beispiel bei der NASA?«
Shepherd nickte. »Ich habe einen Großteil meiner Ausbildung mit NASA-Stipendien finanziert und viel an unterschiedlichen NASA-Projekten geforscht. Das ist nicht ungewöhnlich für jemanden, den sie mit Stipendien fördern. Auf diese Art sichern sich solche Organisationen zusätzlichen Intellekt, und wir, die Geförderten, bekommen einen Fuß in die Tür und praktische Erfahrung in dem, was wir später hoffentlich mal machen werden.«
»So weit, so gut, aber was ist dann geschehen?«
»Der 11. September, Sir. Plötzlich hatten der Heimatschutz und der Krieg gegen den Terror höchste Priorität. Das hat die NASA einen großen Teil ihres Budgets gekostet. Fast wäre sogar das gesamte Weltraumprogramm auf Eis gelegt worden. Und ich stand plötzlich ohne Stipendium und ohne Job da. Ich hatte schlicht kein Geld mehr, um meine Studien fortzusetzen. Es war als … als wäre ich plötzlich gegen eine Wand gerannt.«
»Und deshalb haben Sie dann alles hingeschmissen, ja?«
»So kann man das auch ausdrücken, Sir.«
»Und wie würden Sie das ausdrücken?«
»Zuerst habe ich mich betrogen gefühlt, als hätte man mir was weggenommen. Es kam mir sinnlos vor, weiter für einen Job zu studieren, den es nicht mehr gab. Es gab zwar jede Menge Privatfirmen, die mir anboten, mein Studium zu finanzieren, doch die verlangten im Tausch dafür mein Leben. Ich sollte nach dem Abschluss für sie arbeiten und Aktienkurse statt Sterne studieren. Das wollte ich nicht. Also habe ich mich exmatrikuliert und bin ein wenig gereist, um einen klaren Kopf zu bekommen und herauszufinden, was ich nun mit meinem Leben machen wollte. Die NASA war zumindest keine Option mehr für mich.«
»Und wo sind Sie dann gelandet? Da ist eine fast zweijährige Lücke in Ihrem Lebenslauf. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt: keine Versicherungsunterlagen, keine Anstellungen, keine Kreditkartenrechnungen.«
»Ich war viel im Ausland, Sir – erst in Europa, dann in Südostasien und schließlich in Afrika. Ich bin von einem Ort zum anderen gereist, habe für Cash in Bars gearbeitet oder als Tagelöhner auf Bauernhöfen. Geschlafen habe ich in kleinen Herbergen, wo man pro Nacht bezahlt. In solchen Läden nimmt man keine Kreditkarten. Den größten Teil meines Erwachsenenlebens war ich Student. Also war ich es auch gewohnt, mit wenig Geld auszukommen.«
»Und dann haben Sie das Licht am Ende des Tunnels gesehen und beschlossen, wieder in die Zivilisation zurückzukehren, oder was?«
»Ja, Sir. Mir wurde klar, dass ich gerade eine große Chance verpasste. Der 11. September hatte mein Leben verändert, aber fast dreitausend Menschen hatten ihres verloren. Meine Zukunft hatte sich verändert, den Opfern hatte man ihre genommen. Ich hatte immer vor, die Schulden für meine Ausbildung zurückzuzahlen, indem ich für die NASA arbeitete und damit für das Gemeinwohl. Dann wurde mir bewusst, dass ich das nicht nur bei der NASA konnte. Auch andere öffentliche Einrichtungen hatten Bedarf an meinem Können.«
»Und so haben Sie sich beim FBI beworben.«
»Nicht sofort, Sir.«
»Ja, das stimmt.« O’Halloran klappte die Akte auf und blätterte zu einem Blatt am Ende. »Zuerst haben Sie ehrenamtlich für unterschiedliche Hilfsorganisationen gearbeitet. Sie haben Computernetzwerke aufgebaut, Webseiten eingerichtet und Langzeitarbeitslosen IT-Unterricht gegeben.« Er hob den Blick. »Geld war Ihnen wohl wirklich nie so wichtig.«
»Nein, Sir. Geld hat mich noch nie motiviert.«
O’Halloran schürzte die Lippen und musterte Shepherd wie ein Pokerspieler, der nicht so recht wusste, wie viel er einsetzen sollte. »Es gefällt mir irgendwie gar nicht, dass das FBI, dem ich mein ganzes Leben lang gedient habe, für Sie nur so eine Art Trostpreis ist, Shepherd. Aber ich kann es mir auch nicht leisten, einen Bewerber mit Ihren Qualifikationen abzulehnen.« Er schloss die Akte wieder und legte die Hand auf die zweite. »Ist Ihnen das Goddard Space Flight Center ein Begriff?«
»Ja, Sir. Ich habe dort ein paar Sommer verbracht und Daten von Explorer 66 ausgewertet.«
»Hat das irgendetwas mit dem Hubble-Weltraumteleskop zu tun?«
»Indirekt. Beide sammeln Daten von den äußersten Grenzen des Universums … oder zumindest haben sie das. Explorer wird heutzutage nur noch als Testsatellit verwendet. Hubble macht jetzt das, was Explorer früher getan hat, und Hubble hat eine wesentlich größere Reichweite.«
Wieder schürzte O’Halloran die Lippen. »Jetzt nicht mehr.« Er öffnete die Schreibtischschublade, holte eine Ausweismappe heraus und gab sie Shepherd. »Normalerweise schicke ich zwar keine Rekruten ins Feld, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen oder nicht mindestens ein Jahr in einer Außendienststelle verbracht haben, aber offenbar sind Sie der einzige von gegenwärtig mehr als dreißigtausend Agents, der für diese Situation qualifiziert ist.« Shepherd öffnete die kleine Ledermappe und sah sein Foto auf einem Dienstausweis des FBI. »Damit sind Sie vorübergehend berechtigt, eine verdeckte Waffe zu tragen und sie auch ins Flugzeug mitzunehmen. Auf dem Weg hinaus können Sie sich Ihre Waffe und die Munition bei Agent Williams abholen.«
Shepherd las den Namen neben dem Datum. Der Ausweis lief in einem Monat aus. »Mein zweiter Name ist Thomas, nicht Charles«, sagte er und zeigte O’Halloran den Ausweis.
»In Memphis gibt es bereits einen Special Agent J. T. Shepherd, und da zwei Agents nicht die gleiche ID haben können …« Er hob die Hand und schlug ein Kreuz. »Hiermit taufe ich Sie J. C. Shepherd. Das ist Ihr FBI-Name, und Sie werden darauf hören. Agent Franklin übernimmt die Leitung der Ermittlungen, und Sie werden seine Anweisungen wortgetreu befolgen. Sie sind dieser Ermittlung lediglich zugeteilt, weil Sie über außergewöhnliche Kenntnisse im Bereich der Astronomie verfügen. Sie werden Agent Franklin assistieren und Ihre Meinung nur kundtun, wenn man Sie dazu auffordert. Betrachten Sie die restliche Zeit als einmalige Gelegenheit, von einem der erfahrensten und angesehensten Agents zu lernen. Wenn sie schließlich irgendwann nicht mehr von Nutzen sind, verlieren Sie Ihren Status als Agent wieder. Dann melden Sie sich sofort wieder hier und setzen Ihre Ausbildung fort. Verstanden?«
»Jawohl, Sir.«
»Ich nehme an, Sie wissen, wie Sie von hier nach Goddard kommen. Ich habe einen Wagen für Sie bereitstellen lassen.« O’Halloran nahm die zweite Akte vom Tisch und hielt sie hoch. »Alles Weitere wird Agent Franklin Ihnen auf dem Weg erklären.«
KAPITEL 5
Shepherd und Franklin sprachen die ersten zehn Minuten der Fahrt kein Wort miteinander. Das Quietschen der Scheibenwischer und das Zischen der Reifen auf dem nassen Asphalt wurden nur vom Rascheln des Papiers unterbrochen, wenn Franklin in der Akte blätterte. Gelegentlich machte er sich eine Notiz im Licht der kleinen Taschenlampe, die er mit den Zähnen hielt. Shepherd spürte, dass Franklin mit der Situation unzufrieden war. Damit waren sie schon zu zweit.
Nach seiner Vorstellung in Hogan’s Alley war das Letzte, was Shepherd wollte, mit einer geladenen Waffe unter dem Jackett in die große, weite Welt hinauszuziehen. Wie versprochen hatte Agent Williams, der Waffenausbilder, in der Waffenkammer gewartet und Shepherd erst einmal eine Pistole so schnell wie möglich mit 9x19 Parabellums laden lassen. Dank seiner katholischen Erziehung war Shepherds Latein noch immer gut genug, um zu wissen, dass para bellum ›bereite dich auf den Krieg vor‹ hieß. Doch er hatte versucht, diesen Gedanken zu verdrängen, und sich ganz darauf konzentriert, die fünfzehn Patronen ins Magazin zu stecken. Zweimal blieb er dabei hängen, und sein Ausbilder verzog tadelnd das Gesicht.
»Tun Sie sich selbst einen Gefallen«, hatte Williams gesagt, als Shepherd für Waffe und Munition unterschrieben hatte, »und versuchen Sie, nicht in eine Situation zu geraten, in der Sie diese Waffe ziehen müssen. Lassen Sie sie einfach stecken, und kommen Sie so rasch wie möglich wieder zurück, um Ihre Ausbildung fortzusetzen.«
Shepherd schaute in den Rückspiegel. Hinter sich konnte er das Scheinwerferlicht des grauen Vans sehen, der ihnen aus Quantico gefolgt war. Es waren Kriminaltechniker mitsamt ihrem Equipment, die den Tatort untersuchen sollten, Shepherds ehemaligen Arbeitsplatz. Sie fuhren auf der I-95 in Richtung Norden. Die hellen Lichter von D.C. strahlten am Horizont vor ihnen und erhellten die niedrige Wolkendecke, aus der sich ein wahrer Monsun über die Stadt ergoss. Aufgrund des Wetters kamen sie nur langsam voran, aber wenigstens war die Rushhour schon vorbei. Shepherd nahm an, dass sie in zwanzig Minuten in Maryland sein würden. Allerdings wusste er noch immer nicht, warum sie überhaupt dorthin fuhren.
Franklin schaltete die Taschenlampe aus und drehte sich zu Shepherd um. »Diese kleine Geschichte, die Sie da erzählt haben«, sagte er, »von wegen, Sie seien in der Welt herumgereist, um sich selbst zu finden … Das kaufe ich Ihnen nicht ab.«
Shepherd spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss, und er war froh, dass Franklin das im Dunkeln nicht sehen konnte. »Ich verstehe nicht ganz, Sir.«
»Mehr als zwanzig Jahre lang habe ich mit Menschen gesprochen, die alles Mögliche getan haben – von Scheckfälschung bis hin zu Kindesentführung. Und wissen Sie, was all diese Leute gemeinsam hatten? Sie haben alle versucht, mich anzulügen. Sie mögen ja einen ganz tollen Abschluss in Astrophysik, Raketenwissenschaft oder was weiß ich haben, aber ich habe einen Doktor in Menschenkunde, und ich weiß, wenn jemand versucht, mich auf den Arm zu nehmen. Ich rieche das, und wissen Sie was, Shepherd? Sie stinken.«
Shepherd erwiderte nichts darauf, sondern blickte weiter auf die Straße.
»Dabei ist mir eigentlich egal, warum Sie lügen«, fuhr Franklin fort, »oder was Sie verheimlichen. Das Einzige, was mir wirklich Sorgen bereitet, ist, dass ich einen Partner habe, dem ich nicht vertrauen kann. Das ist nämlich das Gleiche, als wenn man überhaupt keinen Partner hat, und das ist gefährlich. Das haben Sie in dem Keller in Hogan’s Alley ja selbst gemerkt, Shepherd. Sollten Sie also dann und wann die Lust verspüren, mir einen Brocken Wahrheit zuzuwerfen, so von Mann zu Mann, von Partner zu Partner, dann werden wir schon besser miteinander zurechtkommen. Bis dahin muss ich jedoch jedes verdammte Wort aus Ihrem Mund anzweifeln, verstanden?«
»Sir, ich verspreche Ihnen …«
Franklin hob die Hand und wandte sich ab. »Machen Sie es nicht noch schlimmer, indem Sie mich noch mal anlügen. Ich bin ehrlich zu Ihnen, Shepherd, und das Einzige, was ich als Gegenleistung dafür verlange, ist, dass Sie das auch zu mir sind.«
Der Sitz knarrte, als Franklin sich wieder der Akte zuwandte. »Okay, da das jetzt geklärt ist, können Sie sich nützlich machen und mir erklären, warum zum Teufel man mehr als eine Milliarde Dollar für ein Teleskop im Weltall verschwendet hat, dessen jährliche Betriebskosten die Vierzig-Millionen-Marke übersteigen.«
Shepherd starrte nach vorne in den Regen und dachte über die Frage nach. Das war endlich etwas, womit er sich auskannte. Er dachte an die unvorstellbaren Entfernungen, in die das Hubble-Weltraumteleskop vordringen konnte. Dagegen waren terrestrische Instrumente geradezu lächerlich. Er dachte an das Licht toter Sterne, das Hubble aus dem puren Nichts sammeln konnte, und an all die Informationen vom Anbeginn der Zeit. Doch seine Antwort fiel so simpel wie möglich aus. »Wie viele Sterne können Sie heute Nacht sehen?«, fragte er.
Franklin schaute in die nasse schwarze Nacht hinaus. Ein Truck raste viel zu schnell an ihnen vorbei und wirbelte so viel Wasser auf, dass Franklin kaum die Fahrbahnbegrenzung erkennen konnte, geschweige denn den Himmel. »Okay, das verstehe ich. Aber warum baut man nicht einfach ein Teleskop auf irgendeinem Berg in Mexiko oder sonst wo, wo nur die Sonne scheint? Oder noch einfacher: Warum wartet man nicht einfach auf eine klare Nacht? Das wäre deutlich billiger.«
»Das hat man alles schon gemacht. Auf dem Gipfel eines Vulkans in der Sierra Negra im Süden Mexikos steht eine fünfzig Meter große Schüssel, mit der man sowohl den nördlichen als auch den südlichen Himmel beobachten kann. Das Ding ist ziemlich beeindruckend. Das Problem ist nur, dass die Erde sich dreht, sodass man ein bestimmtes Stück Himmel immer nur für ein paar Stunden studieren kann. Ein Weltraumteleskop wie Hubble kann ein fernes Objekt jedoch über Monate oder gar Jahre hinweg ins Visier nehmen, während sich unten die Erde dreht.«
»Und das kostet vierzig Millionen Dollar pro Jahr?«
»Das ist alles sehr kompliziert.«
Franklin grunzte. »Klingt für mich nach Beschiss.«
Shepherd überlegte, es dabei bewenden zu lassen, doch dann hätte wieder dieses beklemmende Schweigen zwischen ihnen geherrscht, und das wollte er auch nicht mehr. »Wie gut schießen Sie?«, fragte er.
»Besser als Sie, Special Agent.«
»Glauben Sie, Sie könnten aus einem fahrenden Auto eine Coladose am Straßenrand treffen?«
»Das hängt davon ab, wie schnell das Auto fährt.«
»Sagen wir mal dreißig.«
»In neun von zehn Fällen … ja.«
»Und was, wenn der Wagen sich mit fünfundachtzig bewegt?«
Franklin dachte kurz nach. »Dann vielleicht mit drei von zehn Schüssen.«
»Okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, der Wagen fährt fünfundachtzigtausend Meilen die Stunde und die Dose steht nicht länger am Straßenrand, sondern auf der anderen Seite des Landes auf dem Hollywood-Schriftzug. Könnten Sie sie dann auch noch treffen?« Franklin antwortete nicht darauf. »Hubble könnte das. Es könnte diese Dose ins Visier nehmen und ein Foto davon machen, das so ruhig und scharf ist, dass Sie die Aufschrift lesen könnten. Hubble fliegt ungefähr mit einer Geschwindigkeit von siebzehntausend Meilen die Stunde um die Erde, und trotzdem können wir es auf einen fünfzehn Milliarden Lichtjahre entfernten Punkt fixieren. Es ist eines der großen Wunderwerke der modernen Technik, ein Meilenstein der Wissenschaft. Deshalb kostet es auch so viel.«
»Und all das wird von Goddard aus kontrolliert?«
»Ja.«
Franklin schüttelte den Kopf. »Nicht mehr. Im Augenblick könnte Ihr vergoldetes Teleskop kein Scheunentor mehr treffen. Es dreht sich wie eine Flasche beim Flaschendrehen. Irgendjemand hat ein Virus hochgeladen, das die Steuerung außer Kraft gesetzt und jegliche Kommunikation unterbrochen hat.«
»Wirklich? So etwas ist … äh … sehr schwierig.«
»Wie schwierig?«
»Als ich in Goddard gearbeitet habe, hatten wir mal ein kleines Sicherheitsproblem. Eine der Bodenkontrollstationen für einen anderen Satelliten war über ein E-Mail-Konto zugänglich, und irgendein Teenager hat sich da reingehackt. Er hat keinen Schaden verursacht, aber ein paar Systeme wurden von dem Internetmist infiziert, den er eingeschleust hat. Das Problem war zwar schnell behoben, trotzdem hat man anschließend das gesamte System auf den Kopf gestellt. Wie viel wissen Sie über Cybersicherheit bei Regierungsstellen?«
»Ungefähr genauso viel wie Sie über Schusswaffen.«
»Okay. Alle staatlichen Computersysteme werden anhand des sogenannten Orange Books klassifiziert, das vom Verteidigungsministerium erstellt wurde. Darin stehen die spezifischen Sicherheitskriterien für alle Regierungssysteme. Sie reichen von D für unbedenkliche Dinge bis hin zu A1 für so etwas wie die NSA, das FBI und militärische Systeme zum Start von Nuklearwaffen. Nach dem Problem in Goddard hat man alle dortigen Systeme auf A1 hochgestuft. Das heißt, es ist mehr als unwahrscheinlich, dass jemand mit einem normalen Cyberangriff in die dortigen Systeme hat eindringen können. Das wäre in etwa so, als würde irgendein Junkie mit einer Zwanzig-Dollar-Pistole Fort Knox ausrauben. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss ganz genau gewusst haben, was er da tut.«
»Glauben Sie, das war ein Insider?«
»Eine andere Erklärung kann ich mir nicht vorstellen. Wir sollten mit Dr. Kinderman sprechen. Er hat die Verantwortung für Hubble und hat bei der Entwicklung der neuen Systeme mitgearbeitet. Er wird uns die Namen von allen geben können, die über das notwendige Wissen verfügen, sowie die von allen ehemaligen Mitarbeitern, die mit Goddard noch ein Hühnchen zu rupfen haben.«
»Das ist ja schön und gut, Agent Shepherd«, sagte Franklin. »Es gibt da nur einen kleinen Fehler in Ihrem perfekten Plan: Dr. Kinderman ist verschwunden. Im Augenblick ist er unser Hauptverdächtiger.«
KAPITEL 6
Acht Monate zuvorBadiyat al-Sham – Syrische WüsteIm Nordwesten des Irak
Als Gabriel Mann das Pferd in Richtung Horizont lenkte, war sein einziger Wunsch, so weit wie möglich weg von der Anlage zu kommen, bevor er starb.
Gabriel ritt in Richtung Nordwesten, ins leere Herz der Wüste. An der Schulter spürte er die Hitze der aufgehenden Sonne, und in der Nase hatte er den Geruch von Orangen. Er versuchte, nicht an all das zu denken, was er zurückließ, denn das machte es nur schwerer für ihn, und er musste das tun. Er musste sie verlassen.
Stattdessen konzentrierte er sich darauf, lange genug zu überleben, um weit, weit weg zu sein, wenn die Krankheit ihn überwältigte. Er wollte es nicht riskieren, andere zu infizieren. Auch durfte er nicht dort vom Pferd fallen, wo kreisende Bussarde menschliche Aasfresser anlocken könnten, die seine Kleider und Waffen stehlen und so auch etwas weit Tödlicheres mitnehmen würden. Gabriel musste an einem Ort sterben, wo ihn niemand finden würde, irgendwo, wo die Wüstensonne sein Fleisch trocknen und reinigen konnte und der Wind Staub über die sterile Erde blies, wo nichts wuchs und alles verging und vergessen wurde.
Gabriel war fast vier Stunden geritten, als das Fieber zuschlug. Die Hitze hatte sich nun schon eine Weile lang aufgebaut. Allerdings hatte Gabriel bis jetzt nicht sagen können, ob sie von der Sonne oder aus seinem Inneren kam. Er hatte gerade den spärlichen Schatten eines flachen, trockenen Wadis erreicht, dessen Ufer sein Pferd vor dem heißen Wind schützten, als seine Haut zu prickeln begann, als hätte sich plötzlich ein ganzer Schwarm Insekten auf ihn gestürzt. Gleichzeitig keimte ein Gefühl von unkontrollierbarer Trauer in ihm auf. Sosehr er sich auch bemühte, dieses Gefühl zu verdrängen, er dachte ständig nur an Liv. Vor seinem geistigen Auge sah er ihr Gesicht, das Grün ihrer Augen und wie ihr Haar hell und golden beim letzten Mal auf das Kissen gefallen war, als er sie in der Krankenstation gesehen hatte. Und die Traurigkeit darüber, sie verlassen zu haben, geschürt noch durch das Fieber, brach schließlich aus ihm hervor, und die Tränen rannen durch den Staub auf seinen Wangen. Zitternd wischte Gabriel sich übers Gesicht, und als er die Hand wieder herunternahm, war sie voller Blut.
Eine Pest, so hatte es der Mönch aus der Zitadelle genannt, ein starker Geruch nach Orangen gefolgt von heftigem Nasenbluten.
Es ist vorbei, dachte Gabriel und empfand tatsächlich so etwas wie Erleichterung. Jetzt kann ich mich hinlegen.
Gabriel lenkte sein Pferd zu einer Felsnase, unter der sich eine kleine Oase des Schattens in dem Meer aus blendendem Weiß befand. Das war es also: sein Grab.
Hier würde er sterben.
KAPITEL 7
Liv verbrachte den größten Teil des ersten Tages damit, sich auf einem der Wachtürme der Anlage vor der Hitze zu verstecken.
Als sie auf der Krankenstation aufgewacht war, war Gabriel verschwunden, und im Lager herrschte eine beängstigende Stille. Liv fand die Nachricht, die Gabriel ihr hinterlassen hatte, unter der Steintafel, die man die Sternenkarte nannte.
Geliebte Liv,nichts ist leicht im Leben, doch dich zu verlassen ist das Schwerste, was ich je getan habe. Jetzt weiß ich, wie mein Vater sich gequält haben muss, als er gegangen ist. Ich hoffe, wieder zurückzukehren, wenn ich kann. Bis dahin such nicht nach mir. Du sollst einfach nur wissen, dass ich dich liebe. Und pass auf dich auf – bis ich dich wiederfinde.
Gabriel
Liv hielt den Zettel in der Hand, als wäre er ein Zauber, mit dem sie Gabriel wieder zurückholen könnte. Immer wieder schaute sie von der riesigen Leere der Syrischen Wüste in die eingezäunte Bohrstelle zurück, wo in gutturalem Arabisch gestritten wurde, das sie aus irgendeinem Grund verstehen konnte. Bei den meisten Streitereien ging es um Geld beziehungsweise den Mangel daran, nun, da das Öl weg war, doch ein paar Diskussionen drehten sich auch um sie. Wütendes Flüstern stieg wie Rauch von einem schwelenden Feuer zu ihr hinauf, und man gab ihr Namen in den unterschiedlichsten Sprachen …
Hawwah
Ishtar
Lilith
Einige verteidigten sie, die meisten aber nicht. Die Mehrheit schimpfte sie eine Hexe, die Erdöl in Wasser verwandelt und sie damit alle ruiniert hatte.
Vollkommen regungslos wie ein Stein lauschte Liv den Stimmen, als könne sie sich so für die Männer unten unsichtbar machen. Sie lugte durch die Spalten in den von der Hitze ausgetrockneten Balken und Brettern des Turms und betrachtete die Trümmer der Schlacht, bei der die Anlage befreit worden war, aber nicht sie. Da war das Wrack des Militärhubschraubers, dessen Turbine stotternd versagt hatte, als Öl zu Wasser geworden war, und da war der See mit dem Bohrturm in der Mitte, aus dessen Zentrum nun Wasser sprudelte. Und überall waren rostrote Flecken auf dem Boden zu sehen, wo Männer gefallen und verblutet waren. Liv war sich ziemlich sicher, dass niemand sie gesehen hatte, als sie hier heraufgeklettert war. Trotzdem hielt sie das Skalpell fest in der Hand, das sie aus der Krankenstation hatte mitgehen lassen. Sie war sich der Tatsache nur allzu bewusst, dass sie die einzige Frau in einem isolierten Lager voller gewalttätiger und feindseliger Männer war, und sie wusste, wie das für gewöhnlich endete. Wenn sie bis zum Einbruch der Nacht unentdeckt blieb, konnte sie hinunterschleichen, sich eines der Pferde nehmen, die am Ufer tranken, und verschwinden.
Am späten Morgen hörte Liv dann schwere Stiefel auf der Metallleiter zum Turm. Leise rollte sie sich über den Boden. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und das Skalpell in ihrer Hand war glitschig von Schweiß. Sie kauerte sich an die Falltür und zog die Beine an, bereit, allem einen kräftigen Tritt zu verpassen, was in der Tür erschien.
Die Schritte kamen immer näher, schwer und laut, und hielten erst unmittelbar unter der Falltür an. »Hallo«, rief eine tiefe, süßliche Stimme auf Englisch zu ihr hinauf.
Liv antwortete nicht.
»Ich bringe Ihnen Wasser und etwas zu essen.« Langsam, ganz langsam öffnete eine Hand die Falltür und schob eine Feldflasche und eine Packung Kampfrationen durch den Spalt. Dann erschienen zwei Augen. »Es gibt keinen Grund zu kämpfen«, sagte der Mann. »Sie sind hier sicher. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf.«
»Wer sind Sie?«, verlangte Liv zu wissen. Nun, da man sie gefunden hatte, musste sie auch nicht mehr still sein.
»Ich bin Tariq al-Bedu. Ich bin mit Ash’abah geritten, dem Geist. Ich werde genauso auf Sie aufpassen, wie er es getan hat, und seinem Namen Ehre machen. Sie müssen trinken. Später bringe ich Ihnen mehr.«
Liv schaute auf die Feldflasche. Sie war noch nass, da man sie zum Füllen in den See getaucht hatte. »Danke«, sagte sie. Dann erinnerte sie sich daran, was sie selbst einmal in einem Artikel über das Überleben von Entführungsopfern geschrieben hatte, nämlich dass es schwerer war, jemandem wehzutun, den man mit Namen kannte, und so fügte sie hinzu: »Ich heiße Liv Adamsen.«
Der Mann lächelte, und Liv sah die Wärme in seinen Augen. »Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er und verschwand wieder.
Liv lauschte den Schritten auf der Leiter, bis sie mit dem Rauschen des Wassers aus dem Bohrloch verschmolzen. Dann zog sie die Feldflasche mit dem Fuß zu sich, denn sie wollte noch immer nicht zu nah an die Falltür heran. Sie drehte die Flasche auf, roch daran und trank einen winzigen Schluck. Sie nahm an, wenn sich irgendeine Droge darin befand, dann würde sie in so geringen Mengen wohl kaum Wirkung zeigen. Also wartete sie, solange ihr Durst das zuließ, ob etwas passierte. Als jedoch nichts geschah, trank sie einen weiteren Schluck, dann noch einen, und schließlich leerte sie die Feldflasche mit langen, kräftigen Zügen. Es dauerte keine Stunde, da kam der Mann wieder zurück und brachte ihr einen Apfel und erneut etwas Wasser. Anschließend ließ er sie in Ruhe und sorgte dafür, dass auch sonst niemand sie belästigte. Und schließlich, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, kamen die Soldaten.
Sie rollten in einer gewaltigen Staubwolke ins Camp, amerikanische Marines mit einer Mission. Einige Bewaffnete sicherten den zerstörten Helikopter, während andere einen Tieflader heranführten, um ihn so rasch wie möglich aufzuladen. Auch boten sie allen auf Arabisch eine Mitfahrgelegenheit nach Al-Hillah an. Liv nutzte die Ablenkung durch die Ankunft der Soldaten, um sich die Leiter hinunterzuschleichen. Unten angekommen duckte sie sich in die Schatten eines der Gebäude. Sosehr sie die Anlage auch verlassen wollte, sie wusste, dass das US-Militär sie eingehend verhören würde, und nach allem, was geschehen war, traute sie niemandem mehr. Sie ließ ihren Blick über die versammelten Männer schweifen und suchte nach Tariq. Ein Schatten fiel auf sie. Sie drehte sich um und sah einen stämmigen Mann in ölverschmiertem Overall, der sie hasserfüllt anfunkelte.
»Verflucht sollst du sein«, knurrte der Mann, spie vor ihr aus und hob die Hand zum Schlag. Liv packte ihr Skalpell, um sich zu wehren, doch dann trat Tariq zwischen sie und den Mann. »Geh«, sagte er zu dem Kerl, »und nimm deinen Zorn mit.«
Der Mann ließ die Hand wieder sinken. Einen Augenblick lang sah es so aus, als wolle er etwas sagen, doch dann spie er nur noch einmal aus und lief zu den wartenden Amerikanern.
»Das ist Malik«, sagte Tariq, den Blick fest auf den Mann gerichtet. »Er hat die Transporte hierher organisiert, bis das Benzin sich in Wasser verwandelt und seine Motoren zerstört hat. Er glaubt, Sie seien dafür verantwortlich.« Sie beobachteten, wie Malik sich an einem Truppentransporter anstellte. »Er geht zusammen mit all den anderen, die nun glauben, dass dieser Ort verflucht ist.«
Ein Marine trat zu den Wartenden und scheuchte sie in das Fahrzeug. Dann betätigte er einen Schalter, und die Ladeklappe schloss sich wieder. Sie waren bereit zum Aufbruch.
»Ich kann Sie bringen, wohin Sie wollen«, sagte Tariq. »Aber Sie wollen sicher noch ein Weilchen hierbleiben, denn es gibt noch viel zu tun, nicht wahr?«
Der Lärm der anspringenden Dieselmotoren erfüllte die Luft, während Liv über diese seltsame Aussage nachdachte. Als der Konvoi sich in Bewegung setzte, trat sie aus dem Schutz des Gebäudes. Vermutlich konnte sie die Fahrzeuge noch einholen, wenn sie wollte, doch sie stand einfach nur da und blickte der Staubwolke hinterher, bis sie am Horizont verschwand.
Schließlich drehte sie sich wieder um und ließ ihren Blick über die Leute schweifen, die geblieben waren. Die meisten davon waren Reiter, aber ein paar trugen auch die weißen Overalls der Arbeiter hier. Diese Männer versammelten sich nun um Liv und schauten sie erwartungsvoll an. »Was wollen die von mir?«, fragte Liv Tariq im Flüsterton.
»Sie wollen wissen, was sie tun sollen.«
Liv lachte. »Und wer hat mich hier zum Boss ernannt?«
Der Ring der Gesichter lächelte Liv an, ein Spiegelbild ihrer eigenen guten Laune. Es war, als hätten die Soldaten allen Zorn mitgenommen und nur ein paar Relikte der Gewalt zurückgelassen: Einschusslöcher an den Gebäuden und die rostroten Flecken auf der Erde. »Was ist mit den Toten geschehen?«, fragte Liv.
»Wir haben sie in einen Kühlwagen gelegt, um sie vor den Fliegen zu schützen«, antwortete Tariq. »Allerdings hat der Wagen keinen Treibstoff mehr. Also läuft auch das Kühlaggregat nicht.«
Liv nickte. »Okay«, sagte sie. »Dann lasst uns zuerst die Toten begraben.«
KAPITEL 8
Gabriel hatte keine Ahnung, wie lange er schon im Schatten des ausgetrockneten Wadis gelegen hatte, als er plötzlich das Geräusch von Motoren im Wind hörte.
Instinktiv rollte er sich herum. Trotz des Fiebers strömte Adrenalin durch seinen Körper, und der gut ausgebildete taktische Teil seines Gehirns übernahm das Kommando.
Er durfte nicht entdeckt werden, nicht solange die Pest in ihm brannte.
Gabriel schnappte sich die Zügel seines Pferds, um es dicht bei sich zu behalten, und lauschte. Er wollte feststellen, aus welcher Richtung das Geräusch kam. Der heiße Wind erschwerte es ihm jedoch, aber das hatte auch etwas Gutes: Wenn er das Geräusch nicht lokalisieren konnte, dann war es noch ein gutes Stück entfernt.
Gabriel zog sich an den Zügeln hoch, strich dem Pferd über die Flanken, um es zu beruhigen, und band es an einen Fels. Dann kämpfte er sich die Uferböschung des Wadis hinauf und schluckte das Schluchzen herunter, das noch immer aus ihm hervorzubrechen drohte. Schließlich erreichte er die Uferkante und lauschte erneut.
Das Geräusch näherte sich ihm. Es kam aus Richtung Westen.
Gabriels Haut brannte, als würden Feuerameisen darüber hinwegkriechen, und er ritt auf diesem Schmerz wie auf einer Welle, die Arme fest an die Seite gedrückt, um sich davon abzuhalten, die brennende Haut aufzukratzen. Als das Brennen ein wenig nachließ, legte er den Kopf auf die Seite und wagte vorsichtig einen Blick über den Rand des Wadis hinweg.