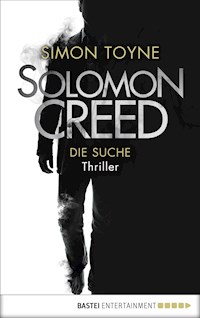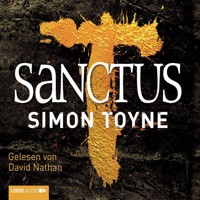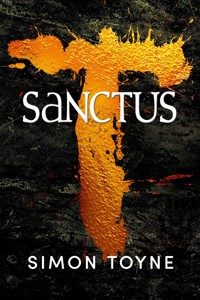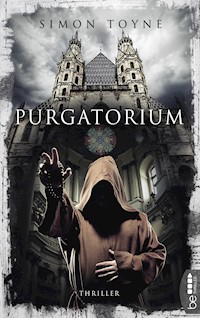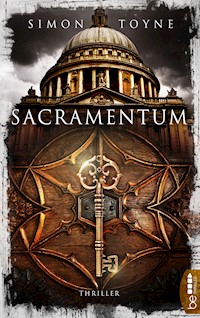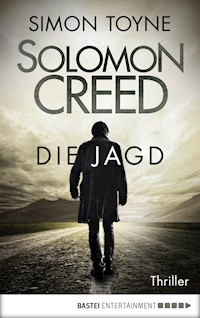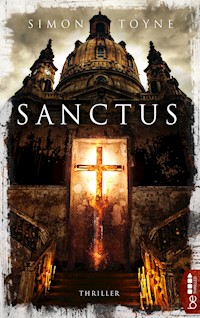
7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Verschwörung auf der Spur: Die Sanctus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Jagd nach dem ältesten Geheimnis der Menschheit hat begonnen!
Es gibt einen Ort, der für alle Welt verboten ist: die Bergzitadelle von Trahpah. Nun flimmern unglaubliche Bilder über die Fernsehschirme. Sie zeigen ein Kreuz auf dem Gipfel der verbotenen Festung. Ein Kreuz, das dort nicht stehen dürfte. Als die Kameras näher heranzoomen, wird ein Mönch erkennbar, die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt, den Kopf gesenkt. Erst nach Stunden bewegt er sich - und springt in den Tod. Nur wenige wissen: Das war ein symbolischer Akt, der die Augen der Welt auf Trahpah lenken sollte. Denn hier befindet sich das älteste Geheimnis der Menschheit, vom Orden der Sancti seit 3000 Jahren bewacht. Und nun ist die Zeit gekommen, dieses Geheimnis zu offenbaren - auch wenn es die Welt für immer verändern wird ...
Pressestimmen zu SANCTUS, einem Verschwörungsthriller erster Güte:
»Ein cooles, souveränes Debüt. Hochspannend.« Daily Telegraph.
»Ein explosives Mystery-Ereignis!« Büchermenschen.
»Herausragend!« Publishers Weekly.
»Faszinierend und fesselnd - und unglaublich rasant.« The Sun.
Die SANCTUS-Trilogie: Band 1: Sanctus, Band 2: Sacramentum, Band 3: Purgatorium.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
TEIL I
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
TEIL II
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
TEIL III
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
TEIL IV
KAPITEL 69
KAPITEL 70
KAPITEL 71
KAPITEL 72
KAPITEL 73
KAPITEL 74
KAPITEL 75
KAPITEL 76
KAPITEL 77
KAPITEL 78
KAPITEL 79
KAPITEL 80
KAPITEL 81
KAPITEL 82
KAPITEL 83
KAPITEL 84
KAPITEL 85
KAPITEL 86
KAPITEL 87
KAPITEL 88
KAPITEL 89
KAPITEL 90
KAPITEL 91
KAPITEL 92
KAPITEL 93
KAPITEL 94
KAPITEL 95
KAPITEL 96
KAPITEL 97
KAPITEL 98
KAPITEL 99
TEIL V
KAPITEL 100
KAPITEL 101
KAPITEL 102
KAPITEL 103
KAPITEL 104
KAPITEL 105
KAPITEL 106
KAPITEL 107
KAPITEL 108
KAPITEL 109
KAPITEL 110
KAPITEL 111
KAPITEL 112
KAPITEL 113
KAPITEL 114
KAPITEL 115
KAPITEL 116
KAPITEL 117
KAPITEL 118
KAPITEL 119
KAPITEL 120
KAPITEL 121
TEIL VI
KAPITEL 122
KAPITEL 123
KAPITEL 124
KAPITEL 125
KAPITEL 126
KAPITEL 127
KAPITEL 128
KAPITEL 129
KAPITEL 130
KAPITEL 131
KAPITEL 132
KAPITEL 133
KAPITEL 134
KAPITEL 135
KAPITEL 136
KAPITEL 137
KAPITEL 138
KAPITEL 139
KAPITEL 140
KAPITEL 141
KAPITEL 142
KAPITEL 143
KAPITEL 144
TEIL VII
KAPITEL 145
KAPITEL 146
KAPITEL 147
DANKSAGUNG
Widmung
Weitere Titel des Autors
Die SANCTUS-Trilogie:
Band 2:Sacramentum
Band 3:Purgatorium
SOLOMON CREED
Solomon Creed – Die Suche
Solomon Creed – Die Jagd
Über dieses Buch
Die Jagd nach dem ältesten Geheimnis der Menschheit hat begonnen!
Es gibt einen Ort, der für alle Welt verboten ist: die Bergzitadelle von Trahpah. Nun flimmern unglaubliche Bilder über die Fernsehschirme. Sie zeigen ein Kreuz auf dem Gipfel der verbotenen Festung. Ein Kreuz, das dort nicht stehen dürfte. Als die Kameras näher heranzoomen, wird ein Mönch erkennbar, die Arme zu beiden Seiten ausgestreckt, den Kopf gesenkt. Erst nach Stunden bewegt er sich – und springt in den Tod. Nur wenige wissen: Das war ein symbolischer Akt, der die Augen der Welt auf Trahpah lenken sollte. Denn hier befindet sich das älteste Geheimnis der Menschheit, vom Orden der Sancti seit 3000 Jahren bewacht. Und nun ist die Zeit gekommen, dieses Geheimnis zu offenbaren – auch wenn es die Welt für immer verändern wird …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Simon Toyne arbeitete über zwanzig Jahre lang als Produzent und Regisseur für das britische Fernsehen, bis seine Leidenschaft für spannende Geschichten ihn auf die Idee brachte, selbst Thriller zu schreiben. Das Ergebnis war sein spektakuläres Debüt SANCTUS. Heute erscheinen seine Bücher in 27 Sprachen und in mehr als 50 Ländern. Bastei Lübbe hat die SANCTUS-Trilogie und die SOLOMON-CREED-Reihe veröffentlicht.
Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.simontoyne.net/.
Simon Toyne
SANCTUS
Religionsthriller
Aus dem britischen Englisch vonRainer Schumacher
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Simon Toyne
Titel der englischen Originalausgabe: »Sanctus«
Originalverlag: HarperCollins Publishers
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Iurii Iaremenko/Shutterstock; tupungato/iStock/Getty Images Plus; koyu/iStock/Getty Images Plus; DavidMSchrader/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2164-6
be-thrilled.de
lesejury.de
TEIL I
»EIN MENSCHISTEIN GOTTIN RUINEN.«
Ralph Waldo Emerson
KAPITEL 1
Als er auf dem Boden aufschlug, zündete ein Lichtblitz in seinem Schädel.
Dann Dunkelheit.
Schwach war er sich bewusst, dass die schwere Eichentür hinter ihm geschlossen und ein dicker Riegel vorgeschoben wurde.
Eine Zeit lang lag er einfach nur da und lauschte dem Hämmern seines Pulses und dem traurigen Rauschen des Windes draußen.
Nach dem Schlag auf den Kopf fühlte er sich benommen, und ihm war schlecht, aber es bestand nicht die Gefahr, dass er das Bewusstsein verlor; dafür würde die quälende Kälte sorgen. Es war eine stille, alte Kälte, so unveränderlich und gnadenlos wie der Stein, aus dem die Zelle gehauen war. Sie drückte ihn nieder und legte sich wie ein Schleier um ihn; sie ließ die Tränen auf seinen Wangen gefrieren und das Blut zu Eis gerinnen, das aus den frischen Schnitten sickerte, die er sich selbst während der Zeremonie zugefügt hatte. Bilder tanzten durch seinen Geist – Bilder der schrecklichen Szenen, deren Zeuge er gerade geworden war, und des furchtbaren Geheimnisses, das er erfahren hatte.
Es war die Erfüllung einer lebenslangen Suche, das Ende einer Reise, von der er gehofft hatte, dass sie zu heiligem, alten Wissen führen würde, das ihn Gott näherbringen konnte. Nun hatte er endlich einen Blick auf dieses Wissen werfen können, doch was er gefunden hatte, war keine Göttlichkeit, sondern unvorstellbares Leid.
Wo war da Gott?
Frische Tränen brannten auf seinen Wangen, und die Kälte drang immer tiefer in seinen Leib und verstärkte den Griff um seine Knochen. Er hörte etwas auf der anderen Seite der Tür. Ein fernes Geräusch. Ein Geräusch, dem es irgendwie gelungen war, in den Bienenstock aus von Hand gegrabenen Tunneln vorzudringen, die den heiligen Berg durchzogen.
Sie werden mich bald holen kommen.
Die Zeremonie wird enden, und dann werden sie sich um mich kümmern …
Er kannte die Geschichte des Ordens, dem er gerade beigetreten war. Er kannte seine brutalen Regeln und nun auch sein Geheimnis. Sie würden ihn mit Sicherheit töten. Vermutlich langsam, vor den Augen seiner ehemaligen Brüder, ein Mahnmal für das, was geschah, wenn man die gnadenlosen Eide brach, die sie schwören mussten.
Nein!
Nicht hier. Nicht so.
Er drückte den Kopf auf den kalten Steinboden und richtete sich auf alle viere auf. Langsam und unter Schmerzen zog er den rauen grünen Stoff seiner Soutane über die Schultern. Die grobe Wolle scheuerte über die Wunden auf seinen Armen und seiner Brust. Er zog sich die Kapuze über den Kopf und brach wieder zusammen. Dann spürte er seinen eigenen, warmen Atem im Bart, und er zog die Knie unters Kinn. So blieb er liegen, bis die Wärme langsam wieder in den Rest seines Körpers zurückkehrte.
Weitere Geräusche hallten von irgendwo weit entfernt im Berg zu ihm herüber.
Er öffnete die Augen wieder. Ein schwacher Lichtschimmer fiel durch das schmale Fenster. Das Licht war gerade stark genug, um die Hauptmerkmale seiner Zelle erkennen zu können. Sie war vollkommen schmucklos, rein funktional. In einer Ecke lag ein Haufen Schutt – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dies einer von Hunderten von Räumen in der Zitadelle war, die nicht länger verwendet wurden.
Er schaute zum Fenster. Es war kaum mehr als ein Schlitz im Fels, ein vor Jahrhunderten in die Wand gehauenes Guckloch, das Bogenschützen freie Sicht auf anrückende Heere hatte geben sollen. Steif rappelte er sich auf und wankte auf die Schießscharte zu.
Der Sonnenaufgang lag noch in weiter Ferne. Kein Mond schien am Firmament, nur ein paar Sterne. Trotzdem kniff er unwillkürlich die Augen zusammen, als ein Licht ihn durch das Fenster blendete. Es stammte von Zehntausenden von Straßenlaternen und Reklametafeln, die sich unter ihm bis zu den fernen Bergen erstreckten. Es war das harte, stete Glühen der modernen Stadt Trahpah.
Er schaute auf die Metropole hinunter, auf die Welt, der er auf seiner Suche nach Wahrheit vor acht Jahren den Rücken zugekehrt hatte – einer Suche, die ihn schlussendlich in diesen uralten Kerker und zu einer Entdeckung geführt hatte, an der seine Seele zerbrochen war.
Wieder ein gedämpftes Geräusch. Diesmal näher.
Er musste schnell sein.
Er zog sich den Strick aus, der ihm als Gürtel diente. Mit geübtem Geschick knüpfte er das eine Ende zu einer Schlinge, trat dann ans Fenster, beugte sich hinaus und tastete auf dem eisigen Fels nach etwas, das ihm als Haken dienen konnte. Schließlich fand er ein vorspringendes Stück Stein. Er warf die Schlinge darüber, lehnte sich zurück, zog sie fest und prüfte ihren Halt.
Sie hielt.
Er steckte sein langes blondes Haar hinter die Ohren und warf einen letzten Blick auf den pulsierenden Lichtteppich unter ihm. Dann, das Herz schwer von dem uralten Geheimnis, das er nun mit sich trug, atmete er so tief ein, wie seine Lunge es ihm gestattete, zwängte sich durch den Spalt und sprang in die Nacht hinaus.
KAPITEL 2
Neun Stockwerke weiter unten, in einem Raum, der so prachtvoll war wie der andere kahl, wusch sich ein anderer Mann das Blut von seinen eigenen, frischen Wunden.
Wie im Gebet kniete er vor einem riesigen Kamin. Sein langes Haar und der Bart waren vom Alter silbern und oben auf dem Kopf dünn, was ihm schon von Natur aus ein mönchisches Aussehen verlieh. Auch er trug wie der Gefangene eine grüne Soutane.
Sein Körper zeigte zwar die ersten Spuren des Alters, war aber trotzdem noch fest und drahtig. Gut trainierte Muskeln bewegten sich unter seiner Haut, als er das Tuch methodisch in die Kupferschüssel neben sich tunkte, das kalte Wasser abtropfen ließ und schließlich die Wunden damit abtupfte. Jedes Mal drückte er das Tuch ein paar Augenblicke lang auf die Wunden; dann wiederholte er das Ritual.
Als die Schnitte an seinem Hals, seinen Armen und an seinem Rumpf zu heilen begonnen hatten, trocknete er sie mit frischen Handtüchern ab und stand auf. Sorgfältig zog er seine Kapuze wieder über den Kopf. Dabei spendete ihm das Brennen der Wunden unter dem groben Stoff seltsamerweise sogar Trost. Er schloss die blassgrauen Augen und atmete tief durch. Unmittelbar nach der Zeremonie hatte er schon immer ein Gefühl absoluter Ruhe, Entspanntheit und Befriedigung empfunden, denn er war es, der die größte Tradition seines Ordens am Leben hielt. Er versuchte, dieses Gefühl so lange wie möglich zu genießen, bevor er wieder in den Alltag seines Amtes zurückkehren musste.
Ein zaghaftes Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken.
»Herein.« Er griff nach dem Strick, der ihm als Gürtel diente.
Die Tür öffnete sich, und das Licht des Kaminfeuers spiegelte sich auf dem reich verzierten und mit Gold beschlagenen Holz. Stumm schlüpfte ein Mönch in den Raum und schloss die Tür hinter sich wieder. Auch er trug eine grüne Soutane und Haar und Bart lang, wie es in ihrem alten Orden üblich war.
»Vater Abt …« Der Mönch sprach leise, fast verschwörerisch. »Bitte, verzeih mein Eindringen zu dieser späten Stunde, aber ich dachte, du solltest es sofort erfahren.«
Er senkte den Blick, als wisse er nicht, wie er fortfahren solle.
»Dann sag es mir auch sofort«, knurrte der Abt, band sich den Gürtel und steckte sein Kruzifix hinein, ein hölzernes Kreuz in Form des Buchstaben ›T‹.
»Wir haben Bruder Samuel verloren …«
Der Abt erstarrte.
»Was meinst du mit ›verloren‹? Ist er tot?«
»Nein, Vater Abt. Ich meine … Er ist nicht in seiner Zelle.«
Der Abt packte sein Kruzifix, bis sich das Holz in sein Fleisch bohrte. Dann, als Logik seine Angst stillte, entspannte er sich wieder.
»Dann ist er wohl gesprungen«, sagte er. »Lass das Gelände absuchen und die Leiche bergen, bevor sie entdeckt werden kann.«
In der Erwartung, der Mönch würde augenblicklich hinauseilen, drehte er sich um und zog seine Soutane zurecht.
»Verzeih mir, Vater Abt«, fuhr der Mönch jedoch fort und starrte weiterhin zu Boden, »aber wir haben bereits gründlich gesucht. Wir haben Bruder Athanasius im selben Moment informiert, als wir Samuels Fehlen bemerkt haben. Er hat Kontakt nach draußen hergestellt und an den Fundamenten eine Suche in die Wege geleitet. Eine Leiche ist nirgends zu sehen.«
Die Ruhe, die der Abt noch vor wenigen Minuten genossen hatte, löste sich nun endgültig auf.
Früher in dieser Nacht war Bruder Samuel bei den Sancti aufgenommen worden, dem inneren Kreis ihres Ordens, eine Bruderschaft, die so geheim war, dass nur jene, die tatsächlich im Berg lebten, überhaupt von ihrer Existenz wussten. Der Initiationsritus war auf traditionelle Art durchgeführt worden, und schließlich hatte man den Anwärter in das uralte Sakrament eingeführt, das heilige Geheimnis, das zu beschützen und zu bewahren ihr Orden gegründet worden war. Während der Zeremonie war jedoch offensichtlich geworden, dass Bruder Samuel diesem Wissen nicht gewachsen war. Das war nicht das erste Mal, dass ein Mönch im Augenblick der Erleuchtung versagt hatte. Das Geheimnis, das zu bewahren sie sich verpflichtet hatten, war machtvoll und gefährlich, und egal wie gut man einen Anwärter auch vorbereitete, wenn der Augenblick kam, war es manchmal schlicht zu viel. Bedauerlicherweise war jemand, der die Last des Geheimnisses nicht tragen konnte, fast genauso gefährlich wie das Geheimnis selbst. In diesen Fällen war es sicherer und vielleicht auch gnädiger, das Leiden desjenigen so schnell wie möglich zu beenden.
Bruder Samuel war solch ein Fall gewesen.
Und nun war er verschwunden.
Solange er sich in Freiheit befand, war das Sakrament in Gefahr.
»Findet ihn«, befahl der Abt. »Sucht noch mal das Gelände ab. Dreht jeden Grashalm um, wenn es sein muss, aber findet ihn.«
»Jawohl, Vater Abt.«
»Solange die Engel sich seiner nicht erbarmt haben, ist er gestürzt, und er muss irgendwo in der Nähe aufgeprallt sein. Und wenn er nicht gefallen ist, dann muss er sich irgendwo in der Zitadelle befinden. Also sichert sämtliche Ausgänge und durchkämmt jeden Raum, bis ihr entweder Bruder Samuel oder seine Leiche gefunden habt. Hast du verstanden?«
Er trat die Kupferschüssel ins Feuer. Eine Dampfwolke stieg empor und erfüllte die Luft mit einem unangenehmen, metallischen Gestank. Der Mönch starrte weiterhin zu Boden und wartete verzweifelt darauf, entlassen zu werden, doch der Abt war in Gedanken woanders.
Als das Zischen verklungen war und das Feuer sich wieder beruhigt hatte, schien auch der Abt sich wieder entspannt zu haben.
»Er muss gesprungen sein«, sagte er schließlich. »Also muss seine Leiche auch irgendwo auf dem Gelände liegen. Vielleicht ist er ja in einem Baum gelandet. Vielleicht hat ihn im Fall ja eine Bö erfasst, und jetzt liegt er an einem Ort, an den ihr noch nicht gedacht habt. Aber wir müssen ihn noch vor Sonnenaufgang finden … bevor die Touristenbusse kommen.«
»Wie du wünschst.«
Der Mönch verneigte sich und schickte sich an zu gehen, doch ein Klopfen erschreckte ihn. Er schaute auf und sah einen weiteren Mönch kühn den Raum betreten; der Mann hatte noch nicht einmal darauf gewartet, dass der Abt ihn hereinbat. Der Neuankömmling war klein und schlank, und sein kantiges Gesicht und die tief in den Höhlen liegenden Augen verliehen ihm ein Aussehen panischer Intelligenz, als verstehe er mehr, als er verstehen wollte. Dennoch strahlte er eine ruhige Autorität aus, obwohl er nur die braune Soutane der Administrata trug, des niedrigsten Ranges in der Zitadelle. Es war der Kammerherr des Abts, Athanasius, ein Mann, den man im ganzen Berg sofort erkannte, denn im Gegensatz zu den ansonsten langhaarigen und langbärtigen Mönchen war er vollkommen kahl. Athanasius warf einen Blick auf den Besucher des Abts, sah die Farbe der Soutane und wandte sich sofort ab. Laut den strengen Regeln der Zitadelle waren die ›Grünkittel‹, die Sancti, von den anderen isoliert. Als Kammerherr des Abts lief Athanasius dem einen oder anderen schon mal über den Weg, doch jegliche Form der Kommunikation mit ihnen war verboten.
»Bitte, verzeih mein Eindringen, Vater Abt«, sagte Athanasius und strich sich bedächtig über den kahlen Kopf – das tat er immer, wenn er unter Stress stand. »Ich möchte dich nur darüber informieren, dass Bruder Samuel gefunden worden ist.«
Der Abt lächelte und breitete die Arme aus, als wolle er die gute Nachricht umarmen.
»Da hätten wir’s ja«, rief er. »Alles ist wieder im Lot. Das Geheimnis ist bewahrt und die Sicherheit unseres Ordens wiederhergestellt. Sag mir, Athanasius, wo habt ihr die Leiche entdeckt?«
Noch immer strich der Kammerherr sich mit der Hand über den blassen Schädel. »Es gibt keine Leiche.« Er hielt kurz inne. »Bruder Samuel ist nicht vom Berg gesprungen. Er ist aus dem Fenster geklettert. Man hat ihn in gut dreihundert Meter Höhe auf der Ostseite entdeckt.«
Der Abt ließ die Arme sinken, und erneut schlich sich ein Schatten auf sein Gesicht.
Vor seinem geistigen Auge sah er die vertikale Granitwand, die eine Seite der heiligen Festung bildete.
»Egal.« Er winkte ab. »Niemand kann die Ostseite erklettern, und uns bleiben noch mehrere Stunden bis Tagesanbruch. Bis dahin wird er ermüden und zu Tode stürzen. Und selbst wenn er es auf wundersame Weise bis nach unten schaffen sollte, werden unsere Brüder sich ihn schnappen. Nach einer solchen Kletterpartie wird er vollkommen erschöpft sein. Mit Widerstand ist also nicht zu rechnen.«
»Natürlich, Vater Abt«, sagte Athanasius, »es ist nur …« Er hörte einfach nicht auf, sich über den Kopf zu streichen.
»Was?«, schnappte der Abt.
»Es ist nur … Bruder Samuel klettert nicht den Berg hinunter.« Endlich nahm Athanasius die Hand herunter. »Er klettert hinauf.«
KAPITEL 3
Der schwarze Wind wehte durch die Nacht, glitt über die Gipfel und den Gletscher zur Ostseite der Stadt und trug die prähistorischen Reste freigelegter Moränen mit sich.
Je tiefer er auf die Ebene von Trahpah herniederging, desto mehr legte er an Geschwindigkeit zu. Er flüsterte durch die antiken Weinberge, Oliven- und Pistazienhaine an den unteren Hängen und hielt auf den Neonschein der riesigen Stadt zu, wo er die Baldachine flattern ließ und an der rot-goldenen Sonnenfahne Alexanders des Großen, dem Vexillum der vierten römischen Legion und all den anderen Standarten der frustrierten Armeen zerrte, die den düsteren Berg erfolglos belagert hatten, um an sein Geheimnis zu gelangen.
Und der Wind wehte weiter, jetzt über den breiten, geraden Ost-Boulevard, vorbei an der von Suleiman dem Prächtigen erbauten Moschee und über den steinernen Balkon des Hotels Napoleon. Einst hatte der große General dort gestanden, während seine Armee die Stadt geplündert hatte. Auch er hatte nur zum Berg hinaufschauen können. Erobern konnte er ihn nie. Der Felsendolch war wie ein Dorn in der Seite von Napoleons unvollständigem Reich gewesen, und auch später noch, auf dem Sterbebett im Exil, hatte er ihn in seinen Träumen geplagt.
Der Wind rauschte weiter gen Osten, über die hohen Mauern der Altstadt hinweg, und zwängte sich durch enge Straßen, die einst das Vorrücken des Feindes hatten behindern sollen.
Schließlich wehte er über die Stadtmauer, ließ das Gras im heutzutage ausgetrockneten Wassergraben rauschen und traf schließlich auf den Berg, in den er nicht eindringen konnte. So stieg er senkrecht auf und fand schlussendlich die einsame Gestalt in der dunkelgrünen Soutane eines Ordens, den man seit dem 13. Jahrhundert nicht mehr gesehen hatte, und die sich langsam, aber unbeirrt die steile, vereiste Wand hinaufbewegte.
KAPITEL 4
Samuel hatte schon seit sehr, sehr langer Zeit nichts so Herausforderndes mehr erklettert wie die Zitadelle. Jahrtausende voller Hagelstürme und eiskaltem Wind hatten den Fels so blank poliert wie Glas, sodass Samuel kaum einen Halt fand, während er sich zum Gipfel hinaufquälte.
Und dann war da die Kälte.
Der eisige Wind drang ihm bis ins Herz. Seine Haut gefror bei jedem Kontakt, sodass er ein paar Augenblicke lang Halt hatte, bis er sie wieder losreißen musste, um nicht festzukleben. Der Wind tobte um ihn herum und versuchte, ihn mit unsichtbaren Fingern in den Tod zu reißen.
Der Strickgürtel, den er sich um den rechten Arm geschlungen hatte, scheuerte die Haut von seinem Handgelenk, denn er musste das Seil immer wieder nach oben, zu winzigen Vorsprüngen werfen, die er ansonsten nie erreicht hätte. Jedes Mal zerrte er hart am Seil, bis die Schlinge sich um was auch immer festgezogen hatte. So arbeitete er sich Zentimeter für Zentimeter mit schierer Willenskraft den unbezwingbaren Monolithen hinauf.
Die Zelle, aus der er entkommen war, lag nicht weit entfernt von der Kammer, in der das Sakrament vollzogen wurde, im obersten Teil der Zitadelle. Je höher Samuel kam, desto weniger lief er Gefahr, in die Nähe einer anderen Zelle zu kommen, wo die Mönche vielleicht auf ihn warten würden.
Plötzlich wurde der bis jetzt so harte und glasige Fels zerklüftet und brüchig. Samuel war zu einer anderen geologischen Schicht vorgestoßen. Hier fanden sich tiefe Spalten im Fels, was das Klettern erleichterte, aber auch riskanter machte. Zwar fand Samuel hier öfter einen Halt, doch der konnte plötzlich wegbrechen. Er stieß seine Finger aus Angst und Verzweiflung tief in die Spalten hinein. So hielten sie sein Gewicht, aber sie rissen ihm auch das Fleisch auf.
Je höher er kam, desto stärker wurde der Wind, und die Felswand bog sich langsam nach vorne. Die Schwerkraft, die ihm bis hierhin geholfen hatte, drohte nun, ihn vom Berg herunterzuziehen. Zweimal, als ein Stück Fels in seiner Hand brach, bewahrte ihn nur das Seil um sein Handgelenk und die kraftvolle Überzeugung, dass die Reise seines Lebens noch nicht vorüber war, vor einem Sturz in die Finsternis.
Schließlich, nach einer halben Ewigkeit, tastete Samuel nach dem nächsten Halt und fand nur Luft. Seine Hand fiel auf eine gerade Fläche, über die der Wind ungehindert in die Nacht rauschte.
Samuel packte die Kante und zog sich nach oben. Mit tauben, geschundenen Füßen stieß er sich ein letztes Mal ab und wuchtete sich auf den Fels, der so kalt war wie der Tod. Vorsichtig kroch er ins Zentrum der Felsplatte und tastete die Ränder ab. Sie war nicht größer als die Zelle, aus der er entkommen war, aber während er dort unten ein hilfloser Gefangener gewesen war, fühlte er sich hier wie immer, wenn er einen scheinbar unbezwingbaren Gipfel erklommen hatte: ekstatisch und schier unglaublich frei.
KAPITEL 5
Die Frühlingssonne stieg früh und klar über den Horizont und warf lange Schatten ins Tal. Um diese Jahreszeit erhob sie sich über die roten Gipfel des Taurusgebirges und schien direkt auf den großen Boulevard, der ins Herz der Stadt führte, wo die Straße, die die Zitadelle umrundete, ihn mit drei weiteren antiken Hauptstraßen verband. Alle vier Straßen zusammen bildeten dabei exakt eine Kompassrose.
Mit der Sonne erklang der traurige Ruf des Muezzins von der Moschee im Osten der Stadt. Er rief die Gläubigen zum Gebet, so wie er es immer getan hatte, seit die einst christliche Stadt im 7. Jahrhundert an die Araber gefallen war. Gleichzeitig traf der erste Touristenbus des Tages ein. Verschlafen und übellaunig vom frühen Aufstehen sammelten sich die Touristen am Fallgatter.
Während sie dort standen und gähnend auf den Beginn ihrer Kulturtour warteten, verhallte der Ruf des Muezzins und wich einem anderen, unheimlichen Geräusch, das durch die antiken Straßen jenseits der schweren Holztore zog. Es war ein Geräusch, das jedem der Touristen bis in die Knochen drang, ihre intimsten Ängste weckte und sie instinktiv die Mäntel enger ziehen ließ. Es klang wie ein Insektenschwarm, der tief im Inneren der Erde zum Leben erwacht war, oder ein großes Schiff, das zerbrach und in der Stille des bodenlosen Meeres versank. Ein paar der Touristen schauten einander nervös an, und sie schauderten unwillkürlich, bis das Geräusch schließlich die Form eines Summens hunderter männlicher Stimmen annahm, die heilige Worte in einer Sprache intonierten, die niemand verstand.
Plötzlich rührte sich das riesige Fallgatter, und die meisten Touristen erschraken, als Elektromotoren es an verstärkten Stahlkabeln hochzogen, die im Mauerwerk verborgen waren, um das antike Bild nicht zu stören. Das Dröhnen der Elektromotoren übertönte den Gesang der Mönche, und als das Fallgatter schließlich einrastete, war der Gesang verstummt, und das Touristenheer drang schweigend in die steilen Straßen vor, die zur ältesten Festung der Welt führten.
Sie suchten sich ihren Weg durch ein komplexes Labyrinth aus Kopfsteinpflasterstraßen und trotteten mit stetem Schritt an den Badehäusern vorbei, wo man schon lange, bevor die Römer die Idee übernommen hatten, das wundersame Heilwasser von Trahpah genossen hatte. Dann ging es an alten Waffenkammern und Schmieden vorüber, die inzwischen Restaurants und Souvenirläden beherbergten, wo man Nachbildungen des Heiligen Grals, abgefülltes Heilwasser und Kruzifixe verkaufte, und schließlich erreichten sie den Hauptplatz, der auf einer Seite von einer riesigen Kirche eingerahmt war, dem einzigen heiligen Haus, das zu betreten ihnen auf dem Stadtgebiet erlaubt war.
Wenn sie die Fassade hinaufschauten, bemerkten einige der unverschämteren Touristen den Kirchendienern gegenüber immer wieder, dass die Zitadelle ja ganz und gar nicht so aussehe wie in den Reiseführern. Wenn man sie dann auf einen imposanten Torbogen auf der anderen Seite des Platzes hinwies, drehten sie sich um, und vor lauter Staunen klappte ihnen das Kinn herunter. Grau, monumental und gewaltig erhob sich dort ein Felsenturm vor ihnen, geformt aus Rampen, Wehrgängen und Bastionen und hier und da von einem Buntglasfenster durchbrochen, dem einzigen Hinweis auf den heiligen Zweck des Bergs.
KAPITEL 6
Dieselbe Sonne, die auf die langsam vorrückende Touristenarmee schien, wärmte auch Samuel, der vierhundert Meter über ihnen reglos auf dem Felsen lag.
Mit der Wärme kehrte auch allmählich das Gefühl wieder in seine Glieder zurück und damit auch der Schmerz. Samuel setzte sich mühsam auf und verharrte so einen Moment lang, die Augen noch immer geschlossen und die zerschundenen Hände flach auf die Felsplatte gedrückt. Schließlich öffnete er die Augen wieder und blickte auf die Stadt hinunter.
Er begann zu beten, wie er es immer tat, wenn er es sicher auf den Gipfel eines Bergs geschafft hatte.
Gütiger Gott, der du bist unser Vater …
Doch kaum formten seine Lippen diese Worte, da erschien ein Bild vor seinem geistigen Auge, und er geriet ins Stocken. Er musste erkennen, dass er nicht länger sicher war, zu wem oder was er eigentlich betete – nicht nach der Hölle, deren Zeuge er gestern Nacht geworden war, nicht nach den Obszönitäten, die in Seinem Namen stattgefunden hatten. Samuel spürte den kalten Fels unter seinen Fingern, denselben Fels, aus dem weiter unten auch die Kammer des Sakraments gehauen war. Und diese Kammer stellte er sich nun vor – sie und das, was sie enthielt, und er empfand Staunen, Schrecken und Scham.
Die Tränen traten ihm in die Augen, und Samuel suchte nach etwas in seinem Geist, nach irgendetwas, was dieses furchtbare Bild ersetzen konnte. Die warme, aufsteigende Luft brachte den Geruch in der Sonne getrockneten Grases mit und weckte eine Erinnerung in Samuel. In seinem Kopf nahm ein Bild Gestalt an, das Bild eines Mädchens, zuerst nur vage, doch dann immer deutlicher. Es war ein fremdes und vertrautes Gesicht zugleich, ein Gesicht aus der Vergangenheit, ein Gesicht voller Liebe.
Samuels Hand bewegte sich instinktiv zu seiner Seite, dorthin, wo sich seine älteste Narbe befand. Sie war nicht mehr frisch und blutig, sondern schon lange verheilt. Während Samuel nun auf sie drückte, spürte er noch etwas anderes, tief in seiner Tasche vergraben. Er holte es heraus und schaute auf einen kleinen, weichen Apfel, den Rest der schlichten Mahlzeit, die er am vergangenen Abend im Refektorium kaum hatte hinunterbekommen können. Er war einfach viel zu nervös gewesen. Schließlich würde man ihn in wenigen Stunden in die älteste und heiligste Bruderschaft der Welt aufnehmen. Und nun war er hier: in seiner persönlichen Hölle auf dem Gipfel der Welt.
Samuel verschlang den Apfel, und die Süße strömte in seinen schmerzenden Leib und verlieh seinen erschöpften Muskeln neue Kraft. Er aß den Apfel gänzlich auf; nur die Kerne spie er in seine aufgescheuerte Hand. Dabei bemerkte er einen Steinsplitter, der sich tief ins Fleisch gebohrt hatte. Er packte ihn mit den Zähnen und riss ihn heraus.
Dann spie er auf den blutigen Stein, eine winzige Replik des schmalen Gipfels, auf dem er nun hockte. Samuel wischte den Splitter mit dem Daumen sauber und schaute ihn sich an. Er war von der gleichen Farbe und Beschaffenheit wie das häretische Buch, das man ihm zur Vorbereitung in den Tiefen der großen Bibliothek gezeigt hatte. Die Seiten waren aus einem ähnlichen Stein gefertigt und von einer längst zu Staub zerfallenen Hand mit Symbolen graviert worden. Die Worte, die Samuel dort gelesen hatte, eine Prophezeiung, warnten vor dem Ende aller Dinge, sollte das Sakrament je außerhalb der Zitadelle bekannt werden.
Samuel ließ seinen Blick über die Stadt schweifen. Die Morgensonne spiegelte sich in seinen grünen Augen. Samuel dachte an all die Menschen dort unten, die ihr Leben lebten und in Gedanken und Tat nach dem Guten strebten, um Gott näherzukommen. Nach all den Tragödien in seinem Leben war er hierhergekommen, zur Quelle des Glaubens, um sich denselben Zielen zu widmen. Und nun kniete er hier, so hoch wie es nur ging, auf dem heiligsten aller Berge …
… und er fühlte sich dem Herrn so fern wie nie.
Bilder zogen durch seinen verdüsterten Geist: Bilder dessen, was er verloren hatte, und Bilder dessen, was er erfahren hatte. Und als die prophetischen Worte, die in den heiligen Stein des ketzerischen Buches graviert waren, in seine Erinnerung krochen, sah er etwas Neues in ihnen, und was er zuerst als Warnung empfunden hatte, strahlte nun wie eine Offenbarung.
Samuel hatte das Wissen um das Sakrament schon so weit aus der Zitadelle hinausgetragen … wie weit mochte er da noch kommen? Vielleicht würde er ja derjenige sein, der Licht in diesen finsteren Berg brachte und damit dem ein Ende bereitete, was er vergangene Nacht hatte sehen müssen. Und selbst falls er sich irren sollte, falls seine Glaubenskrise schlicht die Schwäche eines Menschen sein sollte, der das Göttliche in alledem nicht erkennen konnte, dann würde Gott doch sicherlich verhindern, dass das Geheimnis nach außen drang. Dann würde alles so bleiben, wie es war, und wer würde schon den Tod eines verwirrten Mönchs betrauern?
Samuel schaute in den Himmel hinauf. Die Sonne war weiter aufgestiegen – der Lichtbringer, der Lebensspender. Sein Verstand war wieder klar und scharf.
Und er wusste, was er zu tun hatte.
KAPITEL 7
Über zehntausend Kilometer westlich von Trahpah stand eine schlanke, blonde Frau mit feinen nordischen Zügen im Central Park, eine Hand auf dem Geländer der Bow Bridge, in der anderen einen Brief, der an Liv Adamsen adressiert war. Er war vom wiederholten Betrachten zerknüllt, aber noch ungeöffnet. Liv blickte auf die graue, wabernde Skyline von New York im Wasser und erinnerte sich an das letzte Mal, als sie hier gestanden hatte. Das war mit ihm gewesen, beide als Touristen, und die Sonne hatte geschienen. Jetzt schien sie nicht.
Der Wind wirbelte die Wasseroberfläche auf und trieb die paar vergessenen Ruderboote am Steg gegeneinander. Liv steckte sich eine blonde Haarsträhne hinters Ohr und schaute wieder auf den Umschlag hinab. Ihre scharfen grünen Augen waren ausgetrocknet vom Wind und der Anstrengung, nicht zu weinen. Der Brief war vor fast einer Woche in ihrer Post aufgetaucht. Wie eine Viper hatte er zwischen den üblichen Kreditkartenabrechnungen und Pizzaservicekarten gelauert. Zuerst hatte Liv ihn für eine weitere Rechnung gehalten, doch dann hatte sie den Absender gesehen. Beim Inquirer bekam sie solche Briefe dauernd, Hardcopys von Informationen, die sie für was auch immer für eine Story brauchte, an der sie gerade arbeitete. Dieser Brief hier kam vom Standesamt, wo die heilige Dreifaltigkeit des menschlichen Lebens verwaltet wurde: Geburt, Hochzeit, Tod.
Vor Schock wie benommen hatte Liv den Brief einfach in ihre Tasche gestopft, und dort war er seitdem begraben gewesen, versteckt zwischen Quittungen und Notizbüchern, dem Stoff ihres Lebens. Er hatte auf den richtigen Moment gewartet, geöffnet zu werden, obwohl dieser Augenblick niemals kommen würde. Schließlich, nach einer Woche, in der Liv ihn immer wieder gesehen hatte, wenn sie nach ihren Schlüsseln oder ihrem Handy gekramt hatte, hatte irgendetwas in ihrem Kopf geflüstert, und sie hatte früh zu Mittag gegessen und einen Zug von New Jersey ins Herz der großen, anonymen Stadt genommen. Dort kannte sie niemand, und die Erinnerungen, die die Stadt in ihr weckte, passten zu den Umständen. Außerdem würde niemand auch nur mit der Wimper zucken, sollte sie hier unvermittelt den Verstand verlieren.
Liv verließ die Brücke, ging zum Ufer und holte ein Päckchen Lucky Strike aus ihrer Tasche. Mit der Hand schützte sie das Feuerzeug vor dem Wind und zündete sich eine Zigarette an. Dann stand sie einen Augenblick lang einfach nur am Ufer, atmete den Rauch ein und lauschte den gegeneinanderschlagenden Booten und den fernen Geräuschen der Stadt. Schließlich steckte sie den Finger unter die Umschlagklappe und riss sie auf.
Im Inneren befanden sich ein Brief und ein gefaltetes Dokument. Layout und Sprache waren Liv nur allzu vertraut, doch die Worte waren auf schreckliche Art anders. Ihr Blick huschte über den Text hinweg, und sie las ihn mehr in Clustern, denn als Ganzes:
… achtjährige Abwesenheit …
… keine neuen Beweise …
… offiziell für tot erklärt …
Liv faltete das Dokument auseinander, las seinen Namen und fühlte, wie irgendetwas in ihr nachgab. Die verdrängten Emotionen der vergangenen Jahre brachen mit aller Gewalt an die Oberfläche. Liv begann, unkontrolliert zu schluchzen. Ihre Tränen waren jedoch nicht nur Tränen der Trauer – die hieß sie seltsamerweise sogar willkommen –, sie weinte auch ob der Einsamkeit, die sie plötzlich empfand.
Liv dachte an den letzten Tag zurück, den sie mit ihm verbracht hatte. Wie ein Paar Hinterwäldler waren sie durch die Stadt getourt. Sie hatten sich sogar eines der Boote gemietet, die jetzt kalt und leer am Steg lagen. Liv versuchte, die Erinnerung daran heraufzubeschwören, doch über Bruchstücke kam sie nicht hinaus: die Bewegungen seines großen, sehnigen Körpers beim Rudern, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, sodass die hellblonden Haare auf seinen leicht gebräunten Armen zu sehen waren; die Farbe seiner Augen und die Art, wie die Haut um sie herum sich in Falten legte, wann immer er lächelte. Sein Gesicht blieb jedoch verschwommen. Einst war es ständig präsent gewesen. Liv hatte nur seinen Namen aussprechen müssen, und schon hatte sie es gesehen. Aber heutzutage erschien meist ein Betrüger, der dem Jungen, den sie einst gekannt hatte, zwar ähnelte, doch er war es nicht.
Verzweifelt versuchte Liv, sich zu konzentrieren und der Erinnerung Gestalt zu verleihen, und schließlich erschien tatsächlich ein echtes Bild. Sie sah ihn als Jungen, der mit viel zu großen Rudern auf dem See nicht weit von Granny Jansens Haus kämpfte. Granny Jansen hatte sie aufs Wasser hinausgeschickt und ihnen hinterhergerufen: »Eure Vorfahren waren Wikinger. Erst wenn ihr das Wasser beherrscht, werde ich euch wieder an Land lassen …«
Sie hatten den ganzen Nachmittag auf dem Wasser verbracht und sich beim Rudern abgewechselt, bis das hölzerne Boot sich wie ein Teil von ihnen angefühlt hatte. Granny hatte ein Siegespicknick für sie im von der Sonne warmen Gras vorbereitet und sie Ask und Embla genannt nach den ersten Menschen, die die nordischen Götter aus umgestürzten Bäumen geschnitzt hatten. Anschließend hatte Granny Jansen ihnen dann aufregende Geschichten aus der Heimat ihrer Vorfahren erzählt, Geschichten von wütenden Eisriesen, mächtigen Walküren und Wikingerbegräbnissen in brennenden Langschiffen. Später, als sie in der Dunkelheit ihres Dachzimmers auf den Schlaf gewartet hatten, hatte er Liv zugeflüstert, er wolle einmal genauso aus dieser Welt gehen, nachdem er in irgendeiner heldenhaften Schlacht gefallen war. Er wollte, dass sein Geist sich mit dem Rauch eines brennenden Schiffes vermischte und nach Walhalla aufstieg.
Liv schaute wieder auf das amtliche Dokument hinunter, das ihn offiziell für tot erklärte. Das war kein heldenhafter Tod durch Schwert oder Speer; das war ein Tod per behördlichem Dekret aufgrund von durchgehender Abwesenheit über einen gesetzlich bestimmten Zeitraum hinweg. Liv faltete das Papier mit geübtem Geschick und so, wie sie es aus ihrer Kindheit kannte. Sie faltete ein Boot und setzte es aufs Wasser. Dann legte sie die Hand um das papierene Segel und zündete es mit ihrem Feuerzeug an. Als das trockene Papier zu brennen begann, stieß sie das Boot sanft auf den See hinaus. Kurz flackerten die Flammen und suchten nach neuer Nahrung; dann verloschen sie im kalten Wind. Liv schaute dem kleinen Boot hinterher, bis es schließlich im grauen Wasser kenterte.
Sie rauchte eine weitere Zigarette und wartete darauf, dass das Boot endlich sank, doch es blieb einfach auf dem Spiegelbild der Stadt liegen … wie ein Geist, der im Limbo gefangen war.
Das ist wirklich kein tolles Wikingerbegräbnis …
Liv drehte sich um und ging wieder in Richtung Zug, der sie nach New Jersey zurückbringen würde.
KAPITEL 8
»Nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um zuzuhören, meine Damen und Herren«, bat der Reiseführer seine glasig dreinblickenden Schützlinge, die zur Zitadelle emporstarrten. »Lauschen Sie dem Sprachengewirr um Sie herum: Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch … In all diesen Sprachen wird die Geschichte dieses Ortes erzählt, der ältesten kontinuierlich besiedelten Stadt der Erde. Und fühlen Sie sich angesichts dieses Sprachengewirrs nicht auch an die Legende vom Turmbau zu Babel erinnert, meine Damen und Herren? An jene berühmte Geschichte aus dem Buch Genesis, in dem von einem gewaltigen Turm die Rede ist, der nicht zum Ruhme Gottes, sondern dem der Menschen errichtet worden ist? Wie Sie sich sicher erinnern, wurde Gott ob dieser Anmaßung wütend, ›verwirrte‹ die Sprache der Menschen, wie es heißt, und verstreute sie über die ganze Welt, während der Turm unvollendet blieb. Heutzutage glauben viele Gelehrte, dass sich die Legende auf die Zitadelle hier in Trahpah bezieht. Bitte, beachten Sie dabei, dass es in dieser Legende um ein Gebäude geht, das nicht zum Ruhme Gottes errichtet worden ist. Wenn Sie jetzt zur Zitadelle hinaufsehen, meine Damen und Herren«, dramatisch deutete er auf die gewaltige Struktur, »dann wird Ihnen auffallen, dass nach außen hin nichts auf ihren religiösen Zweck hindeutet. Keine Kreuze, keine Engelsbilder, überhaupt keine Ikonografie, egal welcher Art. Allerdings kann der äußere Eindruck auch täuschen, und so ist das auch hier: Trotz des fehlenden religiösen Schmucks ist die Zitadelle von Trahpah ohne Zweifel ein Haus Gottes. Innerhalb ihrer geheimnisvollen Mauern ist die allererste Bibel geschrieben worden, und die war der spirituelle Grundstein des Christentums.
Tatsächlich ist die Zitadelle das ursprüngliche Zentrum der christlichen Kirche. Dass dieses Zentrum im Jahre 326 n.Chr. nach Rom verlegt wurde, hatte lediglich den Zweck, der sich schnell und stetig ausbreitenden Kirche einen politischen Fokus zu geben. Wie viele von Ihnen waren schon im Vatikan?«
Widerwillig wurden ein paar Hände gehoben.
»Einige von Ihnen, wie ich sehe, und ohne Zweifel haben Sie dort die Sixtinische Kapelle bestaunt, den Petersdom erkundet, die Papstgräber besichtigt oder sogar einer Audienz beim Heiligen Vater beigewohnt. Unglücklicherweise heißt es zwar, die Zitadelle hier berge ähnliche Wunder, doch die werden Sie nicht zu sehen bekommen, denn nur den Mönchen und Priestern, die hier leben, ist es gestattet, diesen geheimnisvollsten und heiligsten aller Orte zu betreten. Diese Regel ist so streng, dass die Bastionen und Wehrgänge, die Sie sehen, nicht von Steinmetzen oder Baumeistern aus dem Fels gehauen worden sind, sondern von den Bewohnern des heiligen Bergs selbst. Das hat dem Ort nicht nur sein ungewöhnliches, verfallen wirkendes Aussehen verliehen, sondern der Stadt auch ihren Namen gegeben: Trahpah. Das ist Aramäisch und bedeutet so viel wie ›verfallen‹, weshalb man häufig auch von der ›Ruinenstadt‹ spricht.
In Wahrheit handelt es sich jedoch keineswegs um eine Ruine. Die Zitadelle ist die älteste Festung der Welt und die einzige, die nie erobert worden ist, obwohl die berühmtesten und berüchtigsten Feldherren aller Zeiten sich daran versucht haben. Und warum haben sie sich daran versucht? Wegen der legendären Reliquie, die der Berg angeblich beherbergt: das heilige Geheimnis von Trahpah – das Sakrament.« Er ließ das Wort kurz in der eisigen Luft hängen. »Es ist das älteste und größte Mysterium der Welt«, fuhr der Reiseleiter in verschwörerischem Flüstern fort. »Manch einer glaubt, es sei das Wahre Kreuz Christi. Andere wiederum sprechen vom Heiligen Gral, aus dem Christus getrunken hat und der alle Krankheiten heilen und ewiges Leben verleihen kann. Viele glauben auch, dass Christus selbst dort ruhe, auf wundersame Weise konserviert, irgendwo in den Tiefen des Bergs. Es gibt aber auch jene, die das alles nur für eine Legende ohne jegliche Substanz halten. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, ist jedoch schlicht, dass niemand es wirklich weiß, und da Geheimhaltung das Fundament der Zitadellenlegende ist, wird sich daran auch nichts ändern, denke ich.
So … Falls jetzt jemand Fragen hat«, sagte der Reiseführer, »dann tun Sie sich keinen Zwang an.« Dabei verriet sein Tonfall jedoch, dass es ihm lieber gewesen wäre, die Touristen blieben stumm.
Die kleinen Augen des Mannes huschten über die leeren Gesichter der Touristen, die zu dem riesigen Gebäude hinaufstarrten und sich Fragen überlegten. Normalerweise fiel jedoch niemandem etwas ein, und das verschaffte ihnen volle zwanzig Minuten umherzuwandern, ein paar Souvenirs zu kaufen und schlechte Fotos zu machen, bevor sie sich wieder am Bus trafen, um eine andere Gegend unsicher zu machen. Der Reiseführer hatte gerade Luft geholt, um die Touristen über diese Tatsache zu informieren, als eine Hand hochgerissen wurde und nach oben deutete.
»Was ist das für ein Ding da?«, fragte ein rotgesichtiger Mann Mitte fünfzig mit nordbritischem Akzent. »Das Ding, das wie ein Kreuz aussieht?«
»Nun, wie ich Ihnen bereits erklärt habe, hat die Zitadelle keinerlei Kreuze auf …«
Er verstummte und kniff die Augen zusammen, um gegen die Sonne besser sehen zu können.
Dort oben, auf dem berühmten, schmucklosen Gipfel der antiken Festung, war eindeutig ein winziges Kreuz zu sehen.
»Ich … äh … Ich bin nicht ganz sicher, was das ist …«, stotterte er.
Aber ihm hörte ohnehin niemand mehr zu. Alle versuchten, einen besseren Blick auf das zu erhaschen, was auch immer dort auf dem Gipfel hockte.
Und was auch immer es sein mochte, es wankte leicht und ähnelte einem ›T‹. War das ein Vogel oder einfach nur eine optische Täuschung?
»Das ist ein Mann!«, rief jemand aus einer anderen Touristengruppe in der Nähe. Der Reiseführer drehte sich zu dem Rufer um. Ein Mann mittleren Alters, dem Akzent nach zu urteilen Holländer, starrte wie gebannt auf das LCD-Display seiner Videokamera.
»Schauen Sie!« Der Mann lehnte sich zurück, damit andere seine Entdeckung auch sehen konnten.
Über die Köpfe der Touristen hinweg warf auch der Reiseführer einen Blick auf den Schirm. Die Kamera war so nahe herangezoomt wie irgend möglich und zeigte das körnige, digital aufgewertete Bild eines Mannes in etwas, das eine grüne Mönchskutte zu sein schien. Sein langes, dunkelblondes Haar wehte um sein bärtiges Gesicht, doch er stand vollkommen still am Rand des Gipfels, die Arme ausgebreitet und den Kopf gesenkt. Er sah tatsächlich wie ein menschliches Kreuz aus … oder wie der leibhaftige, einsame Christus.
KAPITEL 9
In den Hügeln westlich von Trahpah, in einer Obstplantage aus dem Mittelalter, führte Kathryn Mann eine Gruppe von sechs Freiwilligen über die mit Fallobst bedeckte Erde. Jedes Gruppenmitglied trug einen Ganzkörperanzug aus schwerem weißen Leinen und dazu einen breitkrempigen Hut mit langem schwarzen Schleier. Im Licht des frühen Morgens sahen sie wie eine antike Druidensekte auf dem Weg zum Opferritual aus.
Kathryn erreichte ein aufrecht stehendes Ölfass, das mit einer Plane bedeckt war. Sie machte sich daran, die Steine wegzuräumen, die die Plane hielten, und ihre Freiwilligen schwärmten stumm hinter ihr aus. Die ausgelassene Stimmung, die noch im Minibus geherrscht hatte, als sie durch die leeren Straßen gefahren waren, war schon längst verflogen. Kathryn nahm den letzten Stein herunter. Irgendjemand hielt ihr eine Imkerpfeife hin. Für gewöhnlich wurden die Bienen umso aktiver, je wärmer es war, und desto mehr musste Kathryn sie einräuchern. Doch trotz der immer stärker werdenden Hitze sah Kathryn bereits jetzt, dass es bei diesem Stock nicht anders war als bei den anderen auch. Kein Summen war zu hören, und der trockene rote Ziegelstein, der den Tieren als Landeplattform diente, war leer.
Kathryn blies flüchtig ein paar Rauchwolken in den Stock und nahm dann den Deckel ab. Acht regelmäßig angeordnete Holzrahmen kamen darunter zum Vorschein. Es war eine ganz einfache Art von Bienenstock, wie man ihn aus jeder Art von Resten bauen konnte. Die Expedition in den Obsthain war eigentlich als Demonstration zum Thema Bienenhaltung gedacht gewesen. Die Freiwilligen sollten hier etwas lernen, das sie in den unterschiedlichen Gegenden der Welt zum Einsatz bringen konnten, in die man sie für das nächste Jahr schicken würde. Doch nachdem sie einen Stock nach dem anderen untersucht hatten, hatte die Expedition sich in eine Begegnung mit etwas gewandelt, das wesentlich beunruhigender war.
Als der Rauch sich verzog, zog Kathryn vorsichtig einen Rahmen aus dem Fass und drehte sich zu der Gruppe um. Unter dem Rahmen hing eine große, unregelmäßig geformte Wabe, die jedoch fast gar keinen Honig enthielt; dabei war der Stock vor kurzem noch sehr geschäftig und der Ertrag ergiebig gewesen. Nun waren jedoch nur noch ein paar frisch geschlüpfte Arbeiterinnen zu sehen.
»Ein Virus?«, fragte eine männliche Stimme.
»Nein.« Kathryn schüttelte den Kopf. »Schauen Sie sich das an …«
Die Freiwilligengruppe rückte näher an Kathryn heran.
»Wenn ein Stock von CBPV, dem Chronischen Bienenparalysevirus, befallen ist, dann beginnen die Bienen zu zittern. Sie können nicht mehr fliegen und sterben um den Stock herum. Aber jetzt schauen Sie mal auf den Boden.«
Sechs Hüte beugten sich vor und suchten das nasse Gras im Schatten des Apfelbaums ab.
»Nichts«, sagte Kathryn. »Und jetzt schauen Sie in den Stock.«
Die Hüte hoben sich wieder, und die breiten Krempen stießen aneinander.
»Hätte ein Virus das verursacht, wäre der ganze Boden voller toter Bienen. Sie sind wie wir: Fühlen sie sich krank, fliegen sie nach Hause und kauern sich zusammen, bis es ihnen wieder besser geht. Aber da ist nichts. Die Bienen sind einfach verschwunden. Doch da ist noch etwas anderes …«
Kathryn hielt den Rahmen hoch und deutete auf den unteren Teil der Wabe, wo die achteckigen Zellen mit winzigen Wachsdeckeln verschlossen waren.
»Ungeschlüpfte Larven«, erklärte Kathryn. »Normalerweise geben Bienen einen Stock nicht auf, wenn noch Larven schlüpfen müssen.«
»Aber wenn es kein Virus war, was ist dann passiert?«, fragte jemand.
Kathryn steckte den Rahmen in den stummen Stock zurück. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie, »aber es passiert überall.« Sie machte sich auf den Weg zu der vernagelten Hütte am Rand des Haines zurück. »Aus Nordamerika und Europa wird das Gleiche berichtet und sogar aus Taiwan. Bis jetzt hat jedoch noch niemand den Grund dafür herausgefunden. Nur in einem sind sich alle einig: Es wird schlimmer.«
Kathryn zog die Handschuhe aus, als sie den Bus erreichte, und warf sie in eine leere Plastikkiste. Die anderen taten es ihr nach.
»In Amerika nennt man dieses Phänomen ›Colony Collapse Disorder‹, also ›Völkerkollaps‹. Für manche Leute ist das ein sicheres Zeichen für das Ende der Welt. Einstein hat mal gesagt, wenn die Bienen vom Angesicht der Erde verschwinden, hätten auch wir nur noch vier Jahre Zeit. Keine Bienen mehr, kein Bestäuben, keine Ernten, keine Nahrung … kein Mensch mehr.«
Kathryn öffnete ihren Schleier und nahm den Hut ab. Darunter kam ein ovales Gesicht mit blasser, klarer Haut und ungewöhnlich dunklen Augen zum Vorschein. Sie hatte etwas Altersloses und zugleich Natürliches an sich, das auch ein wenig aristokratisch wirkte. Für viele der jungen, freiwilligen Männer war sie ein Objekt der Begierde, und das, obwohl sie älter war als viele ihrer Mütter. Mit der freien Hand griff sie nach oben, löste ihr dichtes dunkelbraunes Haar und schüttelte es aus.
»Und was will man dagegen unternehmen?« Der Fragesteller, ein großer blonder Junge aus dem Mittleren Westen der USA, stieg aus seinem Imkeranzug. Er hatte den gleichen Blick wie die meisten Freiwilligen, wenn sie zum ersten Mal für Kathryn arbeiteten: ernst, voller Hoffnung und vom Guten im Menschen überzeugt. Kathryn fragte sich, wie er wohl aussehen würde, nachdem er ein Jahr im Sudan gearbeitet hatte und hatte zusehen müssen, wie Kinder langsam verhungerten, oder in Sierra Leone, wo Bauern ihre Felder nicht bestellen konnten, weil Guerilleros sie vermint hatten.
»Es wird viel geforscht«, antwortete Kathryn, »um eine Verbindung zwischen dem Völkersterben und Gengemüse, neuen Pestiziden, der Erderwärmung und/oder Parasiten sowie Infektionen herzustellen. Es gibt sogar eine Theorie, nach der Handysignale das Navigationssystem der Bienen stören.«
Sie schüttelte ihren Anzug ab und ließ ihn zu Boden fallen.
»Und was glauben Sie?« Kathryn schaute den ernsten jungen Mann an und sah, wie sich Falten auf ein Gesicht schlichen, das bis jetzt kaum Sorgen gekannt hatte.
»Oh … Ich weiß nicht«, sagte sie. »Vielleicht ist es eine Mischung aus all diesen Dingen. Bienen sind eigentlich recht simple Geschöpfe. Das Gleiche gilt für ihre Sozialordnung. Es braucht nicht viel, um Chaos dort reinzubringen. Bienen kommen zwar gut mit Stress zurecht, aber wenn das Leben zu komplex wird, sodass sie ihre eigene Gesellschaft nicht mehr wiedererkennen, geben sie sie vielleicht auf. Vielleicht fliegen sie dann lieber ihrem Tod entgegen, als noch länger in einer Welt zu leben, die sie nicht mehr verstehen.«
Sie ließ den Blick in die Runde schweifen. Inzwischen hatten sich alle ihrer Anzüge entledigt und schauten besorgt drein.
»Hey«, sagte Kathryn, um die Stimmung zu heben, »hören Sie einfach nicht auf mich. Ich verbringe viel zu viel Zeit mit Wikipedia. Außerdem passiert das ja nicht mit allen Stöcken, wie Sie gesehen haben. In mehr als der Hälfte herrscht noch das pralle Leben. Kommen Sie.« Sie klatschte in die Hände. »Wir haben noch viel zu tun. Packen Sie Ihre Anzüge weg, und holen Sie die Werkzeuge heraus. Wir müssen die toten Stöcke abbauen und ersetzen.« Sie öffnete eine weitere Plastikkiste, die auf dem Gras stand. »Da drin ist alles, was Sie brauchen: Werkzeuge und Anleitungen, wie man aus ein paar alten Latten und Kisten einen Stock zimmern kann. Aber vergessen Sie nicht: Draußen werden Sie Bienenstöcke aus allem bauen müssen, was Sie finden. Nicht, dass Sie dort, wo Sie hingehen, viel finden werden. Menschen, die ohnehin nichts haben, werfen auch nichts weg.
Nur von den toten Stöcken dürfen Sie kein Material verwenden. Sollte tatsächlich ein Virus oder dergleichen für das Völkersterben verantwortlich sein, dann würden Sie ihn so nur weitergeben, und die nächste Katastrophe wäre vorprogrammiert.«
Kathryn öffnete die Fahrertür. Sie musste Distanz zu den Freiwilligen wahren. Die meisten kamen aus gebildeten, bürgerlichen Familien, was hieß, dass sie es zwar gut meinten, aber nur wenig Ahnung von der Praxis hatten. Solche Leute neigten dazu, stundenlang darüber zu diskutieren, wie etwas zu machen war, anstatt es einfach zu tun. Am besten warf man sie ins kalte Wasser und ließ sie aus ihren Fehlern lernen.
»In einer halben Stunde werde ich nachsehen, wie weit Sie sind. Wenn Sie mich brauchen, ich bin im Wagen.« Sie warf die Tür hinter sich zu, bevor jemand eine Frage stellen konnte.
Kathryn hörte das Klappern der Werkzeuge und die erste von vielen theoretischen Diskussionen. Sie schaltete das Radio an. Wenn sie hörte, worüber die jungen Leute redeten, würde sich irgendwann ihr Mutterinstinkt melden, und sie würde ihnen zur Hand gehen, auch wenn damit niemandem geholfen war. Draußen in der Welt konnte sie ihnen auch nicht die Hände halten.
Ein lokaler Radiosender erstickte den Lärm der Freiwilligen mit Verkehrsnachrichten und Schlagzeilen. Kathryn streckte die Hand aus und nahm eine Aktenmappe vom Beifahrersitz. Auf dem Deckel stand nur ein einziges Wort – Ortus –, und darunter prangte ein Logo: eine vierblättrige Blüte mit der Welt in der Mitte. Die Akte enthielt einen Bericht über die Rekultivierung illegal gerodeter Flächen im Amazonasdelta. Kathryn musste noch heute entscheiden, ob ihre Organisation das finanzieren konnte oder nicht. Zwar erhöhte sich das Spendenaufkommen stetig, doch jedes Jahr wurden der Welt neue Wunden geschlagen, die der Heilung bedurften.
»Und zu guter Letzt«, sagte der Radiomoderator in dem typisch amüsierten Tonfall am Ende einer Nachrichtensendung, wenn zu den nicht ganz so ernsten Themen übergeleitet wurde, »sollten Sie sich heute ins Stadtzentrum von Trahpah begeben, dann machen Sie sich auf eine große Überraschung gefasst – denn jemandem, der wie ein Mönch gekleidet ist, ist es gelungen, die Spitze der Zitadelle zu erklettern.«
Kathryn starrte auf das schmale Autoradio.
»Im Augenblick wissen wir noch nicht, was das Ganze soll«, fuhr der Nachrichtensprecher fort, »vielleicht ist das ja nur ein PR-Gag. In jedem Fall tauchte der Mann kurz nach Sonnenaufgang auf, und jetzt steht er da und streckt die Arme aus wie … wie ein menschliches Kreuz.«
Kathryn drehte sich der Magen um. Sie schaltete den Motor an und rammte den Gang hinein. Neben einer Freiwilligen hielt sie kurz an und ließ das Fenster herunter.
»Ich muss ins Büro«, rief sie. »In einer Stunde bin ich wieder zurück.«
Das Mädchen nickte. So plötzlich im Stich gelassen zu werden verwirrte sie, doch Kathryn bemerkte das nicht. Ihr Blick war bereits stur nach vorn gerichtet, zu der Lücke in der Hecke, hinter der ein Feldweg nach Trahpah führte.
KAPITEL 10
Auf halbem Weg zwischen der sich sammelnden Menge und dem Gipfel der Zitadelle saß der Abt vor dem Kamin. Er war müde von einer Nacht, in der er auf immer neue Nachrichten gewartet hatte, und nun schaute er wieder jemanden an, der etwas zu berichten hatte.
»Wir haben immer geglaubt, die Ostseite könne man nicht erklettern«, sagte Athanasius und strich sich mit der Hand über den kahlen Kopf.
»Nun ja«, erwiderte der Abt, »dann haben wir heute Nacht wenigstens etwas gelernt, nicht wahr?« Er blickte zu dem großen Fenster, dessen blau-grüne Buntglasscheibe im Licht der aufgehenden Sonne zu schimmern begann; doch auch das besserte seine Stimmung nicht.
»So«, sagte er schließlich, »wir haben also einen abtrünnigen Mönch, der auf dem Gipfel der Zitadelle steht und eine äußerst provokante Pose einnimmt, und Hunderte von Touristen und Gott weiß wer noch haben ihn so schon gesehen, und wir können nichts dagegen tun, geschweige denn, ihn wieder zurückholen.«
»Das ist korrekt.« Athanasius nickte. »Aber solange er dort oben steht, kann er auch mit niemandem reden, und irgendwann muss er ja wieder runterkommen. Was soll er sonst tun?«
»Zur Hölle fahren zum Beispiel«, spie der Abt, »und zwar je schneller, desto besser für uns alle.«
»So wie ich das sehe, ist die Situation folgende …«, fuhr Athanasius einfach fort. Er wusste, dass man die Launen seines Abts am besten ignorierte. »Er hat nichts zu essen. Er hat nichts zu trinken. Es gibt nur einen Weg den Berg hinunter, und selbst wenn er das im Schutz der Nacht versuchen sollte, werden unsere Infrarotkameras ihn erfassen, sobald er die höchste Bastion erreicht. Auf dem Boden haben wir dann Sensoren, und unser Sicherheitsdienst ist angewiesen, ihn festzunehmen. Mehr noch: Er sitzt in dem einzigen Gebilde der Welt fest, aus dem noch nie jemand entkommen ist.«
Der Abt warf seinem Kammerherrn einen besorgten Blick zu. »Das stimmt so nicht«, erklärte er und brachte Athanasius damit erstaunt zum Schweigen. »Es sind durchaus schon Leute von hier entkommen. Nicht in jüngster Zeit, aber ein paar haben es geschafft. Wenn man eine Geschichte hat, die so lang ist wie unsere, ist das wohl … unvermeidlich. Natürlich sind diese Leute immer geschnappt und zum Schweigen gebracht worden – in Gottes Namen –, zusammen mit jenen, die das Pech hatten, außerhalb dieser Mauern mit ihnen in Kontakt zu kommen.« Er bemerkte, wie Athanasius erbleichte. »Das Sakrament muss beschützt werden.«
Der Abt hatte es schon immer als bedauerlich erachtet, dass sein Kammerherr nicht die Nerven für die komplexeren Pflichten ihres Ordens besaß. Deshalb trug Athanasius auch noch immer die braune Soutane der niederen Ränge und nicht das Dunkelgrün der geweihten Sancti. Dennoch war Athanasius so fromm und pflichtbewusst, dass der Abt bisweilen vergaß, dass der Mann nie das Geheimnis des Bergs kennengelernt hatte, oder dass ihm der größte Teil der Geschichte der Zitadelle unbekannt war.
»Zum letzten Mal ist das Sakrament während des Ersten Weltkriegs in Gefahr geraten«, sagte der Abt und starrte in den Kamin, als stünde die Vergangenheit in der Glut geschrieben. »Ein Novize ist aus einem Fenster gesprungen und durch den Graben geschwommen. Deshalb hat man ihn auch trockengelegt. Glücklicherweise war dieser Novize noch nicht geweiht, weshalb er das Geheimnis unseres Ordens auch noch nicht kannte. Er hat es bis in die besetzten Gebiete Frankreichs geschafft, bevor es uns gelungen ist … ihn einzuholen. Gott war mit uns. Als wir ihn schließlich fanden, hatte der Krieg uns die Arbeit bereits abgenommen.«
Er blickte wieder zu Athanasius.
»Aber das war eine andere Zeit. Damals hatte die Kirche noch viele Verbündete, und Schweigen ließ sich einfach kaufen. Geheimnisse wurden bewahrt. Heute schickt man mittels Internet Informationen binnen Sekunden um die ganze Welt und zu Milliarden von Menschen. Einen Vorfall wie damals können wir schlicht nicht mehr begrenzen. Deshalb dürfen wir auch nicht zulassen, dass so etwas passiert.«
Er schaute wieder zum Fenster, das inzwischen vollständig von der Morgensonne erhellt wurde. Das Pfauenmotiv leuchtete blau und grün, ein archaisches Symbol für Christus und für die Unsterblichkeit.
»Bruder Samuel kennt unser Geheimnis«, erklärte der Abt schlicht. »Er darf diesen Berg nicht verlassen.«
KAPITEL 11
Liv drückte die Klingel und wartete.
Bei dem Haus handelte es sich um einen Neubau in Newark, ein paar Blocks hinter dem Baker Park und nicht weit von der Universität entfernt, wo der Herr des Hauses, Myron, als Laborant arbeitete. Niedrige Lattenzäune markierten die Grundstücksgrenzen, und zu jeder Tür in der Nachbarschaft führte ein gepflasterter Weg. Ein paar Fuß Gras trennten die Häuser von der Straße. Es war der Amerikanische Traum in Miniatur. Hätte Liv an einer anderen Art Story gearbeitet, sie hätte genau dieses Bild benutzt und etwas Rührendes daraus gemacht; aber deshalb war sie nicht hier.
Liv hörte Geräusche im Haus, schwere Schritte auf einem rutschigen Fußboden, und sie bemühte sich, ein Gesicht aufzusetzen, das nichts von der vollkommenen Einsamkeit mehr vermittelte, die sie am See im Central Park empfunden hatte. Die Tür öffnete sich, und dahinter kam eine hübsche, hochschwangere junge Frau zum Vorschein, die fast den ganzen Flur ausfüllte.
»Sie müssen Bonnie sein«, sagte Liv mit einer fröhlichen Stimme, die jemand anderem zu gehören schien. »Ich bin Liv Adamsen, vom Inquirer.«
Bonnie strahlte. »Die Babyreporterin!« Sie riss die Tür weit auf und winkte Liv in den makellosen beigen Flur.
Liv hatte zwar in ihrem ganzen Leben noch nie etwas über Babys geschrieben, aber sie ließ das auf sich beruhen. Stattdessen lächelte sie unbeirrt weiter, bis es in eine perfekt sortierte, kleine Küche ging, wo ein Mann mit frischem Gesicht gerade Kaffee kochte.
»Myron, Liebling, das ist die Reporterin, die über die Geburt schreiben will.«
Liv schüttelte dem Mann die Hand. Allmählich schmerzte ihr Gesicht vor lauter Lächeln. Sie wollte einfach nur nach Hause, sich in ihrem Bett verkriechen und heulen. Doch stattdessen schaute sie sich in dem Raum um und betrachtete die sorgfältig arrangierten Gegenstände: die Duftkerzen, die Rosenduft unter den Geruch des Kaffees mischten; die Flechtkörbe, die nichts als Luft enthielten – alles Dinge, die in Dreierpacks bei IKEA an der Kasse verkauft wurden.
»Ein schönes Heim …« Liv wusste, was von ihr erwartet wurde. Sie dachte an ihr eigenes Apartment, das vor Pflanzen fast schon platzte und ständig nach Ton roch. ›Eine Töpferei mit Bett‹ hatte ein Exfreund es mal genannt. Warum konnte sie nicht wie normale Leute leben und dabei glücklich und zufrieden sein? Liv schaute in den makellosen Garten hinaus, ein Grasquadrat umrahmt von Bäumen, die das Haus in zwei Sommern überragen würden, es sei denn, sie wurden regelmäßig und drastisch geschnitten. Zwei der Bäume verwelkten allerdings schon. Vielleicht würde die Natur den Bewohnern die Arbeit ja abnehmen. Was Liv betraf, so war es ihr Wissen über Pflanzen, das ihr den Job hier überhaupt erst eingebracht hatte.
»Adamsen, Sie kennen sich doch mit Pflanzen und dem ganzen Scheiß aus«, hatte das Gespräch recht prosaisch begonnen, als Rawls Baker, Verleger und Chefredakteur des New Jersey Inquirer in einer Person, sie Anfang der Woche im Aufzug in die Enge getrieben hatte. Und kaum hatte Liv sich versehen, da war sie weg von den Verbrechen gewesen, ihrem eigentlichen Fachgebiet, und hatte den Auftrag erhalten, für die Gesundheitsbeilage der Sonntagsausgabe zweitausend Worte zum Thema ›Die natürliche Geburt – wie Mutter Natur es vorgesehen hat‹ zu schreiben. Hier und da hatte sie zwar schon einmal einen Gartenartikel geschrieben, aber mit Medizin hatte sie sich noch nie auseinandergesetzt.