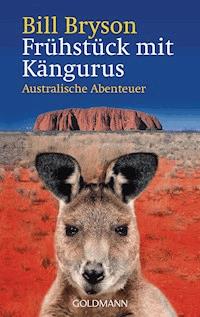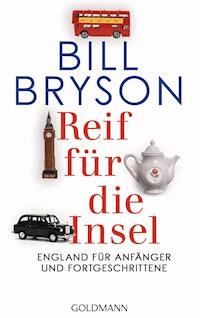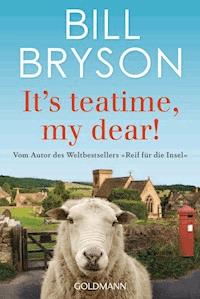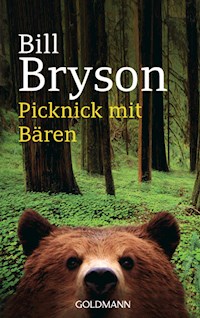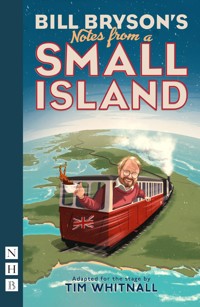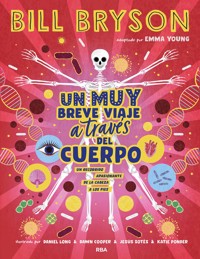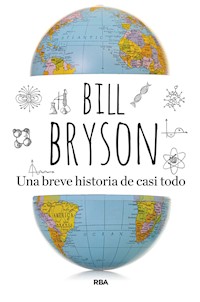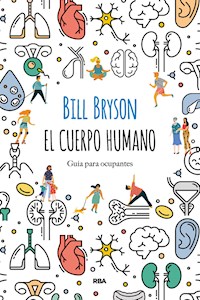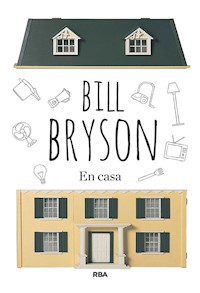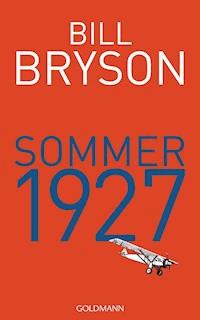
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1927. Ein Sommer der ein ganzes Jahrhundert prägte
Es ist die Geschichte eines Sommers, und doch ist es so viel mehr. Das Jahr 1927 ist für Amerika entscheidend auf dem Weg zur Weltmacht. Es sind die goldenen Zwanziger: der Aktienmarkt boomt, das Fernsehen wird erfunden, die Filme sind nicht mehr stumm, und verrückte Pläne entstehen, wie der, vier Köpfe in den völlig unzugänglichen Mount Rushmore zu meißeln. Es ist die Zeit, in der ein junger Flieger namens Charles Lindbergh Ruhm und Ehre erlangt, aber auch die des Al Capone und des größten Schulmassakers aller Zeiten. Und in diesen Monaten werden durch fatale Entscheidungen die Weichen für die bevorstehende Weltwirtschaftskrise gestellt. Bill Bryson erzählt davon so spannend, als sei es eine unglaubliche Abenteuergeschichte, voller erstaunlicher geschichtlicher Momente aus der Zeit, als Amerika erwachsen wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 887
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Der Sommer von 1927 ist nicht nur für Amerika ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Weltmacht. Innerhalb weniger Monate verändert Amerika auch die ganze Welt für immer. Der amerikanische Aktienmarkt boomt, ein halb verrückter Bildhauer entwickelt den Plan, vier große Köpfe in den völlig unzugänglichen Mount Rushmore zu hauen, und ein junger Flieger namens Charles Lindbergh steht am Ende des Sommers als berühmtester Mann der Welt da. Es ist die Zeit, in der die Filme sprechen lernen, das Fernsehen erfunden wird und Al Capones Macht seinen kriminellen Höhepunkt erreicht. Außerdem werden in diesen Monaten die fatalen Entscheidungen getroffen, die zwei Jahre später zur großen Depression und letztlich zur Weltwirtschaftskrise führen werden. Und das sind nur einige Ereignisse dieses Sommers.
Bill Bryson erzählt eine mitreißende, witzige und lehrreiche Abenteuergeschichte und hat es wieder einmal geschafft, aus historischen Ereignissen ein grandios unterhaltsames Buch zu machen, voller unvergesslicher Persönlichkeiten und Momente.
Weitere Informationen zu Bill Bryson sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Bill Bryson
Sommer 1927
Ins Deutsche übertragen
von Thomas Bauer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»One Summer. America 1927« bei Doubleday,
an imprint of Transworld Publishers, London.
Copyright © 2013 by Bill Bryson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-12019-1V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Annie, Billy und Gracie, und zum Gedenken an
Julia Richardson
Inhalt
Prolog
MAI: Der Junge
JUNI: Das »Babe«
JULI: Der Präsident
AUGUST: Die Anarchisten
SEPTEMBER: Sommerende
Epilog
Literatur
Anmerkungen zu den Quellen und Leseempfehlungen
Dank
Register
Fotonachweis
Prolog
An einem warmen Frühlingsabend kurz vor Ostern 1927 kamen die Bewohner hoher Gebäude in New York ins Grübeln, als das hölzerne Baugerüst um den Turm des brandneuen Sherry-Netherland-Apartment-Hotels Feuer fing und sich zeigte, dass die städtische Feuerwehr nicht über die Mittel verfügte, um Wasser in eine solche Höhe zu befördern.
Schaulustige strömten in Scharen in die Fifth Avenue, um sich den Brand anzusehen, den größten, den es in der Stadt seit Jahren gegeben hatte. Mit achtunddreißig Stockwerken war das Sherry-Netherland das höchste jemals errichtete Wohngebäude – und das Gerüst, das für den letzten Bauabschnitt aufgestellt worden war, umgab die obersten fünfzehn Geschosse und lieferte genug Holz, um die gewaltige Feuersbrunst um seine Spitze zu nähren. Aus der Ferne erinnerte der Bau an ein soeben entzündetes Streichholz. Die Flammen waren noch aus zwanzig Meilen Entfernung zu sehen. Aus der Nähe betrachtet präsentierte sich die Situation deutlich dramatischer. In 150 Metern Höhe lösten sich bis zu fünfzehn Meter lange, brennende Gerüstteile, die zur hämischen Freude der Schaulustigen in einem Funkenregen auf die Straßen hinunterstürzten und die schuftenden Feuerwehrmänner gefährdeten. Auch auf die Dächer benachbarter Gebäude fielen glühende Holzstücke und steckten vier davon in Brand. Die Feuerwehrmänner richteten ihre Schläuche auf das Sherry-Netherland, wobei es sich allerdings nur um eine symbolische Geste handelte, da ihr Strahl nicht höher als bis zum dritten oder vierten Stockwerk reichte. Glücklicherweise war das Gebäude noch nicht fertiggestellt und deshalb unbewohnt.
Im Amerika der zwanziger Jahre fühlten sich die Menschen von Spektakeln ungewöhnlich stark angezogen, und bis zweiundzwanzig Uhr war die Menge auf geschätzte 100 000 Menschen angewachsen – eine riesige Ansammlung für ein unangekündigtes Ereignis. 700 Polizisten mussten hinzugezogen werden, um für Ordnung zu sorgen. Der New York Times zufolge nahmen sich einige wohlhabende Beobachter, die beim abendlichen Feiern unterbrochen worden waren, Zimmer im Plaza Hotel auf der gegenüberliegenden Straßenseite und veranstalteten spontane »Brandzimmerpartys«. Bürgermeister Jimmy Walker traf ein, um sich vor Ort ein Bild zu machen, und wurde nass bis auf die Haut, als er in den Wasserstrahl eines Schlauchs geriet. Einen Augenblick später schlug in seiner Nähe ein loderndes, drei Meter langes Brett auf dem Bürgersteig auf, und er befolgte den Rat, sich zurückzuziehen. Das Feuer richtete im oberen Teil des Gebäudes erheblichen Schaden an, breitete sich aber glücklicherweise nicht nach unten aus und erlosch gegen Mitternacht von selbst.
Die Flammen und der Rauch boten zwei Männern eine willkommene Abwechslung: Clarence Chamberlin und Bert Acosta kreisten seit halb zehn an diesem Vormittag in einem kleinen Flugzeug über dem Roosevelt Field auf Long Island, um den Ausdauer-Weltrekord zu brechen, den zwei Jahre zuvor zwei französische Piloten aufgestellt hatten. Dabei ging es zum Teil um die Ehre der Nation – Amerika, der Geburtsort der Luftfahrt, war inzwischen sogar gegenüber den kleinsten europäischen Ländern hoffnungslos ins Hintertreffen geraten – und zum Teil darum zu untermauern, dass Flugzeuge lange genug in der Luft bleiben konnten, um Langstreckenflüge zu bewerkstelligen.
Der Trick der Übung, wie Chamberlin später erklärte, bestand darin, dem Flugzeug die maximale Reichweite zu entlocken, indem man den Gashebel und das Treibstoffgemisch so einstellte, dass das Flugzeug gerade noch in der Luft blieb – ihm »Hungerrationen« verabreichte, wie Chamberlin es formulierte. Als Acosta und er an ihrem dritten Tag in der Luft kurz vor ein Uhr mittags schließlich wieder zurück zur Erde glitten, flogen sie im Grunde nur noch mit Treibstoffdämpfen. Sie hatten sich einundfünfzig Stunden, elf Minuten und fünfundzwanzig Sekunden ununterbrochen in der Luft befunden und den bisherigen Rekord damit um fast sechs Stunden übertroffen.
Grinsend stiegen die beiden unter dem lautstarken Beifall einer großen Zuschauerschar aus ihrem Flugzeug. (In den zwanziger Jahren kam es bei fast allen Ereignissen zu riesigen Menschenansammlungen.) Die erfolgreichen Piloten waren müde und verspannt – und extrem durstig. Wie sich herausstellte, hatte ein Mitglied ihrer Bodencrew vor lauter Aufregung Seifenwasser in ihre Feldflaschen gefüllt, sodass sie zwei Tage lang nichts zu trinken gehabt hatten. Abgesehen davon war der Flug ein großer Erfolg – groß genug, um es am Karfreitag, dem 15. April, auf die Titelseite der NewYork Times zu schaffen. Über drei Spalten Berichterstattung erstreckte sich folgende Überschrift:
PILOTENSTELLENREKORDMIT 51 STUNDENINDER
LUFTAUF, TAGUNDNACHTOHNEESSENUNDWASSER,
ERSCHÖPFTNACHDERLANDUNG, ABERBEGIERIG
DARAUF, NACHPARISZUFLIEGEN
Die beiden waren 4100 Meilen geflogen – 500 Meilen mehr als die Strecke von New York nach Paris. Genauso beachtlich war die Tatsache, dass es ihnen gelungen war, mit 1400 Litern Treibstoff abzuheben, eine enorme Last für die damalige Zeit, und dazu nur 400 Meter Startbahn benötigt hatten. All das war enorm ermutigend für diejenigen, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, über den Atlantik zu fliegen – und im Frühling 1927 gab es davon etliche, unter ihnen auch Chamberlin und Acosta, die es ganz gewiss versuchen wollten.
Ironischerweise sicherte das Ereignis, das Amerika in der Luftfahrt weit hinter die restliche Welt zurückfallen ließ, gleichzeitig seine Überlegenheit in vielen anderen Bereichen: der Erste Weltkrieg.
Vor 1914 spielten Flugzeuge bei militärischen Überlegungen fast keine Rolle. Das französische Fliegerkorps war mit drei Dutzend Flugzeugen größer als sämtliche anderen Luftstreitkräfte zusammen. Deutschland, Großbritannien, Italien, Russland, Japan und Österreich verfügten jeweils über maximal vier Flugzeuge in ihrer Luftflotte; die Vereinigten Staaten besaßen nur zwei. Doch nach Beginn der Kampfhandlungen wurde Militärkommandeuren schnell bewusst, wie nützlich Flugzeuge sein konnten: zur Überwachung feindlicher Truppenbewegungen, zum Dirigieren von Artilleriefeuer und allem voran als neuartige Methode zum Töten von Menschen.
In den Anfangstagen waren Bomben oft nicht mehr als mit Benzin oder Kerosin gefüllte und mit einem einfachen Zünder versehene Weinflaschen, wenngleich einige Piloten auch Handgranaten abwarfen und manche eigens angefertigte, als »Flechets« bezeichnete Pfeile, die einen Helm durchbohren oder auf andere Weise für Schmerz und Entsetzen bei denjenigen sorgen konnten, die sich unten in den Schützengräben befanden. Die Entwicklung schritt wie immer, wenn es ums Töten geht, rasch voran, und 1918 wurden bereits Fliegerbomben von bis zu zwei Tonnen abgeworfen. Allein Deutschland ließ im Lauf des Krieges eine Million Bomben mit insgesamt etwa 25 000 Tonnen Sprengstoff regnen. Die Bombardierung war nicht besonders zielgenau – eine aus 3000 Metern abgeworfene Bombe traf nur selten ihr Ziel und verfehlte es häufig um eine halbe Meile oder mehr –, doch der psychologische Effekt, den der Einschlag jeder großen Bombe hatte, war erheblich.
Schwerere Bombenladung verlangte nach größeren und leistungsstärkeren Flugzeugen, was im Gegenzug die Entwicklung von schnelleren, wendigeren Kampfflugzeugen zu deren Verteidigung oder Angriff vorantrieb. Das wiederum führte zu den berühmten Luftkämpfen, die die Fantasie von Schuljungen anheizten und die Vorstellung einer ganzen Generation von der Luftfahrt prägten. Der Luftkrieg löste eine unersättliche Nachfrage nach Flugzeugen aus. In vier Jahren investierten die vier wichtigsten am Krieg beteiligten Nationen eine Milliarde Dollar – eine gigantische Summe, die fast vollständig von Amerika geliehen wurde – in ihre Luftflotten. In Frankreich entstand beinahe aus dem Nichts eine Flugzeugindustrie, die fast 200 000 Menschen beschäftigte und etwa 70 000 Flugzeuge produzierte. Großbritannien baute 75 000 Flugzeuge, Deutschland 48 000 und Italien 20 000 – eine beachtliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die weltweite Luftfahrt noch wenige Jahre zuvor aus zwei Brüdern in einem Fahrradladen in Ohio bestanden hatte.
Bis 1914 waren weltweit etwa einhundert Personen in Flugzeugen ums Leben gekommen. Jetzt starben Tausende Männer. Im Frühjahr 1917 betrug die Lebenserwartung eines britischen Piloten acht Tage. Insgesamt wurden in vier Jahren zwischen 30 000 und 40 000 Flieger getötet oder so schwer verletzt, dass sie ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben konnten. Die Ausbildung war kaum weniger gefährlich als der Kampfeinsatz. Bei Unfällen in Flugschulen kamen mindestens 15 000 Männer ums Leben oder wurden zu Invaliden. Amerikanische Piloten waren besonders benachteiligt. Als die Vereinigten Staaten im April 1917 in den Krieg eintraten, hatte kein einziger ranghoher Militärangehöriger jemals ein Kampfflugzeug gesehen, geschweige denn eines befehligt. Als sich der Forscher Hiram Bingham, der Entdecker von Machu Picchu und inzwischen Professor mittleren Alters in Yale, als Ausbilder anbot, ernannte ihn die Armee zum Oberstleutnant und übertrug ihm die Verantwortung für das gesamte Schulungsprogramm, und zwar nicht, weil er über Erfahrung als Fluglehrer verfügte – was nicht der Fall war –, sondern einfach nur deshalb, weil er ein Flugzeug fliegen konnte. Viele angehende Piloten wurden von Ausbildern unterrichtet, die selbst gerade erst ausgebildet worden waren.
Amerika unternahm eine gewaltige, aber letztendlich vergebliche Anstrengung, um in der Luftfahrt den Anschluss zu finden. Der Kongress genehmigte 600 Millionen Dollar zum Aufbau von Luftstreitkräften. Wie Bingham in seinen Memoiren schreibt: »Als wir in den Krieg eintraten, besaß der Air Service zwei kleine Flugplätze, 48 Offiziere, 1330 Männer und 225 Flugzeuge, von denen kein einziges in der Lage war, über feindliche Stellungen zu fliegen. Binnen anderthalb Jahren wuchs dieser Air Service auf fünfzig Flugplätze, 20 500 Offiziere, 175 000 Männer und 17 000 Flugzeuge an.« Bedauerlicherweise erreichte kaum eines dieser 17 000 Flugzeuge Europa, da fast der gesamte Platz auf Schiffen für den Truppentransport benötigt wurde. Deshalb flogen amerikanische Piloten, wenn sie an die Front kamen, überwiegend mit notdürftig zusammengeflickten, von den Alliierten geliehenen Maschinen und wurden somit fast ohne Ausbildung und in meist zweitklassigen überzähligen Flugzeugen gegen einen Feind mit wesentlich mehr Erfahrung in die gefährlichste Form moderner Kriegsführung geschickt. Trotzdem gab es auf keiner Seite und zu keinem Zeitpunkt einen Mangel an freiwilligen Piloten. Die Aussicht darauf, in eine Höhe von 4000 Metern aufzusteigen, mit einer Geschwindigkeit von 130 Meilen in der Stunde zu fliegen und im Gefecht um Leben und Tod durch die Lüfte zu jagen und zu rollen und in den Sturzflug zu gehen, hatte für viele Piloten einen solchen Reiz, dass es zur Sucht wurde. Die damit verbundene Romantik und Anziehung lässt sich aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehen, doch damals galten Piloten als die größten Helden überhaupt.
Dann ging der Krieg zu Ende, und sowohl Flugzeuge als auch Piloten wurden mit einem Mal weitgehend bedeutungslos. Amerika machte auf einen Schlag Flugzeugbestellungen für 100 Millionen Dollar rückgängig und verlor mehr oder weniger jegliches offizielle Interesse an der Fliegerei. Bei anderen Nationen wurden ähnlich drastische Einschnitte gemacht. Piloten, die weiterhin in der Luft bleiben wollten, hatten nur wenige Möglichkeiten. Viele von ihnen gaben sich mangels besserer Alternativen für waghalsige Kunststücke her. Die Galeries Lafayette in Paris setzten in einem Moment unüberlegten Leichtsinns eine Belohnung von 25 000 Francs für denjenigen aus, dem es gelang, ein Flugzeug auf dem Dach des Kaufhauses zu landen. Eine tollkühnere Herausforderung war kaum vorstellbar: Das Dach war nur knapp dreißig Meter lang und von einer einen Meter hohen Brüstung umgeben, die eine Landung noch um einiges gefährlicher machte. Ein ehemaliges Kriegsass namens Jules Védrines beschloss trotzdem, einen Versuch zu wagen. Védrines positionierte mehrere Männer auf dem Dach, die sein Flugzeug bei der Landung an den Tragflächen festhalten sollten. Den Männern gelang es tatsächlich, das Flugzeug daran zu hindern, vom Dach und in die feiernde Menschenmenge unten auf der Place de l’Opéra zu stürzen, allerdings nur, indem sie es gegen ein gemauertes Nebengebäude lenkten, in dem der Aufzugsmechanismus des Kaufhauses untergebracht war. Das Flugzeug wurde dabei völlig zertrümmert, doch Védrines stieg unversehrt aus dem Wrack wie ein Magier nach einem verblüffenden Zaubertrick. Solches Glück konnte jedoch nicht andauern: Drei Monate später kam er bei einem Absturz ums Leben, als er versuchte, auf ganz traditionelle Weise von Paris nach Rom zu fliegen.
Védrines’ Tod auf einem französischen Feld veranschaulichte zwei Tatsachen, die Unbehagen hervorriefen, was Flugzeuge anbetraf: Trotz aller Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Wendigkeit waren sie nach wie vor gefährliche Transportmittel und nicht besonders gut für lange Strecken geeignet. Nur einen Monat nach Védrines’ Absturz unterstrich die US-Marine unabsichtlich diesen Punkt, als sie drei Curtiss-Flugboote auf eine haarsträubend schlecht geplante Reise von Neufundland über die Azoren nach Portugal schickte. Entlang der Route positionierte die Marine sechsundsechzig Schiffe, die zu Hilfe eilen sollten, falls eines der Flugboote in Schwierigkeiten geriet, was vermuten lässt, dass ihr eigenes Vertrauen in das Unterfangen womöglich nicht ganz unerschütterlich war. Es war durchaus von Vorteil, dass Vorkehrungen getroffen wurden. Eines der Flugboote musste bereits im Wasser notlanden und gerettet werden, bevor es überhaupt in Neufundland ankam. Die anderen beiden landeten während der Reise selbst frühzeitig im Meer und mussten zu den Azoren geschleppt werden; eines von ihnen sank unterwegs. Von den drei Flugbooten, die ursprünglich aufgebrochen waren, schaffte es nur eines bis nach Portugal – und benötigte dazu elf Tage. Wäre der Zweck der Übung der gewesen zu zeigen, dass Flugzeuge noch längst nicht bereit für Ozeanüberquerungen waren, hätte sie gar nicht erfolgreicher verlaufen können.
Die Überquerung des Ozeans ohne Zwischenlandung schien eine völlig unerreichbare Zielsetzung zu sein. Als zwei britischen Fliegern im Sommer 1919 jedoch genau das gelang, waren deshalb alle ziemlich überrascht, die beiden Männer selbst offenbar auch. Ihre Namen lauteten Jack Alcock und Arthur Whitten (Teddy) Brown, und sie hätten es eigentlich verdient, wesentlich berühmter zu sein. Ihr Flug war einer der wagemutigsten aller Zeiten, allerdings ist er heute leider in Vergessenheit geraten. Aber auch damals wurde ihm nur wenig Aufmerksamkeit zuteil.
Alcock, damals sechsundzwanzig Jahre alt, war der Pilot und Brown, dreiunddreißig, der Navigator. Beide Männer waren in Manchester aufgewachsen, wobei Brown amerikanische Eltern hatte. Sein Vater war Anfang des 20. Jahrhunderts nach Großbritannien geschickt worden, um dort für Westinghouse Electric eine Fabrik zu bauen, und die Familie war dageblieben. Obwohl Brown nie in den Vereinigten Staaten gelebt hatte, sprach er mit amerikanischem Akzent und hatte erst kurz zuvor seine amerikanische Staatsbürgerschaft abgelegt. Alcock und er kannten sich kaum und waren erst dreimal miteinander geflogen, als sie sich im Juni 1919 in St. John’s in Neufundland in das offene Cockpit einer leicht gebauten und kastenförmigen Vickers Vimy zwängten und in die unfreundliche graue Leere über dem Atlantik starteten.[1]
1 Die Vickers Vimy hängt im Science Museum in London, doch nur wenige Besucher nehmen sie zur Kenntnis. Alcock und Brown wurde erst fünfunddreißig Jahre nach ihrem Flug am Flughafen Heathrow ein Denkmal errichtet. Als ich Graham Wallace’ Bericht über die Unternehmung, The Flight of Alcock & Brown, 14 – 15 June 1919, aus der London Library auslieh, war ich nach siebzehn Jahren der Erste, der das tat.
Wahrscheinlich haben niemals irgendwelche anderen Flieger in einem derart fragilen Flugzeug größeren Gefahren getrotzt. Die Vickers Vimy war kaum mehr als ein motorisierter Kastendrachen. Alcock und Brown flogen stundenlang durch das wildeste Wetter– durch Regen und Hagel und Schneegestöber. Blitze erleuchteten die Wolken, von denen sie umgeben waren, und Windböen schleuderten sie heftig in alle Richtungen. Ein Auspuffrohr platzte und ließ zum verständlichen Entsetzen der beiden Flammen an der Stoffbespannung des Flugzeuges entlangzüngeln. Brown musste sechsmal auf die Tragflächen hinauskriechen, um die Lufteinlässe mit bloßen Händen von Eis zu befreien. Den Großteil der restlichen Zeit brachte er damit zu, Alcocks Schutzbrille abzuwischen, da dieser die Bedienhebel nicht für einen Moment loslassen konnte. Beim Flug durch Wolken und Nebel verloren sie jegliche Orientierung. Als sie irgendwann wieder freie Sicht hatten, mussten sie erstaunt feststellen, dass sie sich nur zwanzig Meter über dem Wasser befanden und seitwärts flogen, im 90-Grad-Winkel zur Wasseroberfläche. Während einer der wenigen kurzen Phasen, in denen Brown in der Lage war zu navigieren, stellte er fest, dass sie versehentlich umgedreht waren und zurück nach Kanada flogen. Es hat tatsächlich nie einen haarsträubenderen Blindflug gegeben.
Nach sechzehnstündigem turbulentem Chaos tauchte wie durch ein Wunder Irland unter ihnen auf, und Alcock legte eine Bruchlandung auf einem sumpfigen Feld hin. Die beiden waren 1890 Meilen geflogen, was zwar nur wenig mehr als die Hälfte der Strecke von New York nach Paris war, aber trotzdem eine beachtliche Leistung darstellte. Nachdem sie unversehrt aus ihrem völlig ramponierten Flugzeug geklettert waren, hatten sie jedoch Probleme, irgendjemandem glaubhaft zu machen, was sie soeben vollbracht hatten. Da die Nachricht von ihrem Abflug in Neufundland mit Verspätung eingetroffen war, hatte in Irland niemand mit ihrer Ankunft gerechnet, und jegliche Vorfreude und Begeisterung fehlte. Die junge Frau im Telegrafenamt von Clifden, der nächstgelegenen Ortschaft, war offenbar nicht besonders gut in ihrem Job und nur in der Lage, kurze, leicht verdrehte Botschaften zu übermitteln, die noch zur Verwirrung beitrugen.
Als sich Alcock und Brown wieder in England einfanden, wurden sie dort wie Helden empfangen – bekamen Medaillen verliehen und wurden vom König zum Ritter geschlagen. Sie kehrten jedoch schnell wieder in ihr ruhiges früheres Leben zurück und gerieten in Vergessenheit. Alcock kam ein halbes Jahr später bei einem Flugunfall in Frankreich ums Leben, als er bei Nebel gegen einen Baum prallte. Brown flog nie wieder. Als der Traum, über den Atlantik zu fliegen, 1927 konkrete Formen annahm, erinnerte sich kaum noch jemand an die Namen der beiden.
Völlig zufällig und fast genau zur selben Zeit, als Alcock und Brown ihren Meilensteinflug unternahmen, hatte der New Yorker Geschäftsmann Raymond Orteig, der überhaupt keine Verbindung zur Fliegerei hatte, sondern einfach nur Gefallen an Flugzeugen fand, die Idee für einen Wettkampf, der die Luftfahrt revolutionieren sollte und als das »Great Atlantic Air Derby« bekannt wurde. Orteig stammte ursprünglich aus Frankreich, war jedoch inzwischen ein erfolgreicher Hotelier in New York. Inspiriert von den Heldentaten der Piloten im Ersten Weltkrieg setzte er einen Preis von 25 000 Dollar für den- oder diejenigen aus, dem oder denen es innerhalb der folgenden fünf Jahre gelang, ohne Zwischenstopp von New York nach Paris oder umgekehrt zu fliegen. Das war ein großzügiges Angebot, aber auch ein vollkommen risikoloses, da es kein Flugzeug gab, das eine solche Strecke in einem Stück hätte zurücklegen können. Wie Alcock und Brown schmerzhaft unter Beweis gestellt hatten, stieß bereits ein Flug über die Hälfte dieser Distanz an die äußersten Grenzen von Technik und Glück.
Niemand machte von Orteigs Angebot Gebrauch, doch 1924 erneuerte er es, und langsam schien der Gedanke in den Bereich des Möglichen zu rücken. Die Entwicklung luftgekühlter Motoren – Amerikas einziger herausragender Beitrag zur Luftfahrttechnologie in dieser Zeit – steigerte die Reichweite und Zuverlässigkeit von Flugzeugen. Außerdem gab es weltweit eine Fülle von talentierten, oft sogar brillanten und fast immer unterbeschäftigten Luftfahrtingenieuren und -konstrukteuren, die darauf brannten zu zeigen, was in ihnen steckte. Für viele war der Orteig-Preis nicht nur die größte Herausforderung weit und breit, sondern die einzige.
Der Erste, der einen Versuch wagte, war der große französische Pilot René Fonck, und zwar in Zusammenarbeit mit dem emigrierten russischen Konstrukteur Igor Sikorsky. Niemand hatte Erfolg dringender nötig als Sikorsky. Er war früher ein führender Flugzeugkonstrukteur in Europa gewesen, hatte jedoch 1917, während der Russischen Revolution, alles verloren und war nach Amerika geflüchtet. Jetzt, 1926, mit siebenunddreißig Jahren, hielt er sich über Wasser, indem er ebenfalls ausgewanderte Landsleute in Chemie und Physik unterrichtete und Flugzeuge baute, wenn sich die Gelegenheit ergab.
Sikorsky hatte eine Vorliebe für gut ausgestattete Flugzeuge – eines seiner Vorkriegsmodelle verfügte über eine Toilette und ein »Promenadendeck« (wobei es sich, zugegeben, um eine recht großzügige Beschreibung handelte) –, und das Flugzeug, das er jetzt für den Atlantikflug baute, war das luxuriöseste von allen. Es besaß eine Lederausstattung, ein Sofa und Sessel, eine Kochmöglichkeit und sogar ein Bett – alles, was eine Crew von vier Personen sich in Bezug auf Komfort und Eleganz wünschen konnte. Die Idee dahinter war, unter Beweis zu stellen, dass der Atlantik nicht nur überquert werden konnte, sondern mit Stil überquert werden konnte. Sikorsky wurde von einem Verband von Investoren unterstützt, die sich selbst »die Argonauten« nannten.
Als Piloten wählten sie René Fonck aus, Frankreichs größtes Kriegsass. Fonck hatte fünfundsiebzig deutsche Flugzeuge abgeschossen – er selbst behauptete, es seien über 120 gewesen –, eine Leistung, die aufgrund der Tatsache, dass er nur in den letzten zwei Jahren des Krieges geflogen war, umso bemerkenswerter war. Die ersten zwei Jahre hatte er damit verbracht, Schützengräben auszuheben, bevor es ihm gelang, die französische Luftwaffe davon zu überzeugen, ihm eine Chance in ihrer Flugschule zu geben. Fonck war geschickt beim Abschießen feindlicher Flugzeuge, besaß aber noch größeres Talent dafür, seine eigene Haut zu retten. Bei allen seinen Gefechten wurde Foncks Flugzeug nur einmal von einer feindlichen Kugel getroffen. Leider sind die Fähigkeiten und das Temperament, die im Kampfeinsatz gefragt sind, nicht unbedingt dieselben, die erforderlich sind, um ein Flugzeug erfolgreich über einen großen und leeren Ozean zu fliegen.
Was die Vorbereitung anbelangte, stellte Fonck nicht unbedingt gesunden Menschenverstand unter Beweis. Zuerst beharrte er darauf zu starten, bevor das Flugzeug hinreichend getestet worden war, und brachte Sikorsky damit beinahe zum Verzweifeln. Dann, was noch schlimmer war, belud er es viel zu schwer. Er packte zusätzlichen Treibstoff, eine Fülle von Notfall-Ausrüstungsgegenständen, zwei verschiedene Funkgeräte, Wechselbekleidung, Geschenke für Freunde und Unterstützer und jede Menge Essen und Getränke ein, unter anderem Wein und Champagner. Er wollte sogar ein Abendessen aus Wasserschildkröte, Truthahn und Ente mitnehmen, das zubereitet und gegessen werden sollte, nachdem sie Paris erreicht hatten, als hätten sie nicht darauf zählen können, in Frankreich verpflegt zu werden. Beladen wog das Flugzeug über zwölfeinhalb Tonnen, weit mehr, als konstruktionsbedingt vorgesehen war und als es vermutlich tragen konnte.
Am 20. September kam die Nachricht, dass zwei Franzosen, ein Major namens Pierre Weiss und ein gewisser Leutnant Challé, ohne Zwischenlandung von Paris nach Bandar Abbas in Persien (heute Iran) geflogen waren, eine Strecke von 3230 Meilen und damit fast genauso weit wie von New York nach Paris. Ermutigt von dieser Demonstration der scheinbar angeborenen Überlegenheit französischer Flieger bestand Fonck auf sofortige Vorbereitungen zum Abflug.
Am folgenden Morgen wurde die »Sikorsky« – die vor lauter Eile nicht einmal einen Namen bekommen hatte – vor den Augen einer großen Menschenmenge in Position gerollt, und ihre drei mächtigen silberfarbenen Motoren wurden angelassen. Schon von dem Augenblick an, als sie begann, die Rollbahn hinunterzurumpeln, war klar, dass irgendetwas nicht stimmte. In den zwanziger Jahren waren Flugfelder im Grunde genau das, Felder, und das Roosevelt Field war nicht besser als die meisten anderen. Da das Flugzeug einen besonders langen Anlauf brauchte, musste es zwei unbefestigte Zufahrtsstraßen überqueren, von denen keine geglättet worden war – eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie unüberlegt und vorschnell das ganze Unterfangen war. Als die »Sikorsky« mit hohem Tempo über die zweite Zufahrtsstraße holperte, brach ein Teil ihres Fahrwerks ab und beschädigte das linke Seitenruder, und ein gelöstes Rad rollte hüpfend von dannen. Fonck ließ sich jedoch nicht abbringen, gab Gas und nahm immer mehr Geschwindigkeit auf, bis er beinahe schnell genug war, um abzuheben. Beinahe war jedoch leider nicht genug. Tausende Hände wurden vor Münder gehalten, als das Flugzeug das Ende der Rollbahn erreichte, ohne auch nur einen Fingerbreit abgehoben zu haben, schwerfällig eine sechs Meter hohe Böschung hinunterpurzelte und aus dem Blickfeld verschwand.
Einige Augenblicke lang stand die Zuschauermenge in fassungsloser und unheimlicher Stille da. Vogelgezwitscher war zu hören und vermittelte den Eindruck von Beschaulichkeit, die in krassem Widerspruch zu der Katastrophe stand, welche sich soeben vor den Augen aller Anwesenden ereignet hatte. Dann kehrte mit einer gewaltigen Gasexplosion die schreckliche Realität zurück, als fast 11 000 Liter Flugbenzin in Flammen aufgingen und einen Feuerball fünfzehn Meter hoch in die Luft warfen. Fonck und seinem Navigator Lawrence Curtin gelang es irgendwie, ins Freie zu klettern, doch die anderen beiden Besatzungsmitglieder verbrannten auf ihren Sitzen. Der Vorfall schockierte die Fliegerschaft. Der Rest der Welt war ebenfalls geschockt, aber gleichzeitig beinahe krankhaft begierig nach mehr.
Für Sikorsky war der Vorfall sowohl in emotionaler als auch in finanzieller Hinsicht ein Schlag. Der Bau des Flugzeugs hatte mehr als 100 000 Dollar verschlungen, doch seine Geldgeber hatten bislang nur einen Bruchteil davon bezahlt und weigerten sich jetzt, nachdem das Flugzeug nicht mehr existierte, den Rest auszuhändigen. Sikorsky fand schließlich mit dem Bau von Helikoptern eine neue berufliche Aufgabe, doch fürs Erste waren Fonck und er, ihr Flugzeug und ihre Träume erledigt.
Bis auf Weiteres war es auch für andere potenzielle Ozeanflieger zu spät. Da die Wetterverhältnisse das sichere Überfliegen des Nordatlantiks nur während weniger Monate im Jahr zuließen, mussten alle bis zum nächsten Frühling warten.
Der Frühling kam, und Amerika hatte drei Teams im Rennen, alle mit hervorragenden Flugzeugen und erfahrener Besatzung. Allein die Namen der Flugzeuge – Columbia,America,American Legion – zeigten, wie sehr es inzwischen bei der Angelegenheit um Nationalstolz ging. Der ursprüngliche Favorit war die Columbia gewesen, der Eindecker, mit dem Chamberlin und Acosta kurz vor Ostern ihren Ausdauerrekord aufgestellt hatten. Doch zwei Tage nach diesem geschichtsträchtigen Flug wurde ein noch eindrucksvolleres und weitaus teureres Flugzeug aus seinem Werk in Hasbrouck Heights in New Jersey gerollt. Bei diesem Flugzeug handelte es sich um die America, die über drei leistungsstarke, brüllende Motoren verfügte und einer Besatzung von vier Mann Platz bot. Der Chef des America-Teams war der siebenunddreißigjährige Marine-Kommandant Richard Evelyn Byrd, der scheinbar zum Helden geboren war. Er stammte aus einer der ältesten, angesehensten Familien Amerikas und war weltmännisch und gut aussehend. Die Byrds hatten in Virginia seit der Zeit von George Washington eine Vormachtstellung inne. Richard Byrds Bruder Harry war Gouverneur des Bundesstaats, und er selbst war 1927 bereits ein gefeierter Abenteurer. Im vorangegangenen Frühling hatte er zusammen mit dem Piloten Floyd Bennett als Erster den Nordpol überflogen (wobei seit langem angezweifelt wird, ob dem tatsächlich so war, wie wir noch sehen werden).
Bei Byrds aktueller, selbst zur patriotischsten erklärter Expedition handelte es sich zudem um die mit Abstand am besten finanzierte – dank Rodman Wanamaker, seines Zeichens Eigentümer von Kaufhäusern in Philadelphia und New York, der selbst eine halbe Million Dollar zur Verfügung gestellt und zusätzliche Mittel in unbestimmter Höhe von anderen führenden Geschäftsleuten gesammelt hatte. Durch Wanamaker hatte Byrd jetzt die Kontrolle über die Verpachtung des Roosevelt Field, bei dem es sich um das einzige Flugfeld im ganzen Bundesstaat New York handelte, dessen Rollbahn lang genug war, um einem zur Überquerung des Atlantiks gebauten Flugzeug Platz zu bieten. Ohne Byrds Zustimmung konnte niemand anderer auch nur in Erwägung ziehen, im Rennen um den Orteig-Preis mitzumischen.
Wanamaker bestand darauf, dass es sich bei dem Unterfangen um eine durch und durch amerikanische Angelegenheit handeln solle. Darin lag eine gewisse Ironie, da der Konstrukteur des Flugzeugs, ein eigensinniger und schwieriger Zeitgenosse namens Anthony Fokker, Holländer war und die Maschine zum Teil in den Niederlanden gebaut worden war. Noch schlimmer, wenn auch nur selten erwähnt, war die Tatsache, dass Fokker die Kriegsjahre in Deutschland verbracht und Flugzeuge für die Deutschen gebaut hatte. Er hatte sogar die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Im Zuge seines Engagements für die deutsche Lufthoheit hatte er außerdem das synchronisierte Maschinengewehr erfunden, das in der Lage war, Kugeln zwischen den Flügeln des sich drehenden Propellers abzufeuern. Erstaunlicherweise hatten Flugzeughersteller bis dahin nicht mehr tun können, als die Propeller mit einer Panzerung zu versehen und zu hoffen, dass die Kugeln, die die Propellerflügel trafen, nicht nach hinten abprallten. Die einzige Alternative war, die Maschinengewehre in größerer Entfernung zum Propeller zu montieren, was jedoch bedeutete, dass die Piloten weder nachladen noch Munitionsstaus beheben konnten, die es häufig gab. Fokkers synchronisiertes Maschinengewehr verschaffte deutschen Fliegern eine Zeit lang einen tödlichen Vorteil und sorgte dafür, dass er vermutlich für mehr Tote unter den Alliierten verantwortlich war als irgendeine andere Einzelperson. Jetzt behauptete er allerdings, nie wirklich auf der Seite Deutschlands gestanden zu haben. »Mein Heimatland blieb während des großen Konflikts die ganze Zeit über neutral, und in gewissem Sinn tat ich das ebenfalls«, schreibt er in seiner Nachkriegs-Autobiografie Der fliegende Holländer. Die Memoiren des Anthony H. G. Fokker. Er erklärte nie, in welchem Sinn er sich für neutral hielt, was zweifellos daran lag, dass es keinen Sinn gab, in dem er es gewesen war.
Byrd hatte Fokker noch nie leiden können, und im April 1927 wurde die Feindschaft zwischen den beiden noch erbitterter. Kurz vor sechs Uhr abends zwängten sich Fokker und die drei anderen Mitglieder des Byrd-Teams – der Copilot Floyd Bennett, der Navigator George Noville und Byrd selbst – ungeduldig ins Cockpit. Fokker übernahm bei dem Jungfernflug den Steuerknüppel. Die America hob problemlos ab und funktionierte in der Luft einwandfrei, doch bei der Landung zeigte sich, dass die unvermeidliche Last der Schwerkraft sie dazu zwang, sich nach vorne zu neigen und mit der Nase zuerst aufzusetzen. Das Problem war, dass sich das ganze Gewicht im vorderen Bereich befand und sich keiner der vier Männer an Bord nach hinten begeben konnte, um die Beladung umzuverteilen, da ein großer Treibstofftank den mittleren Teil des Rumpfs vollständig ausfüllte.
Fokker kreiste über dem Flugfeld, während er sich überlegte, welche Optionen er hatte (oder sich vielmehr überlegte, dass er keine Optionen hatte), und setzte dann zu einer möglichst sanften Landung an. Was genau als Nächstes geschah, sorgte sofort für hitzige Diskussionen. Byrd behauptete, Fokker habe den Steuerknüppel losgelassen, alles unternommen, um sich selbst zu retten, und die anderen ihrem Schicksal überlassen. Fokker stritt das vehement ab. Aus einem abstürzenden Flugzeug zu springen sei unmöglich, sagte er. »Vielleicht bildete sich Byrd das in der Aufregung nur ein«, schrieb Fokker später mit gequältem Sarkasmus in seiner Autobiografie. Erhalten gebliebene Filmaufnahmen von der Bruchlandung, die sowohl kurz als auch unscharf sind, zeigen, wie das Flugzeug unsanft landete, mit der Nase aufsetzte und dann aufs Heck kippte – alles in einer flüssigen Bewegung wie ein Kind, das einen Purzelbaum schlägt. Fokker und alle übrigen Insassen konnten nichts anderes getan haben, als sich abzustützen und festzuhalten.
Bei Betrachtung der Filmaufnahmen wirkt der Schaden unerheblich, doch im Inneren des Flugzeugs herrschte heftiges Chaos. Ein Teil des Propellers war ins Cockpit eingedrungen und hatte sich in Bennetts Brust gebohrt. Er war schwer verletzt und verlor viel Blut. Noville, der das Feuer, das zwei von Foncks Männern getötet hatte, noch schmerzhaft in Erinnerung hatte, boxte sich den Weg nach draußen durch die Stoffverkleidung des Flugzeugs frei. Byrd folgte ihm. Vor lauter Wut auf Fokker nahm er angeblich nicht einmal zur Kenntnis, dass sein linker Arm wie ein Zweig abgeknickt war und auf grauenhaft unnatürliche Weise herabhing. Fokker, der unverletzt war, stand da, schrie Byrd ebenfalls an und warf ihm vor, das Flugzeug auf seinem ersten Flug überladen zu haben.
Der Vorfall säte beträchtlichen Hass im Byrd-Lager und warf das Team bei seinen Plänen um Wochen zurück. Bennett wurde schnellstens nach Hackensack ins Krankenhaus gebracht, wo er die nächsten zehn Tage mit dem Tod rang. Für das Team fiel er damit endgültig aus. Das Flugzeug musste fast vollständig neu aufgebaut und zu einem großen Teil umkonstruiert werden, um für eine vernünftigere Gewichtsverteilung zu sorgen. Das Byrd-Team war also vorerst aus dem Rennen.
Somit blieben zwei andere amerikanische Flugzeuge übrig, aber leider meinte es das Schicksal mit ihnen auch nicht gut. Am 24. April, acht Tage nach der Byrd-Bruchlandung, ließ sich Clarence Chamberlin dazu überreden, mit der neunjährigen Tochter des Columbia-Eigentümers Charles A. Levine und der Tochter eines Beamten des Brooklyn Chamber of Commerce eine kurze Runde über Long Island zu drehen. Der Flug wurde für Chamberlins junge Passagiere aufregender, als sie erwartet hatten, da während des Starts das Fahrwerk auseinanderfiel und ein Rad zurückblieb, was bedeutete, dass er zum Landen nur noch ein Rad hatte. Chamberlin gelang trotzdem eine beinahe perfekte Landung, bei der weder er selbst noch seine Passagiere verletzt wurden, doch eine Tragfläche schlug auf dem Boden auf, und der Schaden am Flugzeug reichte aus, um den Zeitplan des Columbia-Teams erheblich zu verzögern.
Alle Hoffnung richtete sich jetzt auf zwei beliebte Marineoffiziere der Hampton Roads Naval Airbase in Virginia, auf Noel Davis und Stanton H. Wooster. Die beiden waren clevere, fähige Piloten, und ihr Flugzeug, eine in Bristol gebaute Keystone Pathfinder, war funkelnagelneu und wurde von drei Wright-Whirlwind-Motoren angetrieben. Was die Öffentlichkeit nicht wusste, war, dass das Flugzeug bei der Auslieferung gut 500 Kilo mehr auf die Waage brachte als ursprünglich geplant. Davis und Wooster unternahmen eine Reihe von Testflügen, bei denen sie jedes Mal vorsichtig den Treibstoffvorrat erhöhten, und hatten bislang keine Probleme gehabt. Ihren letzten Testflug setzten sie für den 26. April an, zwei Tage nach Chamberlins Notlandung. Dieses Mal wollten sie mit einer Gesamtbeladung von 7700 Kilogramm starten, über 25 Prozent mehr, als das Flugzeug bislang zu heben versucht hatte.
Unter denjenigen, die gekommen waren, um den beiden zuzujubeln, befanden sich Davis’ junge Frau mit dem gemeinsamen Baby in den Armen sowie Woosters Verlobte. Dieses Mal hatte das Flugzeug Mühe, sich vom Boden zu lösen. Zu guter Letzt erhob es sich aber doch in die Lüfte, allerdings nicht hoch genug, um eine Baumreihe am Rand eines angrenzenden Feldes zu überfliegen. Wooster ging scharf in die Querlage, worauf das Flugzeug überzog und mit einem scheußlichen Krachen auf die Erde fiel. Davis und Wooster waren sofort tot, und Amerika hatte zumindest vorläufig keine Anwärter auf den Orteig-Preis mehr.
Zu allem Übel lief es für Ausländer ziemlich gut. Während die amerikanischen Flieger ihre gesamte Energie in Landflugzeuge steckten, sahen die Italiener die Zukunft in Wasserflugzeugen. Letztere boten einige Vorteile: Sie konnten Meere inselhüpfend überqueren, Flüssen tief in Dschungelgebiete folgen, in Küstengemeinden landen, bei denen es keinen Platz für Landepisten gab, und andere Orte erreichen, an die herkömmliche Flugzeuge nicht gelangten.
Niemand demonstrierte die Vielseitigkeit und Nützlichkeit von Wasserflugzeugen besser als der italienische Pilot Francesco de Pinedo. Als Sohn eines Rechtsanwalts aus Neapel war Pinedo gut ausgebildet und strebte eine Karriere in einem gehobenen Beruf an, bis er die Fliegerei für sich entdeckte, die zu seinem Lebensinhalt wurde. 1925 flog Pinedo in Begleitung eines Mechanikers namens Ernesto Campanelli von Italien nach Australien und über Japan wieder zurück. Die beiden schafften die Strecke in verhältnismäßig kurzen Etappen, blieben immer in der Nähe des Festlands und brauchten sieben Monate, um ihre Reise zu vollenden – doch sie legten insgesamt 34 000 Meilen zurück, eine gewaltige Distanz, ganz egal, welche Maßstäbe man anlegte. Pinedo wurde zum Nationalhelden und von Benito Mussolini, der 1922 an die Macht gekommen war, mit Ehrungen überhäuft. Mussolini war von der Fliegerei begeistert – von ihrer Geschwindigkeit, dem dafür erforderlichen Wagemut und der Verheißung technologischer Überlegenheit. Seiner Ansicht nach verkörperte der kleine Neapolitaner, der zu seinem Abgesandten der Lüfte wurde, alle diese Eigenschaften auf magische Weise.
Die Zeitschrift Time, damals vier Jahre alt und verliebt in Stereotypen, beschrieb Pinedo im Frühjahr 1927 als »dunkelhäutiges Faschisten-Fliegerass«. (Die Time bezeichnete damals fast jeden, der von der Südseite der Alpen kam, als »dunkelhäutig«.) In Wirklichkeit war Pinedo nicht besonders dunkelhäutig und ganz bestimmt kein Fliegerass – er hatte den Krieg damit zugebracht, Aufklärungsflüge zu machen –, doch er war in der Tat ein treu ergebener Faschist. Mit seinem schwarzen Hemd, seinem vor Brillantine glänzenden Haar, seinem markanten Kinn und seiner Angewohnheit, mit in die Hüften gestützten Händen dazustehen, war er in beinahe lächerlichem Maße der Inbegriff des umherstolzierenden, selbstgefälligen Faschisten. Das stellte für niemanden ein Problem dar, solange Pinedo in Europa blieb. Aber im Frühjahr 1927 kam er nach Amerika. Schlimmer noch, er kam auf die denkbar heldenhafteste Art und Weise.
Während sich Amerikas Atlantik-Aspiranten bemühten, ihre Flugzeuge fertigzustellen, bahnte sich Pinedo effizient den Weg in die Vereinigten Staaten an der Küste Afrikas entlang, über die Kapverden, Südamerika und die Karibik. Dabei handelte es sich um die erste Überquerung des Atlantiks mit einem Flugzeug in westlicher Richtung – eine wahre Meisterleistung, auch wenn sie nicht ohne Zwischenlandung erfolgte. Pinedo erreichte die Vereinigten Staaten Ende März in New Orleans und begann eine aufwendige, wenn auch nicht immer ganz willkommene Rundreise durch das Land.
Es war schwierig zu entscheiden, was man von ihm halten sollte. Einerseits war er ohne Zweifel ein begabter Flieger und hatte ein Recht auf die eine oder andere Parade. Andererseits handelte es sich bei ihm um einen Repräsentanten einer abscheulichen Regierungsform, die von vielen italienischen Einwanderern bewundert wurde und dadurch eine Bedrohung für den »American Way of Life« darstellte. In einer Zeit, in der Amerika bei seinen Bemühungen auf dem Gebiet der Luftfahrt einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen musste, wirkte Pinedos ausgedehnte Ehrenrunde durch das Land ein wenig unsensibel.
Nach seiner Ankunft in New Orleans flog Pinedo Richtung Westen nach Kalifornien weiter und legte unterwegs Zwischenstopps in Galveston, San Antonio, Hot Springs und anderen Gemeinden ein, um aufzutanken und sich von kleinen Gruppen von Anhängern und einer deutlich größeren Anzahl von ausschließlich Neugierigen feiern zu lassen. Am 6. April, auf dem Weg zu einem Empfang in San Diego, landete er in der Wüste westlich von Phoenix auf einem Stausee mit dem Namen Roosevelt Lake. Selbst an einem so abgeschiedenen Ort wie diesem versammelte sich eine Menschenmenge. Während die Anwesenden ehrerbietig zusahen, wie das Flugzeug gewartet wurde, zündete sich ein Jugendlicher namens John Thomason eine Zigarette an und warf das Streichholz gedankenlos ins Wasser. Die Wasseroberfläche war mit Öl und Flugbenzin bedeckt und fing mit einem heftigen Knall Feuer, der die Schaulustigen auseinanderstieben ließ. Binnen Sekunden stand Pinedos geliebtes Flugzeug in Flammen, und die Mechaniker schwammen um ihr Leben.
Pinedo, der in einem Hotel am See zu Mittag aß, blickte von seinem Teller auf und sah Rauch, wo sich soeben noch sein Flugzeug befunden hatte. Die Maschine wurde bis auf ihren Motor, der auf den Grund des Sees in zwanzig Metern Tiefe sank, völlig zerstört. Die italienische Presse, die bereits überempfindlich auf die antifaschistische Stimmung in Amerika reagierte, kam zu dem Schluss, dass es sich um einen heimtückischen Sabotageakt gehandelt habe. »Abscheuliches Verbrechen gegen den Faschismus«, beklagte sich eine Zeitung in einer Überschrift. »Abstoßende Tat von Antifaschisten«, echote eine andere. Der amerikanische Botschafter in Italien, Henry P. Fletcher, machte die Sache noch schlimmer, indem er rasch einen Entschuldigungsbrief an Mussolini schrieb, in dem er das Feuer als einen »Akt krimineller Torheit« bezeichnete und versprach, der Schuldige werde »ausfindig gemacht und schwer bestraft«. Anschließend berichtete ein Times-Korrespondent tagelang aus Rom, die italienischen Bürger würden über kaum etwas anderes als diesen katastrophalen Rückschlag für »ihren Helden, ihren Übermenschen, ihren Halbgott de Pinedo« sprechen. Letztendlich beruhigten sich jedoch alle Seiten und nahmen hin, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte, doch die Verdächtigungen kochten auf kleiner Flamme weiter, und von nun an wurden Pinedo und seine Habseligkeiten von Furcht einflößenden Fascisti-Freiwilligen bewacht, die mit Stiletten und Schlagstöcken bewaffnet waren.
Pinedo überließ es seinen Helfern, den durchnässten Motor aus dem See zu bergen und wieder zu trocknen, während er sich auf den Weg Richtung Osten nach New York machte, um dort auf das Eintreffen eines Ersatzflugzeugs aus Italien zu warten, das ihm Mussolini sofort zugesagt hatte.
Was Pinedo natürlich nicht ahnen konnte, war, dass seine Probleme, sowohl im Leben als auch in der Luft, gerade erst begonnen hatten.
Die Aufmerksamkeit der Welt schwenkte auf Paris, wo im Morgengrauen des 8. Mai zwei Männer leicht fortgeschrittenen Alters in unförmigen Fluganzügen unter dem respektvollen Applaus derer, die ihnen alles Gute wünschten, aus einem Verwaltungsgebäude am Flugplatz Le Bourget auftauchten. Die beiden Männer, Captain Charles Nungesser und Captain François Coli, bewegten sich steif und etwas unsicher voran. In ihrer schweren Montur, die nötig war, da sich die beiden anschickten, 3600 Meilen in einem offenen Cockpit zu fliegen, hatten sie eine verblüffende Ähnlichkeit mit kleinen Jungen in Schneeanzügen.
Viele der Anwesenden hatten die ganze Nacht im Freien gewartet und trugen noch immer Abendbekleidung. Die New York Times verglich die Szene mit einer Gartenparty. Unter denjenigen, die gekommen waren, um die beiden Flieger zu verabschieden, befanden sich auch der Boxer Georges Carpentier, ein Freund von Nungesser, und der Sänger Maurice Chevalier mit seiner Geliebten, einer berühmten Chanteuse und Schauspielerin, die unter dem sinnlichen Pseudonym Mistinguett bekannt war.
Nungesser und Coli waren Kriegshelden und spazierten normalerweise mit dem lässigen und großspurigen Auftreten von Männern umher, die sich von Gefahren nicht aus der Ruhe bringen ließen, doch an diesem Tag war alles ein wenig anders. Coli war mit seinen sechsundvierzig Jahren eine ehrwürdige Figur: Nicht viele Piloten lebten und flogen in diesem Alter noch. Er trug ein verwegenes schwarzes Monokel vor seinem fehlenden rechten Auge – eine von fünf Verletzungen, die er im Kampfeinsatz davongetragen hatte. Das war allerdings nichts verglichen mit Nungessers ausschweifender Neigung zu Blessuren. Niemand war im Krieg häufiger verwundet gewesen – zumindest niemand, der anschließend wieder aufstand. Nungesser erlitt so viele Verletzungen, dass er sie nach dem Krieg alle auf seiner Visitenkarte auflistete. Dazu zählten: sechs Kieferbrüche (viermal Oberkiefer, zweimal Unterkiefer); eine Schädel- und Gaumenfraktur; Schussverletzungen am Mund und an den Ohren; Luxation des Handgelenks, der Schulter, des Fußknöchels und der Knie; der Verlust von Zähnen; Granatsplitterwunden am Oberkörper; mehrere Gehirnerschütterungen; mehrere Beinbrüche; mehrere innere Verletzungen sowie »zu viele Prellungen, um sie aufzulisten«. Außerdem wurde er bei einem Autounfall, bei dem ein Kamerad ums Leben kam, schwer verwundet. Oft war er so lädiert, dass er von Crewmitgliedern zu seinem Flugzeug getragen und vorsichtig ins Cockpit gesetzt werden musste. Trotz seiner Wunden schoss Nungesser vierundvierzig feindliche Flugzeuge ab (er selbst behauptete, wesentlich mehr), eine Zahl, die unter französischen Fliegern nur von René Fonck übertroffen wurde, und erhielt so viele Medaillen, dass er beim Gehen beinahe rasselte. Letztere listete er ebenfalls auf seiner Visitenkarte auf.
Wie bei so vielen Fliegern sorgte der Waffenstillstand bei ihm für eine gewisse Ratlosigkeit. Er arbeitete eine Zeit lang als Gaucho in Argentinien, gab zusammen mit einem Freund, dem Marquis de Charette, Flugvorführungen in Amerika und spielte die Hauptrolle in einem Spielfilm mit dem Titel The Sky Raider, der auf dem Roosevelt Field in New York gedreht wurde, wo sich jetzt die Anwärter auf den Orteig-Preis versammelten.
Mit seinem gallischen Charme und einer Brust voller Medaillen erwies sich Nungesser für Frauen als unwiderstehlich, und im Frühling 1923 verlobte er sich nach einer stürmischen Romanze mit einer jungen Dame der New Yorker Gesellschaft mit dem herrlichen, nicht verbesserungsfähigen Namen Consuelo Hatmaker. Miss Hatmaker, die erst neunzehn war, stammte aus einer langen Linie quirliger Frauen. Ihre Mutter, die ehemalige Nellie Sands, war eine bekannte Schönheit und hatte sich bereits für drei Ehemänner als nicht zu bändigen erwiesen, unter ihnen der namengebende Mr Hatmaker, dessen sie sich bei ihrer Scheidung im Jahr 1921 entledigte. Dieser fassungslose, aber wohlmeinende Gentleman hatte – auf den ersten Blick durchaus berechtigte – Einwände gegen die Hochzeit seiner Tochter mit Captain Nungesser, und zwar aufgrund der Tatsache, dass Nungesser mittellos, ein körperliches Wrack, ein ziemlicher Rabauke, außer in Kriegszeiten erwerbsunfähig und Franzose war. Mr Hatmaker wurde darin allerdings nicht von seiner Exfrau unterstützt, die mit der Heirat nicht nur einverstanden war, sondern ankündigte, dass sie zum selben Zeitpunkt ihren neuesten Liebhaber, Captain William Waters, ehelichen werde, einen Amerikaner von liebenswerter Anonymität, der offenbar nur zweimal in seinem Leben das flüchtige Interesse der Öffentlichkeit erregte: einmal, als er sich mit Mrs Hatmaker vermählte, und einmal, als sich die beiden wenige Jahre später wieder scheiden ließen. Also heirateten Mutter und Tochter bei einer gemeinsamen Zeremonie in Dinard in der Bretagne, nur unweit von dem Ort entfernt, wo Charles Nungesser im Frühjahr 1927 einen letzten Blick von seinem Heimatboden erhaschen sollte.
Die Ehe von Consuelo und Charles war kein Erfolg. Sie verkündete von vornherein, dass sie nicht in Frankreich leben wolle, während er es für unter seiner Würde hielt, irgendwo anders zu leben. Die beiden trennten sich schnell wieder und wurden 1926 geschieden. Doch Nungesser überlegte es sich offenbar noch einmal anders, da er in Gegenwart von Freunden plötzlich laut darüber nachdachte, ob eine heldenhafte Geste womöglich dabei helfen würde, ihn mit der üppigen Consuelo und ihrem nicht minder üppigen Vermögen wieder zu vereinen. Was ihm bei seinen Bestrebungen half, war die Pechserie von Fonck, dessen Bruchlandung im vorangegangenen Herbst es Nungesser erleichterte, den Flugzeughersteller Pierre Levasseur zu überreden, ihn mit einer Maschine auszustatten, damit er den französischen Nationalstolz wiederherstellen konnte. Wenn ein Preis, der von einem Franzosen gestiftet worden war, von französischen Piloten in einem französischen Flugzeug gewonnen worden wäre, hätte das dem Ansehen Frankreichs zweifellos Vorschub geleistet. Coli schloss sich dem Vorhaben bereitwillig als Navigator an. Die beiden tauften ihr Flugzeug L’Oiseau Blanc, »Weißer Vogel«, und lackierten es weiß, damit es leichter zu finden sein würde, falls es ins Meer stürzte.
In Paris zu starten war eine patriotische Eitelkeit, die sich nach Ansicht vieler als ihr Verderben erweisen würde. Es bedeutete, dass sie gegen vorherrschende Winde fliegen mussten, die ihre Geschwindigkeit reduzieren und ihren Treibstoffverbrauch drastisch erhöhen würden. Ihr Flugzeug war mit einem wassergekühlten Lorraine-Dietrich-Motor ausgerüstet, dem gleichen Modell, mit dem Pinedo nach Australien geflogen war, daher besaß es einen Stammbaum, allerdings handelte es sich dabei nicht um einen Motor, der für lange Ozeanüberquerungen konstruiert worden war. Auf jeden Fall konnten sie nur Treibstoff für vierzig Flugstunden mitnehmen, was ihnen fast keinen Spielraum für Fehler ließ. Nungesser schien sich darüber im Klaren zu sein, dass das, was sie zu erreichen hofften, wahrscheinlich nicht möglich war. Als er am 8. Mai um sein Flugzeug herumging, lächelte er diejenigen, die ihnen alles Gute wünschten, gequält an und wirkte abwesend. Um seine Wachsamkeit zu steigern, ließ er sich eine intravenöse Koffein-Injektion verabreichen, die seinen Nerven sicherlich nicht guttat.
Coli dagegen machte einen völlig entspannten Eindruck, gab Nungesser jedoch recht, dass das Flugzeug überladen war und erleichtert werden sollte. Die beiden beschlossen, einen Großteil ihres Reiseproviants sowie ihre Rettungswesten und ein Schlauchboot zurückzulassen. Falls sie gezwungen waren, auf dem Wasser notzulanden, hätten sie nichts bei sich gehabt, das ihnen dabei geholfen hätte zu überleben, außer einer Vorrichtung zum Destillieren von Meerwasser, einem Stück Angelschnur mit Haken und einer merkwürdigen Auswahl an Nahrungsmitteln: drei Dosen Tunfisch und eine Dose Sardinen, ein Dutzend Bananen, ein Kilo Zucker, eine Thermosflasche mit heißem Kaffee und Brandy. Nach dem Ausladen von Ausrüstungsgegenständen wog ihr Flugzeug noch immer knapp fünf Tonnen. Es hatte nie zuvor mit einer solchen Beladung abgehoben.
Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, umarmten sich Coli und seine Frau, dann winkten er und Nungesser den Anwesenden zum Abschied und kletterten an Bord. Um 5:15 Uhr morgens nahmen sie schließlich ihre Startposition ein. Die Rollbahn in Le Bourget war zwei Meilen lang, und sie würden fast alles davon brauchen. Das Flugzeug überquerte die Grasfläche erschreckend langsam, nahm aber nach und nach Geschwindigkeit auf. Nach einiger Zeit hob es kurz ab, sackte jedoch wieder herunter und legte hüpfend weitere 300 Meter zurück, ehe es sich endlich mit Mühe in die Lüfte aufschwang. Der Chefingenieur, der einen großen Teil der Strecke neben dem Flugzeug hergelaufen war, fiel weinend auf die Knie. Allein der Start war ein einzigartiger Triumph. Bislang hatte das kein anderes Flugzeug im Atlantikwettkampf geschafft. Die Zuschauermenge brachte lautstark ihre Anerkennung zum Ausdruck. Dann kletterte die L’Oiseau Blanc mit schmerzlicher Langsamkeit in den milchigen Dunst des westlichen Himmels und nahm Kurs auf den Ärmelkanal. Eine Stunde und siebenundzwanzig Minuten später, um 6:48 Uhr, erreichten Nungesser und Coli bei Étretat die Kalkklippen der Normandie. Eine Staffel von vier Begleitflugzeugen neigte zum Gruß die Tragflächen und drehte ab, und die L’Oiseau Blanc flog allein auf die Britischen Inseln und den kalten Atlantik dahinter zu.
Ganz Frankreich hielt gespannt den Atem an.
Am folgenden Tag traf die freudige Nachricht ein, dass die beiden Flieger es geschafft hätten. »Nungesser est arrivê«, verkündete die Pariser Zeitung L’Intransigeant aufgeregt (so aufgeregt, dass sie einen Zirkumflex anstelle eines Accent aigu auf »arrivé« setzte). Ein Konkurrenzblatt, die Paris Presse, zitierte Nungessers erste Worte zum amerikanischen Volk nach der Landung. Diesem Bericht zufolge hatte Nungesser eine sanfte und elegante Landung im Hafen von New York hingelegt und das Flugzeug vor der Freiheitsstatue zum Stehen gebracht (die ebenfalls aus Frankreich stamme, wie die Zeitung stolz anmerkte). An Land seien die beiden Flieger dann von einer zutiefst beeindruckten und jubelnden Stadt empfangen und bei ihrer Parade auf der Fifth Avenue mit Konfetti überschüttet worden.
In Paris brachte die frohe Kunde die Stadt beinahe zum Erliegen. Glocken läuteten. Fremde lagen sich weinend in den Armen. Menschenmengen scharten sich um jeden, der im Besitz einer Zeitung war. Levasseur schickte ein Glückwunschtelegramm. Im Haus von Colis Mutter in Marseille wurde Champagner hervorgeholt. »Ich wusste, mein Sohn würde es schaffen, weil er mir das versprochen hat«, sagte Colis Mutter, auf deren Wangen Tränen der Freude und Erleichterung glänzten.
Wie sich jedoch bald herausstellte, basierten die beiden Berichte nicht nur auf Missverständnissen, sondern waren traurigerweise frei erfunden. Nungesser und Coli waren nicht in New York angekommen. In Wirklichkeit waren sie verschollen, und man befürchtete, dass sie abgestürzt waren.
Daraufhin wurde unverzüglich mit einer riesigen Suchaktion auf dem Meer begonnen. Schiffe der Marine wurden ausgesandt, und Handelsschiffe wurden angewiesen, genau Ausschau zu halten. Das Marine-Luftschiff USSLos Angeles erhielt den Befehl, aus der Luft zu suchen. Der Passagierdampfer France, der von Le Havre nach New York unterwegs war, wurde von der französischen Regierung angewiesen, trotz des Risikos von Eisbergen einen nördlicheren Kurs zu nehmen als sonst, in der Hoffnung, dass er auf die womöglich im Meer treibende L’Oiseau Blanc stoßen würde. Am Roosevelt Field setzte Rodman Wanamaker eine Belohnung von 25 000 Dollar aus, falls es jemandem gelang, die vermissten Piloten zu finden – tot oder lebendig.
Ungefähr einen Tag lang klammerten sich die Menschen an die Hoffnung, dass Nungesser und Coli jeden Moment triumphierend ins Blickfeld getuckert kämen, doch jede Stunde, die verstrich, zählte gegen sie, und jetzt verschlechterte sich auch noch das ohnehin düstere Wetter merklich. Dichter Nebel machte sich über dem östlichen Atlantik breit und verhüllte die nordamerikanische Meeresküste von Labrador bis zu den Mittelatlantikstaaten. Der Leuchtturmwärter von Ambrose Light, einem schwimmenden Leuchtturm vor der Einfahrt zum New Yorker Hafen, berichtete, dass Tausende Vögel, die sich auf ihrer alljährlichen Wanderung nach Norden verirrt hatten, verzweifelt an jeder Oberfläche, an der sie sich festkrallen konnten, Schutz suchen würden. Auf Sandy Hook, New Jersey, schwenkten vier Suchscheinwerfer unablässig, aber sinnlos über den Himmel, da ihr Lichtstrahl nicht imstande war, die alles verhüllende Düsternis zu durchdringen. In Neufundland gingen die Temperaturen in den Keller, und leichter Schneefall setzte ein.
Da einigen Berichterstattern nicht bewusst war, dass sich die beiden Flieger im letzten Moment von einigen Vorräten getrennt hatten, merkten sie an, Nungesser und Coli hätten genug Nahrungsmittel eingepackt, um sich wochenlang versorgen zu können. Außerdem behaupteten sie, ihr Flugzeug sei darauf ausgelegt, sich unbegrenzt an der Wasseroberfläche zu halten (was nicht zutraf). Viele Leute schöpften aus der Tatsache Hoffnung, dass zwei Jahre zuvor der amerikanische Pilot Commander John Rodgers und seine drei Besatzungsmitglieder neun Tage lang tot geglaubt durch den Atlantik getrieben waren, ehe sie von einem U-Boot gerettet wurden, nachdem es ihnen nicht gelungen war, von Kalifornien nach Hawaii zu fliegen.
Nungesser und Coli wurden daraufhin an den unterschiedlichsten Orten vermutet: in Island, in Labrador, auf irgendeinem vorbeifahrenden Schiff, das sie aus dem Meer gefischt hatte. Drei Personen in Irland behaupteten, sie gesehen zu haben, was manchen Zuversicht vermittelte, während andere der Meinung waren, dass drei Sichtungen in einem Land mit drei Millionen Einwohnern nicht viel seien. Sechzehn Neufundländer, überwiegend aus Harbour Grace und Umgebung, gaben an, ein Flugzeug gehört oder gesehen zu haben, wenngleich sich keiner von ihnen sicher war, dass es sich dabei um das von Nungesser und Coli gehandelt hatte. Entsprechende Meldungen kamen aus Nova Scotia, Maine, New Hampshire und sogar aus dem deutlich südlicher gelegenen Port Washington auf Long Island.
Ein kanadischer Trapper präsentierte eine angeblich von Nungesser unterschriebene Botschaft, doch bei genauerer Untersuchung zeigte sich, dass diese verdächtig viele Schreibfehler enthielt und in einer Handschrift verfasst war, die der von Nungesser überhaupt nicht ähnlich sah, dafür aber der des Sohns des Trappers. Flaschenpost wurde ebenfalls gefunden und tauchte noch bis 1934 auf. Was jedoch nicht entdeckt wurde, war eine Spur von der L’Oiseau Blanc oder von ihren Insassen.
In Frankreich zirkulierte das Gerücht, der US-Wetterdienst habe den Franzosen wichtige Informationen vorenthalten, um den Vorteil amerikanischer Flieger zu wahren. Der Botschafter der Vereinigten Staaten, Myron Herrick, telegrafierte nach Washington, dass ein amerikanischer Flug zu diesem Zeitpunkt unklug wäre.
Die ganze Woche entpuppte sich als Desaster für die französische Luftfahrt. Zur selben Zeit, als Nungesser und Coli von Le Bourget starteten, kam ein anderes ehrgeiziges französisches Flugprojekt ins Rollen – das heute in Vergessenheit geraten ist und bereits damals vom Rest der Welt kaum zur Kenntnis genommen wurde –, bei dem die drei Flieger Pierre de Saint-Roman, Hervé Mouneyres und Louis Petit vom Senegal, an der afrikanischen Westküste, Richtung Brasilien starteten. Als sie nur noch 120 Meilen von der brasilianischen Küste entfernt waren, gaben sie über Funk die frohe Kunde durch, sie würden in einer guten Stunde ihr Ziel erreichen – zumindest berichtete das ein Korrespondent der Zeitschrift Time. Anschließend hörte nie wieder jemand etwas von ihnen. Ein Flugzeugwrack wurde nie gefunden.
Innerhalb von neun Monaten waren elf Menschen beim Versuch, den Atlantik zu überfliegen, ums Leben gekommen. Genau zu diesem Zeitpunkt traf ein schlaksiger junger Mann mit dem Spitznamen »Slim« aus dem Westen ein und verkündete sein Vorhaben, den Ozean allein mit dem Flugzeug zu überqueren. Sein richtiger Name lautete Charles Lindbergh.
Der Beginn eines außergewöhnlichen Sommers stand unmittelbar bevor.
MAI: Der Junge
Im Frühjahr 27 blitzte etwas Strahlendes und
Neuartiges durch den Himmel.
F. Scott Fitzgerald,
Geschichten aus der Jazz-Ära
Erstes Kapitel
Zehn Tage bevor Charles Lindbergh so berühmt wurde, dass es vor jedem Gebäude, in dem er sich aufhielt, zu Menschenaufläufen kam und sich Kellner um einen Maiskolben zankten, den er auf seinem Teller zurückließ, hatte noch niemand etwas von ihm gehört. Die New York Times hatte ihn einmal im Zusammenhang mit bevorstehenden Atlantikflügen erwähnt und dabei seinen Namen falsch geschrieben.
Was die ganze Nation in Bann hielt, als 1927 der Frühling dem Sommer wich, war die Nachricht von einem grauenhaften Mord in einem bescheidenen Familienheim auf Long Island – zufälligerweise in der Nähe des Roosevelt Field, wo sich jetzt die Atlantikflieger versammelten. Die Zeitungen nannten ihn voller Begeisterung den Sash Weight Murder Case, den »Schiebefenster-Gegengewichts-Mordfall«. Die Geschichte war folgende:
Als Mr und Mrs Albert Snyder am späten Abend des 20. März 1927 in ihrem Haus in der 222. Straße, einer ruhigen Mittelklassegegend von Queens Village, nebeneinander in Einzelbetten schliefen, hörte Mrs Snyder plötzlich Geräusche aus dem Flur im Obergeschoss. Sie stand auf, um nach dem Rechten zu sehen, und fand unmittelbar vor ihrer Schlafzimmertür einen großen Mann vor – einen »Riesen«, wie sie der Polizei sagte. Er unterhielt sich in einer Fremdsprache mit einem anderen Mann, den sie nicht sehen konnte. Bevor Mrs Snyder reagieren konnte, packte sie der Riese und schlug sie so heftig, dass sie für sechs Stunden das Bewusstsein verlor. Dann begaben sich er und sein Komplize ans Bett von Mr Snyder, strangulierten den armen Mann mit einem Stück Bilderdraht und schlugen ihm mit dem Gegengewicht eines Schiebefensters den Schädel ein. Dieses Gegengewicht entfachte die Fantasie der Öffentlichkeit und gab dem Fall seinen Namen. Anschließend rissen die beiden Schurken im ganzen Haus Schubladen heraus und flohen mit Mrs Snyders Schmuck, sie hinterließen jedoch auf einem Tisch im Erdgeschoss ein Indiz in Form einer italienischsprachigen Zeitung.
Die New York Times zeigte sich am nächsten Tag fasziniert, aber auch irritiert. In einer großen Überschrift auf Seite eins titelte sie:
KUNSTREDAKTEURIMBETTERSCHLAGEN
EHEFRAUGEFESSELT, HAUSDURCHSUCHT
MOTIVSTELLTDIEPOLIZEIVORRÄTSEL
In dem Artikel hieß es, ein gewisser Dr. Vincent Juster vom St. Mary Immaculate Hospital habe Mrs Snyder untersucht und keine Beule an ihr feststellen können, die ihre sechsstündige Bewusstlosigkeit hätte erklären können. Tatsächlich stellte er überhaupt keine Verletzungen bei ihr fest. Vielleicht, spekulierte er vorsichtig, sei eher das Trauma, das sie aufgrund des Vorfalls erlitten habe, für ihren länger andauernden Zusammenbruch verantwortlich gewesen als eine tatsächliche Schädigung.
Die Ermittler der Polizei waren inzwischen allerdings eher argwöhnisch als verwirrt. Zum einen waren am Haus der Snyders keinerlei Spuren für ein gewaltsames Eindringen zu erkennen, und überhaupt handelte es sich dabei um ein merkwürdig bescheidenes Ziel für mordlustige Schmuckdiebe. Die Ermittler fanden es außerdem eigenartig, dass Albert Snyder von dem heftigen Handgemenge unmittelbar vor seiner Tür nicht aufgewacht war. Die neunjährige Tochter der Snyders, Lorraine, hatte in ihrem Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs ebenfalls nichts gehört. Außerdem erschien es merkwürdig, dass sich Einbrecher Zugang zu einem Haus verschafft und dann offenbar eine Pause eingelegt hatten, um eine anarchistische Zeitung zu lesen, die sie ordentlich auf einem Tisch ablegten, ehe sie sich ins Obergeschoss begaben. Am allerseltsamsten war jedoch die Tatsache, dass Mrs Snyders Bett – aus dem sie angeblich aufgestanden war, um nach dem Lärm im Flur zu sehen – ordentlich gemacht war, als hätte niemand darin geschlafen. Sie war nicht in der Lage, das zu erklären, und berief sich auf ihre Gehirnerschütterung. Während sich die Ermittler wegen dieser Unregelmäßigkeiten den Kopf zerbrachen, hob einer von ihnen gedankenverloren eine Ecke der Matratze auf Mrs Snyders Bett an und förderte dabei den Schmuck zutage, den sie als gestohlen gemeldet hatte.
Alle Augen richteten sich auf Mrs Snyder. Sie erwiderte die Blicke unsicher, dann brach sie zusammen und gestand das Verbrechen – wobei sie einem Rohling namens Judd Gray, ihrem heimlichen Liebhaber, die ganze Schuld daran gab. Mrs Snyder wurde verhaftet, die Suche nach Judd Gray wurde eingeleitet, und die Zeitung lesende Bevölkerung war im Begriff, in außerordentliche Begeisterung zu geraten.
Die zwanziger Jahre waren allgemein ein großartiges Jahrzehnt, was Lesen anbelangte – aller Wahrscheinlichkeit nach die Blütezeit des Lesens im amerikanischen Leben. Bald sollte es von der passiven Ablenkung überholt werden, die das Radio bot, doch zunächst blieb Lesen für die meisten Menschen die wichtigste Methode, um Leerzeiten zu füllen. Amerikanische Verlage produzierten jährlich 110 Millionen Bücher und mehr als 10 000 verschiedene Titel: doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor. Für diejenigen, die sich von einer solchen Fülle literarischer Möglichkeiten einschüchtern ließen, hatte gerade ein hilfreiches neues Phänomen, der Buchclub, seinen Einstand gefeiert. Der Book-of-the-Month Club wurde 1926 gegründet, gefolgt von der Literary Guild, der »literarischen Gilde«. Beide waren auf Anhieb ein Erfolg. Autoren wurden auf eine Art und Weise verehrt, wie es heute kaum noch vorstellbar ist. Als Sinclair Lewis in seine Heimat Minnesota zurückkehrte, um an seinem Roman Elmer Gantry (der im Frühjahr 1927 erschien) zu arbeiten, strömten die Leute aus einem meilenweiten Umkreis herbei, nur um ihn zu Gesicht zu bekommen.
Zeitschriften und Magazine boomten ebenfalls. Die Werbeeinnahmen schnellten in einem Jahrzehnt um 500 Prozent nach oben, und viele Publikationen von bleibender Bedeutung feierten ihr Debüt: Reader’s Digest 1922, Time 1923, der American Mercury und Smart Set 1924, der New Yorker 1925. Time