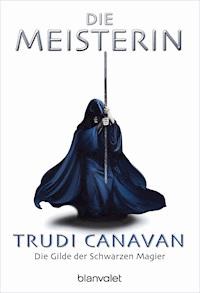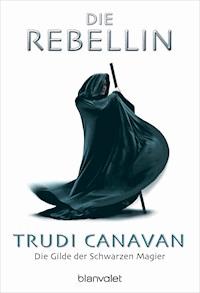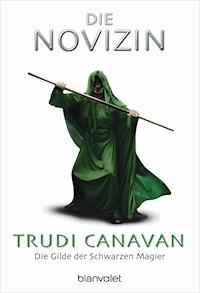Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
1 Das Alte und das Neue
2 Fragwürdige Verbindungen
3 Sichere Orte, gefährliche Ziele
4 Neue Verpflichtungen
5 Vorbereitungen
6 Die Anhörung
7 Eine Reise beginnt
8 Zeichen
9 Auf der Suche nach Wahrheiten
10 Eine neue Herausforderung
11 Verlockende Informationen
12 Entdeckungen
13 Die Falle
14 Unerwartete Verbündete
15 Nächtliche Besucher
ZWEITER TEIL
16 Der Jäger
17 Gejagt
18 Der Verräter
19 Das Versteck
20 Verbündete und Feinde
21 Willkommene Unterstützung
22 Ein Wiedersehen
23 Neue Helfer
24 Die Verbündeten, die man braucht
25 Die Nachrichten des Boten
26 Eine lange Nacht
27 Die Falle ist zugeschnappt
28 Fragen
29 Antworten und neue Fragen
Epilog
Copyright
ERSTER TEIL
1 Das Alte und das Neue
Das erfolgreichste und meistzitierte Stück des Dichters Rewin, der größte Redefluss, der aus der Neuen Stadt hervorgegangen war, hieß Stadtlied. Es fing ein, was man des Nachts in Imardin hörte, wenn man sich die Zeit nahm, innezuhalten und zu lauschen: eine nie endende, gedämpfte und ferne Mischung von Geräuschen. Stimmen. Gesang. Ein Lachen. Ein Stöhnen. Ein Ächzen. Ein Schrei.
In der Dunkelheit von Imardins Neuem Südquartier erinnerte sich ein Mann des Gedichts. Er hielt inne, um zu lauschen, aber statt das Lied der Stadt in sich aufzunehmen, konzentrierte er sich auf ein einziges misstönendes Echo. Ein Geräusch, das nicht hierhergehörte. Ein Geräusch, das sich nicht wiederholte. Er schnaubte leise und setzte seinen Weg fort.
Einige Schritte später trat vor ihm eine Gestalt aus der Dunkelheit. Die Gestalt war männlich und ragte drohend über ihm auf. Licht fing sich auf der Schneide einer Klinge.
»Dein Geld«, sagte eine grobe Stimme, hart vor Entschlossenheit.
Der Mann erwiderte nichts und verharrte reglos. Vielleicht war er vor Entsetzen erstarrt. Vielleicht war er tief in Gedanken versunken.
Als er sich dann doch bewegte, geschah es mit unheimlicher Geschwindigkeit. Ein Klicken, ein Rascheln des Ärmels, und der Räuber keuchte auf und sank auf die Knie. Ein Messer fiel klappernd zu Boden. Der Mann klopfte ihm auf die Schulter.
»Tut mir leid. Falsche Nacht, falsches Opfer, und ich habe keine Zeit zu erklären, warum.«
Als der Räuber mit dem Gesicht nach unten auf das Pflaster fiel, stieg der Mann über ihn hinweg und ging weiter. Dann blieb er stehen und blickte über die Schulter, auf die andere Seite der Straße.
»He! Gol. Du sollst doch angeblich mein Leibwächter sein.«
Aus der Dunkelheit tauchte eine weitere große Gestalt auf und eilte an die Seite des Mannes.
»Ich schätze, du brauchst eigentlich keinen, Cery. Ich werde langsam auf meine alten Tage. Ich sollte dich dafür bezahlen, mich zu beschützen.«
Cery runzelte die Stirn. »Deine Augen und Ohren sind immer noch scharf, nicht wahr?«
Gol zuckte zusammen. »So scharf wie deine«, erwiderte er mürrisch.
»Nur allzu wahr.« Cery seufzte. »Ich sollte in den Ruhestand gehen. Aber Diebe bekommen keine Gelegenheit, das zu tun.«
»Außer indem sie aufhören, Diebe zu sein.«
»Außer indem sie zu Leichen werden«, korrigierte ihn Cery.
»Aber du bist kein gewöhnlicher Dieb. Ich schätze, für dich gelten andere Regeln. Du hast nicht auf die übliche Art angefangen, warum solltest du also auf die übliche Art aufhören?«
»Ich wünschte, alle anderen wären der gleichen Meinung.«
»Das wünschte ich auch. Die Stadt wäre ein besserer Ort.«
»Wenn alle deiner Meinung wären? Ha!«
»Für mich wäre es besser.«
Cery lachte leise und setzte seinen Weg fort. Gol folgte in kurzem Abstand. Er verbirgt seine Furcht gut, dachte Cery. Hat es immer getan. Aber er muss denken, dass wir beide diese Nacht vielleicht nicht überstehen. Zu viele von den anderen sind bereits gestorben.
Mehr als die Hälfte der Diebe – der Anführer der kriminellen Gruppen in Imardins Unterwelt – war während der letzten Jahre umgekommen. Jeder auf eine andere Weise und die meisten durch unnatürliche Ursachen. Erstochen, vergiftet, von einem hohen Gebäude gestoßen, in einem Feuer verbrannt, ertrunken oder in einem eingestürzten Tunnel zerquetscht. Einige sagten, eine einzelne Person sei dafür verantwortlich, ein Freischärler, den man den Jäger der Diebe nannte. Andere glaubten, es seien die Diebe selbst, die alte Zwistigkeiten regelten.
Gol sagte, die Wetter setzten ihr Geld nicht darauf, wer als Nächster das Zeitliche segnen würde, sondern wie.
Natürlich hatten jüngere Diebe den Platz der alten eingenommen, manchmal friedlich, manchmal nach einem schnellen, blutigen Kampf. Das war zu erwarten. Aber selbst diese kühnen Neulinge waren nicht immun gegen den Jäger. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nächste Opfer wurden, war genauso groß wie bei einem älteren Dieb.
Es gab keine offenkundigen Verbindungen zwischen den Morden. Obwohl unter den Dieben jede Menge Streitigkeiten herrschten, konnte keine davon der Grund für so viele Morde sein. Und während Anschläge auf das Leben von Dieben nicht gar so ungewöhnlich waren – das war etwas, womit jeder Dieb rechnen musste -, war der Erfolg dieser Anschläge sehr wohl ungewöhnlich. Und dass der Mörder oder die Mörder weder damit geprahlt hatten noch dabei gesehen worden waren.
In der Vergangenheit hätten wir eine Zusammenkunft abgehalten. Strategien erörtert. Zusammengearbeitet. Aber es ist lange her, seit die Diebe Hand in Hand gearbeitet haben, und wir wüssten heutzutage vermutlich gar nicht mehr, wie wir das anstellen sollten.
Er hatte die Veränderung in den Tagen nach dem Sieg über die Ichani kommen sehen, aber nicht, wie schnell es gehen würde. Sobald die Säuberung – der alljährliche erzwungene Exodus der Obdachlosen aus der Stadt in die Elendsviertel – geendet hatte, waren die Elendsviertel zu einem Teil der Stadt erklärt worden, und die alten Grenzen waren seither Geschichte. Bündnisse zwischen Dieben erloschen, und neue Rivalitäten flammten auf. Diebe, die während der Invasion zusammengearbeitet hatten, um die Stadt zu retten, wandten sich gegeneinander, um ihre Territorien zu behaupten oder auszudehnen, um sich wiederzuholen, was sie an andere verloren hatten, und um neue Gelegenheiten auszunutzen.
Cery ging an vier jungen Männern vorbei, die an einer Mauer lehnten, wo die Gasse auf eine breitere Straße stieß. Sie musterten ihn, und ihr Blick fiel auf das kleine Medaillon, das an Cerys Mantel steckte und ihn als einen Mann der Diebe auswies. Alle drei nickten respektvoll. Cery nickte knapp zurück, dann blieb er am Ende der Gasse stehen und wartete, bis Gol an den Männern vorbei war und zu ihm aufschloss. Der Leibwächter war vor Jahren zu dem Schluss gekommen, dass er mögliche Gefahren besser ausmachen konnte, wenn er nicht direkt neben Cery herging – und mit den meisten brenzligen Situationen wurde Cery sehr gut selbst fertig.
Quer über den Eingang der Gasse war eine rote Linie gemalt; bei ihrem Anblick lächelte Cery erheitert. Nachdem der König die Hüttenviertel zu einem Teil der Stadt erklärt hatte, hatte er mit wechselndem Erfolg versucht, die Kontrolle darüber zu erlangen. Verbesserte Bedingungen in einigen Gegenden führten zu erhöhten Mieten, was ebenso wie der Abriss unsicherer Häuser die Armen in noch ärmlichere Stadtteile zwang. Sie setzten sich dort fest und machten sich diese Orte zu eigen, und wie in die Enge getriebene Tiere verteidigten sie sie mit grimmiger Entschlossenheit und gaben ihren Nachbarschaften Namen wie Finstergassen und Wohnfeste. Es gab inzwischen Grenzen, einige markiert, andere nur nach Namen und ungefährer Lage, die kein Stadtwächter zu übertreten wagte, es sei denn, er befand sich in Gesellschaft mehrerer Kollegen – und selbst dann mussten sie mit einem Kampf rechnen. Einzig die Anwesenheit eines Magiers war eine wirkliche Garantie für ihre Sicherheit.
Als sein Leibwächter zu ihm aufschloss, wandte Cery sich ab, und sie überquerten gemeinsam die breitere Straße. Eine Kutsche rollte vorbei, beleuchtet von zwei hin und her schwingenden Laternen. Die allgegenwärtigen Wachsoldaten der Stadt schlenderten paarweise mit Laternen umher, niemals außer Sichtweite anderer Wachen vor oder hinter ihnen.
Dies war eine neue Durchgangsstraße, die den gefährlichen Stadtteil Wildwegen querte. Cery hatte sich zuerst gefragt, warum der König sich Mühe gemacht hatte, diese Straße bauen zu lassen. Jeder, der allein unterwegs war, lief Gefahr, von den Bewohnern links oder rechts der Straße überfallen zu werden und dabei wahrscheinlich ein Messer in den Leib gerammt zu bekommen. Aber andererseits war die Straße breit und bot Räubern wenig Deckung, und die Tunnel darunter, einst ein Teil des Untergrundnetzwerkes, das allenthalben die Straße der Diebe genannt wurde, waren während des Baus verfüllt und verschüttet worden. Manche der alten, von viel zu vielen Menschen bewohnten Gebäude zu beiden Seiten waren abgerissen und durch große, sichere Häuser ersetzt worden, die sich im Besitz von Kaufleuten befanden.
Die neue Straße hatte wichtige Verbindungen des alten Wildwegen zerschnitten. Es würden sicherlich bereits Anstrengungen unternommen, neue Tunnel zu bauen – davon war Cery überzeugt -, aber das würde seine Zeit dauern, und da fast die Hälfte der ehemals ansässigen Bevölkerung zum Wegzug gezwungen worden war, schien sich der Charakter des Viertels bereits unwiderruflich geändert zu haben.
Cery fühlte sich im Freien wie immer unbehaglich. Und nach der Begegnung mit dem Räuber war seine Unruhe noch gewachsen.
»Denkst du, er ist ausgeschickt worden, um mich zu prüfen?«, fragte er Gol.
Gol antwortete nicht sofort, und sein langes Schweigen sagte Cery, dass er gründlich über die Frage nachdachte.
»Ich bezweifle es. Höchstwahrscheinlich hatte er lediglich fatales Pech.«
Cery nickte. Ich bin seiner Meinung, aber die Zeiten haben sich verändert. Die Stadt hat sich verändert. Manchmal ist es so, als lebe man in einem fremden Land. Oder so, wie ich mir das Leben in einer anderen Stadt vorstelle, da ich Imardin niemals verlassen habe. Unvertraut. Andere Regeln. Gefahren, wo man sie nicht erwartet. Man kann gar nicht genug aufpassen. Und ich stehe schließlich vor der Begegnung mit dem meistgefürchteten Dieb in Imardin.
»Ihr da«, erklang eine laute Stimme. Zwei Wachsoldaten kamen auf sie zu; einer von ihnen hielt seine Laterne hoch. Cery berechnete die Entfernung zur anderen Straßenseite, dann seufzte er und blieb stehen.
»Ich?«, fragte er und wandte sich den Wachsoldaten zu. Gol sagte nichts.
Der größere der beiden Männer blieb einen Schritt hinter seinem untersetzten Gefährten stehen. Er antwortete nicht, sondern schaute einige Male zwischen Gol und Cery hin und her, bis sein Blick schließlich auf Cery ruhen blieb.
»Nennt eure Adresse und eure Namen«, befahl er.
»Cery von der Flussstraße, Nordseite«, antwortete Cery.
»Ihr beide?«
»Ja. Gol ist mein Diener. Und Leibwächter.«
Der Wachmann nickte und würdigte Gol kaum eines Blickes. »Euer Ziel?«
»Eine Besprechung mit dem König.«
Der stillere Wachsoldat sog scharf den Atem ein, was ihm einen Blick von seinem Vorgesetzten eintrug. Cery beobachtete die Männer, und es erheiterte ihn, dass beide – erfolglos – versuchten, ihr Entsetzen und ihre Furcht zu verbergen. Man hatte ihm aufgetragen, ihnen diese Information zu geben, und obwohl es eine geradezu lächerliche Behauptung war, machte der Wachmann den Anschein, als glaube er ihm. Oder – was wahrscheinlicher war – er verstand, dass es sich um eine verschlüsselte Nachricht handelte.
Der größere Wachmann straffte die Schultern. »Dann setzt euren Weg fort. Und … gebt auf euch acht.«
Cery drehte sich um und ging, dicht gefolgt von Gol, über die Straße. Er fragte sich, ob die Nachricht ihnen verraten hatte, mit wem genau Cery sich traf, oder ob sie nur wussten, dass jemand, der diese Worte sagte, nicht aufgehalten werden durfte.
So oder so, er bezweifelte, dass er und Gol zufällig auf eine korrupte Wache gestoßen waren. Es hatte schon immer Wachsoldaten gegeben, die bereit waren, mit den Dieben zusammenzuarbeiten, aber der Hang zur Korruption hatte zugenommen und war allgegenwärtiger denn je. Es gab noch ehrliche, anständige Männer in der Wache, die danach trachteten, schwarze Schafe in ihren Reihen bloßzustellen und zu bestrafen, aber sie standen in einer Schlacht, die eigentlich schon seit einiger Zeit verloren war.
Alle sind mit der einen oder anderen Form von internen Streitigkeiten beschäftigt. Die Wache kämpft gegen die Korruption in ihren Reihen, die Häuser liegen untereinander in Fehde, die reichen und armen Novizen und Magier in der Gilde hacken aufeinander herum, die Verbündeten Länder können sich in der Sachaka-Frage nicht einigen, und die Diebe liegen miteinander im Krieg. Faren hätte das alles sehr unterhaltsam gefunden.
Aber Faren war tot. Im Gegensatz zu den übrigen Dieben war er im Winter vor fünf Jahren an einer vollkommen normalen Lungenentzündung gestorben. Cery hatte zuvor schon jahrelang nicht mit ihm gesprochen. Der Mann, den Faren zu seinem Nachfolger ausgebildet hatte, hatte die Zügel seines kriminellen Reiches ohne Wettbewerb oder Blutvergießen übernommen. Der Mann, der sich Skellin nannte.
Der Mann, mit dem Cery sich heute Nacht treffen würde.
Während Cery durch den kleineren der beiden noch erhaltenen Teile von Wildwegen ging und dabei die Rufe von Huren und Buchmacherjungen ignorierte, überdachte er, was er über Skellin wusste. Faren hatte die Mutter seines Nachfolgers bei sich aufgenommen, als Skellin noch ein Kind gewesen war, aber ob die Frau Farens Geliebte oder seine Ehefrau gewesen war oder ob sie nur für ihn gearbeitet hatte, war unbekannt. Der alte Dieb hatte die beiden abgeschirmt und geheim gehalten, wie die meisten Diebe es mit Menschen, die sie liebten, tun mussten. Skellin hatte sich als ein talentierter Mann erwiesen. Er hatte viele Unternehmen der Unterwelt übernommen und etliche selbst ins Leben gerufen, und dabei hatte es nur wenige Fehlschläge gegeben. Er stand in dem Ruf, gerissen und kompromisslos zu sein. Cery glaubte nicht, dass Faren Skellins absolute Skrupellosigkeit gebilligt hätte. Doch die Geschichten waren wahrscheinlich im Laufe der Zeit ausgeschmückt worden, so dass man nicht beurteilen konnte, wie verdient der Ruf des Mannes war.
Cery kannte kein Tier, das als »Skellin« bezeichnet wurde. Farens Nachfolger war der erste neue Dieb gewesen, der mit der Tradition, Tiernamen zu benutzen, gebrochen hatte. Es bedeutete natürlich nicht, dass »Skellin« zwangsläufig sein richtiger Name war. Jene, die das glaubten, hielten es für mutig von ihm, seinen Namen zu enthüllen. Jene, die es nicht glaubten, scherten sich nicht darum.
Sie bogen in eine andere Straße ein und gelangten in einen sauberen Teil des Bezirks. Sauber jedoch nur dem Anschein nach. Hinter den Türen dieser respektabel aussehenden Häuser lebten lediglich wohlhabendere Huren, Hehler und Auftragsmörder. Die Diebe hatten in Erfahrung gebracht, dass die – zu dünn besetzte – Wache nicht so genau hinsah, wenn nur der äußere Anschein respektabel war. Und im Zweifelsfall konnten auch ein paar kleine Spenden für die bevorzugten Wohltätigkeitsprojekte in der Stadt dem guten Ruf sehr förderlich sein.
Wie zum Beispiel die Hospitäler, die Sonea leitete, immer noch eine Heldin der Armen, obwohl die Reichen nur von Akkarins Bemühungen und Opfern während der Ichani-Invasion sprachen. Cery fragte sich häufig, ob sie ahnte, wie viel von dem Geld, das ihrer Sache gespendet wurde, aus korrupten Quellen kam. Und wenn sie es ahnte, kümmerte es sie?
Er und Gol verlangsamten ihr Tempo, als sie die Kreuzung erreichten, die Cery als Treffpunkt genannt worden war. Dort bot sich ihnen ein seltsamer Anblick.
Wo einst ein Haus gestanden hatte, füllte ein grüner, mit bunten Farben gesprenkelter Grasteppich die Lücke in der Bebauung. Zwischen den alten Grundfesten und eingestürzten Mauern wuchsen Pflanzen aller Größen. Und alle wurden von Hunderten von Lampen beleuchtet. Das »Sonnenhaus« war während der Ichani-Invasion zerstört worden, und der Besitzer hatte es sich nicht leisten können, es wieder aufzubauen. Er hatte sich im Keller der Ruine eingerichtet und seine Tage damit verbracht, seinen geliebten Garten dazu zu ermutigen, das Anwesen in Besitz zu nehmen – und die Einheimischen, ihn zu besuchen und sich daran zu erfreuen.
Es war ein seltsamer Treffpunkt für Diebe, aber Cery sah durchaus seine Vorteile. Das Grundstück war relativ offen – niemand konnte sich unbemerkt nähern oder lauschen – und doch öffentlich genug, dass jeder Kampf oder Überfall beobachtet werden würde, was hoffentlich Verrat und Gewalt vorbeugte.
Die Anweisungen hatten besagt, dass er neben der Statue warten solle. Als Cery und Gol den Garten betraten, sahen sie in der Mitte der Ruine eine steinerne Gestalt auf einem Sockel. Die Statue war aus schwarzem, mit grauen und weißen Adern durchzogenem Stein. Sie zeigte einen mit einem Umhang bekleideten Mann, der nach Osten gewandt war, dabei aber nach Norden blickte. Als er näher kam, stellte Cery fest, dass die Gestalt etwas Vertrautes hatte.
Es soll Akkarin sein, erkannte er mit einem leichten Schock. Er hat sich der Gilde zugewandt, blickt aber nach Sachaka. Er trat näher heran und betrachtete die Züge der Statur. Aber es ist kein gutes Abbild.
Gol stieß ein leises, warnendes Geräusch aus, und Cery konzentrierte sich sofort wieder auf seine Umgebung. Ein Mann kam auf sie zu, und ein anderer folgte ihm mit einigen Schritten Abstand.
Ist das Skellin? Er sieht definitiv fremdländisch aus. Aber dieser Mann stammte von keiner Rasse ab, der Cery bisher begegnet war. Sein Gesicht war lang und schmal mit hohen Wangenknochen und spitzem Kinn. Dies ließ den stark geschwungenen Mund zu groß für sein Gesicht wirken. Aber seine Augen und seine dichten Brauen passten gut zueinander – fast hätte man sie als schön bezeichnen können. Seine Haut war dunkler als die der Bewohner Elynes oder Sachakas, aber nicht bläulich schwarz wie die der Leute aus Lonmar, sondern leicht rötlich getönt. Und das dunkle Rot seines Haares würde man bei anderen Bewohnern dieser drei Länder lange suchen.
Er sieht aus, als sei er in ein Fass mit Farbe gefallen, die noch nicht ganz herausgewaschen ist, ging es Cery durch den Kopf. Ich würde sagen, er ist etwa fünfundzwanzig.
»Willkommen bei mir zu Hause, Cery von der Nordseite«, sagte der Mann, in dessen Stimme kein Anflug eines fremdländischen Akzents lag. »Ich bin Skellin. Skellin, der Dieb, oder Skellin, der Schmutzige Ausländer, je nachdem, mit wem du redest und wie berauscht der Betreffende ist.«
Cery war sich nicht sicher, wie er darauf reagieren sollte. »Wie soll ich dich nennen?«
Skellins Lächeln wurde breiter. »Skellin genügt. Ich habe nichts übrig für fantastische Titel.« Sein Blick wanderte zu Gol hinüber.
»Mein Leibwächter«, erklärte Cery.
Skellin nickte Gol einmal knapp zu, dann wandte er sich wieder an Cery. »Können wir unter vier Augen reden?«
»Natürlich«, antwortete Cery. Er nickte Gol zu, der sich außer Hörweite begab. Auch Skellins Mann zog sich zurück.
Der andere Dieb ging zu einer der niedrigen Mauern der Ruine und setzte sich. »Es ist eine Schande, dass die Diebe dieser Stadt sich nicht mehr treffen und zusammenarbeiten«, begann er. »Wie in alten Tagen.« Er sah Cery an. »Du kennst die alten Traditionen und bist früher einmal den alten Regeln gefolgt. Vermisst du sie?«
Cery zuckte die Achseln. »Veränderungen passieren ständig. Man verliert etwas und gewinnt etwas anderes.«
Skellin zog eine seiner elegant geschwungenen Augenbrauen hoch. »Wiegen die Gewinne schwerer als die Verluste?«
»Für manche mehr als für andere. Ich habe nicht viel von der Spaltung profitiert, aber ich habe immer noch einige Übereinkünfte mit anderen Dieben.«
»Das ist gut zu hören. Denkst du, es besteht eine Chance, dass wir zu einer Übereinkunft kommen könnten?«
»Eine Chance besteht immer.« Cery lächelte. »Es hängt davon ab, worin wir deiner Meinung nach übereinkommen sollen.«
Skellin nickte. »Natürlich.« Er hielt inne, und seine Miene wurde ernst. »Es gibt zwei Angebote, die ich dir gern machen würde. Das erste ist eins, das ich bereits einigen anderen Dieben unterbreitet habe, und sie waren alle damit einverstanden.«
Ein Prickeln überlief Cery. Alle? Aber andererseits sagt er auch nicht, wie viele »einige« sind.
»Du hast von dem Jäger gehört?«, fragte Skellin.
»Wer hat nicht von ihm gehört?«
»Ich glaube, dass es ihn tatsächlich gibt.«
»Eine einzige Person hat all diese Diebe getötet?« Cery zog die Augenbrauen hoch; er machte sich nicht die Mühe, seine Ungläubigkeit zu verbergen.
»Ja«, sagte Skellin entschieden und hielt Cerys Blick stand. »Wenn du dich umhörst – die Leute fragst, die etwas gesehen haben -, weisen die Morde Ähnlichkeiten auf.«
Ich werde Gol der Sache noch einmal nachgehen lassen müssen, überlegte Cery. Dann kam ihm ein Gedanke. Ich hoffe, Skellin glaubt nicht, dass ich diesen Jäger der Diebe für ihn finden kann, nur weil ich dem Hohen Lord Akkarin bei der Suche nach den sachakanischen Spionen geholfen habe.
»Also … was willst du seinetwegen unternehmen?«
»Ich hätte gern dein Wort, dass du mir davon berichtest, falls du etwas über den Jäger hören solltest. Ich habe mir sagen lassen, dass viele Diebe nicht miteinander reden, daher biete ich mich stattdessen selbst als Empfänger für Informationen über den Jäger an. Wenn alle zusammenarbeiten, werde ich ihn euch vielleicht vom Hals schaffen können. Oder ich werde zumindest in der Lage sein, diejenigen zu warnen, die angegriffen werden sollen.«
Cery lächelte. »Letzteres ist eine Spur optimistisch.« Skellin zuckte die Achseln. »Ja, es besteht immer die Chance, dass ein Dieb eine Warnung nicht weitergibt, wenn er weiß, dass der Jäger einen Rivalen töten wird. Aber vergiss nicht, dass jeder getötete Dieb eine Informationsquelle weniger bedeutet, die uns helfen könnte, uns des Jägers zu entledigen und unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten.«
»Sie würden schnell genug durch andere ersetzt werden.«
Skellin runzelte die Stirn. »Von jemandem, der vielleicht nicht so viel weiß wie sein Vorgänger.«
»Kein Sorge.« Cery lächelte. »Im Augenblick gibt es niemanden, den ich genug hasse, um das zu tun.«
Der andere Mann lächelte ebenfalls. »Also sind wir uns einig?«
Cery dachte nach. Obwohl ihn die Art von Gewerbe, die Skellin betrieb, nicht gefiel, wäre es dumm gewesen, dieses Angebot abzulehnen. Die einzigen Informationen, die der Mann wollte, bezogen sich auf den Jäger der Diebe, auf nichts sonst. Und er bat nicht um einen Pakt oder ein Versprechen – wenn Cery außerstande war, Informationen weiterzugeben, weil sie seine Sicherheit oder sein Geschäft gefährdeten, konnte niemand behaupten, er habe sein Wort gebrochen.
»Ja«, antwortete er.
»Dann haben wir schon eine Übereinkunft erzielt«, sagte Skellin lächelnd. »Jetzt lass uns sehen, ob wir nicht zwei daraus machen können.« Er rieb sich die Hände. »Du weißt sicher, welches das wichtigste Produkt ist, das ich importiere und verkaufe.«
Cery machte sich nicht die Mühe, seinen Abscheu zu verbergen, und nickte. »Feuel oder ›Fäule‹, wie manche es nennen. Nichts, woran ich Interesse hätte. Und wie ich höre, hast du das Geschäft fest in der Hand.«
Skellin nickte. »Allerdings. Als Faren starb, hinterließ er mir ein schrumpfendes Territorium. Ich brauchte eine Möglichkeit, mir Geltung zu verschaffen und meine Macht zu stärken. Ich habe es mit verschiedenen Gewerben versucht. Die Beschaffung von Feuel war neu und unerprobt. Es hat mich erstaunt, wie schnell die Kyralier sich dafür erwärmt haben. Es hat sich als sehr profitabel erwiesen, und nicht nur für mich. Die Häuser beziehen ein hübsches kleines Einkommen aus der Miete für die Glühhäuser.« Skellin hielt inne. »Du könntest ebenfalls Gewinn aus dieser kleinen Industrie ziehen, Cery von der Nordseite.«
»Nenn mich einfach Cery.« Cery lächelte, dann ließ er seine Miene wieder ernst werden. »Ich fühle mich geschmeichelt, aber die Nordseite ist die Heimat von Menschen, die größtenteils zu arm sind, um Feuel bezahlen zu können. Es ist eine Gewohnheit für die Reichen.«
»Aber die Nordseite wird immer wohlhabender, dank deiner Bemühungen, und Feuel wird billiger, je mehr davon auf den Markt kommt.«
Cery verkniff sich ein zynisches Lächeln angesichts der Schmeichelei. »Aber noch nicht billig genug. Der Handel würde aufhören zu wachsen, wenn man zu viel Feuel zu schnell ins Land brächte.« Und ich käme zurecht, auch wenn wir überhaupt keine Fäule hätten. Er hatte gesehen, was Feuel mit Männern und Frauen machte, die sich ihm hingaben – sie vergaßen, zu essen oder zu trinken, vergaßen, ihre Kinder zu füttern, es sei denn, um ihnen etwas von der Droge zu geben, damit sie aufhörten, über Hunger zu klagen. Aber ich bin nicht töricht genug zu denken, ich könnte es für immer von der Nordseite fernhalten. Wenn ich es nicht beschaffe, wird jemand anders es machen. Ich werde einen Weg finden müssen, um es zu tun, ohne allzu großen Schaden anzurichten. »Es wird einen richtigen Zeitpunkt geben, um Feuel auf die Nordseite zu bringen«, sagte Cery. »Und wenn dieser Zeitpunkt kommt, werde ich wissen, an wen ich mich wenden muss.«
»Warte nicht zu lange damit, Cery«, warnte Skellin. »Feuel ist beliebt, weil es neu und modisch ist, aber schließlich wird es so sein wie Bol – einfach eine weitere Last der Stadt, angebaut und zubereitet von jedem. Ich hoffe, dass ich bis dahin neue Gewerbe aufgebaut habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.« Er hielt inne und wandte den Blick ab. »Eins der alten, ehrenwerten Diebesgewerbe. Oder vielleicht sogar etwas Gesetzliches.«
Er drehte sich wieder um und lächelte, aber in seinen Zügen lag ein Anflug von Traurigkeit und Unzufriedenheit. Vielleicht steckt in dieser Haut ein ehrlicher Kerl, dachte Cery. Wenn er nicht erwartet hat, dass Feuel sich so schnell ausbreitet, hat er vielleicht auch nicht erwartet, dass es so große Schäden anrichten würde … Aber das wird mich nicht dazu bewegen, selbst in das Gewerbe einzusteigen.
Skellins Lächeln verblasste, und an seine Stelle trat ein ernstes Stirnrunzeln. »Es gibt Leute, die gern deinen Platz einnehmen würden, Cery. Feuel könnte deine beste Verteidigung gegen sie sein, wie es das auch für mich war.«
»Es gibt immer Leute, die mich von meinem Platz vertreiben wollen«, erwiderte Cery. »Ich werde gehen, wenn ich so weit bin.«
Der andere Dieb wirkte erheitert. »Du glaubst wirklich, dass du die Zeit und den Ort wirst wählen können?«
»Ja.«
»Und deinen Nachfolger?«
»Ja.«
Skellin lachte leise. »Mir gefällt dein Selbstbewusstsein. Faren war sich seiner selbst ebenfalls sicher. Er hatte zumindest zur Hälfte recht: Er konnte seinen Nachfolger wählen.«
»Er war ein kluger Mann.«
»Er hat mir viel von dir erzählt.« Ein neugieriger Ausdruck trat in Skellins Augen. »Dass du nicht auf die gewohnte Weise zum Dieb geworden bist. Dass der berüchtigte Hohe Lord Akkarin es arrangiert hat.«
Cery widerstand dem Drang, zu der Statue hinüberzusehen. »Alle Diebe gewinnen Macht durch mächtigen Leuten erwiesene Gefälligkeiten. Ich habe zufällig mit einem sehr mächtigen Mann Gefälligkeiten ausgetauscht.«
Skellin zog die Augenbrauen hoch. »Hat er dich jemals Magie gelehrt?«
Cery lachte auf. »Schön wär’s!«
»Aber du bist mit einer Magierin aufgewachsen und hast deine Position mithilfe des ehemaligen Hohen Lords errungen. Gewiss hast du etwas aufgeschnappt.«
»So funktioniert Magie nicht«, erklärte Cery. Aber das weiß er gewiss. »Man braucht die Gabe dazu und einen Lehrer, der einem beibringt, sie zu kontrollieren und zu benutzen. Man kann es nicht lernen, indem man jemanden beobachtet.«
Skellin nickte, einen Finger ans Kinn, und musterte Cery nachdenklich. »Aber du hast immer noch Verbindungen in die Gilde, nicht wahr?«
Cery schüttelte den Kopf. »Ich habe Sonea seit Jahren nicht mehr gesehen.«
»Wie enttäuschend nach allem, was du getan hast – was alle Diebe getan haben -, um ihnen zu helfen.« Skellin lächelte schief. Ich fürchte, dein Ruf als Freund von Magiern ist nicht annähernd so aufregend wie die Realität, Cery.«
»So ist das mit dem Ruf. Im Allgemeinen.«
Skellin nickte. »In der Tat. Nun, ich habe unser Gespräch genossen und meine Angebote gemacht. Wir sind zumindest zu einer Übereinkunft gelangt. Ich hoffe, wir werden mit der Zeit zu einer weiteren kommen.« Er stand auf. »Danke, dass du dich mit mir getroffen hast, Cery von der Nordseite.«
»Danke für die Einladung. Viel Glück bei der Suche nach dem Jäger.«
Skellin lächelte, nickte höflich, drehte sich dann um und schlenderte den gleichen Weg zurück, über den er gekommen war. Cery beobachtete ihn einen Moment lang, dann warf er noch einen schnellen Blick auf die Statue. Es war wirklich kein gutes Abbild.
»Wie ist es gelaufen?«, murmelte Gol, als Cery sich wieder zu ihm gesellte.
»Wie erwartet«, antwortete Cery. »Nur dass …«
»Nur dass?«, wiederholte Gol, als Cery den Satz nicht beendete.
»Wir sind übereingekommen, Informationen über den Jäger der Diebe auszutauschen.«
»Dann gibt es ihn also wirklich?«
»Das glaubt Skellin.« Cery zuckte die Achseln. Sie überquerten die Straße und gingen auf Wildwegen zu. »Das war jedoch nicht das Seltsamste.«
»Tatsächlich?«
»Er hat gefragt, ob Akkarin mich Magie gelehrt habe.«
Gol schwieg einen Moment lang. »Aber das ist eigentlich nicht so seltsam. Faren hat Sonea versteckt, bevor er sie der Gilde auslieferte, und zwar in der Hoffnung, dass sie Magie für ihn wirken würde. Skellin muss alles darüber gehört haben.«
»Glaubst du, er hätte gern seinen eigenen Schoßmagier?«
»Sicher. Obwohl er dich natürlich nicht in Dienst würde nehmen wollen, da du ein Dieb bist. Vielleicht denkt er, er könnte durch dich die Gilde um Gefälligkeiten bitten.«
»Ich habe ihm gesagt, ich hätte Sonea seit Jahren nicht mehr gesehen.« Cery verzog das Gesicht. »Wenn ich sie das nächste Mal treffe, werde ich vielleicht fragen, ob sie einem meiner Diebesfreunde helfen würde, nur um den Ausdruck auf ihrem Gesicht zu sehen.«
In der Gasse vor ihnen erschien eine Gestalt, die auf sie zugeeilt kam. Cery verlangsamte seine Schritte und registrierte dabei die möglichen Ausgänge und Verstecke um sie herum.
»Du solltest ihr sagen, dass Skellin Erkundigungen einholt«, riet Gol ihm. »Er könnte versuchen, jemand anderen anzuwerben. Und es könnte funktionieren. Nicht alle Magier sind so unbestechlich wie Sonea.« Auch Gol wurde jetzt langsamer. »Das ist … das ist Neg.«
Der Erleichterung darüber, dass es kein weiterer Angreifer war, folgte Sorge. Neg hatte Cerys Hauptversteck bewacht. Das tat er lieber, als durch die Straßen zu streifen, da freie Flächen ihn nervös machten.
Etwas auf seinem Gesicht leuchtete selbst im schwachen Straßenlicht, und Cery spürte, wie sein Herz ihm in die Hose, nein, in die Schuhe rutschte. Ein Verband. Neg keuchte, als er die beiden anderen Diebe erreichte.
»Was ist los?«, fragte Cery mit einer Stimme, die er kaum als seine erkannte.
»T… tut mir leid«, keuchte Neg. »Schlimme Neuigkeiten.« Er holte tief Luft, dann stieß er den Atem heftig aus und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll.«
»Sag es«, befahl Cery.
»Sie sind tot. Alle. Selia. Die Jungen. Hab nicht gesehen, wer. Sind an allem vorbeigekommen. Weiß nicht, wie. Kein Schloss aufgebrochen. Als ich zu mir kam …«
Während Neg weiterredete, sich entschuldigte und erklärte und seine Worte sich überschlugen, erfüllte ein Rauschen Cerys Ohren. Sein Verstand versuchte einen Moment lang, eine andere Erklärung zu finden. Er muss sich irren. Er hat sich den Kopf angeschlagen und leidet an Wahnvorstellungen. Er hat es geträumt.
Aber er zwang sich, sich der wahrscheinlichen Wahrheit zu stellen. Was er jahrelang gefürchtet hatte – was ihn in Albträumen verfolgt hatte -, war geschehen.
Jemand hatte es an all den Schlössern und Wachen und Schutzvorrichtungen vorbeigeschafft und seine Familie ermordet.
2 Fragwürdige Verbindungen
Es war weit vor der Zeit, zu der sie normalerweise erwachte. Der Morgen würde erst in einigen Stunden heraufdämmern. Sonea blinzelte in der Dunkelheit und fragte sich, was sie geweckt hatte. Ein Traum? Oder hatte etwas Reales sie mitten in der Nacht in diesen Zustand plötzlicher Wachsamkeit versetzt?
Dann hörte sie im Nebenzimmer ein Geräusch, schwach, aber unleugbar.
Mit hämmerndem Herzen und prickelnder Kopfhaut stand sie auf und bewegte sich leise auf die Schlafzimmertür zu. Sie hörte einen Schritt hinter der Tür, dann noch einen. Eine Hand auf die Klinke gelegt, zog sie Magie in sich hinein, riss einen Schild empor und holte tief Luft.
Die Klinke drehte sich lautlos. Sonea zog die Tür ein klein wenig auf und spähte hindurch. Im schwachen Mondlicht, das zwischen den Fensterläden ins Gästezimmer fiel, sah sie eine Gestalt auf und ab gehen. Männlich, eher klein von Wuchs und eindeutig vertraut. Erleichterung durchflutete sie.
»Cery«, sagte sie und zog die Tür ganz auf. »Wer sonst würde es wagen, sich mitten in der Nacht in meine Räume zu schleichen?«
Er drehte sich zu ihr um. »Sonea«, sagte er. Er atmete tief durch, sagte aber sonst nichts mehr. Eine lange Pause folgte, und Sonea runzelte die Stirn. Es sah ihm nicht ähnlich zu zögern. War er gekommen, um einen Gefallen zu erbitten, von dem er wusste, dass er ihr nicht gefallen würde?
Sie konzentrierte sich und schuf eine kleine Lichtkugel, gerade groß genug, um den Raum mit einem sanften Schein zu erfüllen. Einen Moment lang stockte ihr der Atem. Sein Gesicht war voller tiefer Falten. Die Jahre der Gefahr und der Sorge eines Lebens als Dieb hatten ihn schneller altern lassen als jeden anderen, den sie kannte.
Ich trage selbst jede Menge Spuren meiner Jahre, dachte sie, aber die Schlachten, die ich gekämpft habe, waren nur kleinliche Zankereien zwischen Magiern; ich brauchte nicht in der kompromisslosen und häufig grausamen Unterwelt zu überleben.
»Also … was führt dich mitten in der Nacht in die Gilde?«, fragte sie, während sie ins Gästezimmer trat.
Er betrachtete sie nachdenklich. »Du fragst mich nie, wie ich unbemerkt hier hereinkomme.«
»Ich will es gar nicht wissen. Ich will das Risiko nicht eingehen, dass jemand anderer es erfahren könnte, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich jemandem erlauben muss, meine Gedanken zu lesen.«
Er nickte. »Ah. Wie laufen die Dinge hier?«
Sie zuckte die Achseln. »Wie immer. Reiche und arme Novizen zanken sich. Und jetzt, da einige der ehemals armen Novizen ihren Abschluss gemacht haben und Magier geworden sind, haben wir Gezänk auf einer neuen Ebene. Eins, das wir ernst nehmen müssen. In wenigen Tagen werden wir eine Versammlung haben, bei der wir die Abschaffung der Regel überdenken, nach der es Novizen und Magiern verboten ist, Umgang mit Verbrechern oder Personen von schlechtem Ruf zu pflegen. Wenn die Zusammenkunft Erfolg hat, werde ich nicht länger eine Regel brechen, wenn ich mit dir rede.«
»Ich kann dann durchs Vordertor kommen und offiziell um eine Audienz ersuchen?«
»Ja. Nun, das ist ein Szenario, das den Höheren Magiern einige schlaflose Nächte bescheren wird. Ich wette, sie wünschten, sie hätten den unteren Klassen niemals gestattet, der Gilde beizutreten.«
»Wir haben immer gewusst, dass sie es bereuen würden«, sagte Cery. Er seufzte und wandte den Blick ab. »Ich wünsche mir langsam, die Säuberungen hätten niemals aufgehört.«
Sonea runzelte die Stirn und verschränkte die Arme vor der Brust; ein Stich des Ärgers und der Ungläubigkeit durchzuckte sie. »Das ist doch gewiss nicht dein Ernst.«
»Alles hat sich zum Schlechteren gewendet.« Er trat an ein Fenster und sah hinaus. Doch es wurde nichts sichtbar als die Dunkelheit dahinter.
»Und das liegt daran, dass die Säuberung aufgehört hat?« Sie betrachtete mit schmalen Augen seinen Rücken. »Es hat nichts mit einem gewissen neuen Laster zu tun, das das Leben so vieler Menschen in Imardin zerstört, reicher wie armer?«
»Feuel?«
»Ja. Die Säuberung hat Hunderte getötet, aber Feuel hat Tausende geholt – und noch mehr versklavt.« Jeden Tag sah sie die Opfer in ihren Hospitälern. Nicht nur jene, die den Verlockungen der Droge verfallen waren, sondern auch deren verzweifelte Eltern, Ehegatten, Geschwister, Kinder und Freunde.
Und nach allem, was ich weiß, könnte Cery einer der Diebe sein, die es importieren und verkaufen, konnte sie nicht umhin zu denken, und das nicht zum ersten Mal.
»Es heißt, es würde dafür sorgen, dass man aufhört, Anteil an den Dingen zu nehmen«, sagte Cery leise und wandte ihr das Gesicht zu. »Keine Probleme oder Sorgen mehr. Keine Furcht. Keine … Trauer.«
Seine Stimme brach beim letzten Wort, und plötzlich spürte Sonea, dass all ihre Sinne schärfer wurden.
»Was ist passiert, Cery? Warum bist du hergekommen?«
Er holte tief Luft. Stieß den Atem langsam wieder aus. »Meine Familie«, antwortete er, »ist heute Nacht ermordet worden.«
Sonea zuckte zurück. Die Schärfe eines schrecklichen Schmerzes traf sie wie ein Dolchstoß und erinnerte sie daran, dass manche Verluste niemals vergessen werden konnten – oder vergessen werden sollten. Aber sie hielt sich zurück. Sie würde Cery keine Hilfe sein, wenn sie sich von diesem Gefühl verzehren ließ. Er wirkte so verloren. In seinen Augen standen unverhohlener Schock und Qual. Sie ging auf ihn zu und zog ihn in die Arme. Er versteifte sich einen Moment lang, dann entspannte er sich.
»Es gehört zum Leben eines Diebs«, sagte er. »Du tust alles, was du kannst, um deine Leute zu beschützen, aber es besteht immer Gefahr. Vesta hat mich verlassen, weil sie nicht damit leben konnte. Es nicht ertragen konnte, eingesperrt zu sein. Selia war stärker. Mutiger. Nach allem, was sie ertragen hat, hat sie es nicht verdient … und die Jungen …«
Vesta war Cerys erste Frau gewesen. Sie war klug gewesen, aber widerspenstig und aufbrausend. Mit Wutanfällen hatte man bei ihr immer rechnen müssen. Selia hatte erheblich besser zu ihm gepasst, sie war ruhig gewesen und hatte die stille Weisheit eines Menschen besessen, der die Welt mit offenen und versöhnlichen Augen betrachtete. Sonea hielt ihn im Arm, während er von Schluchzen geschüttelt wurde. Auch ihre eigenen Augen füllten sich mit Tränen. Kann ich mir vorstellen, wie es sein muss, ein Kind zu verlieren? Ich kenne die Angst, alles zu verlieren, aber nicht den Schmerz des tatsächlichen Verlustes. Ich denke, es wäre schlimmer, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Zu wissen, dass die eigenen Kinder niemals erwachsen werden … Nur … was war mit seinem anderen Kind? Obwohl sie inzwischen bereits erwachsen sein musste.
»Geht es Anyi gut?«, fragte sie.
Cery war einen Moment lang ganz ruhig, dann löste er sich von ihr. Seine Miene war angespannt. »Ich weiß es nicht. Nachdem Vesta und Anyi gegangen waren, habe ich die Leute glauben lassen, mir läge nichts mehr an ihnen, zu ihrem eigenen Schutz – obwohl ich gelegentlich dafür gesorgt habe, dass Anyi und ich einander über den Weg gelaufen sind, so dass sie mich zumindest weiterhin erkennen würde.« Er schüttelte den Kopf. »Wer immer das getan hat, hat die besten Schlösser überwunden, die man mit Geld kaufen kann, und Leute, denen ich uneingeschränkt vertraut habe. Der Betreffende hat seine Hausaufgaben gemacht. Er könnte von ihr wissen. Aber er weiß vielleicht nicht, wo sie sich aufhält. Wenn ich nach ihr sehe, könnte ich ihn zu ihr führen.«
»Kannst du ihr eine Warnung zukommen lassen?«
Er runzelte die Stirn. »Ja. Vielleicht …« Er seufzte. »Ich muss es versuchen.«
»Was wirst du ihr raten?«
»Sich zu verstecken.«
»Dann wird es keine Rolle spielen, ob du den Mörder zu ihr führst oder nicht, nicht wahr? Sie wird sich ohnehin verstecken müssen.«
Er wirkte nachdenklich. »Ja, wahrscheinlich.«
Sonea lächelte, als ein Ausdruck der Entschlossenheit seine Züge verhärtete. Sein ganzer Körper war jetzt angespannt vor Zielstrebigkeit. Er sah sie an, und ein entschuldigender Ausdruck trat in seine Züge.
»Geh nur«, sagte sie. »Und warte beim nächsten Mal nicht so lange, bis du mich besuchst.«
Er brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ich verspreche es. Oh. Da ist noch etwas anderes. Es ist vermutlich keine große Sache, aber ich schätze, einer der anderen Diebe, Skellin, hätte gern seinen eigenen Magier. Er ist ein Feuel-Lieferant, daher solltest du besser hoffen, dass keiner von deinen Magiern eine Schwäche für das Zeug hat.«
»Sie sind nicht meine Magier, Cery«, rief sie ihm ins Gedächtnis, und das nicht zum ersten Mal.
Statt mit seinem gewohnten Grinsen antwortete er mit einer Grimasse. »Ja. Wie dem auch sei. Wenn du nicht wissen willst, wie ich hierher und wieder fortkomme, solltest du besser den Raum verlassen.«
Sonea verdrehte die Augen, dann ging sie auf die Schlafzimmertür zu. Bevor sie sie hinter sich schloss, drehte sie sich noch einmal um. »Gute Nacht, Cery. Das mit deiner Familie tut mir so leid, und ich hoffe, dass Anyi lebt und nicht in Gefahr ist.«
Er nickte, dann schluckte er. »Das hoffe ich auch.«
Dann schloss sie die Tür hinter sich und wartete. Aus dem Gästezimmer kamen einige leise Geräusche, und wenige Augenblicke später war alles still. Sie zählte bis hundert, dann öffnete sie die Tür abermals. Cery war spurlos verschwunden.
Inzwischen dämmerte es bereits, und Sonea spähte zwischen den Läden hindurch nach draußen, wo im ersten Morgenlicht Gestalten und Formen gerade erkennbar wurden. War das die mächtige Silhouette der Residenz des Hohen Lords, oder bildete sie sich das nur ein? So oder so, bei dem Gedanken daran überlief sie ein Schauer.
Hör auf damit. Er ist nicht dort.
Balkan hatte die letzten zwanzig Jahre dort gelebt. Sie hatte sich oft gefragt, ob er sich vom Schatten des ehemaligen Bewohners der Residenz verfolgt fühlte, doch sie hatte nie gefragt, denn sie war davon überzeugt, dass eine solche Frage taktlos gewesen wäre.
Er ist oben auf dem Hügel. Hinter dir.
Sie drehte sich um, den Blick durch die Wände ihrer Zimmer hindurch in die Ferne gerichtet, und in ihrer Fantasie sah sie auf dem Friedhof die neuen glänzenden, weißen Grabsteine zwischen den alten grauen aufragen. Eine alte Sehnsucht machte sich in ihr breit, aber sie zögerte. Sie hatte heute viel zu tun. Doch es war noch früh – die Dämmerung hatte gerade erst begonnen. Ihr blieb noch Zeit genug. Und es war schon eine Weile her. Cerys schreckliche Nachricht erfüllte sie mit dem Verlangen zu … was zu tun? Vielleicht, seinen Verlust anzuerkennen, indem sie sich an ihren eigenen erinnerte. Sie musste mehr tun, als nur dem gewohnten Alltagstrott zu folgen und vorzugeben, es sei nichts Schreckliches geschehen.
Nachdem sie in ihr Schlafzimmer zurückgekehrt war, wusch sie sich hastig und kleidete sich an, dann warf sie sich einen Umhang um die Schultern, Schwarz über Schwarz. Schließlich schlüpfte sie durch die Haupttür zu ihrem Zimmer und ging so leise sie konnte durch den Flur der Magierquartiere bis zum Eingang. Dort verließ sie das Gebäude und machte sich auf den Weg zum Friedhof.
Seit sie vor über zwanzig Jahren mit Lord Rothen zum ersten Mal dort gewesen war, hatte man neue Pfade angelegt. Das Unkraut wurde gejätet, aber der Wall schützender Bäume rund um die äußeren Gräber war unverändert geblieben. Sie betrachtete die glatten Quader der neueren Grabsteine. Bei der Errichtung einiger von ihnen war sie dabei gewesen. Wenn ein Magier starb, wurde jedwede Magie, die in seinem oder ihrem Körper verblieben war, freigelassen, und wenn genug davon vorhanden war, wurde der Leichnam davon verzehrt. Also waren die alten Gräber ein Rätsel gewesen. Wenn es keine Leiche zu begraben gab, warum waren dann Gräber hier?
Die Wiederentdeckung schwarzer Magie hatte diese Frage beantwortet. Die letzte Magie dieser altertümlichen Magier war von einem Schwarzmagier aufgesogen worden, und so war eine Leiche zurückgeblieben, die man begraben konnte.
Jetzt, da schwarze Magie nicht länger ein Tabu war – obwohl strikt kontrolliert -, waren Begräbnisse wieder in Mode gekommen. Die Aufgabe, die letzte Magie eines Magiers in sich aufzunehmen, fiel den beiden Schwarzmagiern der Gilde zu, ihr und Schwarzmagier Kallen.
Sonea fand, dass sie, wenn sie beim Tod eines Magiers seine letzte Macht genommen hatte, auch bei der Beerdigung zugegen sein sollte. Ich frage mich, ob Kallen sich auf gleiche Weise verpflichtet fühlt, wenn ein Magier ihn auswählt. Sie ging zu einem schlichten, schmucklosen Stein und trocknete mit magischer Hitze den Tau auf einer Ecke, so dass sie sich setzen konnte. Ihr Blick fand den in den Stein gemeißelten Namen. Akkarin. Es hätte dich erheitert zu sehen, wie viele der Magier, die so vehement dagegen waren, die Benutzung schwarzer Magie wiederzubeleben, am Ende darin Zuflucht suchen, damit ihr Fleisch nach ihrem Tod im Boden verwesen kann. Vielleicht wärst du wie ich zu dem Schluss gekommen, dass es für einen Magier passender sei, seinen Körper von seiner letzten Magie verzehren zu lassen, und – sie betrachtete den zunehmend kunstvoller werdenden Schmuck auf den neuen Gräbern der Gilde – beträchtlich weniger kostspielig.
Sie las die Worte auf dem Grabstein, auf dem sie saß. Ein Name, ein Titel, ein Hausname, ein Familienname. Später waren in kleinen Buchstaben die Worte »Vater von Lorkin« ergänzt worden. Doch ihr eigener Name war nicht erwähnt. Und wird es niemals werden, solange deine Familie etwas damit zu tun hat, Akkarin. Aber zumindest haben sie deinen Sohn akzeptiert.
Sie schob ihre Verbitterung beiseite, dachte für eine Weile an Cery und dessen Familie und überließ sich der Trauer und dem Schmerz des Mitleids. Gestattete den Erinnerungen zurückzukehren, von denen einige willkommen waren, andere nicht. Nach einer Weile riss sie das Geräusch von Schritten aus ihren Gedanken, und sie stellte fest, dass inzwischen die Sonne aufgegangen war.
Langsam drehte sie sich zu dem Besucher um und lächelte, als sie Rothen auf sich zukommen sah. Einen Moment lang war sein runzliges Gesicht eine Maske der Sorge, dann entspannte es sich zu einem Ausdruck der Erleichterung.
»Sonea«, sagte er, bevor er innehielt, um wieder zu Atem zu kommen. »Ein Bote hat nach dir gesucht. Niemand wusste, wo du warst.«
»Und ich wette, das hat eine Menge unnötigen Wirbel und Aufregung verursacht.«
Er sah sie stirnrunzelnd an. »Dies ist kein guter Zeitpunkt, um die Gilde an ihrem Vertrauen zu einer gemeingeborenen Magierin zweifeln zu lassen, Sonea, wenn man an die Veränderung der Regeln denkt, die in Kürze vorgeschlagen werden soll.«
»Gibt es jemals einen guten Zeitpunkt dafür?« Sie erhob sich und seufzte. »Außerdem habe ich gerade doch nicht die Gilde zerstört und alle Kyralier zu Sklaven gemacht, nicht wahr? Ich habe nur einen Spaziergang unternommen. Überhaupt nichts Finsteres.« Sie sah ihn an. »Ich habe die Stadt seit zwanzig Jahren nicht verlassen, und das Gelände der Gilde verlasse ich nur, um in Hospitälern zu arbeiten. Ist das nicht genug?«
»Für einige Leute nicht. Und gewiss nicht für Kallen.«
Sonea zuckte die Achseln. »Das erwarte ich von ihm. Es ist seine Aufgabe.« Sie legte eine Hand um seinen Ellbogen, und gemeinsam gingen sie den Pfad wieder hinunter. »Macht Euch wegen Kallen keine Sorgen, Rothen. Mit dem werde ich schon fertig. Außerdem würde er es nicht wagen, sich darüber zu beschweren, dass ich Akkarins Grab besuche.«
»Du hättest Jonna eine Nachricht hinterlassen und ihr mitteilen sollen, wo du hinwolltest.«
»Ich weiß, aber solche Besuche macht man ja meist ziemlich spontan.«
Er sah sie an. »Geht es dir gut?«
Sie lächelte. »Ja. Ich habe einen Sohn, der lebt und sich prächtig macht, Hospitäler in der Stadt, in denen ich ein wenig Gutes tun kann, und Euch. Was brauche ich mehr?«
Er hielt inne, um nachzudenken. »Einen Ehemann?«
Sie lachte. »Ich brauche keinen Ehemann. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich einen will. Ich dachte, ich würde mich einsam fühlen, nachdem Lorkin bei mir ausgezogen ist, aber ich stelle fest, dass es mir gefällt, ein wenig mehr Zeit für mich zu haben. Ein Ehemann wäre … im Weg.«
Rothen kicherte.
Oder er wäre eine Schwäche, die ein Feind ausnutzen könnte, fuhr es ihr unwillkürlich durch den Kopf. Aber dieser Gedanke ging eher auf Cerys Unglück zurück, das ihr noch so gegenwärtig war, als auf irgendeine reale Bedrohung. Obwohl man kaum sagen konnte, dass sie keine Feinde hatte, missbilligten diese Leute sie lediglich wegen ihrer niederen Herkunft oder fürchteten die schwarze Magie, über die sie gebot. Nichts, was einen von ihnen dazu veranlassen würde, jenen, die sie liebte, Schaden zuzufügen. Anderenfalls hätten sie Lorkin bereits ins Visier genommen.
Als sie an ihren Sohn dachte, stiegen Erinnerungen an ihn als Kind in ihr auf, ungeordnet, ältere und jüngere, glückliche und enttäuschende, und sie nahm eine vertraute Enge ums Herz wahr, die teils Freude und teils Schmerz war. Wenn er still und grüblerisch war, angestrengt nachdachte oder sich besonders klug verhielt, erinnerte er sie so sehr an seinen Vater. Aber er hatte auch eine selbstbewusste, charmante, halsstarrige, gesprächige Seite – und Rothen behauptete, dieser halsstarrige und gesprächige Teil seines Wesens sei definitiv ihr Erbe.
Als sie aus dem Wald traten, hatten sie einen guten Blick über das Gelände der Gilde. Der ihnen zunächst gelegene langgestreckte, rechteckige Bau mit den Magierquartieren beherbergte jene Magier, die sich dafür entschieden hatten, auf dem Gelände zu leben. Daran schloss sich ein Innenhof an, hinter dem ein weiteres Gebäude wie ein Spiegelbild des ersten aufragte – die Novizenquartiere.
An der dritten und von ihrem Standpunkt aus jetzt fernsten Seite des Innenhofes lag das prächtigste und höchste Gebäude der Gilde, die Universität. Selbst nach zwanzig Jahren verspürte Sonea eine Spur von Stolz, dass es ihr und Akkarin gelungen war, die Universität zu retten. Und wie immer folgten diesem Gefühl Traurigkeit und Bedauern angesichts des Preises, den sie dafür gezahlt hatten, dass sie das Gebäude verteidigt und jene nicht hatten sterben lassen, die darin verblieben waren. Hätten sie es den Feinden überlassen und währenddessen die Macht der Arena genommen, wäre Akkarin vielleicht am Leben geblieben.
Aber es hätte keine Rolle gespielt, wie viel Macht wir gesammelt hätten. Nachdem er verletzt war, hätte er sich trotzdem dafür entschieden, mir all seine Macht zu geben und zu sterben, statt sich selbst zu heilen – oder mir zu erlauben, ihn zu heilen – und das Risiko einzugehen, dass wir von den Ichani besiegt werden. Und ganz gleich, wie viel Macht wir genommen hätten, ich hätte niemals die Zeit gehabt, Kariko zu besiegen und Akkarin zu heilen. Sie runzelte die Stirn. Vielleicht hat Lorkin seine Halsstarrigkeit ja doch nicht von mir.
»Fühlst du dich versucht, zugunsten des Antrags zu sprechen?«, fragte Rothen, als sie ein paar Schritte gegangen waren. »Ich weiß, dass du dafür bist, die Regel abzuschaffen.«
Sie schüttelte den Kopf.
Rothen lächelte. »Warum nicht?«
»Ich würde ihrer Sache mehr schaden als nutzen. Schließlich ist jemand, der in den Hüttenvierteln aufgewachsen ist, dann einen Schwur gebrochen, fremdländische Magie erlernt und den Höheren Magiern und dem König in einem solchen Maß getrotzt hat, dass sie gezwungen waren, ihn ins Exil zu schicken, kaum geeignet, um Vertrauen in Magier von geringerer Herkunft zu wecken.«
»Du hast das Land gerettet.«
»Ich habe Akkarin geholfen, das Land zu retten. Das ist ein großer Unterschied.«
Rothen verzog das Gesicht. »Du hast eine ebenso große Rolle gespielt – und den letzten Schlag geführt. Daran sollten die Menschen sich erinnern.«
»Und Akkarin hat sich geopfert. Selbst wenn ich nicht aus den Hüttenvierteln käme und keine Frau wäre, würde es mir schwerfallen, damit zu konkurrieren.« Sie zuckte die Achseln. »Ich bin nicht interessiert an Dank und Anerkennung, Rothen. Für mich zählen nur Lorkin und die Hospitäler. Und Ihr natürlich.«
Er nickte. »Aber was wäre, wenn ich dir erzählte, dass Lord Regin sich erboten hat, die Gegner der Petition zu re präsentieren.«
Bei dem Namen krampfte sich Soneas Magen zusammen. Obwohl der Novize, ihr Peiniger während ihrer frühen Jahre an der Universität, inzwischen ein verheirateter Mann mit zwei erwachsenen Töchtern war und sie seit der Ichani-Invasion stets nur mit Höflichkeit und Respekt behandelt hatte, konnte sie nicht umhin, ein Echo von Misstrauen und Abneigung zu verspüren.
»Das überrascht mich nicht«, sagte sie. »Er hielt sich schon immer für etwas Besseres.«
»Ja, obwohl sich sein Charakter seit euren Novizentagen erheblich verbessert hat.«
»Er hält sich immer noch für etwas Besonderes, trägt das aber mit besseren Manieren vor.«
Rothen lachte leise. »Fühlst du dich jetzt versucht?«
Sie schüttelte abermals den Kopf.
»Nun, du solltest besser damit rechnen, dass man dich nach deiner Meinung zu dem Thema fragen wird«, warnte er. »Viele Leute werden deine Ansichten hören wollen und dich um Rat bitten.«
Als sie den Innenhof erreichten, seufzte Sonea. »Ich bezweifle es. Aber für den Fall, dass Ihr recht habt, werde ich darüber nachdenken, auf welche Fragen ich gefasst sein muss und wie ich darauf antworten werde. Ich will auch kein Hemmnis für die Antragsteller sein.«
Und wenn Regin die Opposition repräsentiert, sollte ich auf jeden Fall mit seinen Ränken rechnen. Seine Manieren mögen sich verbessert haben, aber er ist immer noch so intelligent und verschlagen wie eh und je.
In der Gliarstraße West im Nordviertel gab es eine kleine, ordentliche Schneiderei, die in einigen privaten Räumen im ersten Stock den jungen, reichen Männern der Stadt Unterhaltung bot, so sie denn die richtigen Leute kannten, um dort Zugang zu erhalten.
Lorkin war vor vier Jahren von Dekker, seinem Freund und Mitschüler, zum ersten Mal mit hierher genommen worden. Wie immer war es Dekkers Idee gewesen. Er war der Draufgänger unter Lorkins Freunden – kein ganz untypischer Charakterzug für einen jungen Krieger. Zu ihrem Freundeskreis gehörten Sherran, Reater und Orlon; Sherran hatte stets getan, was immer Dekker vorschlug, während Reater und Orlon sich nicht so leicht zu Unfug hinreißen ließen. Vielleicht war es nur natürlich, dass Heiler zur Vorsicht neigten. Aus welchem Grund auch immer, Lorkin hatte sich nur bereitgefunden, Dekker zu begleiten, weil die beiden Freunde es ebenfalls getan hatten.
Vier Jahre später waren sie alle examinierte Magier, und die Schneiderei war ihr Lieblingstreffpunkt. Heute hatte Perler seine Cousine Jalie aus Elyne zu ihrem ersten Besuch dort mitgebracht.
»Dies ist also die Schneiderei, von der ich so viel gehört habe«, sagte die junge Frau, während sie sich im Raum umschaute. Die Möbel waren kunstvoll gefertigt, abgelegte Stücke aus den wohlhabenderen Häusern der Stadt. Die Bilder an den Wänden und auf den Fensterläden dagegen konnte man nur billig nennen, sowohl was ihre Thematik als auch die Ausführung betraf.
»Ja«, erwiderte Dekker. »Alle Freuden, nach denen es dich vielleicht gelüstet.«
»Zu einem Preis«, bemerkte sie und sah ihn von der Seite an.
»Zu einem Preis, den wir um deinetwillen vielleicht zu zahlen bereit sind, um des Vergnügens deiner Gesellschaft willen.«
Sie lächelte. »Du bist so lieb!«
»Aber nicht ohne Zustimmung ihres älteren Cousins«, fügte Perler hinzu und sah Dekker dabei fest an.
»Natürlich«, erwiderte der junge Mann und verbeugte sich leicht in Perlers Richtung.
»Also, welche Freuden hat man hier zu bieten?«, fragte Jalie.
Dekker machte eine knappe Handbewegung. »Freuden des Körpers, Freuden des Geistes.«
»Des Geistes?«
»Ooh! Lasst uns ein Kohlenbecken hereinholen«, sagte Sherran mit glänzenden Augen. »Gönnen wir uns ein wenig Feuel, um uns zu entspannen.«
»Nein«, widersprach Lorkin. Als er eine andere Stimme ebenfalls protestieren hörte, drehte er sich um, um Orlon dankbar zuzunicken, den die Droge ebenso abstieß wie ihn selbst.
Sie hatten es einmal ausprobiert, und Lorkin hatte die Erfahrung beunruhigend gefunden. Es war nicht der Umstand gewesen, dass das Feuel Dekkers grausame Seite zum Vorschein gebracht hatte, so dass er das Mädchen, das zu jener Zeit in ihn vernarrt gewesen war, gereizt und gequält hatte, sondern vielmehr der Umstand, dass Dekkers Verhalten ihn plötzlich nicht mehr gestört hatte. Tatsächlich hatte er es witzig gefunden, obwohl er später nicht mehr verstehen konnte, warum.
Die Schwärmerei des Mädchens hatte an jenem Tag geendet, und Sherrans Liebesgeschichte mit Feuel hatte begonnen. Vor jener Zeit hätte Sherran alles getan, worum Dekker ihn bat. Seit diesem Tag tat er es nur noch dann, wenn es ihn nicht von seinem Feuel abhielt.
»Lasst uns stattdessen etwas trinken«, schlug Perler vor. »Etwas Wein.« Er betrachtete die Dienstmagd, die zögernd an der Tür stand, und nickte, woraufhin die Frau lächelte und davoneilte.
»Trinken Magier denn?«, fragte Jalie. »Ich dachte, das dürften sie nicht.«
»Wir dürfen durchaus«, erwiderte Reater, »aber es ist keine gute Idee, sich allzu sehr zu betrinken. Wenn man die Kontrolle verliert, wirkt sich das wahrscheinlich auf die Magie genauso aus wie auf den Magen oder die Blase.«
»Ich verstehe«, sagte sie. »Also muss die Gilde sicherstellen, dass keine der Prollis, die sie aufnimmt, Trinker sind?«
Die anderen sahen Lorkin an, und er lächelte unwillkürlich. Sie wussten genau, dass er den Raum verlassen würde, wenn sie mehr als den gelegentlichen Scherz über die einfachen Leute machten.
»Es gibt wahrscheinlich mehr Schnösis, die Trinker sind, als Prollis«, erklärte Dekker ihr. »Wir haben Methoden, mit ihnen zu verfahren. Was möchtest du trinken?«
Lorkin wandte den Blick ab, als das Gespräch sich dem Thema Getränke zuwandte. »Prollis« und »Schnösis« waren die Namen, die die reichen und die armen Novizen einander gegeben hatten, nachdem die Gilde beschlossen hatte, auch junge Leute außerhalb der Häuser zur Magierausbildung an der Universität zuzulassen.
Lorkin passte in keine der beiden Gruppen. Seine Mutter stammte aus den Hüttenvierteln, und sein Vater war der Spross eines der mächtigsten Häuser Imardins gewesen. Er war in der Gilde aufgewachsen, fernab von den politischen Manipulationen und Verpflichtungen der Häuser oder dem harten Leben der Hüttenviertel. Die meisten seiner Freunde waren Schnösis. Er hatte es nicht mit Absicht vermieden, sich mit Prollis zu befreunden, aber obwohl die meisten Prollis für ihn nicht die gleiche Abneigung wie für die Schnösis zu empfinden schienen, war es schwierig gewesen, mit ihnen zu reden. Erst nach einigen Jahren, als Lorkin einen festen Kreis von Schnösi-Freunden hatte, war ihm klar geworden, dass die Prollis sich von ihm – oder vielmehr von dem Mann, der sein Vater gewesen war – eingeschüchtert fühlten.
»… Sachaka? Halten sie dort wirklich immer noch Sklaven?«
Lorkin schaltete sich wieder in das Gespräch ein. Beim Namen des Landes, aus dem der Mörder seines Vaters gekommen war, überlief ihn stets ein Schauer. Doch während es früher ein Schauer der Angst gewesen war, rührte er jetzt auch von einer seltsamen Erregung. Seit der Ichani-Invasion hatten die Verbündeten Länder ihre Aufmerksamkeit auf den zuvor lange ignorierten Nachbarn gerichtet. Magier und Diplomaten hatten sich nach Sachaka hineingewagt, in der Hoffnung, zukünftige Konflikte durch Verhandlungen, Geschäfte und Übereinkünfte vermeiden zu können. Wann immer sie zurückkehrten, brachten sie Beschreibungen von einer seltsamen Kultur und einer noch seltsameren Landschaft mit.
»Das tun sie allerdings«, erwiderte Perler. Lorkin setzte sich ein wenig gerader hin. Reaters älterer Bruder war vor einigen Wochen aus Sachaka zurückgekehrt, nachdem er dort ein Jahr lang als Gehilfe des Gildebotschafters gearbeitet hatte. »Obwohl man die meisten von ihnen gar nicht zu sehen bekommt. Deine Roben verschwinden aus deinem Zimmer und tauchen gesäubert wieder auf, aber du siehst niemals, wer sie holt. Den Sklaven, der abgestellt wurde, dich zu bedienen, siehst du natürlich. Wir haben alle einen.«
»Du hattest einen eigenen Sklaven?«, fragte Sherran. »Verstößt das nicht gegen das Gesetz des Königs?«
»Sie gehören uns nicht«, erwiderte Perler achselzuckend. »Die Sachakaner wissen nicht, wie man Dienstboten richtig behandelt, daher müssen wir es ihnen erlauben, uns Sklaven zuzuweisen. Entweder das, oder wir müssten unsere Kleider selbst waschen und unsere Mahlzeiten selbst zubereiten.«
»Was entsetzlich wäre«, bemerkte Lorkin mit gespieltem Grauen. Ihre Dienerin war die Tante seiner Mutter, deren Angehörige ebenfalls als Dienstboten für reiche Leute ihr Geld verdienten. Dennoch besaßen sie eine Würde und Findigkeit, die er respektierte. Er war fest entschlossen, dass er, sollte er jemals häusliche Arbeiten verrichten müssen, sich durch diese Tätigkeiten niemals so gedemütigt fühlen würde wie die anderen Magier.
Perler sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Dafür bleibt keine Zeit. Es gibt immer so viel Arbeit zu erledigen. Ah, da sind die Getränke.«
»Welche Art von Arbeit?«, fragte Orlon, während Wein eingeschenkt und Gläser herumgereicht wurden.
»Es müssen Geschäftsabschlüsse ausgehandelt werden, und es gilt zu versuchen, die Sachakaner dazu zu ermuntern, der Sklaverei abzuschwören, um sich den Verbündeten Ländern anzuschließen. Außerdem muss man die sachakanische Politik verfolgen – es gibt eine Gruppe von Rebellen, von denen Botschafter Maron gehört hatte und über die er mehr in Erfahrung zu bringen versuchte, bis er zurückkehren musste, um die Probleme seiner Familie zu lösen.«
»Klingt langweilig«, meinte Dekker.
»Tatsächlich war es ziemlich aufregend.« Perler grinste. »Ein wenig beängstigend bisweilen, aber ich hatte das Gefühl, als täten wir etwas, nun, Historisches. Als bewirkten wir etwas. Als veränderten wir die Dinge zum Besseren – und sei es auch nur mit winzigen Schritten.«
Ein seltsames Gefühl der Erregung durchlief Lorkin. »Denkst du, sie werden beim Thema Sklaverei einlenken?«, fragte er.
Perler zuckte die Achseln. »Einige tun es, aber es ist schwer zu sagen, ob sie es nur vortäuschen, um höflich zu wirken oder um etwas dadurch zu gewinnen. Maron denkt, man könne sie viel eher dazu überreden, die Sklaverei aufzugeben als die schwarze Magie.«
»Es wird schwer sein, sie zur Aufgabe der schwarzen Magie zu überreden, solange wir selbst zwei schwarze Magier haben«, bemerkte Reater. »Kommt mir ein wenig scheinheilig vor.«
»Sobald sie schwarze Magie verbieten, werden wir es ebenfalls tun.«
Dekker drehte sich mit einem Grinsen zu Lorkin um. »Wenn das geschieht, wird Lorkin das Amt seiner Mutter nicht übernehmen.«
Lorkin schnaubte verächtlich. »Als ob sie mir das erlauben würde. Nein, ihr wäre es viel lieber, wenn ich die Leitung der Hospitäler übernähme.«
»Wäre das so schlimm?«, fragte Orlon leise. »Nur weil du Alchemie gewählt hast, bedeutet das nicht, dass du den Heilern nicht helfen könntest.«
»Um etwas Derartiges zu tun, muss man von einer absoluten, unbeirrbaren Hingabe angetrieben werden«, erwiderte Lorkin. »Diese Hingabe besitze ich nicht. Obwohl ich beinahe wünschte, ich hätte sie.«
»Warum?«, fragte Jalie.
Lorkin breitete die Hände aus. »Ich würde gern etwas Nützliches mit meinem Leben anfangen.«
»Pah!«, sagte Dekker. »Wenn du es dir leisten kannst, dein Leben in Müßiggang zu verbringen, warum solltest du es dann nicht tun?«
»Langeweile?«, meinte Orlon.
»Wer langweilt sich?«, erklang eine neue Frauenstimme.
Eine ganz andere Art von Erregung durchlief Lorkin. Ihm stockte der Atem, und sein Magen krampfte sich unangenehm zusammen. Alle drehten sich um und sahen eine dunkelhaarige junge Frau eintreten. Sie lächelte, als sie sich im Raum umschaute. Als ihr Blick auf Lorkin fiel, geriet ihr Lächeln ins Wanken, aber nur für einen Moment.
»Beriya.« Er sprach ihren Namen, beinahe ohne es zu wollen, und sofort hasste er die Art, wie es geklungen hatte, ein schwaches, jämmerliches Ächzen.
»Setz dich doch zu uns«, lud Dekker sie ein.
Nein,