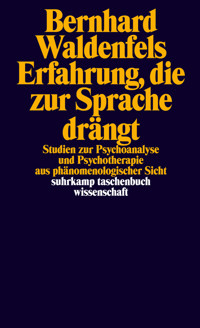19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Soziale Erfahrung entspringt einem Miteinander, das die Fremdheit des Anderen weder zu integrieren noch zu eliminieren vermag. Keine Sozialität ohne Alterität, keine Alterität ohne Sozialität. Diese ungesellige Geselligkeit entfaltet sich in gemeinsamen Intentionen und Affektionen, zwischen Ich und Wir, an den Schwellen des Fremden und unter Mitwirkung der Dinge. Folgerichtig trifft in Bernhard Waldenfels' neuem Buch Phänomenologie auf Ethnologie, Psychoanalyse und Politik. In Auseinandersetzung mit Husserl, Schütz, Searle, Castoriadis, Ricœur und Foucault geht es um Normalität, Alltagsmoral, soziale Imagination, Vergessen, Erinnern und den Freimut der Rede. Der Homo respondens und die Vielstimmigkeit Europas bilden die Eckpfeiler dieser Untersuchung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Soziale Erfahrung entspringt einem Miteinander, das die Fremdheit des Anderen weder zu integrieren noch zu eliminieren vermag. Keine Sozialität ohne Alterität, keine Alterität ohne Sozialität. Diese ungesellige Geselligkeit entfaltet sich in gemeinsamen Intentionen und Affektionen, zwischen Ich und Wir, an den Schwellen des Fremden und unter Mitwirkung der Dinge. Folgerichtig trifft in Bernhard Waldenfels’ neuem Buch Phänomenologie auf Ethnologie, Psychoanalyse und Politik. In Auseinandersetzung mit Husserl, Schütz, Searle, Castoriadis, Ricœur und Foucault geht es um Normalität, Alltagsmoral, soziale Imagination, Vergessen, Erinnern und den Freimut der Rede. Der Homo respondens und die Vielstimmigkeit Europas bilden die Eckpfeiler dieser Untersuchung.
Bernhard Waldenfels ist emeritierter Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen (stw 1952), Sinne und Künste im Wechselspiel (stw 1973) und Hyperphänomene (stw 2047).
Bernhard Waldenfels
Sozialität und Alterität
Modi sozialer Erfahrung
Suhrkamp
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2137
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-74135-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
Prolog: Homo respondens
Der vielgestaltige Mensch – Das Rätsel der Sphinx – Technisch normierte, normale und kreative Antworten – Responsivität als Grundzug des Verhaltens – Pathos… – … und Response – Diastase – Namen
I. Analysen
1. Das Dilemma einer ungeselligen Geselligkeit
1. Egologische Ausbrüche und der soziologische Zirkel
2. Die soziale Ordnung und das soziale Band
3. Soziale Differenz und der Hiatus zwischen Ich und Wir
4. Frontale und laterale Sozialität
5. Der Andere als Appellant, der Dritte und das Zwischen
2. Koaffektion und Kointention
1. Das Rätsel des Sozialen im Suchfeld der Phänomenologie
2. Erstaunliche und erschreckende Ereignisse
3. Widerfahrnis, Antwort und Widerstand
4. Der zweifelhafte Status materialer Werte und sozialer Gefühle
5. Koaffektion, Korrespondenz und Kointention
6. Selbstaffektion und Fremdaffektion
3. Angst und Furcht als Ausdruck des Pathischen
1. Erstaunen und Erschrecken
2. Knotenpunkte der Angst
3. Angst, Furcht und Schreck im Lichte von Pathos und Response
4. Angst schwebend zwischen Erinnerung und Erwartung
5. Angst inmitten von Eigenem und Fremdem
6. Haben, Gelten und Sein im Zeichen der Angst
7. Angst als Schutzschild gegen Furcht und Schreck
8. Verkörperung von Angst in Phobien
9. Normale und pathologische Angst
4. Geburt und Tod als Grenzzonen des Mitseins
1. Ungleichzeitigkeiten des Lebens
2. Der pathische und der allopathische Charakter von Geburt und Tod
3. Unser Antworten auf den Tod
4. Tod im Bild
5. Absterben und Aufleben
5. Wir vor und unter dem Gesetz
1. Varianten des performativen Wir
2. Der Dritte als Stellvertreter
3. Der Dritte als Übergangsfigur
4. Inklusives und exklusives Wir
5. Urszenen der Gesetzgebung
6. Gesetz als Antwort
6. Metapolitischer Einschub: Gleichheit, Ungleichheit und Gleichgültigkeit
7. Fremdheitsschwellen
1. Schwellenerfahrung als Prototyp der Fremderfahrung
2. Übergänge
3. Kommen und Gehen
4. Zwischen
5. Übergangsformen
6. Kleine und große Schwellen
7. Überschreitbarkeit von Schwellen
8. Mitwirkung der Dinge
1. Die wichtigsten und die nächsten Dinge
2. Widerfahrnisse
3. Aufforderungscharaktere
4. Als-Struktur
5. Das Umfeld der Dinge
6. Der Leib und die Dinge
7. Vom Gedächtnis der Dinge
8. Überdinge
9. Am Leitfaden des Mitseins
9. Transformationen der Erfahrung
1. Die Arbeit der Erfahrung
2. Taumel der Leere
3. Heterogenese
4. Supplemente und Substitute
5. Zwiespältigkeit der Symptome
6. Kreative Responsivität und responsive Kreativität
7. Prokreation und Konkreation
II. Debatten
10. Edmund Husserl: Normalität im Widerstreit
1. Zweideutigkeiten der Normalität
2. Normalisierung zwischen Orthologie und Heterologie
3. Instanzen der Normalisierung
4. Entschärfung des Widerstreits durch Optimierung und Finalisierung
5. An den Grenzen der Normalität und über sie hinaus
6. Wege der Denormalisierung
11. Alfred Schütz und Aron Gurwitsch: Alltagsmoral
1. Der Fremde und der Flüchtling
2. Der zweideutige Status der Alltagsmoral
3. Separation von Alltagspragmatik und Moralistik
4. Alltagsethos und Alltagsmoral
5. Verkörperung der Moral im Alltags- und Berufsethos
6. Das Alltägliche und das Außeralltägliche
7. Zeuge und Beobachter
8. Unauffälligkeit der Moral
12. John R. Searle: Sozialontologie auf sozialbiologischer Basis
1. Von Sprechakten und intentionalen Akten zur sozialen Wirklichkeit
2. Kollektive Intentionalität als Brücke zwischen Natur und Gesellschaft
3. Partizipatorischer Individualismus
4. Das Rohe und das Geregelte
5. Institutionelle Bodensuche
13. Paul Ricœur: Erzählen, Erinnern und Vergessen
1. Die Zeit unter der Obhut der Erzählung
2. Vergessen unter der Obhut des Vergessens
3. Vergessen im Herzen der Gegenwart
4. Erzählen des Unerzählbaren
14. Cornelius Castoriadis: Revolutionäre Praxis und ontologische Kreation
1. Persönliche und zeitgeschichtliche Reminiszenzen
2. Ein Autor zwischen den Fronten
3. Kreation und Imagination im Zeichen der Autonomie
4. Fremdheit als blinder Fleck
15. Michel Foucault: Wahrsprechen und Antworten
1. Die Parrhesia als Kreuzungspunkt
2. Parrhesia und Pragmatik
3. Gute und schlechte Parrhesia
4. Die Brüchigkeit des Redepaktes
5. Wahrsprechen und Wahrhören
6. Andere Welt und anderes Leben?
Epilog: Mehrstimmiges Europa
»Wir guten Europäer« – Ich im Wir, Wir im Ich – Ich und Wir im Widerstreit – Verdoppelung des Ich – Eigene und fremde Stimme – Zwischen uns – Stellvertretung – Alte und neue Herausforderungen
Literatur
Namenregister
Sachregister
Vorwort
Phänomenologie ist eine Denkweise, die sich nicht nur auf Erfahrungen stützt, sondern aus Erfahrung erwächst und ihr zum Ausdruck verhilft. Stachel dieses Bemühens ist eine zugleich erstaunliche und erschreckende Fremdheit inmitten aller Vertrautheit. Diese Fremdheit erreicht eine besondere Stärke durch die Verdoppelung und Vervielfältigung der Fremdheit meiner selbst in der Fremdheit der Anderen. Nachdem in drei vorausgehenden Bänden wechselnde Modi der zeiträumlichen, der aisthetisch-ästhetischen und der hyperbolischen Erfahrung zur Sprache kamen, geht es in diesem Band um spezielle Modi der sozialen Erfahrung.
Was sich fortsetzt, ist die Beachtung primärer Formen von Erfahrung, die nicht ohne sekundäre Bearbeitung zu denken sind, aber nicht darin aufgehen. Das Primäre der Erfahrung, in dessen Erforschung sich Phänomenologie und Psychoanalyse berühren, ist weder mit schlichter Unmittelbarkeit noch mit Mikrophänomenen zu verwechseln. Es erreicht eine eigentümliche Tiefe. Hinzu kommt die Erkundung produktiver Formen der Erfahrung, innerhalb deren die Ordnung der Dinge sich bewährt, sich wandelt und immer wieder das Chaos streift. Mit der besonderen Form von sozialer Erfahrung öffnet sich ein immenses Feld erhöhter Komplexität. Jedes Schlüsselwort, mit dem man sich Einlaß verschafft, ob Gemeinschaft, Gesellschaft, Staat oder Kommune, ob Intersubjektivität oder Sozialität, ob Mitmensch, Mitbürger, Verwandter oder Rollenträger, ob Vorfahr oder Nachfahr, stürzt uns in ein Meer von Fragen. Um einseitige Vorentscheidungen zu vermeiden, orientieren wir uns an dem winzigen Mit, syn oder cum, das in vielen Wortverbindungen auftaucht und das als Präfix oder als Präposition verschiedene Wege der Erfahrung offenhält. Wenn wir diese Erfahrung rundweg als sozial bezeichnen, so geschieht dies proleptisch in Erwartung einer laufenden Klärung und Ausdifferenzierung. Unter dem Politischen verstehen wir eine spezifische Organisation und Instituierung des Sozialen, die wie das Sprachliche oder das Ästhetische alles in der Erfahrung berührt, aber nicht alles bestimmt.
Das Mit dient uns als Kristallisationskern für eine Reihe von Fragen, die einst quaestiones disputatae genannt wurden und die im Schatten der großen Summen und Systeme ihre Unruhe verbreiten. Immer wieder taucht Altes, das wir zu gut kennen, in neuen Formen auf, die wir zu wenig beachten. In wiederholten Anläufen werden wir auf neuralgische Punkte und symptomatische Befunde stoßen, die zu weiterer Arbeit an den Phänomenen auffordern. Der fakultative Charakter des Mit wird uns davor bewahren, das Mitmenschliche fraglos auf Instanzen wie Subjekt oder Person, Familie, Volk oder Staat festzulegen, und es wird uns ebensosehr von einem sozialen Paternalismus oder humanen Chauvinismus abhalten, der alles Nicht-Menschliche, seien es Tiere, Pflanzen oder Dinge, rigoros menschlichen Belangen unterwirft. Das Mit läßt Nuancen und Abstufungen zu, die den Rastern binärer Ordnungsmuster wie Sein und Sollen, Fakten und Normen, Subjekt und Objekt entgleiten. Entscheidend ist dabei die Rolle des Leibes, der auf der Schwelle von Kultur und Natur agiert, indem er im Zuge einer Zwischenleiblichkeit von mir selbst auf die Anderen übergreift und in Gestalt von Verkörperungen eine ganze Skala von Zwischendingen entstehen läßt, die wie unser Leib weder dem Subjektiven noch dem Objektiven zuzuschlagen sind. In dieser Zwischensphäre entfalten sich erfinderische Kräfte. Dazu gehört eine Imagination, die soziale Formen des Imaginären einschließt; dazu gehören Rituale, die uns über Schwellen hinweghelfen; dazu gehört eine Somatotechnik, die sich zur Soziotechnik ausweitet; dazu gehören immer wieder Störungen und Einbrüche, die eine Pathologie des Sozialen entstehen lassen.
Nähern wir uns dem Kernbereich des Sozialen, so stoßen wir auf ein Grundparadox. Der Andere ist einer unter anderen wie ich selbst, doch gäbe es die Anderen nicht als Andere, so wäre jeder von uns nichts weiter als einer unter anderen. In der wechselnden Groß- und Kleinschreibung, deren sich auch Lacan bedient, deutet sich an, daß der Status des Anderen nicht eindeutig ist. Ich selbst und der/die Andere sind Kontrastfiguren, deren Singularität sich nicht verallgemeinern und deren wechselseitige Fremdheit sich nicht restlos integrieren läßt. Das bipolare Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft spiegelt sich wider in einer zweifachen Genese. Einzelne und Gemeinschaften gibt es nur im Zuge eines doppelseitigen Prozesses gleichzeitiger Vereinzelung und Vergemeinschaftung. Wer sich vereinzelt, ist kein restlos Einzelner, und wer sich vergemeinschaftet, ist niemals restlos in der Gemeinschaft beschlossen. Singularität und Sozialität verhalten sich zueinander wie Figur und Grund; eines geht auf Kosten des anderen, doch eines ist nichts ohne das andere. Sowenig es eine in sich abgeschlossene Sozialität gibt, so wenig gibt es reine Singularität. Letzteres gilt für die Singularität meiner selbst ebenso wie für die der Anderen. Die Singularität ist eine Singularität im Plural; Selbstheit und Alterität sind keine referentiellen, sondern differentielle und topische Bestimmungen. Die soziale Genealogie, die sich in einer performativen Form des Sozialen bekundet, erzeugt eine Unruhe, die in keiner Sozialontologie, aber auch in keiner politischen Ontologie zur Ruhe kommt. Das Rätsel des Sozialen liegt darin, daß esSoziales gibt, ähnlich wie es Sinn, Wahrheit und Ordnung gibt. Dies besagt nicht zuletzt, daß es Andere gibt, ohne daß deren Alterität auf Eigenheit und Gemeinsamkeit zurückgeführt werden kann. Die beiden Titelbegriffe der Sozialität und der Alterität signalisieren eine Spannung, die das Leben eines jeden von uns und das Zusammenleben von uns allen durchzieht. Dramatik des Außerordentlichen und Epik des Ordentlichen sind nicht voneinander zu trennen.
Mit diesen Überlegungen bewegen wir uns auf dem vertrauten Boden einer pathisch und responsiv angelegten Phänomenologie. Motive wie Schwellenerfahrung, Zwischenereignisse, offene Anknüpfung in der Sinnbildung, Überschüsse des Fremden, Widerfahrnis und Antwort oder Eingriffe des Dritten, die seit langem bearbeitet wurden, werden nun aus der Perspektive einer Sozialphänomenologie aufgegriffen. Die Konfrontation von Phänomenologie und Psychoanalyse und die Nähe zur Ethnologie als einer Fremdheitswissenschaft spielen weiterhin eine bedeutsame Rolle. Die Analyse von Hyperphänomenen wie Gabe, Stellvertretung und Vertrauen, in denen sich eine Ungeselligkeit in der Geselligkeit bemerkbar macht, und die Analyse sozialer Gewaltausübung, in der die Ungeselligkeit sich der Geselligkeit entgegenstellt, wird weitergeführt.1
Der Gesamttext wird eingerahmt von einem Prolog, der das Grundmotiv der Responsivität anklingen läßt, und einem Epilog, der die Mehrstimmigkeit als Wahrzeichen eines sich selbst suchenden und sich selbst überschreitenden Europas vor Augen führt. Der Haupttext ist auf zwei Teile angelegt. Der erste Teil enthält ausgesuchte Sachanalysen. Er beginnt mit einem aporetischen Anfangskapitel, das um das kantische Motiv einer ungeselligen Geselligkeit kreist. Die Sozialität wird von Grund auf problematisiert, ausgehend von Grundfiguren wie Ich, der Andere, das Wir und der Dritte, die sich immer wieder in einem egologischen oder aber in einem sozialen Zirkel zu verfangen drohen. Die Frage ist, wie man diesen Zirkel durchbrechen kann, ohne alles Soziale abzuwerten zugunsten eines »ganz Anderen«. Alterität ohne Sozialität wäre ebenso fatal wie Sozialität ohne Alterität. – In den Kapiteln 2 bis 4 verfolgen wir das Soziale bis hinein in die Niederungen einer gemeinsamen Passivität und Affektivität, in die Abgründe erschütternder Erfahrungen wie Erstaunen und Erschrecken und in die Grenzzonen von Geburt und Tod. Hierbei werden insbesondere Anregungen aus den Bereichen der Medizin, der Psychoanalyse sowie der Sozial- und Entwicklungspsychologie aufgegriffen. Eine gewichtige Rolle spielen dabei Sigmund Freuds Gänge durch die Untergründe der Erfahrung und Kurt Goldsteins responsive Konzeption des Organismus. Bei Geburt und Tod wird die spezielle Umsetzung pathischer Erfahrungen und Affekte in kollektive Bilder auf exemplarische Weise berücksichtigt. – Kapitel 5 befaßt sich mit der Verklammerung von Wir-Rede, Stellvertretung und Gesetzesanspruch. Das Wir, dem wir uns zugehörig fühlen, ist kein substantielles, sondern ein performatives Wir, das ständiger Erprobung ausgesetzt ist. Das Wir bezeichnet mehr als ein Ich im Plural, und Bürgerschaft bedeutet mehr als die Menge derer, die ein und demselben Gesetz unterstehen. Damit betreten wir die institutionellen Bereiche von Recht und Politik, die unsere soziale Erfahrung prägen, sie umgekehrt aber auch voraussetzen. In Kapitel 6 erfährt das Politische, das sich nicht auf Entscheidungen und Maßnahmen der institutionellen Politik beschränkt, eine Zuspitzung in Form eines unerläßlichen Gleichsetzens des Ungleichen. Lösen Gleichheit und Ungleichheit sich voneinander ab, so droht das Abdriften in die Gleichgültigkeit eines Indifferentismus oder umgekehrt das Aufflackern eines Extremismus, der sich an seiner eigenen Radikalität berauscht. An aktuellen Beispielen fehlt es nicht. – Kapitel 7, in dem die alltägliche und außeralltägliche Überschreitung von Schwellen als eine initiatorische Form leibhaftiger Fremderfahrung vorgestellt wird, macht deutlich, daß Sozialität nicht denkbar ist ohne wiederholte Grenzüberschreitungen. Dies führt uns mit Walter Benjamin, Arnold van Gennep und Victor Turner auf die Spuren von Ethnologie, Kulturanthropologie und Literatur. – Bis zu einem gewissen Grad gilt dies auch für Kapitel 8, in dem der Radius des Mit ausgeweitet wird auf die Mitwirkung kulturell geprägter und natürlich vorgeprägter Dinge. Darin deutet sich eine generalisierte Form des Mitseins an, die alles Lebendige einbegreift, aber auch dazu führen kann, daß sich die unerläßlichen Differenzen des Mit in einer quasi-animistischen Allbelebung oder in einer quasi-juridischen Inthronisation der Dinge verwässern. Neuere Versuche wie die von Michel Serres, Bruno Latour und Philippe Descola, die darauf abzielen, die Kluft zwischen menschlicher Kultur und nicht-menschlicher Natur zu schließen, sind kritisch zu bedenken. – In Kapitel 9 versetzen wir uns in das Laboratorium einer Erfahrung, die in Prozessen der Umgestaltung, Umformung und Umstrukturierung eine Heterogenese von Sinn betreibt und die dem Amorphen Raum gibt, ohne es auf bloßes Rohmaterial oder bloße Hardware eigenmächtiger Produktionen und Konstruktionen zu reduzieren. Was dabei zutage tritt, ist weder eine schlichte Unmittelbarkeit alltäglicher Dinge noch die schlechte Unendlichkeit eines kulturalistischen Sammeltriebs. Die Arbeit der Erfahrung kreist um niemals auszufüllende Leerstellen, indem sie in Zwischeninstanzen wie Supplementen, Substituten und Symptomen Halt sucht und eine Kreativität entfaltet, die aus dem Antworten auf unaufholbare Voranfänge erwächst. Auch die Gemeinschaftlichkeit ist Resultat solcher Transformationen.
Den Sachanalysen schließt sich als zweiter Teil eine Reihe von Debatten an. Von Kapitel zu Kapitel verbinden sich problematische Brennpunkte mit den Namen einschlägiger Autoren. Diese offene Kette von Anknüpfungen und Auseinandersetzungen führt immer wieder an die Grenzen der Phänomenologie, ohne diese völlig hinter sich zu lassen; sie reicht von Husserl, Schütz und Gurwitsch bis zu Searle, Ricœur, Castoriadis und Foucault. Behandelt werden drängende Themen wie Normalität und Anomalität, Alltägliches und Außeralltägliches, Narrativität, Erinnern und Vergessen, kollektive Intention, soziales Imaginäres und Freimut der Rede. Diese Ausführungen können als erweiternder Kommentar zu den Sachfragen im ersten Teil gelesen werden. In beiden Teilen wurde eine Selektion vorgenommen, die teils auf persönlichen Interessen, teils auf der paradigmatischen Ausrichtung phänomenologischer Forschung, teils auf einer historisch-geographischen Ausgangslage beruht. Bislang stellt sich im postkommunistischen Osteuropa vieles anders dar als bei uns im Westen, wo wir mit den Folgen eines technologisch aufgerüsteten Neokapitalismus zu kämpfen haben und die prononcierte ›soziale Frage‹ sich in eine Fülle sozialer Fragen aufsplittert. Hinzu kommt die Heterogenität der Kulturen. Jemand, der aus dem fernen Osten oder aus Afrika kommt, sagt anders ›ich‹ oder ›wir‹, was nicht heißt, daß er es ganz anders sagt. Hier deutet sich eine interkulturelle Vielfalt an, die wir nur streifen werden; sie läßt sich nur kooperativ bearbeiten und niemals global bewältigen. Jedenfalls macht die Alterität und die plurale Singularität auch vor fremden Kulturen nicht halt.
*
Teilweise gehen die Einzelkapitel dieses Bandes auf Vortragstexte zurück, die bereits in einer Erstfassung veröffentlicht, aber in der Regel überarbeitet wurden. – Prolog: Vortrag zum 20jährigen Bestehen der Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA), Dortmund 2013, unveröffentlicht. – Kapitel 7: Veröffentlicht in dem Tagungsband: J.Achilles u.a. (Hg.), Liminale Anthropologien, Würzburg: Königshausen & Neumann 2012. – Kapitel 10: Veröffentlicht in: S.Stoller, G. Unterthurner (Hg.), Entgrenzungen der Phänomenologie und Hermeneutik. FS für Helmuth Vetter, Nordhausen: Traugott Bautz 2012. – Kapitel 11: Veröffentlicht in: M.Staudigl (Hg.), Alfred Schütz und die Hermeneutik, Konstanz: UVK 2010. – Kapitel 12: Veröffentlicht in: Philosophische Rundschau 45 (1998), S.97-112. – Kapitel 14: Veröffentlicht in: H.Wolf (Hg.), Das Imaginäre im Sozialen. Zur Sozialtheorie von Cornelius Castoriadis, Göttingen: Wallstein 2012. – Kap. 15: Veröffentlicht in: P.Gehring, A.Gelhard (Hg.), Parrhesia. Foucault und der Mut zur Wahrheit, Zürich: diaphanes 2012. – Epilog: Tagung zur gegenwärtigen Lage Europas, Ljubljana 2008. Veröffentlicht in: Phainomena (Ljubljana) 68-69 (2009).
München, Juni 2014
Prolog: Homo respondens
Der Mensch ist ein Wesen, das sich selbst in Frage stellt. Die Frage »Wer bin ich?« läßt sich ebensowenig überspringen wie das »hier« und »jetzt« dieser Rede. Eine Anthropologie, die jeden Rest von Egologie zu tilgen versucht, erstarrt zwangsläufig in einer Ideologie, die uns über die Herkunft der Ideen im Dunklen läßt. Da aber jede Rede sich implizit oder explizit an jemanden richtet, verdoppelt sich die Frage »Wer bin ich?« durch die Frage »Wer bist du?«. Dies alles hat nichts zu tun mit einer narzißtischen Selbstverliebtheit des Menschen, sondern es rührt daher, daß jede Frage, auch die Frage nach dem Menschen, einen Ort hat, von dem aus sie sich stellt. Fragen fallen nicht vom Himmel.
Der vielgestaltige Mensch
Die Selbstbefragung bringt es mit sich, daß der Mensch in verschiedenen Rollen und mit nicht enden wollenden Epitheta auftritt. Seit Linné hat er als homo sapiens seinen Platz im Stammbaum der Natur: ein einsichtiges Wesen, das körperlich als homo erectus herausragt und das dem Clair-obscur von Menschenaffen und Affenmenschen entsteigt. Als homo faber zeichnet er sich aus durch kunstfertiges Geschick und durch den Gebrauch von Bronze oder Stein, als homo laborans geht er mühevoller Arbeit nach, als homo ludens erprobt er seine spielerischen Kräfte, als homo pictor setzt er sich und seine Welt in Bilder um, beginnend mit frühen Höhlenzeichnungen. Die evolutionäre Vielfalt des Menschen begegnet uns als einzigartiges Zusammenspiel von Wort und Geste in der meisterlichen Darstellung des Paläoontologen André Leroi-Gourhan, und sie erweist sich als kulturelle Schubkraft in den neueren Forschungen von Michael Tomasello. Hinzu kommen Konstrukte wie der homo oeconomicus und Retortenprodukte wie der homunculus. Nun also ein weiterer – homo respondens? Der Mensch als antwortendes Wesen erinnert gewiß an die alte aristotelische Definition des Menschen als eines Lebewesens, das einen Logos hat und das mit anderen in einer Polis lebt. Doch mit der Antwort setzen wir einen eigenen Akzent. Wenn jedes Wort der Sprache laut Michail Bachtin ein »halbfremdes Wort« ist, so gilt dies in besonderem Maße für die Antwort. Die Stimme des Antwortenden ist eine pro-vozierte Stimme, sie wird von einer fernen Stimme hervorgerufen; man antwortet auf etwas oder auf jemanden. Das Worauf der Antwort ist nicht zu verwechseln mit dem Worüber einer Aussage, die ich selbst mache, oder mit dem Wozu einer Entscheidung, die ich selbst fälle. Antworten gehen nicht von mir selbst aus. Der Mensch, der in der Antwort zutage tritt, stellt sich quer zu geläufigen Definitionen. Er ist weder ein bloßes »Mängelwesen«, das Fehlendes zu kompensieren hat, noch ragt er hervor als »Krone der Schöpfung«, noch wohnt er »in der Mitte der Welt«. Vielmehr erweist er sich als ein »Zwischenwesen«, das Brücken schlägt und das als »nicht festgestelltes Tier« mit seiner Ortssuche sich und die Welt in Unruhe versetzt.
Das Rätsel der Sphinx
Die Ortssuche des Menschen spiegelt sich wider in mannigfachen Ursprungsgeschichten. Darunter findet sich eine alte Rätselgeschichte aus der griechischen Antike, die den mythologischen Hintergrund der Ödipus-Tragödie bildet. Diese Geschichte beginnt nicht als dramatische Handlung, sie erwächst aus einem Pathos. Die Stadt Theben, die von der Pest heimgesucht wird, leidet unter den Schrecken der Sphinx. Dieses geflügelte Ungeheuer, dieser verkörperte Nicht-Mensch, sucht sich seine menschlichen Opfer, indem es ihnen eine Rätselfrage stellt: »Wer ist das Wesen, das erst auf vier, dann auf zwei, schließlich auf drei Füßen über die Erde schreitet?« Jeder, der die Antwort schuldig bleibt, wird von dem Ungeheuer verschlungen. Ödipus, der nach seiner Geburt vom Vater ausgesetzt wurde und den sein Name ›Schwellfuß‹ als jemanden verrät, dessen eigener Schritt gehemmt ist, rettet die Stadt. Er löst das Rätsel, indem er mit dem Aussprechen des Namens ›Mensch‹ den Bann bricht: »Vom Menschen sprichst du – ἄνθρωπον κατέλεξας…« Der Wortlaut der Lösung läßt die Vorzüge von Logos und Polis verblassen, indem er den Menschen als sterbliches, alterndes Wesen darstellt, dessen Leben mit der Hilflosigkeit des Kindes beginnt und in der Hinfälligkeit des Alters endet. »Allbewandert. Unbewandert zu nichts kommt er. Der Toten künftigen Ort nur zu fliehen weiß er nicht.« So der von Hölderlin übertragene Passus aus dem Chorlied der Antigone (v. 360-363), in dem das »Ungeheure« des Menschen beschworen wird. Doch die Rätselszene erschließt noch einiges mehr. Wir verfehlen ihre Lektion, wenn wir Ödipus zum Forscherheld erheben oder umgekehrt das Rätsel der Sphinx einer Quizfrage annähern. Wie der Prolog von König Ödipus (v. 38) kundtut, kam Ödipus nicht ohne »Beihilfe eines Gottes – προσθήκῃ θεοῦ« auf die rechte Lösung. Und die Frage selbst entpuppt sich, wie oft im Märchen, als eine Frage auf Leben und Tod, deren Beantwortung mehr verlangt als bloßen Scharfsinn. Der Fortgang der Tragödie zeigt, in welche Abgründe aus Vatermord und Inzest Ödipus mit seinem unermüdlichen Forschungsdrang hineintreibt. Wieviel Freuds Abstieg ad inferos der intensiven Lektüre der griechischen Tragödie verdankt, ist bekannt.
Wir neigen dazu, solch alte Texte zu entschärfen. Stammen sie nicht aus prämodernen Zeiten mangelnder Selbstbestimmung, in denen noch Götter und Fabelwesen unser Geschick bestimmten? Zeichnet sich der emanzipierte Mensch nicht dadurch aus, daß er selbst Fragen stellt, anstatt auf fremde Fragen zu antworten? Wenn schon Antike, dann scheint sich Prometheus eher als Erzvater der Menschheit anzubieten. In der zweiten Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft preist Kant moderne Naturforscher wie Galilei und Torricelli: »Sie begriffen, daß die Vernunft […] die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse […].« Freiheit, die den Menschen als Vernunftwesen auszeichnet, bedeutet dann, bei sich selbst zu beginnen. Das Selbst ist großgeschrieben in Form einer moralischen und politischen Autonomie und inzwischen auch in der systemischen Form einer Autopoiesis. Wer einem Heteron das Wort redet, scheint in den Zustand unmündiger Abhängigkeit zurückzukehren und sich gleichsam wieder auf allen vieren zu bewegen, anstatt aufrecht voranzuschreiten. Doch nicht minder gewiß ist inzwischen, daß die forcierte Modernisierung ihre Schattenseiten offenbart bis hin zu dem Punkt, an dem der Mensch sich von seinen eigenen Erfolgen überrannt fühlt. Den Griechen, die in den Statuen des Dädalus den Einsatz automatischer Werkzeuge vorausdachten, diente der Sturz des Ikarus als frühe Warnung. Angesichts eines angeschlagenen »Projekts der Moderne« ist die Versuchung groß, auf die Gegenbahn einer Antimoderne überzuwechseln; auch die Geschichte hat ihre Geisterfahrer. Doch bloße Kehrtwendungen wie Restauration statt Revolution, Konservierung statt Innovation haben noch nie gefruchtet. Die Responsivität, um die es uns geht, bedeutet keinen Umschlag ins Gegenteil, sondern eine Umgewichtung, die keine Aufkündigung, sondern eine Verfremdung der Moderne nach sich zieht. Der antwortende Mensch gebärdet sich weder als Herr der Dinge noch als deren Spielball. Dies zeigt sich, wenn wir die Grundzüge einer responsiven Phänomenologie ins Auge fassen. Sie zielt nicht darauf ab, das Rätsel der Sphinx zu lösen, sondern darauf, der Erfahrung ihre Rätselhaftigkeit zurückzugeben.
Technisch normierte, normale und kreative Antworten
Doch um welche Art von Antwort handelt es sich beim Homo respondens? Das Antworten genießt üblicherweise kein großes Ansehen. Es scheint einzig dazu da, eigene und fremde Wissenslücken zu schließen, die bereits einen Wissensrahmen voraussetzen. Die rechte Antwort wäre herauszufinden; zu erfinden bliebe nicht viel. Das Multiple-choice läßt keine große Wahl. Steht ein Antwortrepertoire zur Verfügung, so kann man die Antwort abrufen; bei hinreichender Formatierung genügt ein Antwortapparat. Ein Computerprogramm kann selbst therapeutische Diagnosen erstellen und Ratschläge erteilen. Vorausgesetzt ist allerdings, daß die Patienten mit ihren Beschwerden den Spielraum der Regelung nicht überschreiten und sich an die normierten Formate und Formulare halten. Abgesehen von technisch präparierten Antworten gibt es normale Antworten, die zu unserem Alltag gehören; sie sind nützlich und unentbehrlich als Gesprächskitt, aber sie leben von den Beständen unserer Alltagspraxis, die lediglich umgesetzt und in der Arbeitswelt erprobt werden. Für den Alltag der Institutionen, also auch für den Forschungsalltag der Normalwissenschaften, gilt ähnliches. Antworten sinken schließlich herab zu bloßen Reaktionen, wenn sie, getreu dem behavioristischen Schema von Stimulus und Response, als Effekt eines Stimulus definiert und entsprechend konditioniert werden. Daran ändert sich nichts Grundlegendes, wenn das lineare Modell durch einen Regelkreis ersetzt wird und die gegebenen Antworten selbst rückwirkend stimulieren wie beim Thermostat. Ernst wird es erst, wenn der normale Ablauf gestört wird und wenn Antwortgewohnheiten und Antwortprogramme versagen. In solchen Fällen sind kreative Antworten verlangt, die Neuartiges ins Spiel bringen. Dann aber stellt sich die Frage, wie denn eine Antwort als Antwort kreativ und eine Kreation als Kreation responsiv sein kann.
Responsivität als Grundzug des Verhaltens
Wenn hier von Responsivität die Rede ist, so bezieht sich diese nicht auf spezielle Verhaltensweisen wie etwa das Erteilen einer Auskunft oder die Beantwortung einer Prüfungsfrage, sondern auf einen Grundzug, der unser gesamtes leibliches Verhalten prägt und dabei eine Findigkeit des Körpers in Anspruch nimmt. Das Hinsehen, Hinhören, Phantasieren, Lächeln oder Fühlen ist davon ebenso betroffen wie das Reden, Tun, Machen oder Herstellen. Antworten bedeutet, daß wir auf Fremdes eingehen, das sich nicht mit den vorhandenen Mitteln des Eigenen und Gemeinsamen bewältigen läßt.
Ich selbst habe den Ausdruck Responsivität der Sprache der Medizin, genauer: der Redeweise der Virchow-Schule entlehnt. Der deutsch-jüdische Neurophysiologe Kurt Goldstein versteht unter Responsivität die Fähigkeit des Organismus beziehungsweise eines Individuums, adäquat auf Anforderungen eines Milieus zu antworten, und als Irresponsivität bezeichnet er die krankhafte Beeinträchtigung dieser Fähigkeit. Goldstein, der in Frankfurt in den Zwischenkriegsjahren bis zu seiner erzwungenen Emigration ein Rehabilitationszentrum leitete, untersuchte mit seinen Mitarbeitern über Jahre hin, wie bei dem Patienten Schneider eine durch einen Granatsplitter verursachte Hirnverletzung in der optischen Zone die Responsivität des Gesamtverhaltens beeinträchtigte, und gleichzeitig erprobte er Wege einer responsiven Therapie. Sein 1934 in den Niederlanden erschienenes Werk Der Aufbau des Organismus erscheint 2014 zum erstenmal im Herkunftsland des Autors. Spuren davon finden sich in den Krankengeschichten von Oliver Sacks. Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte führt an die pathologischen Ränder eines ungesicherten Menschseins.
Die Antwortfähigkeit, die von der Verantwortlichkeit des Handelns wohl zu unterscheiden ist, hat längst in die Sozialpraktiken Eingang gefunden. Doch die üblichen Handlungs- und Sprachtheorien begnügen sich zumeist damit, Zielsetzungen, Regelungen und pragmatische Umstände zu überprüfen, ohne die Frage zu stellen, worauf jemand antwortet, wenn er dieses oder jenes sagt oder tut. Doch erst mit dieser Frage betreten wir das Gebiet, das Kant als das »fruchtbare Bathos der Erfahrung« bezeichnet. Wer sich vorschnell auf die Ebene des Urteilens und Entscheidens begibt, tut so, als würde sich das Leben in einem imaginären Gerichtssaal abspielen. Die Kreativität des antwortenden Menschen kommt in einer solchen Orthologie und Orthopraxie zu kurz.
Pathos…
Damit kommen wir zum Kern unserer Überlegungen. Die Responsivität, die den Gang unserer Erfahrung bestimmt, präsentiert sich als ein Doppelereignis aus Pathos und Response. Unter dem griechischen Ausdruck Pathos oder dem deutschen Ausdruck Widerfahrnis verstehe ich die Urtatsache, daß uns etwas zustößt, zufällt, auffällt oder einfällt, daß uns etwas trifft, glückt und auch verletzt wie das touché aus dem Fechtkampf. Überraschendes und Ungewöhnliches kann aus minimalen Veränderungen hervorgehen, die eine Tiefenwirkung entfalten. Sie äußern sich sinnkräftig in der Form eines plötzlichen Aufblitzens, eines explosiven Knalls oder einer Erschütterung. Sie können in nächster Nähe auftreten oder in weiter Ferne wie das Aufleuchten eines neuen Sterns oder der mühsam errechnete Urknall des Universums. Die Veränderung kann von Worten und Gedanken ausgehen, wie sie Nietzsche vorschwebten: »Die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.« Unsere persönliche Geschichte ist skandiert von einmaligen Ereignissen wie Geburt und Reife, Partnerwahl und Partnerverlust, Berufseintritt, Berufswechsel und Stellenverlust, Krankheit und Tod. Die öffentliche Geschichte wäre ein unendliches Gewimmel von Tatsachen und Zuständen ohne epochale Umbrüche wie Renaissance, Reformation oder Revolution, ohne einbrechende Ereignisse wie Kriegsausbruch, Börsenkrach oder Naturkatastrophe, ohne technische Neuerungen wie die Einführung des Internets oder künstlerische Neuanfänge wie die Erfindung der Zentralperspektive, die impressionistische Entfesselung der Farbe oder der Übergang zur atonalen Musik. Manche Ereignisse tragen feste Orts- und Zeitdaten: New York am 11. September 2001 oder Fukushima am 11. März 2011, während andere Änderungen sich allmählich anbahnen, bevor sie an die Oberfläche treten. Ähnlich wie es akute und chronische Erkrankungen gibt, gibt es akute und chronische Szenenwechsel. In allen Fällen handelt es sich um starke Formen der Erfahrung, in denen sich nicht nur etwas in der Welt und in unserem Leben ändert, sondern die Welt und das Leben sich im ganzen umstrukturiert oder aus den Fugen gerät.
Das Einbrechen oder Einsickern des Neuen konfrontiert uns mit Ereignissen, die vom Gewohnten abweichen und uns im äußersten Fall aus der Fassung bringen. Doch hinter der Vielfalt der Ereignisse, die sich darin andeutet, steckt eine Ereignisstruktur besonderer Art. Pathos oder Widerfahrnis sind nicht zu verwechseln mit beobachtbaren Events, sie erschließen sich nur aus der Teilnehmerperspektive. Was mir, dir, uns oder anderen zustößt, äußert sich in einer leibhaftigen Wirkung, indem es uns affiziert, wörtlich: antut oder anmacht, und indem es an uns appelliert, uns anspricht. Starke Wirkungen produzieren im Erstaunen, Erschrecken oder Befremden einen affektiven Überschuß. Platon läßt die Philosophie mit einem Staunen beginnen, das uns schwindeln läßt und dem Schrecken benachbart ist. Mit einer solchen Initiation überqueren wir eine Fremdheitsschwelle. Das Staunen beginnt nicht im Eigenen wie der methodische Zweifel bei Descartes, noch läßt es sich lernen. »Ein Gedanke kommt, wenn ›er‹ will, nicht wenn ›ich‹ will«, wie Nietzsche uns einschärft. Was uns auffällt und einfällt, haben wir nie völlig in der Hand. Grammatisch betrachtet lassen sich Verben wie ›widerfahren‹, ›auffallen‹ oder ›einfallen‹ nicht im Aktiv verwenden; sie sind nicht als Akte zu verstehen, die wir uns als eigene Leistung zurechnen. Darin gleichen sie den Prozessen des Aufwachens und Einschlafens, die im »dogmatischen Schlummer« oder in der »religiösen Erweckung« ihre metaphorische Wirkung entfalten. Die Aktionsgelüste eines Subjekts werden also gedämpft, doch dies ist kein Grund, Hals über Kopf in einen Lebensstrom einzutauchen. An jedem Widerfahrnis ist durchaus jemand beteiligt, nur eben nicht im Nominativ des Autors, sondern im Dativ oder Akkusativ eines im weiteren Sinne zu verstehenden Patienten: »Mir stößt etwas zu«, »Mich hat etwas getroffen«. Ein Widerfahrnis ohne jemanden, dem etwas zustößt, wäre wie ein Schmerz ohne jemanden, der ihn verspürt. Wir sind durchaus beteiligt, nur eben nicht als selbstherrliche Subjekte.
… und Response
Doch dies ist nur die eine Seite der Medaille. Das Widerfahrnis bliebe wirkungslos und unwirklich, käme es nicht zum Ausdruck oder zur Sprache. Kommt es zum Ausdruck, so nicht als etwas, worüber wir sprechen, sondern als etwas, worauf wir antworten. In dieser winzigen Differenz entfaltet sich der Antwortcharakter der Response. Antworten heißt vom Fremden her sprechen. Damit verwandle ich mich vom Patienten in einen Respondenten, der auf das antwortet, was ihm widerfährt. Das eigene Selbst ist ein geteiltes Selbst. Die Rede von einem Homo respondens bedeutet nicht bloß, daß der Mensch ein Wesen ist, das antworten kann und zu antworten bereit ist, sondern daß er zum Menschen wird, indem er antwortet, so wie Ödipus zum Retter der Stadt wird, indem er das Rätsel löst. Die Antwort geht ihrer eigenen Ermöglichung voraus.
Das Antworten liegt nicht in unserem Belieben; es folgt aus einer Unausweichlichkeit, wie sie uns bereits in der Rätselfrage der Sphinx begegnet ist. Wenn uns etwas anspricht, so können wir nicht nicht antworten, so wie wir laut Paul Watzlawick nicht nicht kommunizieren können. Wir sitzen in einer Art responsiver Falle. Keine Antwort wäre auch eine Antwort, wie das Sprichwort sagt. Die Nötigung zur Antwort besagt freilich nicht, daß diese fertig vorläge. Jeder Anspruch läßt einen Spielraum. Es liegt nicht an uns, ob wir antworten, wohl aber, wie wir antworten. Bliebe unsere Erfahrung den Blitzschlägen des Augenblicks ausgesetzt, so würden wir überhaupt keine dauerhaften Erfahrungen machen. In unserem Antworten verwandelt sich das Worauf des Antwortens in das Was einer Antwort. Was uns widerfährt, nimmt eine wiederholbare Gestalt an, etwa als Farbkontrast oder als Klangfolge; es nimmt Sinn an, es bilden sich Regeln, und es entsteht eine den wechselnden Anforderungen entsprechende Antwortbereitschaft. Dieser Umwandlungsprozeß kann stocken oder mißlingen.
Goethes Ausspruch »Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide« meint mehr als die Fähigkeit, über das eigene Leiden zu sprechen; es geht darum, daß das Leiden die Schwelle des Schweigens überschreitet, daß es zur Sprache kommt, daß sich Worte finden auch für das Unsägliche. Im Lernen durch Leiden, dem sprichwörtlichen πάθει μάθος, vollzieht sich das, was in der Psychoanalyse Verarbeitung heißt. Der Umgang mit dem Leiden gehört zum Berufsalltag der Klinik. Der Arzt behandelt das Leiden des Kranken als eine Krankheit, die typische Symptome zeigt, einen typischen Verlauf nimmt, sich behandeln und heilen oder wenigstens lindern läßt. Responsiv ist die Therapie, sofern sie nicht nur einen Normalzustand wiederherstellt wie bei der Reparatur einer Maschine, sondern die Antwortfähigkeit unter veränderten Bedingungen neu entfacht und Antwortblockaden durchbricht. Auf spezielle Weise gilt dies für die therapeutische Behandlung Traumatisierter, die förmlich mundtot sind und deren Verletzung sich in die Körpersprache der Symptome flüchtet. Es geht aber auch um kollektive Antworten im großen Stil. So bedeutet die Politik, die nach der Atomkatastrophe von Fukushima in Gang gesetzt wurde, eine Antwort und keinen schlichten Neuanfang. Fällt die Antwort so aus, als sei nichts gewesen, so ist auch dies eine Antwort, allerdings keine, die einen Lernprozeß auslöst. Auch die Erinnerungsarbeit, die uns Deutschen durch die Politik des Dritten Reichs und durch die Greuel des Holocaust auferlegt wurde, hat einen responsiven Charakter. Ohne öffentliche Antwortbereitschaft hätten Gedenkstätten und Gedenkfeiern nichts weiter zu bieten als leere Wiederholungen, denen das Unwiederholbare entgleitet.
Pathos und Response sind wie zwei Glieder einer Kette, die sich nicht schließt. Eines läßt sich nicht aus dem anderen herleiten. Ein Pathos ohne Response wäre ein bloß momentaner Ausbruch, der sich im Schrei bekundet, oder es bliebe auf ewig stumm und würde über kurz oder lang vergessen. Eine Response ohne Pathos wäre eine leere Floskel oder eine bloße Pflichtübung. Kreativ ist eine Antwort, die erfindet; sie erfindet, was sie zur Antwort gibt, nicht aber das, worauf sie zu antworten hat. Darin unterscheidet sie sich sowohl von einem Fundamentalismus, der fertige Antworten vortäuscht, wie von einem Konstruktivismus, der Widerfahrnisse zu bloßen Basisdaten zurechtstutzt.
Diastase
Eine Erfahrung, die sich zwischen Pathos und Response bewegt, weist eine eigentümliche Zeitstruktur auf. Überraschende Ereignisse haben es an sich, daß sie zu früh kommen, gemessen an unseren Erwartungen; sonst wären sie nicht überraschend. Nur normale Ereignisse, die unseren Erwartungen und Planungen entsprechen, kommen mehr oder weniger rechtzeitig, mögliche Verspätungen wie im Reiseverkehr eingeschlossen. Solche Verspätungen lassen sich korrigieren, doch für Überraschungen gilt dies nicht. Wenn also das, was uns widerfährt, zu früh kommt, so kommt umgekehrt unsere Antwort zu spät, gemessen an dem, was uns in Anspruch nimmt. Die zweifache Ungleichzeitigkeit von originärer Vorgängigkeit des Pathischen und originärer Nachträglichkeit des Responsiven bezeichne ich als Zeitverschiebung oder mit einem alten griechischen Ausdruck als Diastase. Die Erfahrung tritt buchstäblich auseinander, sie zerdehnt sich. Diese eigentümliche Zeitverschiebung läßt sich nicht begreifen als Abfolge von Zeitpunkten auf einer Zeitlinie und als lineare Kausalität, als käme erst das Widerfahrnis und folgte dann die Antwort. Vielmehr geht die Erfahrung sich selbst voraus; als Antwortende sind wir von Anfang an mit im Spiel, nur eben nicht als Urheber.
Die Zeitverschiebung taucht in mancherlei Gestalt auf. Schon meine Geburt gehört einer Vorvergangenheit an, die nie als Gegenwart durchlebt wurde, und doch bin ich es, der sich als geboren vorfindet. Dies wiederholt sich überall, wo in der Geschichte Neues auftaucht, das im Alten keinen zureichenden Grund findet, wie etwa beim Ursprung der Geometrie, der Tragödie oder der Demokratie. Singuläre Stiftungsereignisse, ob politischer, religiöser oder künstlerischer Art, lassen sich nur im nachhinein als solche erfassen. Dies gilt auch für die immensen Zeiträume des Kosmos, die uns Sterne sehen lassen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, wenn wir sie im Teleskop entdecken. Nur eine Erfahrung, in der im Grunde alles beim Alten bleibt, bliebe von solchen Zeitverschiebungen verschont.
Die Nachträglichkeit unserer Antworten ist alles andere als ein bloßer Mangel. Nur weil es mit uns schon begonnen hat, wenn wir selbst beginnen, öffnet sich uns eine Zukunft, die mehr bedeutet als eine Verlängerung der eigenen Gegenwart und eine Hochrechnung von Trends. In dem Mythos von der Ausstattung des Menschen, den Platon im Dialog Protagoras erzählt, tritt das Brüderpaar Prometheus und Epimetheus auf. Prometheus, der gefeierte Held der technischen Erfindung, ist, wie sein Name andeutet, ›vorbedacht‹, im Gegensatz zu Epimetheus, der ›nachbedacht‹ ist; der eine trifft Vorsorge, der andere hat das Nachsehen. Doch der antwortende Mensch ist auf gewisse Weise Prometheus und Epimetheus in einer Person. Voraussehen und Nachsehen schieben sich ineinander wie Eigenes in Fremdes und Fremdes in Eigenes. Wenn der mündige Mensch auf zwei Füßen geht, so ist die Zweifüßigkeit doch nicht völlig synchronisiert. Der schwellfüßige Ödipus löst nicht einfach das Rätsel der Sphinx, er verkörpert es auch.
Namen
Unsere Überlegungen zur Antwortlichkeit des Menschen wären unvollständig ohne einen Blick auf die Namentlichkeit des Menschen. Dabei geht es in erster Linie nicht um Gattungsnamen, die allgemeine Eigenschaften bezeichnen, oder um Eigennamen, die der Identifizierung von Individuen dienen. Solche Namen werden vergeben wie Kenn- oder Paßwörter. Wäre dies jedoch alles, so wäre der Namensgeber Herr der Namen. Er selbst hätte gleich dem transzendentalen Subjekt eine Funktion, aber keinen Namen. Vom Namen des Menschen bliebe nur der Gattungsname mit seinen wechselnden Konnotationen, die den Status des Menschen spezifizieren. Es macht dann keinen großen Unterschied, ob man von ἄνθρωπος, von homo oder von man beziehungsweise geschlechtsneutral von human spricht.
Doch der Homo respondens, mit dem wir es zu tun haben, ist kein bloßer Namensträger, er ist ein singuläres Wesen, das seinen Namen von Anderen empfangen hat. Der Name ist Signet einer Unersetzlichkeit. Man feiert Namenstage, aber keine Begriffstage. Bevor der Name als Namensbezeichnung zur Verfügung steht, taucht er als Rufname auf, auf den der Angeredete hört und antwortet – oder eben nicht antwortet. Ein solcher Eigenname weist Züge eines Fremdnamens und einen Kern an Namenlosigkeit auf. In ihm finden sich die Spuren einer Namensgeschichte. Dies gilt für den vom Vater mit durchstochenen Fersen ausgesetzten Ödipus, von dem schon die Rede war. Besonders eindringlich zeigt es sich in den Verheißungen jüdischer Namen, wenn etwa Abraham als »Vater der vielen (Völker)« oder Isaak als »Er wird lachen« angesprochen wird. Das »Lebewesen, das Vernunft hat« ließe sich demgemäß abwandeln in ein »Lebewesen, das auf einen Namen antwortet«. Was dies für die Singularität des Menschen bedeutet, tritt deutlich zutage, sobald der Name entzogen und durch Nummern und Kennzeichen ersetzt wird wie bei KZ-Häftlingen oder verkäuflichen Sklaven. Dies führt uns in das weite Feld einer Kultur, einer Politik und einer Ethik der Namen. Auch der Gebrauch von Namen in außermenschlichen Bereichen wäre zu bedenken, von der Benennung von Haustieren und seltenen Pflanzen bis zur Benennung von Hurrikans und seltenen Sternen. Daß der Mensch auf emphatische Weise antwortet, heißt nicht, daß alles andere nur funktioniert oder gehorcht. Die Leibhaftigkeit und Weltzugehörigkeit des Menschen schließt vielmehr ein, daß der Mensch immerzu mehr oder weniger Mensch ist. Nur durch und durch normalisierte Menschen wären mit sich im reinen.
I. Analysen
1. Das Dilemma einer ungeselligen Geselligkeit
ὁ ἄνθροπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις […] πολέμου ἐπιθυμήτης ἅτε περ ἄζυξ ὢν ὥσπερ ἐν πέττοις.
Der Mensch ist ein Lebewesen, das von Natur aus in der Polis lebt, und wer ohne Polis ist […], ist kriegslüstern, da er unverbunden dasteht wie ein Stein im Brettspiel.
Aristoteles, Politik
Negari non potest, quin status hominum naturalis antequam in societatemcoiretur, bellum fuerit; neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes.
Man kann nicht leugnen, daß der natürliche Zustand der Menschen, bevorsie zur Gesellschaft zusammentraten, der Krieg gewesen ist, und zwar nichtder Krieg schlechthin, sondern der Krieg aller gegen alle.
Thomas Hobbes, De cive
1. Egologische Ausbrüche und der soziologische Zirkel
Die »ungesellige Geselligkeit«, die Kant in seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht anspricht, bringt in einer leicht altertümlichen Diktion ein Grunddilemma zum Ausdruck. Die Neigung, »sich zu vergesellschaften«, kämpft mit dem Hang, »sich zu vereinzeln« (Werke VI, 37f.). Die Art und Weise, wie dieser Widerstreit in der westlichen Kultur ausgetragen wird, beschwört eine lange Geschichte herauf, in der wir gewahren, wie Hobbes von Aristoteles abweicht, ohne ihn verleugnen zu können. Der Mensch als ein Lebewesen, das von Natur aus in einer Polis lebt, weicht einem Wesen, das sein Überleben sichert, indem es aus einem allseits bedrohlichen Naturzustand in einen bürgerlichen Zustand überwechselt. Der Staat, der aus einem künstlich herbeigeführten Vertragsschluß hervorgeht, beendet die anfängliche Ungeselligkeit, doch ohne sie in eine ungebrochene Geselligkeit verwandeln zu können. Das »krumme Holz«, aus dem der Mensch gemacht ist, wird zurechtgebogen, ohne daß die Krümmung in einen geradlinigen Wuchs übergeht. Der Umbruch, der so vor sich geht, wird von einem allmählichen Sprachwechsel begleitet. Das ›Politische‹, das in der Politeia einer mitbürgerlich verfaßten Polis verankert war, reiht sich, wenn auch in der Höchstform einer societas perfecta, unter die diversen Formen des ›Sozialen‹ ein, oder es schwillt an zu großräumigen ›Reichen‹. Doch unser Augenmerk richtet sich weniger auf diese komplizierten Wandlungsprozesse als auf die verbleibende Ungeselligkeit. Was haben wir unter Ungeselligkeit zu verstehen? Handelt es sich etwa um ein Moment des Antisozialen, unter dessen Wirkung das Soziale zerfällt und sich zersetzt, oder aber um ein Moment des Asozialen, infolge dessen sich etwas der Macht des Sozialen entzieht, ohne dieses zu verleugnen? Die zweite Möglichkeit weist voraus auf eine Phänomenologie des Fremden, die aus dem sozialen Zirkel ausbricht, ohne auf ein autarkes Ego zu rekurrieren.
Doch bevor das Soziale derart fraglich wird, begegnet es uns auf implizite Weise in Form eines stillschweigenden Einverständnisses, vergleichbar dem »stillschweigenden Vertrauen«, dem tacit trust bei Locke (vgl. Second Treatise of Government, XV, 171). Eine solch unausgesprochene und unauffällige Einigung entspricht dem, was bei Husserl »natürliche Wir-Einstellung« oder »natürliche kommunikative Einstellung« heißt (Hua VIII, 56, 59); sie läßt durchaus zu, daß wir wechselnd »asozial« in einer Privatsphäre oder eben »sozial« im aktuellen Austausch leben (Hua XV, 511). Bei Schütz setzt sich dies fort als durchgängige »Wir-Beziehung«, bei Heidegger als fundamentales »Miteinandersein«. Jeder von uns lebt auf selbstverständliche Weise mit Anderen in der Welt. Es bedarf besonderer Umstände, damit diese Selbstverständlichkeit ins Wanken gerät, und es bedarf einer methodischen Form von sozialer Epoché, um sich dieser Voraussetzung als einer Form elementarer Gemein- und Fremderfahrung bewußt zu werden. Husserl operiert wiederholt mit der Hypothese der »Verrücktheit«. Dieses Verfahren, das bei neuzeitlichen Autoren wie Descartes oder Locke lediglich einer sich selbst bestätigenden Vernunft als Folie dient, ohne daß Konsistenz und Konsens ernsthaft erschüttert werden, wird von Husserl eingesetzt, um der Kohärenz unserer persönlichen und gemeinschaftlichen Erfahrung ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen und das »Dogmatische« der natürlichen Einstellung zu durchbrechen (Hua III, §62). In Foucaults Geschichte von Vernunft und Wahnsinn setzt sich dies auf radikale Weise fort. Ohne derartige Verunsicherungen bliebe es bei einem schlichten »Wir sind Wir«, das dem »Ich bin Ich« nichts hinzufügt als einen Pluralis Societatis. Hierbei geht es nicht um einen erkenntnistheoretischen Zweifel, der zusammen mit der sogenannten Außenwelt auch die Anderen beweispflichtig machen würde. Dies wären cartesianische Nachhutgefechte. Die soziale Spielart des θαυμάζειν, nämlich das Erstaunen, aber auch das Erschrecken darüber, daß und wie es die Anderen gibt, konfrontiert uns vielmehr mit dem Rätsel des Sozialen, das in seiner untilgbaren Faktizität eine lange Geschichte diverser Lösungs- und Beschwichtigungversuche wachgerufen hat. Die Varianten der abendländischen Kultur ließen sich jederzeit durch interkulturelle Varianten ergänzen.
Es liegt uns fern, in extenso auf die Winkelzüge einer Geschichte des Sozialen und verwandt damit einer Geschichte des Politischen einzugehen, an deren langfristiger Erforschung so viele Disziplinen beteiligt sind. Wir werden nur einige Nahtstellen herausheben, an denen das eingangs erwähnte Dilemma besonders deutlich hervortritt.
Versetzen wir uns also in die Umbruchzeit der beginnenden Moderne. In der Aufkündigung von Voraussetzungen, die einer langen Vorgeschichte angehören, rebelliert die Moderne gegen eine natur- oder gottgegebene Geselligkeit. Philosophisch findet dieser Aufstand seinen prägnanten Ausdruck bei Descartes und Hobbes, und dies vor dem Hintergrund einer sich neu formierenden Gesellschaft. Beide Protagonisten setzen auf eine präsoziale Instanz, die sich selbst als Ego bezeichnet und allen anderen Egos ihren epistemischen beziehungsweise praktischen Rang abkauft. Ich denke, also bin ich. Dieses auf Selbstgewißheit drängende Denken rückt alle Mitbewerber auf den Platz eines alter ego, das sich vor mir auszuweisen hat, vergleichbar einem Fremden, der ins eigene Land eindringt. Daß die Anderen ebenfalls so denken, hilft ihnen nicht weiter, da sie als meine Anderen auf einen Paß angewiesen sind, den nur ich ihnen ausstellen kann. Auch der göttliche Denker verschafft mir keinen direkten sozialen Kontakt, da sich in ihm lediglich das eigene Ich ins Unendliche steigert, es sei denn, das Unendliche wird, wie bei Levinas, als ein un-endliches Durchbrechen der Endlichkeit verstanden. Die praktische Variante liefert Hobbes. Ich suche mich mit allen Mitteln am Leben zu erhalten. Da alle anderen dem gleichen bedingungslosen Selbsterhaltungstrieb unterliegen, nehmen sie die Position eines feindlichen Gegen-Ichs ein, von dem eine permanente Bedrohung ausgeht. Die Konfrontation mit dem Gegen-Ich erreicht eine höheren Grad der Gefährdung als die denkende Bezugnahme auf ein anderes Ich, das ungeachtet aller kriegerischen Umstände, die Descartes’ frühen Diskurs begleiten, friedlich vor seinem Kammerfenster vorbeispaziert; sie löst eine Angst aus, die das eigene Ich in seiner Existenz erschüttert. Das Miteinander gewinnt scharfe Konturen in Form eines unerbittlichen Gegeneinanders. In seiner Autobiographie, in der Hobbes auf kriegerische Umstände seiner Frühgeburt Bezug nimmt, aber darin paradigmatische Züge aufdeckt, sieht er sich als Zwilling der Angst: Die Mutter gebar zugleich »Mich und die Angst – Me and Fear«. Wie in einem späteren Kapitel zu zeigen ist, bleibt Freud auf diesen Spuren, indem er das Ich als »Urstätte der Angst« ansetzt. Die doppelte Zentrierung auf das eigene Ego findet ihre Stütze in privatem Eigentum und Besitz, und sie tendiert hin zu einem extremen Besitzstreben, in dem Besitzen und Besessensein sich verquicken: Ich bin, was ich habe. Die Anderen rücken ein in die Rolle von Konkurrenten, die Dinge reduzieren sich auf etwas, über das wir verfügen. Wie wenig selbstverständlich diese Tendenz ist, zeigt die Sprache, die in weitaus den meisten Fällen das ›etwas haben‹ durch Wendungen wiedergibt, die im Deutschen einem ›jemandem ist‹ oder ›bei jemandem ist‹ entsprechen.[1] Die strikte Trennung von Sein und Haben, die in den phänomenologischen Analysen von Günther Anders, Gabriel Marcel und Jean-Paul Sartre eine zentrale Rolle spielt, ist ebenfalls ein neuzeitliches Erbe, das die Mitwirkung der Dinge auf ein Minimum herabsetzt.
Die beiden neuzeitlichen Protagonisten lösen mit ihren extremen Positionen eine Kette von Hilfsmaßnahmen aus, darunter einerseits die Empathie, mit der einer sich in das Seelenleben des Anderen hineinfühlt und hineinversetzt, andererseits der Kontrakt, mit dem der Einzelne seinen Willen an den fremden Willen bindet.[2]Desungeachtet ist einzuräumen, daß die Übersteigerung des Ich erheblich zur Entdeckung der Alterität beigetragen hat. Dafür spricht die Tatsache, daß weder das Ich als Ich-Instanz noch der Andere als fremder oder fremde Andere im herkömmlichen griechischen Denken eine prononcierte Rolle spielt. Das Ich bleibt ein schwaches Ich; selten tritt es, mit einem Artikel versehen, als ›das Ich‹ auf, hervorgehend aus einer Substantivierung, die Schopenhauer der idealistischen Ich-Lehre als eine Art intellektuellen Sündenfall ankreidet.[3] Bei den Griechen bleibt das Ich-Sagen der praktischen Philosophie vorbehalten; es findet seinen Platz in den Rede- und Anredeformen der dialogischen, rhetorischen, erotischen, pädagogischen und therapeutischen Praxis. Es ist nicht Sache der Ersten Philosophie, die es mit dem Was, Warum und Wozu aller Dinge zu tun hat, nicht aber mit der selbstbezüglichen Frage »Wer bin ich?« oder der fremdbezüglichen Frage »Wer bist du?«. Mit den neuzeitlichen Ausbruchversuchen des Ich wurde insofern ein Durchbruch erzielt. Was die geläufige Darstellung der Ichzentrierung betrifft, so ist sie nicht frei von Konstrukten und Hypothesen; bei Descartes wie bei Hobbes finden sich Gegenmotive, die den schroffen Gegensatz von Geselligem und Ungeselligem abmildern. Doch Dilemmata hebt man nicht auf, indem man die Reibeflächen glättet.
Der Gegenschlag gegen die egologischen Exzesse läßt nicht auf sich warten. Er weitet sich aus zu einer förmlichen Kampagne, die einen genuinen Logos der sozialen Welt teils neu entdeckt, teils wiederentdeckt. Das soziologische Denken, das sich am Ende als eigene Disziplin etabliert, speist sich in weitem Maße aus Reaktionen auf eine Egozentrik, die dazu führt, daß sich, mit Norbert Elias zu reden, eine »Gesellschaft von Individuen« etabliert. Doch die antiindividualistischen Reaktionen tendieren hin zu einer gegenläufigen Soziozentrik, wenn die Ich-Wir-Balance sich in die andere Richtung verschiebt und der Primat eines Ich, das dem Wir vorausgeht, dem Primat eines Wir weicht, das dem Ich vorausgeht.
Der springende Punkt liegt in der Konstitution des Sozialen. Diese findet im okzidentalen Sprachbereich ihren Ausdruck in schlichten Präfixen und Präpositionen wie mit, syn, cum/co. Das Präfix ›syn‹ ist jedoch doppeldeutig. In einem Falle geht es primär darum, daß etwas zusammen mit anderem als Teileines einheitlichen Ganzen vorkommt. In Wortbildungen wie ›Synthese‹, ›Synopse‹, ›Synergie‹ oder ›Symbol‹ entspringt das ›zusammen mit‹ Akten der Zusammensetzung, der Zusammenschau, des Zusammenwirkens oder Zusammentreffens, die auf Einheit oder Ganzheit abzielen. Niemand wird bei der Synthesis a priori oder bei der Synopse der Evangelien an Gemeinschaftsbildung denken. Ganz anders steht es mit Ausdrücken wie ›Mitsein‹ (συνεῖναι), ›Mitleben‹ (συζῆν) und ›Zusammenleben‹ (συμβίωσις), die uns noch oft begegnen werden. Hier geht es primär darum, daß jemand sein eigenes Selbst dem Zusammensein mit Anderen und der Zugehörigkeitzu einer Gruppe oder umgekehrt der Trennung und der Nicht-Zugehörigkeit verdankt. Noch das ›ohne‹ hält einen Platz frei für das ›mit‹, das im englischen with-out hörbar mit anklingt. Dieses ›mit‹ ist nicht primär partitiv, sondern kompositiv, nicht primär zyklisch, sondern seriell zu verstehen. Man kann zur Klärung auch den vielerörterten Kontrast von Redefiguren wie Metapher und Metonymie, Symbol und Allegorie heranziehen, von denen die erste das Verbindende und Ähnliche, die zweite das anderweitig Hinzukommende betont. Die Vermengung beider Aspekte könnte für die Neigung zu einer holistischen und organizistischen Auffassung von Gemeinschaft und ebenso für die Exzesse einer sozialen Mengenlehre mitverantwortlich sein.
Das kompositive Mit entfaltet seine Bindekraft in allen nur möglichen Richtungen und Formen. Die Bindung kann eine feste und enge oder eine gelockerte Form annehmen. In der negativen Form des ›nicht ohne‹ (ἄνευ οὗ οὐκ, sine qua non) streift sie alles Überschüssige ab zugunsten des Unerläßlichen. Eines kann nicht bestehen oder geschehen, ohne daß zugleich etwas anderes besteht oder geschieht; die Verbundenheit nimmt die Form einer Abhängigkeit an, die als Notwendigkeit eine Not abwendet und als Notgemeinschaft nicht um ihrer selbst willen erstrebt wird. Die Angabe notwendiger Bedingungen läßt offen, wozu etwas unentbehrlich ist. In den bloß ›mitvorkommenden‹ Akzidenzien (συμβηβηκότα) oder den bloß ›mitvorfallenden‹ Symptomen (συμπτώματα) hat die Bindung dagegen etwas Beiläufiges, wenn nicht gar Beliebiges. Die normale soziale Bindung liegt dazwischen. Sie prägt den engeren Kreis von Mitgliedern einer Familie und einer Sippschaft, den weiteren Kreis von Nachbarn, Mitbürgern und Mitbewohnern, von Gemeinden, Vereinen und Verbänden. Im Mitfühlen, Mitleiden, Mittun, Mitreden, Mitdenken oder Mitspielen öffnen sich Horizonte, die unsere Mitwelt, unser Mitleben und Mitsein bestimmen. Das alte Vokabular der Geselligkeit lebt fort in der Rede von Genossen,[4] von Zeitgenossen, Volksgenossen, Parteigenossen, Genossenschaften, Tischgesellschaften und in der dubiosen Form von Spießgesellen oder in der weniger verdächtigen Form der Kameradschaft. Sprache, Sitte, Verkehrsformen, Besitztümer und leibliche Kontakte haben daran ebenso ihren Anteil wie die Vielfalt soziokultureller Praktiken und die von Land zu Land wechselnden Ideologien, darunter die »deutsche Ideologie« als eine Ideologie von besonders verfänglicher Art. Im umfassenden Sinne spricht man von κοινωνία, von communitas und societas, von communauté und société, von community und society, von maatschapij und im Deutschen, allerdings erst seit Beginn des 19.Jahrhunderts, von Gemeinschaft im Gegensatz zur Gesellschaft. Entscheidend ist letzten Endes, daß wir es mit einer sozialen Gemeinsphäre zu tun haben, die als durchgängiges Beziehungsgeschehen, Beziehungsgefüge oder Beziehungsnetz vor niemandem und nichts haltmacht. Wer sich von diesen Bezügen freizumachen und einen extrasozialen Ort einzunehmen sucht, wird von ihnen eingeholt, sobald er sich nur äußert. So wie das Schweigen die Sprache unterfüttert und unterbricht, sie aber nicht verläßt, so scheint es ähnlich mit Randphänomenen wie Einsamkeit, Vereinzelung, Außenseitertum oder Rebellion zu stehen. Sie führen über die Grenzen der bestehenden Gemeinschaft oder Gesellschaft hinaus, aber es bleibt fraglich, ob sie die Grenzen der Geselligkeit schlechthin zu überschreiten vermögen. Solche Überschreitungen würden voraussetzen, daß die Gesellschaft nicht »alles ist« wie einst die aristotelische Seele, in der sich alles Seiende spiegelt, doch was sollte es außer ihr geben, das ihr gar nichts verdankt? Es zeichnet sich ein sozialer Zirkel ab, in dem wir uns ebenso unwillkürlich bewegen wie in dem bekannten hermeneutischen Zirkel; mehr noch, der soziale Zirkel, der uns mit Anderen zusammenschließt, und der hermeneutische Zirkel, der all unser Erleben und Verhalten in Sinnzusammenhänge einbettet, scheinen einander zu verstärken. Ein solcher Zirkel hat nichts mit der petitio principii eines Zirkelschlusses zu tun, wohl aber mit einer petitio totius, eines Vorgriffs auf das Ganze. Ausgeschlossen wäre im Falle des Sozialen einzig das Asoziale im Sinne des Antisozialen, das ähnlich wie das geläufige Alogische, Irrationale oder Sinnlose eine bloße Privation darstellt. Von dieser privatio boni communis würde die bestehende Ordnung gefährdet, aber sie würde nicht von innen her aufgesprengt.
2. Die soziale Ordnung und das soziale Band
Jede soziale Gruppierung hat es mit einer Mehrzahl von Mitgliedern zu tun. Dies gilt selbst für den Grenzfall eines Einsiedlers, der nicht umhinkann, mit sich selbst Zwiesprache zu halten, indem er sich der Fremdheit der eigenen Stimme aussetzt, ganz zu schweigen von der Zudringlichkeit aller möglichen Dämonen. Im Gesang von Goethes Harfenspieler klingt die Verlustseite an: »Wer sich der Einsamkeit ergibt, ach, der ist bald allein.« Doch das Einsamkeitsgefühl ist nicht gebunden an das Alleinsein, es stellt die Gemeinsamkeit auf die Probe. Wie Scheler bemerkt, tritt es häufig gerade in der Gesellschaft oder in Gemeinschaftsbeziehungen auf. »Denn erst hier wird die absolute Grenze der Selbstmitteilbarkeit der Person an eine andere am eindringlichsten ermessen.« (FO 549) Maurice Blanchot geht einen Schritt weiter, indem er die Einsamkeit von innen her aufsprengt: »Es gibt keine Einsamkeit, wenn diese nicht die Einsamkeit auflöst, um den Einsamen dem vielfältigen Draußen auszusetzen.« (2005, S.14)
Was nun die soziale Vielfalt angeht, so findet sie ihren Zusammenhalt in einer sozialen Ordnung, die inmitten der Vielfalt heterogener Eigenheiten für Einheit und inmitten der Vielheit divergierender Bestrebungen für Einigkeit sorgt. Grundlegend für jedes strukturierte Gemeinwesen, das über eine zufällige Ansammlung von Individuen hinausgeht, sind zwei Ordnungsgesten, die den beiden Grundformen der aristotelischen Gerechtigkeit entsprechen. Einerseits geht es um eine Verteilung von Aufgaben, Anrechten und Lebenschancen und andererseits um einen Ausgleich, falls die Verteilungsordnung gestört oder verletzt ist. Was daraus resultiert, heißt traditionell ὁμόνοια, concordia oder Eintracht. Anders als in der stets drohenden Zwietracht ist man eines Herzens oder eines Sinnes, selbst wenn man nicht einer Meinung ist. Entscheidend ist indessen die Frage, worauf diese Gemeinsamkeit beruht und wodurch die jeweilige Gemeinschaft oder Gesellschaft zusammengehalten wird. Es ist die alte und neue Frage nach einem sozialen Band, das zusammenfügt, was zusammengehört. Bedeutet Zusammenfügen ein Zusammenwachsen oder ein Zusammensetzen?
Um das Phänomen einer sozialen Zusammenbindung zu verdeutlichen, benutzt Platon in speziellen Zusammenhängen den Ausdruck συνδεσμός, der in der griechischen Grammatik das Bindewort, die Konjunktion bezeichnet.[5] In der Politeia geht es um das »Band der Polis (τὸν σύνδεσμον πόλεως)«, um das sich der Philosoph zu kümmern hat (520 a), und im Symposion ist es der Eros, der nicht nur in der liebenden Verschmelzung[6] aus zweien eins macht (192 e), sondern dafür sorgt, daß das »All selbst in sich selbst zusammengebunden ist (συδεδέσθαι)« (202 e). In der politischen Webkunst des Politikos (308 c-310 b) nimmt die Bindung (σύνδεσμος), die sich göttliche und menschliche Bänder (δεσμοί) zunutze macht, die lockerere Form eines Bindegewebes, eines Geflechts (συμπλοκή) an, bei dem verschiedene Fäden ineinander laufen und ein vielfarbiges Gesamtmuster bilden. In den Nomoi (949 d) ist es das Pfand (ἐνέχυρον), das als Band fungiert, indem es eine Beziehung haltbar (ἔνχυρος) macht. Die Vorstellung eines Geflechts kehrt in dem lateinischen Wort nexus wieder oder auch in dem französischen Wort entrelacs, auf das Merleau-Ponty häufig zurückgreift und das Norbert Elias in seiner deutschen Version verwendet. Daneben gibt es das vinculum, das allerdings zweideutig ist, da darunter ein Bindemittel verstanden werden kann, aber auch die Fessel wie im Falle des Gesetzes, das laut Hobbes die Freiheit bändigt (De cive 14,3). Im spätmittelalterlichen vinculum substantiale und später dann bei Leibniz nimmt das Band ontologische Ausmaße an. Im Hintergrund steht schließlich die axiologische Form der Verbindlichkeit, der obligatio, traditionell abgestützt durch eine entsprechend verstandene religio.[7] Dies sind Motive, die auf verschiedenste Weise fortwirken. Hervorzuheben ist die Bedeutung des lien social in der Durkheim-Schule sowie die soziale und politische Kohäsion der solidarité, die von französischen Sozialprogrammen des 19.Jahrhunderts herrührt, die auch als ein Prinzip der katholischen Soziallehre auftaucht und die der polnischen Solidarność-Bewegung ihr Leitwort geliefert hat (vgl. Bayertz 1998). Auf psychische Formen der Bindung und Trennung, die in der Psychoanalyse eine besondere Rolle spielen und zu denen nicht nur die Bindungssuche, sondern auch die Bindungsangst gehört, werden wir in Kapitel 3 zurückkommen.
Das Phänomen der Bindung läßt mancherlei Varianten zu. Seine Erschließungskraft wird verkürzt, wenn man vorweg zwischen einer realen, materiellen und einer bloß metaphorisch verstandenen, geistigen oder seelischen Bindung unterscheidet. Die strikte Dichotomie von Gemeinschaft und Gesellschaft, die Ferdinand Tönnies vertritt, beruht darauf, daß die soziale Verbindung alternativ als »reales und organisches Leben« oder als »ideelle und mechanische Bildung« verstanden wird (1970, S.3). Daraus erwächst eine historische Verfallsgeschichte, innerhalb deren die Zivilisation als Widersacher der Kultur auftritt und in deren Verlauf gemeinschaftliche und genossenschaftliche Verbindungen mehr und mehr durch ein gesellschaftliches Verhältnis zwischen »Ungenossen« ersetzt werden (ebd., S.242). Doch die Leibhaftigkeit einer Bindung, die in der Zwischenleibhaftigkeit eine sozial vermittelnde Rolle spielt, läßt solch cartesianisch geprägte Dualismen hinter sich. Dies betrifft auch das Urphänomen der Berührung. Der soziale Kontakt ist weder mit einem gegen null gehenden Abstand gleichzusetzen noch mit einer geistigen oder seelischen Verschmelzung; er setzt vielmehr, wie noch zu zeigen ist, eine wechselnde Nähe und Ferne voraus. Grundlegend für die soziale Bindung sind die reflexive Form des Sich-Bindens und die reziproke Form des Sich-aneinander-Bindens; sie sind nicht abzulösen von der Ich- und Du-Perspektive, als handele sich um eine Art chemischer Verbindung. Die »Wahlverwandtschaften«, die Goethe der chemischen Form einer attractio electiva abgewonnen hat, spielen lediglich mit natürlichen Vorprägungen des Sozialen und mit entsprechenden Analogien.
Abgesehen von solch subtilen Bindungseffekten stellt schon die gewöhnliche Bindung einen höchst differenzierten Vorgang dar. So unterscheidet sich die Bindung in actu, die stets etwas von einer tastenden Anbindung und Anknüpfung hat, von der habituellen Verbundenheit und dauerhaften Verknüpfung sowie von dem Einsatz subsistierender Bindeglieder wie Pfand oder geschriebene Satzung. Sie kann sich auf augenblickliche Situationen beziehen wie im Falle des öffentlichen Verkehrs oder auf spezielle Rollen wie beim Kontakt zwischen Arzt und Patient; sie kann aber auch das Leben im ganzen erfassen und sich auf das Selbstsein der Person erstrecken wie im Falle von Freunden oder Familienangehörigen. Ferner beschränkt sich die Bindung nicht auf ein einträchtiges Miteinander; das konkurrierende oder feindliche Gegeneinander übt ebenfalls eine Bindekraft aus, wie die Verbissenheit eines Kampfes oder die Obsession einer Familienfeindschaft zeigt, die in den von Karl Kraus apostrophierten »Familienbanden« ihre zweideutige Form erkennen läßt. Im Kampfspiel, das auf Sieg, aber nicht auf Vernichtung abzielt, treten den Mitspielern Gegenspieler gegenüber; doch die gegnerischen Parteien vereinen sich, wenn alles gutgeht, zu einem gemeinsamen Spiel, das nach neutralen Regeln abläuft. Schließlich kann die Bindung, mitsamt dem daraus resul