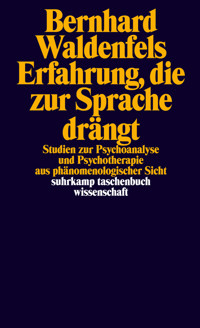19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Globale Herausforderungen wie Flucht, Migration, Terrorismus, Viruspandemie und Klimawandel rufen nach lokalen Antworten, die sich digitaler Mittel bedienen, ohne sich in Daten, Algorithmen und einer Technologie des Machbaren zu erschöpfen. Gastlichkeit, Zeitverschiebung und Ansprüche künftiger Generationen liefern Stichwörter für eine Phänomenologie, die sich im Medium des Pathischen und Responsiven bewegt. Der leibliche Austausch zwischen Kultur und Natur, zwischen Eigenem und Fremdem spielt sich in wechselnden Grenzzonen ab. Kritische Diagnosen wie die von Edmund Husserl, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Emmanuel Levinas, Jan Patočka, Paul Valéry oder Robert Musil tragen dazu bei, dass das Salz des Fremden nicht schal wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
3Bernhard Waldenfels
Globalität, Lokalität, Digitalität
Herausforderungen der Phänomenologie
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschebuch wissenschaft 2391
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77463-2
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
I
. Europa unter dem Druck der Globalisierung
1. Wir guten Europäer
2. Im Banne des Nationalismus
3. Über die Nation hinaus
4. Denationalisierung durch Globalisierung
5. Renationalisierung als Rückzug auf den eigenen Boden
6. Festung Europa
7. Europa der Nachbarschaften
II
. Sinnliche Erschließung des Landschaftsraumes
1. Vor Ort
2. Zwischen Geographie und Ästhetik
3. Landschaft als Lebensraum
4. Im Dickicht der Landschaft
5. Landmarken
Hier und Dort
Wege
Bewegungsarten
Tempi
Nähe und Ferne
Grenzen
Landschaftsdichte
Dominanten
Aussichtspunkte
Abseits des Festlandes
6. Landschaft zwischen Eidos und Pathos
III
. Migranten auf dem Weg und Flüchtlinge als Gäste in Not
1. Migranten als Besucher, Auswanderer und Einwanderer
2. Auf der Flucht
3. Ankunft: Der Gast auf der Flucht
4. Aufnahme: Traditionelle und rechtliche Gastlichkeit
5. Bedingte oder unbedingte Gastlichkeit?
6. Responsive Politik des Fremden
IV
. Das Machbare und das Unmachbare ‒ Philosophie nach Fukushima
1. Prometheus und Epimetheus
2. Oikos: Welt als Umwelt und Mitwelt
3. Praxis: Handeln unter Risiko
4. Ethos: Leben in der Nähe und in die Ferne
V
. Der Leib als Umschlagstelle zwischen Kultur und Natur
1. Zwischen Natur und Kultur
2. Leibliche Zwischenphänomene
3. Die Doppelrolle des Leibes
4. Zwischendinge
5. Naturpflege zwischen Einwirkung und Schonung
VI
. Berechenbares und Unberechenbares ‒ im Reich des Digitalen
1. Zur Vorgeschichte der heutigen Technologie
2. Wettlauf zwischen Mensch und Maschine
3. Leiblicher Austausch zwischen Geist und Natur
4. Kooperation mit der Maschine
5. Im Zwischenfeld der Phänomenotechnik
6. Technische Kunststücke
6.1. Ortssinn, Ortsbewegung und Raumberechnung
6.2. Automatisches Übersetzen
6.3. Gesichts(v)erkennung
7. Heuristische Technologie
VII
. Ausbruch der Viruspandemie
1. Virus zwischen Pathos und Response
2. Virus als Koaffektion und Infektion
3. Bekämpfung des Virus
3.1. Identifizierung des Krankheitsherdes
3.2. Abwehrversuche
3.3. Verteilungskonflikte
3.4. Schuldzuweisungen
4. Konklusionen
VIII
. Zeugnis im Bild und Zeugnisse der Gewalt
1. Bilder zwischen Politisierung und Ästhetisierung
2. Zeugnis als Wissen aus zweiter Hand
3. Zeugnis als Wiedergabe fremder Erfahrung
4. Verkörperung von Zeugnissen im Bild
5. Exemplarische Schlüsselmotive
IX
. Fremde Zukunft und Ansprüche künftiger Generationen
1. Der problematische Ort der Zukunft
2. Antworten auf das, was uns widerfährt
3. Verzögerte Antworten
4. Unausweichlichkeit des Antwortens
5. Einstehen für Ansprüche künftiger Generationen
6. Generative Zukunft
7. Nahe und ferne Zukunft
8. Antwortgeben und Zeitgeben
X
. Ausklang mit Musil: Zwischen Kakanien und Paradies
1. Niemand als Nicht-jemand
2. Abschaffung oder Überbietung der Wirklichkeit?
3. Ulrich als Zaungast in einer allzu normalen Welt
4. Ulrich und Agathe auf der Schwelle zu einem Reich mystischer Vereinigung
5. Rückreise in die gewohnte Welt oder Ausreise in eine andere Welt?
6. Das offene Ende des Romans und die Unfertigkeit der Sache
7. Geschehnisse und Widerfahrnisse
8. Moosbruggers Lektion
9. Erzählbares und Unerzählbares
Nachwort zur Ukraine:
Nostra res agitur
Literatur
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
9Vorwort
Was haben eruptive Geschehnisse wie Kriegsausbruch, Flüchtlingsstrom, atomare Katastrophe, Flutkatastrophe, Viruspandemie und problematische Trends wie Klimawandel, Waldsterben, Verstädterung, Globalisierung und Digitalisierung miteinander zu tun? Wo spielen sie sich ab? Eine erste Antwort könnte lauten: In allen Fällen handelt es sich darum, daß das menschliche Leben in der Welt und in der Gesellschaft schlagartig erschüttert oder langfristig verändert wird. Die übliche Ereignis- und Strukturgeschichte gerät in den Sog von Störungen, Katastrophen und Umschichtungen, die weder teleologisch noch nomologisch, noch pragmatisch durch vorhandene Ordnungsregister aufzufangen sind. Das gewohnte Leben wird aus der Bahn geworfen, Selbstverständliches, das unseren Alltag bestimmt, wird fraglich. So bedarf es neuer Antworten, jenseits der Polarität von Fortschritt und Rückgang, von Modernität und Traditionalität, jenseits von endlosem Immer-weiter oder beharrlichem Immer-wieder. Krisenhafte Ausbrüche und Einbrüche, wie wir sie heute erleben, sind nichts schlechthin Neues. Sie erinnern an mythische Urereignisse wie die Sintflut oder den Turmbau zu Babel oder an historisch dokumentierte Naturkatastrophen wie den Untergang von Pompeji, von dem Plinius der Jüngere als Augenzeuge berichtet, das Erdbeben von Lissabon, das europaweit an den Pfeilern der Theodizee rüttelte, den Einsturz der Brücke am Thay, der in Fontanes Ballade als Hexenwerk gedeutet wird, oder an historische Umwälzungen wie die Reformation und die Französische Revolution. In den Zwischenkriegsjahren des 20. Jahrhunderts steigert sich das »Unbehagen in der Kultur« bis zur fatalistischen Vision eines »Untergangs des Abendlandes«. Autoren wie Edmund Husserl, der die »Krisis des europäischen Menschentums« auf eine Lebensweltvergessenheit zurückführt, und Paul Valéry, der vor einem sich an sich selbst berauschenden »Automatismus der Kühnheit« warnt, oder Jan Patočka, der eine »Solidarität der Erschütterten« beschwört, liefern Stichwörter, deren Echo bis heute nicht verstummen will.
*
10Die folgenden Überlegungen schweifen nicht aus in die Weltgeschichte, vielmehr setzen sie an bei gegenwärtigen Szenerien, allerdings begleitet von Rückblenden auf ältere Traditionen, die bis heute fortwirken. Den konzeptuellen Rahmen liefert die Phänomenologie, genauer gesagt eine responsive Phänomenologie des Fremden, die den Verfasser seit Jahrzehnten beschäftigt. Die Bruchstellen der Erfahrung kamen mit ihren wechselnden Modi von leibhaftiger, ästhetischer, hyperbolischer und sozialer Erfahrung bereits früher ausführlich zur Sprache.[1] Sie durchlaufen nunmehr eine kritische, bisweilen auch katastrophale Zuspitzung. Die Spielart von Phänomenologie, die dabei zum Zuge kommt, orientiert sich an einem starken Begriff von Erfahrung, wie er nicht nur bei Husserl, Heidegger und den französischen Phänomenologen zu finden ist, sondern ähnlich bei William James oder Henri Bergson. In einer solchen Erfahrung tritt nicht nur Neues hervor, sondern Neuartiges, das in die Ordnung der Dinge eingreift. Was hier auf dem Spiel steht, gründet in einem Doppelereignis von Widerfahrnis und Antwort, von Pathos und Response. Mit allem, was wir sagen und tun, antworten wir auf etwas, das uns widerfährt. Diese Doppelbewegung findet ihren eigentümlichen Rhythmus nicht in einem linearen oder konzentrischen Zeitgefüge, sondern in einer Zeitverschiebung, einem Ineinander von Kommen und Gehen. Wir gehen auf etwas ein, das auf uns zukommt, indem es unserer Initiative vorauseilt. Zukunft und Vergangenheit schieben sich ineinander. Der Übergang vom einen zum anderen hat etwas Beunruhigendes und Befremdendes, da wir uns, wo immer Neuartiges zu erwarten ist, auf keinem festen Boden, auf keinem fundamentum inconcussum befinden. Die Annahme, philosophisches Denken werde, selbst wenn es auf Zeitloses bedacht ist, unermüdlich von Affekten des Erstaunens und Erschreckens aus der Ruhe gebracht und wachgehalten, begegnet uns bereits frühzeitig in Platons Theaitet. Umbrüche und Erschütterungen schließen jedoch nicht aus, daß unser Denken immer wieder in einen Schlummer versinkt. Anfänge, die nicht geplant wurden, erweisen sich als Voranfänge, auf die wir wiederholt zurückgeworfen werden, ohne 11sie je einzuholen. Mit Husserl oder Heidegger sprechen wir von Stiftungsereignissen, mit Ethnologen wie Evans-Pritchard von Schlüsselideen. Darin verbindet sich philosophisches Denken mit den vielfältigen Renaissancen, Reformationen und Revolutionen in Kultur, Politik, Wissenschaft und Religion. Ebenso berührt es sich mit den Stollengängen der Psychoanalyse, die sich in eine individuelle und kollektive Vorzeit zurücktasten. Die progressio in infinitum, die Thomas Hobbes in der Morgenröte der Moderne als das höchste aller menschlichen Güter anpries, gerät aus dem Tritt, wenn Bruchstellen und Bruchlinien unsere Erfahrung durchziehen.
Der Zweitakt von Widerfahrnis und Antwort nimmt eine besondere Rhythmik an je nach Beschaffenheit dessen, was uns zufällt und zustößt, was unsere Kräfte herausfordert und sie nicht selten überfordert. Wenn ich in diesem Zusammenhang von Herausforderung spreche, so knüpfe ich an eine Begrifflichkeit an, die sich in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts herausbildete. Ich denke einerseits an Vertreter der Berliner Gestaltpsychologie wie K. Lewin, M. Wertheimer, K. Duncker, D. Katz, K. Koffka oder W. Köhler, die zusammen mit vielen anderen politisch Vertriebenen die gefährliche Rückseite solcher Herausforderungen zu spüren bekamen. Den sinnlichen Gestalten, die unser kognitives und praktisches Verhalten prägen und stabilisieren, werden »Aufforderungscharaktere« und »Gefordertheiten« zugesprochen, die den eingespielten Gegensatz von Sein und Sollen, von Tatsache und Norm, aber auch das kalkulierte Zusammenspiel von Daten und Algorithmen unterlaufen. Ihre grammatische Form finden Aufforderungen im lateinischen Gerundiv. Was sich als agendum, faciendum, videndum oder dicendum ankündigt, ist ein Zu-sein, etwas, das zu tun oder zu unterlassen, zu sagen oder zu verschweigen ist. Dabei treten Anreiz, Antun (lat. Affektion), Angehen, Anmutung oder Anspruch auf als Impulse, die bei leiblichen Wesen ein Eigenverhalten in Gang setzen und modulieren. In dem vielfältig genutzten Präfix ›an‹ (gr. προς-, lat. ad-) deutet sich eine Bewegungsrichtung an, die nicht von Handelnden ausgeht, sondern auf sie zuläuft. Dieser Ansatz entspricht der mikrologischen Vorgehensweise der Gestalttheorie oder der Umweltforschung, die auf mannigfache Weise mit einer Phänomenologie sinnlicher und leibhaftiger Erfahrung verknüpft ist. Hinzu kommt als Wortführer der englische Historiker Arnold Toynbee, der aus makrologischer 12Sicht Weltgeschichte als einen Wechsel von kollektivem challenge und kollektiver response darstellt. Ich greife dieses Begriffspaar auf und lege dabei besonderes Gewicht auf eine Reihe hervorstechender Aspekte.
(1) Die elementare Form der Herausforderung, um die es hier geht, besteht nicht darin, daß ein kausales Ereignis x gemäß funktionalen Gesetzen eine Wirkung y hervorbringt oder produziert, sondern darin, daß ein Ereignis x ein Ereignis y hervorruft oder provoziert (gr. πρόκλησις). Das Rätselhafte liegt in dem drängenden Charakter der Herausforderung, die sich zwischen zwei Instanzen abspielt, ohne auf einer der beiden Seiten festen Halt zu finden. Die Herausforderung gleicht einem ausgeworfenen Seil, wer fängt es auf? Sie bliebe leer ohne das Entgegenkommen der Antwort, die Antwort bliebe ohnmächtig ohne das Drängen der Herausforderung. Diese Anspielung auf das kantische Zusammenwirken von Anschauung und Begriff ist nicht zu verstehen als Suche nach einer Synthese. Vielmehr begegnet uns hier eine Diastase, ein Auseinandertreten, das zugleich verbindet und trennt. Es fehlt ein ontologisches, dialektisches oder regulatives Bindeglied, das den Riß der Erfahrung heilen und die Kluft überbrücken könnte. Darin liegt kein Mangel. Nur wenn eine Lücke aufklafft und die Erfahrung an sich hält, wenn sie immer wieder Atem holt und stockt, entsteht Raum für Neues, das von gewohnten Bahnen abweicht. Der Spalt, der sich auftut, wenn die Erfahrung überraschend über sich selbst hinauswächst, entzieht sich dualen Gegensätzen wie Aktion und Passion, Subjekt und Objekt, Form und Materie, ohne daß die Gegensätze in einem umgreifenden Dritten aufzuheben sind. Der Hiatus zwischen fremdem Anstoß und eigener Erwiderung, zwischen fremdem Anruf und eigener Antwort führt dazu, daß die Antwort als Antwort von anderswoher, aus der Fremde kommt. Der Hiatus hat zur Folge, daß Antworten auch anders ausfallen können, daß sie also in einem radikal erfinderischen Sinne kontingent sind. Keine Antwort enthält eine endgültige Lösung
(2) Ein zweiter Aspekt betrifft die Ambivalenz der Herausforderung. Setzt jeweils etwas unsere Erfahrung in Gang, so mag dies willkommen, erfreulich, bekömmlich oder aber widrig, bedrohlich, schädlich, verletzend sein. Starke Erfahrungen, die an die Ordnung der Dinge rühren, nehmen sich durchwegs mehr oder weniger be13drohlich aus. Selbst Goethe, der einer ruhigen Betrachtung der Dinge zuneigt und es eher mit den Neptunisten als mit den Vulkanisten hält, bemerkt in seinen Maximen und Reflexionen: »Die Welt ist eine Glocke, die einen Riß hat; sie klappert, aber klingt nicht«, und weiter: »Die Wahrheit ist eine Fackel, aber eine ungeheure; deswegen versuchen wir alle nur blinzend so daran vorbeizukommen, in Furcht sogar, uns zu verbrennen.« (Werke, Bd.9, S.518, 522) Diese Sichtweise entspricht dem pathischen Charakter einer Erfahrung, die sich auf die Dauer nicht gängeln und somit für Unberechenbares Raum läßt. Das Wort ›Pathos‹ bedeutet kraft seiner griechischen Herkunft zunächst ein Widerfahrnis, also ein Erleiden von etwas im Sinne des Passivs. Es bedeutet aber zugleich ein Leiden unter etwas oder unter jemandem. Es bedeutet schließlich eine gesteigerte Form der Anteilnahme in Form der Leidenschaft. Im Falle des Leidens nimmt das Antworten besondere Formen der Abwehr an, die leiblich mit dem Zusammenzucken, dem Schrei oder der Klage beginnen. Das deutsche Wort ›Entgegnen‹ hat eine entsprechend schillernde Bedeutung. Dies wird uns anläßlich der aktuellen Herausforderungen, auf die wir uns fallweise beziehen, unaufhörlich begegnen. Erfahrung hat es von Anfang an nicht mit rohen Sinnesdaten zu tun, die auf ihre Formung warten, oder mit digitalen Daten, die einer algorithmischen Regelung bedürfen. Selbst die Apathie ist noch eine Schwundform des Affiziertseins, und ähnliches gilt für die monotone Unansprechbarkeit der Langeweile.
(3) Als dritter Aspekt bleibt der kollektive Charakter von Herausforderung und Antwort. Im Hinblick auf den Zweitakt von Widerfahrnis und Antwort bedeutet dies, daß wir es stets mit Formen der Ko-affektion, der Ko-intention und der Kor-respondenz zu tun haben. Das durchgängige Mitsein, Mitleben und Mitempfinden, das uns in der klassischen griechischen Philosophie, aber auch auf der Theaterbühne unaufhörlich begegnet und das, nachdem nun der cartesianische Individuierungsschub abgeflaut ist, in postcartesianischen Konzeptionen von Sozialität und Alterität auf neue Weise zutage tritt, entzieht sich der Antithese von Individualismus und Kollektivismus und dem Wechselspiel von Egozentrik und Soziozentrik. Das Privatgefühl, das von technologischen Enthusiasten inzwischen selbst Maschinen zugeschrieben wird, ist ein ebenso künstliches Gebilde wie die Privatsprache, der Wittgenstein den Garaus gemacht hat.
14(4) Einen vierten, alles beherrschenden Aspekt bildet die Polarität von Globalem und Lokalem, die gleich am Anfang angeklungen ist und die in unseren weiteren Überlegungen immer wieder durchdringt. Die Welt bildet einen Universalhorizont, der sich aber nur hier und jetzt und immer aufs neue in leibhaftiger Form erschließt. Unser Wohnen in der Welt unterliegt einem Junktim von Hier und Dort, von Hier und Anderswo. Wir sind weder überall noch an einem festen Ort zu Hause. Globale Antworten, die sich von den Bedingtheiten des Lokalen ablösen, beruhen auf einer Anmaßung, lokale Antworten, die sich in einen engen Raum einschließen, lassen den nötigen Wagemut vermissen. Zwischen Globalem und Lokalem bewegt sich auch mein jüngst erschienenes Reisetagebuch eines Phänomenologen, das gegenüber einem Übermaß an Historisierung geographische Bezüge des Denkens hervorkehrt und die Zeit mit dem Raum versöhnt.
*
Die folgenden Kapitel verdanken ihre Entstehung durchwegs bestimmten Anlässen, und ihr okkasioneller Charakter entspricht dem sporadischen Charakter der zu behandelnden Themen. Diese beschränken sich nicht auf das, was in Sonderwelten oder Subsystemen auftritt, in ihnen verschmelzen vielmehr persönliche Belange mit ökonomischen, politischen, rechtlichen, medizinischen, künstlerischen, religiösen und mythischen Aspekten. Austauschstätte ist der sozio-kulturelle Alltag, der sich in wechselnden Lebenswelten ausbreitet, der von spezifischen kulturellen und interkulturellen Traditionen geprägt ist, aber immer wieder Außerordentliches aufscheinen läßt. Der von Husserl aufgehellte Lebensweltbezug und die drohende Lebensweltvergessenheit machen sich nicht zuletzt darin bemerkbar, wie wir auf anstehende Herausforderungen antworten oder ihnen ausweichen.
Kapitel I geht zurück auf eine Tagung, die 2018, also genau hundert Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, einer Besinnung auf die gegenwärtige Lage Europas gewidmet war. Veranstaltet wurde sie in Vigoni am Comer See von slowenischen Forschern, von Mira Miladinović Zalaznik und Dean Komel, und zwar im Rahmen des dortigen Deutsch-Italienischen Zentrums und im Namen des Forum for the Humanities mit Sitz in Ljubljana. Im Mittelpunkt 15meiner eigenen Überlegungen steht die Spannung zwischen zwei extremen Tendenzen, die sich in der Gegenwart auf besondere Weise abzeichnen, einem technisch-ökonomisch ausgerichteten Globalismus, der sich in einem Überall-und-Nirgends zu verflüchtigen droht, und dem Rückfall in einen erneuten Lokalismus, der sich auf das eigene Hier fixiert. Denationalisierung und Renationalisierung stoßen aufeinander und heizen einander an. Es fragt sich, wie ein Europa der Zukunft aussehen könnte, das sich nicht auf eine »Festung Europa« zurückzieht, das aber ebensowenig seine Eigenart preisgibt. Was sich anbietet, ist ein »Europa der Nachbarschaften«, das seine Grenzen nicht aufhebt, sondern, wie Michel Serres vorschlägt, »Wege des Übergangs zwischen Lokalem und Globalem« ins Auge faßt. Nietzsches Parole »Wir guten Europäer«, die unsere Überlegungen begleitet, wäre dann nicht Ausdruck eines Besitzerstolzes, sondern aus ihr sprächen eine nach außen gerichtete Einladung und eine nach innen gerichtete Forderung.
Kapitel II greift weiter zurück auf ein interdisziplinäres Symposium zum Thema der Landschaft, das 2010 in dem von Max Imdahl ins Leben gerufenen Bochumer Kunstzentrum »Situation Kunst« stattfand und von einer Ausstellung »Weltsichten« umrahmt wurde. Die geopolitische Problematik der letzten Jahrzehnte, die in unserem Eingangskapitel zur Sprache kommt, gewinnt hier ein historisches und sinnliches Relief, bei dessen Ausgestaltung die Künste, aber auch Raumtechniken wie die Navigation eine zentrale Rolle spielen. Die Landschaft, deren Konzeption auf ältere Raumformen wie Region und Provinz zurückverweist, bildet einen Bereich der Übergänge, in dem sich die verschiedensten Wege kreuzen, in dem Allgemeines sich aussondert und Besonderes sich verallgemeinert, in dem Weltganzes und Einzelsituation sich verbünden, in dem aber auch heterogene Interessen aufeinanderprallen. Wie die städtischen Passagen, denen Walter Benjamins zentrale Aufmerksamkeit galt, steht auch die Landschaft sowohl für eine Lebensform wie für eine Denkform. Sie liefert eine Matrix für vieles, was in den nachfolgenden Kapiteln im einzelnen problematisiert und aktualisiert wird.
Kapitel III entstand 2017 mitten in der Flüchtlingskrise, die weiterhin eine Herausforderung darstellt, selbst wenn der Wellengang einem Auf und Ab folgt und die Brennpunkte sich verschieben. Die Aufnahme von Flüchtlingen und Immigranten ist ein anhaltender Prozeß, angefacht durch immer wieder neue Fluchtursachen. Die 16Erinnerung an die kulturell tief verankerte Institution der Hospitalität weckt Fragen nach einer responsiven Politik des Fremden, die das alte Ethos der Gastlichkeit neu belebt. Das Wie der Aufnahme läßt sich nicht mit moralischen Appellen oder administrativer Routine erledigen, es bedarf eines gehörigen Maßes an Erfindungskraft und Sensibilität. Die Frage nach einer bedingten oder unbedingten Gastlichkeit, die sich von Levinas und Derrida her stellt, führt uns auf die Spuren einer Un-bedingtheit, deren hyperbolische Form sich stets aufs neue hier und jetzt geltend macht, indem sie die konkreten sozialen und kulturellen Bedingungen übersteigt, aber nicht überspringt. In diesem Sinne gehört Gastlichkeit zu den Hyperphänomenen, in denen gängige Phänomene wie die Häuslichkeit ihre Überschüsse ausspielen. Sie entspringt einer Geste des Gebens, die von Marcel Mauss ethnologisch neu ins Spiel gebracht wurde und die in deutlichem Kontrast steht zu einer reinen Ökonomie des Tausches und ihren neoliberalen Auswüchsen.
Kapitel IV ging hervor aus einer von Tokio aus inszenierten Videokonferenz, die im Dezember 2011 kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima einberufen wurde und vergleichbare Katastrophen wie die atomaren Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki oder das Atomdesaster von Tschernobyl in Erinnerung rief. Im Mittelpunkt steht der riskante Charakter einer hypertrophen Technologie, deren Machwerke mehr und mehr unsere Lebenswelt beherrschen und sie zu überdecken drohen. Die Phänomenologie, die auf Sinn und Bedeutung der Phänomene und auf entsprechende Antriebskräfte ausgerichtet ist, bedarf der Ergänzung durch eine Form der Phänomenotechnik, die den funktionalen Gesetzmäßigkeiten der Technik den ihnen gemäßen Ort inmitten der lebendigen Erfahrung zuweist. Katastrophen wie jene an der japanischen Ostküste sind Alarmzeichen. Alte Gemeinplätze wie Oikos, Praxis, Techne und Ethos rücken in ein neues Licht, wenn Haus- und Landesgrenzen systematisch gelockert und überschritten werden, wenn Eigenhandlungen und Fernhandlungen ineinander übergehen oder wenn man Kampfhandlungen auf Automaten und speziell auf automatische Waffen überträgt. Die Frage nach dem, was machbar ist und was nicht, die Frage nach dem, was in unserer Hand liegt und was unserem Zugriff entgleitet, stellt sich neu. Zugleich zeigen die Berichte aus Japan, wie sehr der technische und ökonomische Umgang mit der Natur kulturell vorgeprägt, aber auch vorbelastet ist.
17Kapitel V schließt sich an, indem es die fernöstliche Atomkatastrophe in einen weiteren interkulturellen Horizont rückt. Der Text geht zurück auf einen Berliner Kongreß von 2016, der das Phänomen des Embodiments aus einer östlich-westlichen Perspektive behandelte. Das phänomenologisch zentrale Phänomen der Leiblichkeit wird in dem vorliegenden Beitrag als ein Phänomen der Schwelle präsentiert, über die hinweg Kultur und Natur auf vielfältige Weise ineinander übergehen. Dabei greift die Zwischenrolle des Leibes über auf eine medial und technisch geprägte Zwischenwelt der Dinge, die in der Naturpflege zum Zuge kommt, deren Status aber im folgenden Kapitel ausdrücklich problematisiert wird.
Kapitel VI, das wir an dieser Stelle einblenden, wurde neu verfaßt mit dem Blick auf aktuelle Debatten. Es nimmt weitgehend die Form von quaestiones disputatae an und befaßt sich mit dem omnipräsenten Prozeß der Digitalisierung. Dieser Prozeß antwortet nicht nur auf entsprechende Herausforderungen, sondern er wird selbst selbst zu einer besonderen Herausforderung, wenn er den prädigitalen Boden der Lebenswelt verläßt. Husserls Diagnose der Krisis der europäischen Wissenschaften gewinnt an neuer Bedeutung. Sie zielt ab auf eine genetische Technologie von unten. Die digitale Prägung der Erfahrung, die zusammen mit den älteren Prozessen der Arithmetisierung und Geometrisierung und einer umfassenden Technisierung der Lebenswelt zu den Errungenschaften der Neuzeit gehört, gerät ins Zwielicht, wenn die digitale Formierung der Erfahrung zur Austrocknung der leiblich-sinnlichen Erfahrung führt. Im Mittelpunkt unserer Überlegungen steht das heikle Verhältnis von Mensch und Maschine, das inmitten von Wettlauf, Austausch und Kooperation seine Konturen zu überspielen und sein Konto zu überziehen droht. Eine Phänomenologie der Leiblichkeit und Zwischenleiblichkeit, wie sie hier ins Spiel gebracht wird, verbindet sich mit einer entsprechenden Form von Phänomenotechnik, die sich nicht gegen die Wirkungen der Technik abschottet, wohl aber dagegen ankämpft, daß Technik sich technizistisch aufbläht. Spezielle Erfindungen wie automatisches Fahren, automatische Übersetzung oder die automatische Gesichtserkennung dienen uns als alltagstechnische Proben aufs Exempel.
Kapitel VII führt mitten hinein in die Welt von Gesundheit und Krankheit. Es entstand 2020 im Zuge der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus. Es erschien als Beitrag zu einem Sonderheft der 18Philosophischen Rundschau, in dem anläßlich der Heimsuchung durch den neuen Virus die Frage nach einer »Kulturzeitdämmerung« aufgeworfen wurde. Der hier vorgelegte, leicht erweiterte Text erinnert daran, daß das Virus, wie schon bei Thukydides in seiner Schrift Der Peloponnesische Krieg, diesseits der Handlungs- und Planungsschwelle anzusetzen ist. Es erweist sich als ein elementares Pathos, dessen πάσχειν sich auf gefährliche Weise in ein συμπάσχειν verwandelt und epidemisch oder pandemisch auf die Allgemeinheit des Demos übergreift. Zu den vielfältigen Maßnahmen, die auf diese lebensgefährliche Herausforderung antworten, gehört die Impftätigkeit, die alle nur möglichen medizintechnischen und sozialmedizinischen Ressourcen in Anspruch nimmt und in der Maskenpflicht älteste theatralische Rollenspiele wachruft. All dies ist einer Antwortarbeit zuzuordnen, die sich ähnlich wie Freuds Trauerarbeit nicht auf bloße Bastelei beschränkt, sondern Erfahrenes neu durcharbeitet. Die »pathologische Betrachtung«, die Jacob Burckhardt in seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen anmahnt, greift hinaus über bloße Fragen des Überlebens, aber erst recht über neuere Techno-Phantastereien eines digital afterlife, mit denen der Tod geradewegs mechanisiert wird. Es ist kaum zu erwarten, daß das Coronavirus in einer säkularisierten Welt tiefgehende Fragen einer Theodizee aufrührt wie das Erdbeben von Lissabon, das im 18. Jahrhundert die europäische Öffentlichkeit in große Unruhe versetzte und Zweifel an der göttlichen Vorsorge wachrief. Aber nicht nur die Bedrohung, sondern auch die Schuldfrage ist geblieben. Die Theodizee hat sich teilweise in eine Soziodizee verwandelt, die nun nicht mehr einem Gott, sondern der Gesellschaft den Prozeß macht und mit ihren Verschwörungshysterien auf höchst dubiose Weise das Zusammenleben vergiftet.
Herausforderungen, die aus dem menschlichen und mitmenschlichen Leiden erwachsen, lassen sich nicht wie Betriebsstörungen behandeln; sie lassen sich aber auch nicht beschönigen, als ginge es um bloße Wendepunkte eines Lernprozesses, der schrittweise unsere Kompetenzen erweitert. Die Aufgabe, die Husserl der Phänomenologie stellt, nämlich die »reine und sozusagen noch stumme Erfahrung zur Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen«, wird durch Leiden, wie die Pandemie sie verursacht, auf eine neue und harte Probe gestellt.
Mit Kapitel VIII wechseln wir hinüber in den Bereich der Kunst, 19aber auch in den der nicht mehr schönen Künste. Dies geschieht im Anschluß an eine Tagung, die 2010 wiederum in den Räumen der Bochumer »Situation Kunst« organisiert wurde und in deren Mittelpunkt die bildliche Darstellung von Gewalt stand. Damit behalten wir die Forderung nach einer »pathologischen Betrachtung« im Blick, die sich entschieden einer digitalen Formalisierung entzieht. Das Zeugnis im Bild, das uns an einem fremden und fernen Geschehen teilnehmen läßt, stellt uns vor die Frage nach der bildhaften Anregung und Ausprägung unserer Erfahrung. Wir schlagen hierbei einen Mittelweg ein. Einerseits vermeiden wir eine Verschmelzung von Moral, Politik und Ökonomie mit der Bildkunst, doch ebenso vermeiden wir deren strikte Isolierung oder Purifizierung. Mit anderen Worten, es geht darum, sowohl eine Moralisierung und Politisierung der Kunst zu vermeiden wie deren Entmoralisierung und Entpolitisierung. Bildform und Ethos überschneiden sich, wenn dem Bild als Bild ein eigentümlicher Zeugnischarakter zukommt. Zeugnisgeben bedeutet ursprünglich keine bloße Wiedergabe fremden Wissens, sondern ein Einstehen für fremde Erfahrungen, die sich im Bild verkörpern und an denen der Bildbetrachter als Ko-Patient oder Ko-Patientin partizipiert. Die Wirkung, die von Bildern ausgeht, läßt sich exemplifizieren anhand einer Reihe von Szenen, in denen Gewaltsames einbricht oder sich andeutet. Diese Beispiele reichen von Kriegsbildern aus der Hand von Goya und Twombly bis hin zu einer Skulptur von Serra, die mit dem von Primo Levi entlehnten Titel The Drowned and the Saved an die Verfolgung der Juden erinnert.
Kapitel IX lenkt unseren Blick auf Herausforderungen, die von der Zukunft ausgehen. Der italienische Kollege Ferdinando Menga regte dazu an, die Phänomenologie explizit für Fragen der Generationengerechtigkeit zu öffnen. Ich habe diese Anregung bereitwillig aufgegriffen. Dabei verstehe ich Zukunft primär nicht als Bewahrung des Vergangenen oder als Verlängerung der Gegenwart, sondern ganz und gar im Sinne von Ereignissen, die als Zu-kunft, als à-venir buchstäblich auf uns zukommen. Entscheidend ist dabei eine radikale Form des Zweiten Futurs, die sich nicht damit begnügt, Zukünftiges in die Vergangenheitsform eines futurum exactum zu versetzen, die vielmehr einer Urvergangenheit entspringt. Wie Kierkegaard uns einschärft, kommt es darauf an, »sich nach vorn zu erinnern«. Die radikalisierte Zukunft nimmt schließlich 20eine potenzierte Form der Fremdheit an in Form einer intergenerativen Zukunft, die einem Zeugungszusammenhang entspringt und sich in einer Bildung von Alterskohorten manifestiert. Sache einer responsiven Politik und Ökonomie wäre es demnach, mit geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, daß die Welt bewohnbar bleibt. Dabei bedarf es einer Art von Tele-Moral, die analog zu der von Nietzsche geforderten Fernstenliebe und ganz im Sinne von Levinas’ Ethik dem Gesicht des Anderen Züge einer künftigen Menschheit entlockt, deren Leibhaftigkeit nicht zu bloßen Menschheitsideen verblaßt. Dabei geht es nicht darum, Nähe und Ferne gegeneinander auszuspielen, sondern in der nächsten Nähe Fernes und Fremdes zu entdecken, ohne es einem digitalen Formenspiel zu überantworten, das nur wechselnde Abstände kennt, aber kein Nächstes und keinen Nächsten im emphatischen Sinne.
Im Schlußkapitel X finden unsere Überlegungen ein literarisches Nachspiel. Wir lassen uns leiten von Robert Musil, der uns schon im Eingangskapitel auf markante Weise begegnet ist. An dessen großes Werk Der Mann ohne Eigenschaften erinnerte das Klagenfurter Robert-Musil-Institut 2021 mit einer von Artur Reginald Boelderl organisierten Online-Tagung. Das Generalthema lautete: »Musil und die Phänomenologie«.
Das Motto, das meinem Beitrag voransteht, erinnert mit der Anspielung an Salz, das für sich allein weder schmackhaft noch nahrhaft und dennoch unentbehrlich ist, an das Fremde, das man als Salz der Erfahrung bezeichnen kann. Der Kontrast zwischen einer entweder salzlosen oder aber versalzenen Kost deutet hin auf die doppelte Szenerie des Romans, die sich auf zwei große Bücher verteilt, um dann in vielen Nachlaßnotizen zu versickern. Der Roman beginnt im Wiener Kakanien der k. u. k. Monarchie in Vorahnung des Großen Krieges und des nicht mehr nur mythischen Dritten Reichs; er bricht ab mit der versuchten Ausreise in ein nie betretenes Paradies der Liebes- und Gottseligkeit. Man fühlt sich als Leser ständig herausgefordert, ohne recht zu wissen, wovon. Ulrich, der als eigenschaftsloser Einzelgänger durch die Stadt irrt, stößt an Straßenecken, in Amtsstuben und Salons auf einen Schwarm technizistischer, nationalistischer, antisemitischer, militaristischer, vitalistischer, erotischer oder weltumfassender Wahnideen, und mit dem wegen Sexualmord angeklagten Moosbrugger gerät man an den Rand der Klinik. Eine »Unruhe ohne Sinn« macht sich breit. 21Am Ende sucht Ulrich mit seiner Schwester Agathe das Weite, kann sich aber eine Rückkehr in die »Höhle« des Wiener Alltags nicht ganz versagen.
Als Schlüsselmotiv dient uns die Spannung zwischen dem Ordentlichen und dem Außerordentlichen. Gerungen wird um eine Wirklichkeit, die sich teils als übertrieben darstellt, da nichts Wichtiges geschieht, die teils überboten wird, getrieben von der unsicheren Erwartung, daß überhaupt etwas geschieht, wenn nicht seinesgleichen, so eben nicht seinesgleichen. In diesem Laboratorium des Lebens fehlt es nicht an Herausforderungen, doch was soll man dazu sagen? Der Roman endet mit einer Serie von Fragezeichen. Leser und Leserinnen mögen schauen, wie sie damit zurechtkommen. Phänomenologen werden sich erneut auf Husserls Epoché besinnen, die in Ulrichs Urlaub vom Leben eine literarische Form von ›Auszeit‹ annimmt.
*
Ein Teil der hier vorgelegten Kapitel erschien bereits vorher in einer ersten kürzeren Fassung.
Kapitel I: in Mira Miladinović Zalaznik, Dean Komel (Hg.), Europe at the Crossroads of Contemporary World. 100 Years after the Great War./Europa an den Scheidewegen der gegenwärtigen Welt. 100 Jahre nach dem Großen Krieg, Ljubljana: Institut Nove revje 2020; engl. Übs. »Europe Between Globalism and Localism, in: Christian Cultural Values in Migration Encounters. Troubled Identities in the Nordic Region?, hg. von C. Nahnfeldt, K. Rønsdal, London 2021. ‒ Kapitel III: in Deutsche Zeitschrift für Philosophie 2017 (1), S.89-105. – Kapitel IV: in Journal of International Philosophy (Tokio) 2012, No. 1, S.227-232. – Kapitel V: in Yearbook for Eastern and Western Philosophy. Embodiment. Phenomenology East/West, vol. 2, 2017. ‒ Kapitel VII: in Philosophische Rundschau, Sonderheft, Bd.67 (2020), S.96-100. ‒ Kapitel IX: in Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy (Genève-Lausanne), vol. 5, No. 2 (2017): Responsibility and Justice for Future Generations in Dialogue with Phenomenology, hg. von M. Fritsch, F. Menga. ‒ Kapitel II, VI, VIII und X sind unveröffentlicht, für letzteres ist eine Veröffentlichung im Rahmen der Klagenfurter Musil-Tagung geplant. – Das Nachwort zur Ukraine, das in Reaktion auf die rus22sische Invasion angefügt wurde, erscheint zugleich im »Forum for the Humanities« in Ljubljana.
München, März 2022
23I. Europa unter dem Druck der Globalisierung
… neue Wege des Übergangs zwischen Lokalem und Globalem.
Michel Serres, Atlas
Der Rückblick auf die letzten hundert Jahre, die seit Beendigung des Ersten Weltkriegs verstrichen sind, ist nicht gerade ein Grund zum Feiern, wohl aber zur Rückbesinnung. Zum alten Europa gehört die Pflege eines Langzeitgedächtnisses, das unserem »geschwinden Europa« Einhalt gebietet, das der Suche nach einem »guten Europäertum« Raum läßt (Nietzsche, KSA 5, 706) und das sich dem jederzeit drohenden Wiederholungszwang widersetzt.
Mit den folgenden Überlegungen setze ich meine früheren Gedanken zu Europa fort.[1] Speziell gehe ich aus von den Herausforderungen einer weltweiten Globalisierung, die Europa als Lebens- und Denkort zu überschwemmen droht. Was wird aus Europa, wenn es am Ende nur noch über digitale Paßwörter zu erreichen ist? Was wird aus den Spielräumen der Erfahrung, wenn sie den Strategien von Global Players überantwortet werden? Was wird aus der Geschichte Europas, wenn die »großen Erzählungen« durch Zahlenspiele ersetzt werden? Die Unruhe, die sich in den letzten Jahren auszubreiten begonnen hat, läßt sich nur teilweise als heilsam bezeichnen. Wirkliche oder eingebildete Verlusterfahrungen verlocken dazu, einer Tendenz zur globalen Denationalisierung mit Versuchen einer lokalen oder regionalen Renationalisierung entgegenzutreten. Man ist geneigt, Karl Marx mit seiner Eingangsbemerkung aus dem Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte zu zitieren: »In der Geschichte passiert alles zweimal, einmal als Tragödie und einmal als Farce.« (MEW 8, S.115) Doch selbst wenn der Ausdruck eines solchen Neonationalismus eine Farce wäre, die sich weit von einer Geschichte der Völker im Sinne Herders oder Vicos 24entfernt, so wäre sie ernst zu nehmen als Symptom für etwas, das selbst keine bloße Farce ist.
Meine Überlegungen, die aus deutscher Sicht auf die heutige Lage Europas blicken und einerseits den Krieg, andererseits die Flüchtlingsfrage als Testfall benutzen, kreisen um einen Kontrast von Eigenem und Fremdem, von Lokalem oder Regionalem und Globalem, der sich sowohl einer totalisierenden Form der Nationalisierung wie einer homogenisierenden Form der Globalisierung entzieht. Methodisch orientiere ich mich an den Leitlinien einer responsiven Phänomenologie des Fremden. Berücksichtigt werden darüber hinaus selbstkritische Europagedanken, wie sie nicht nur von Edmund Husserl ausgehen, sondern auch von Hannah Arendt, Thomas Mann, Jan Patočka, Paul Valéry oder Jacques Derrida. Seitenblicke fallen auf Marx, Nietzsche und Freud, die Paul Ricœur einer école de soupçon zurechnet; deren Schriften sind aus dem heutigen Abstand heraus nicht mehr als Heilslehren zu bewerten, durchaus aber als Warnschriften. Letzteres gilt im hohen Maß auch für die europäische Literatur des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhundert, aus der wir passende Proben einblenden werden.
1. Wir guten Europäer
Auf welche Weise und von welchem Ort aus läßt sich von Europa sprechen? Als Philosophen neigen wir dazu, Europa in eine Idee zu verwandeln und diesen Erdteil in eine Werteskala aufzunehmen, um es von den Zufälligkeiten einer zeitlich-räumlichen Realität zu befreien. Doch wiederum tönen uns Marx’ Worte im Ohr: »Die ›Idee‹ blamierte sich immer, soweit sie von dem ›Interesse‹ unterschieden war.« (MEW 2, S.85) Soweit sie davon unterschieden oder geschieden war? Anstatt uns auf die verschlungenen Pfade einer Ideologiekritik zu begeben, die Ideen und Realität aneinander mißt und die ihrerseits einer Metakritik bedarf, wollen wir lieber ›Europa‹ beim Wort nehmen. ›Europa‹, geboren aus einer mythischen Ursprungsfigur, ist ein Name, den jeder für sich selbst übernimmt und den wir einander zuweisen, wenn wir ›von uns Europäern‹ sprechen. Der Gebrauch dieses Namens ist wie der eines jeden Eigennamens okkasionell; er weist zurück auf Gelegenheiten eines 25Hier und Jetzt, die sich nicht restlos in Termini und Daten überführen und am Ende digitalisieren lassen. Das ›wir‹ wird ähnlich wie das ›ich‹ performativ benutzt, bevor es mit einem Artikel versehen und prädikativ eingesetzt wird. Austins doing things with words trifft auch auf die Europa-Rede zu.
Nietzsche ist sich der sprachlichen Fallen und Tücken wohl bewußt, die hinter großen Worten lauern. In seiner 1886 erschienenen Schrift Jenseits von Gut und Böse widmet er ein Hauptstück den Völkern und Vaterländern; der zweite Paragraph beginnt mit der Formel: Wir ›guten Europäer‹ (KSA 5, 180). Europa wird nicht eingeführt als Gegenstand eines geographischen oder historischen Wissens, sondern als Thema einer Selbstbesinnung, ganz im Sinne eines tua res agitur, in dem nicht nur etwas auf dem Spiel steht, sondern unser eigenes Dasein. Doch die Wir-Rede ist alles andere als eindeutig. Es genügt, an die bekannte Differenz von inklusivem und exklusivem Wir zu erinnern. Ein Deutscher wird den Satz anders lesen als ein Franzose, ein Europäer anders als ein Orientale, anders auch als ein Jude, dessen Zugehörigkeit zu Europa seit Jahrhunderten labil ist. Erinnert sei daran, daß Juden in Deutschland, anders als im westlichen Nachbarland der Revolution, erst mit der Reichsgründung von 1871 das förmliche Bürgerrecht erhielten. Daß dessen Ausübung auch danach europaweit viel zu wünschen übrigließ, wissen wir nur zu gut. In Frankreich wirkte die Dreyfus-Affäre als ein Katalysator, der Reste eines tiefsitzenden Antisemitismus ans Licht brachte. Doch diese Ablehnung des Fremden ist nicht zu vergleichen mit der 1933 in Deutschland einsetzenden systematischen Vertreibung und schließlichen Ermordung von Millionen Juden. Daß Husserl wie viele seiner jüdischstämmigen Mitbürger darunter zu leiden hatte, ist wohlbekannt. Man könnte die Liste der Diskriminierungen und Selektionen jedoch fortsetzen. Als »vaterlandslose Gesellen« galten unter Kaiser Wilhelm II. alle Sozialisten und Kommunisten. Dazu die sarkastische Bemerkung im Kommunistischen Manifest: »Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben.« (MEW 4, S.479) Zu denken ist auch an »Randvölker« wie die Armenier, Georgier, Tataren oder Kurden, die zwischen verschiedenen Reichsgrenzen zerrieben wurden, ganz zu schweigen von dem ausgebeuteten, aber kulturell weithin zu Tode geschwiegenen Afrika. Vieles bleibt nachzuholen, und einiges wird reichlich spät nachgeholt.
26In dem ›Wir‹, das sich in Nietzsches Europa-Appell ausspricht, steckt bestenfalls die Erwartung eines kommenden Europas, wie Derrida es in seiner Europaschrift beschwört. Nicht umsonst qualifiziert Nietzsche all jene Europäer, denen er sich verbunden fühlt, als ›gute Europäer‹, die einem inneren Anspruch folgen; das bloße ›wir‹ ließe Raum für Zerwürfnisse, Usurpationen und Exklusionen jeglicher Art. Wenn Husserl 1935, also ein halbes Jahrhundert später, seinen Wiener Vortrag, der die Philosophie in die »Krisis der europäischen Menschheit« einbezieht, mit Nietzsches Appell an die »guten Europäer« abschließt (Hua VI, 348), so versucht er die Formel mit Inhalt zu füllen. Die entscheidenden Stichworte lauten ›Vernunft‹ und ›Geist‹. Allerdings ist nicht zu übersehen, daß auch Husserl noch Kind seiner Zeit war; in dem »geistigen Europa«, das er beschwört, ist für »herumvagabundierende« Zigeuner ebensowenig Platz wie für Ureinwohner, die am nördlichen Rand Europas siedeln (ebd., 318f.). Jan Patočka greift in den siebziger Jahren die Husserlsche Idee eines vernunftorientierten Europas auf, indem er das griechische Erbe des alten Europas mit einem künftigen »Nach-Europa« verbindet (1988, S.207-287). Der tschechische Philosoph wurde jedoch selbst Opfer einer Entwicklung, in deren Verlauf das »Gespenst des Kommunismus«, das damals in Europa umging und sich anschickte, »alle Länder« im Zeichen des Proletariats zu vereinen, sich seinerseits in eine imperiale Großmacht verwandelte, die alle nachfolgenden Revolutionen zu Konterrevolutionen erklärte und im Zweifelsfalle »Bruderarmeen« anrücken ließ. Die Orte Berlin, Budapest, Prag und Warschau und die Jahreszahlen 1953, 1956, 1968 und 1980 stehen für ein rebellierendes Europa.
Die Parole »wir guten Europäer« schillert, wie wir sehen, in vielen Farben. Als Nietzsche in der Blütezeit des Nationalismus diese Parole ausgab, bezog er sich auf Völker im Plural; spöttisch bezeichnete er den herrschenden europäischen Wirrwarr als »Vaterländerei«. Seitdem hat sich einiges getan, aber die Gefährdung ist geblieben. Steht Europa wiederum an einem Scheideweg?
2. Im Banne des Nationalismus
Der Erste Weltkrieg bildet eine Zäsur; er ist nicht bloß Folge eines grassierenden Nationalismus, der sich mit Flaggen schmückt, mit 27ihm tritt der Ernstfall ein. Die offen ausbrechende Feindschaft, die ganz Europa und seine Ränder erfaßt, geht hervor aus einer latenten Feindseligkeit. In den Nationalkriegen des 19. Jahrhunderts wiederholt sich auf halbsäkularisierte Weise die zerstörerische Gewalt der Religionskriege, die im Dreißigjährigen Krieg ihren Gipfelpunkt erreichte. Ich spreche von einer halbsäkularisierten Art und Weise, da die Nation, für die man im 19. und 20. Jahrhundert lebt und stirbt, eine religiöse Aura wahrt, auch wenn religiöse Symbole zumeist nur als Staffage dienen. Die Nationalreligion schillert in vielen Farben, wie die große Religionssoziologie von Wolfgang Eßbach zeigt (2014, Bd. I, S.529-560). Daß jede Partei das »Gott mit uns« für sich reklamierte, in Deutschland sichtbar eingraviert in das Koppelschloß der Soldaten, am Ende kombiniert mit Adler und Hakenkreuz, dies gehört zur Ironie der religiös aufgeladenen Kriegsgeschichte Europas, die durch eine nicht abreißende Serie von Kriegsdenkmälern nicht nur bezeugt, sondern befeuert wurde. »Invictis victi victuri – Den Unbesiegten die Besiegten, die siegen werden«, so lautet eine Inschrift, die der klassisch-humanistisch und antinietzeanisch geprägte Gelehrte Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 1918 in elegantem Latein verfaßte und an einem Denkmal für die gefallenen Angehörigen der Berliner Universität anbringen ließ; bis heute begegnet mir der martialische Spruch tagtäglich auf der Außenwand einer Kirche in München-Schwabing. Deutschland betrachtete sich 1918 in der Tat als »unbesiegt im Felde«, auf einen »aufgeschobenen Sieg« wartend (vgl. Löwith 1990, S.54). Vergessen war Artikel 1 aus Kants Schrift Zum ewigen Frieden, der so lautet: »Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden« und der als bloßer »Aufschub der Feindseligkeiten« nicht den Namen »Frieden«, sondern nur den eines »Waffenstillstands« verdient (Werke, VI, 196).
Der Nationalismus hatte etwas Selbstzerstörerisches; was zurückblieb, war ein zerstückeltes Europa. Selbst Intellektuelle und Literaten wie Bergson, Eucken, Scheler, Thomas Mann, Max Weber, Ernst Jünger sowie der junge Brecht und der junge Zuckmayer ließen sich anfangs von der Kriegshysterie mitreißen, anders als Hermann Hesse, Karl Kraus oder Romain Rolland. Selbst Hermann Cohen, der mit allen Wassern einer jüdischen Ethik und einer kantischen Moral gewaschen war, klammerte sich in seiner 1914 28erschienenen Schrift Das Eigentümliche des deutschen Geistes an »unser Dichten und Denken«, in dem Nationalismus und Idealismus eine beispielhafte Verbindung eingehen. Buber und Rosenzweig sind ihm darin nicht gefolgt.[2] Auf den Höhen der Wissenschaft stand der kaisertreue Max Planck dem pazifistisch gesinnten Albert Einstein gegenüber.[3]
Was Europa im ganzen betrifft, so konnten das gemeinsame Band aus Handel und Verkehr, Recht, Wissenschaft und klassischer Bildung und selbst ein grenzüberschreitendes Phänomen wie der französische Wagnerianismus oder dynastische Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Höfen von Berlin, London und Petersburg das Unheil nicht aufhalten. In ihm verquickte sich der Trieb zur Selbsterhaltung mit einem Trieb zur Fremdvernichtung, angeheizt durch eine allseitige Kriegspropaganda, verstärkt durch eine industriell genutzte Waffentechnik und beseelt von einer Fin-de-siècle-Stimmung. So schreibt Thomas Mann in seinem zeitgenössischen Roman Doktor Faustus (1967, S.399): In »unserem Deutschland« wirkte der Krieg »vorwiegend als Erhebung, historisches Hochgefühl, Aufbruchsfreude, Abwerfen des Alltags, Befreiung aus einer Welt-Stagnation, mit der es so nicht weiter hatte gehen können, als Zukunftsbegeisterung, Appell an Pflicht und Mannheit, kurz, als heroische Festivität«, während er zur nämlichen Zeit in Nachbarländern als »grand malheur« bejammert wurde.
Begleitet wurde der innereuropäische Nationalismus vom Welteroberungsdrang eines Kolonialismus, der fremde Erdteile in ein exotisch ausgelagertes Schatteneuropa verwandelte – mit feinen Unterschieden je nachdem, ob die Kulturnation einen mildernden Einfluß geltend machte wie im Falle Frankreichs, ob der Kolonialismus offen rassistische Züge annahm wie in Italiens Abessinien-Feldzug oder ob die Wirtschaftsnation alle Kräfte auf sich zog wie in den meisten anderen Fällen. »Sie sagen ›Christus‹ und meinen Kattun«, so die trockene, bei aller Anglophilie kritische Bemerkung des preußischen Fontane im Stechlin, diesem Altersroman, in des29sen flackernder Moderne sich die Geschicke eines sich wandelnden Europas abzeichnen wie in einem Wetterleuchten. Die Folgen des kolonialistischen Europaexports reichen bis in die Gegenwart, wenn wir erleben, wie Menschen aus dem Irak, aus Syrien, Libyen oder Afghanistan, aus Somali oder dem Kongo in ihre kolonialen ›Vaterländer‹ fliehen. Wenn schon ›Überfremdung‹, so handelt es sich um eine ›Überfremdung‹ durch ›Überfremdete‹, nur daß diese Vorgeschichte in den Fremdheitsdebatten selten als solche wahrgenommen wird. Das geht bis zu der gedankenlosen, aber keineswegs arglosen Rede eines bayerischen Ministerpräsidenten, der sich erdreistete, von »Asyltourismus« zu sprechen. Der grenzüberschreitende Flüchtlingsstrom, der von heutigen Populisten vielfach wie ein neuer Hunneneinfall beschrieben wird, konfrontiert Europa nicht nur, aber auch mit seiner eigenen Geschichte. Geschichtskundige werden sich an einen gewissen Scipio Africanus erinnern, der seinen Namen nicht seiner Herkunft, sondern dem römischen Sieg über den punischen Hannibal verdankte. Man sollte dabei nicht übersehen, daß die europäische Geschichte über Jahrhunderte hin durch eine ottomanische Vorgeschichte durchkreuzt wird; diese hat im Vorderen Orient und auf dem Balkan Spuren hinterlassen, die nicht weniger zweideutig sind als die des ›christlichen Abendlandes‹.[4]
3. Über die Nation hinaus
Das Lernen aus dem Desaster der europäischen Bruderkriege nimmt einen eigentümlichen Verlauf. Ulrich, der Protagonist aus Musils Mann ohne Eigenschaften, distanziert sich von der zügellosen »Vaterländerei« mit einer ironischen Volte (1978, S.18). Er erinnert sich an einen patriotischen Schulaufsatz, dessen Thema für österreichische Kinder weniger siegesgewiß klang als für deutsche.
Denn die Österreicher hatten in allen Kriegen ihrer Geschichte zwar auch gesiegt, aber nach den meisten dieser Kriege hatten sie irgend etwas abtreten müssen. Das weckt das Denken, und Ulrich schrieb in seinem Aufsatze 30über die Vaterlandsliebe, daß ein ernster Vaterlandsfreund sein Vaterland niemals das beste finden dürfe […].
Die gebotene Zurückhaltung schließt Heimatliebe nicht aus. In meinem Schullesebuch fand sich einst die Geschichte eines ostpreußischen Mädchens, das bei einem Besuch in Berlin gegenüber allen angebotenen Herrlichkeiten der Hauptstadt an dem Vorzug seines Heimatortes festhielt: »Gerdauen ist doch schöner.« Heimatliebe läßt sich durchaus plural denken wie jede Vorliebe. Was dagegen fragwürdig bleibt, ist eine Vergötterung der Heimat. Entscheidend ist dabei, wie sich das Verhältnis von Eigenem und Fremdem über Landesgrenzen hinweg gestaltet. Während der ererbte Nationalismus auf eine Abwehr des Fremden und im äußersten Konfliktfall auf dessen Vernichtung abzielt, läßt sich die Vereinigung Europas, die im Völkerbund unter der Regie von Gustav Stresemann und Aristide Briand ihre erste institutionelle Ausprägung erfuhr, als eine Ausweitung und Öffnung des Eigenen bestimmen. In diesem Falle wird das Nationale nicht idealiter übersprungen, sondern realiter überstiegen in Form supranationaler Organisationsformen, an denen wir bis heute arbeiten. Doch wie ist die Wirkung dieses Überstiegs einzuschätzen?
Karl Löwith schildert in seinen 1940 unternommenen »Betrachtungen zur geistigen Vorgeschichte des europäischen Krieges« das »Ende von Alteuropa«. Er geht zurück bis auf den späten Goethe, der eine von Reichtum, Schnelligkeit und allen möglichen »Fazilitäten der Kommunikation« geprägte »mittlere Kultur« entstehen sieht, zugehörig einem »Jahrhundert für leichtfassende, praktische Menschen, die mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet ihre Superiorität über die Menge fühlen«. Im Ton einer ihm eher fremden Resignation fügt er hinzu: »Wir werden, mit vielleicht noch Wenigen, die Letzten sein einer Epoche, die sobald nicht mehr wiederkehrt.« (Brief an Zelter, zitiert und kommentiert in Löwith 1990, S.59) Nietzsche fährt auf der gleichen Linie fort, angestachelt von einer Lust zur Polemik. Er sieht den »werdenden Europäer« auf dem Weg zu einer »wesentlich übernationalen und nomadischen Art Mensch«, der sich von allen klimatischen und rassischen Bedingungen loslöst. In dieser allmählichen »Anähnlichung« der Europäer, die gleichsam alle Spitzen und Kanten abschleift und Europa seiner Eigenart beraubt, erblickt er einen Prozeß der »Vermit31telmäßigung«, der aus dem Menschen ein »nützliches, arbeitsames, vielfach brauchbares und anstelliges Herdentier Mensch« macht. Und mehr noch, hinter dieser »Demokratisierung« Europas wittert er eine neue Tyrannis; denn die neuen Arbeitssklaven bedürfen eines »starken Menschen«, der über sie befiehlt (KSA 5, 707f.). Durch Nietzsches Diagnose hallt wie ein fernes Echo die Reminiszenz an die platonische Politeia, die in ihrem Endstadium von der demokratischen Willkürherrschaft zum Gewaltregime der Tyrannei überspringt. Natürlich kann der Tyrann im platonischen Sinne nicht eigentlich als stark betrachtet werden, da er nicht einmal sich selbst beherrscht, gleich wie der Tyrann im Sinne Nietzsches nicht mit dem Übermenschen gleichzusetzen ist, da es ihm nicht gelingt, sich selbst zu überwinden. Gleichwohl verbreitet sich hier ein dubioses Klima, das in Deutschland das Zerrbild einer konservativen Revolution, in Frankreich die Gewaltbereitschaft einer Action Française, in Italien und Spanien faschistische Führerträume, in Norwegen die Kollaboration der Quislinge ausbrütete.
Man sollte sich hüten, eine eindeutige Verfallsgeschichte zu bilanzieren. Nehmen wir nur Husserl, er hat mit diesen extremen Auswüchsen nichts zu tun. Seine Krisenbehandlung zielt ebenfalls auf eine »Übernationalität Europa« ab, doch in der Einheit versucht er die Vielfalt zu wahren. »Die europäischen Nationen mögen noch so sehr verfeindet sein, sie haben doch eine besondere innere Verwandtschaft im Geiste, durch sie alle hindurchgehend, die nationalen Grenzen übergreifend.« Das »europäische Menschentum« gilt als Vorbote einer Menschheit, die ihr Telos in einer umgreifenden Vernunft hat. Die Souveränität jeweiliger »Sondernationen« scheint der Herrschaft der Vernunft keinen Abbruch zu tun (Hua VI, 320f.). Die Vision richtet sich auf eine »Synthese der Nationen, in welcher jede dieser Nationen gerade dadurch, daß sie ihre eigene ideale Aufgabe im Geiste der Unendlichkeit anstrebt, ihr Bestes den mitvereinten Nationen schenkt« (ebd., S.336). Im Zuge einer allgemeinen Europäisierung der Welt, die im Gegensatz steht zu einer nicht auszudenkenden Indianisierung (ebd., S.320), wird das klassische Gemeinwohl über die Grenzen der eigenen Nation hinaus verlegt. Dazu paßt, daß Husserl dem »sich verirrenden Rationalismus« der Neuzeit (ebd., S.337) keinen Irrationalismus entgegensetzt, sondern einen »Überrationalismus […], der den schwächlichen Mystizismus und Irrationalismus als unzu32länglich überschreitet und doch seine innersten Intentionen rechtfertigt«.[5]
Ist die Qualität dieser ›Übernationalität‹ wirklich über jeden Zweifel erhaben? Probleme treten auf, sobald wir versuchen, das vereinte Europa oder gar die ganze Welt als eine gemeinsame Lebenswelt zu denken. Werfen wir mit Aristoteles einen Blick auf die alteuropäische Politik, die sich auf die je eigene Polis konzentrierte und die in ihrem Verhältnis zu den Sklaven im Inneren, zu den Barbaren im Äußeren erhebliche Geburtsfehler aufwies, so stoßen wir auf deutliche Grenzen eines handlungsgeleiteten Weltverständnisses. Handlungs- und Beratungsfelder beschränken sich aus aristotelischer Sicht auf das, »was in unserer Hand liegt (τὰ ἐφ’ ἡμῖν)«. Dies bedeutet etwa, daß kein Spartaner sich darum kümmern wird, wie die Skythen am besten ihren Staat einrichten (Nik. EthikIII, 5, 1112a28f.), und es bedeutet erst recht, daß Griechen sich wohl hüten, darüber zu beratschlagen, was bei den Indern vor sich geht (Eud. EthikII, 10, 1126a29), oder gar darauf zu sinnen, »als König über alle Menschen zu herrschen« (1235b33). Obwohl die Antike bereits Imperien von beträchtlicher Größe kannte, hielt sich der Radius des praktischen, nur rudimentär technisierten Handelns in deutlichen Grenzen. Es braucht kaum der Erwähnung, wieviel sich geändert hat, seitdem Politik, Ökonomie und Kultur planetarische Ausmaße angenommen haben. Doch umso dringlicher erscheint die Frage, worin denn die Gemeinsamkeit der Bewohner des europäischen Erdteils besteht, ganz zu schweigen von der Gemeinsamkeit der Erdbewohner insgesamt. ›Wir‹ ist schnell gesagt, aber weniger schnell getan. Vom österreichischen Friedensinstitut wurde unter der Leitung von Werner Wintersteiner jüngst eine Kampagne gestartet, die mit ihrem Titel »Heimatland Erde« an den französischen Soziologen Edgar Morin und sein Plädoyer für ein »ökologisches Solidaritätsbewußtsein« erinnert, verbunden mit der Forderung nach einer Humanisierung des irdischen Planeten, die über eine bloße Hominisierung hinausgeht (vgl. Wintersteiner 2021).
Die Dinge nehmen ihren Lauf. Auf einer mittleren Ebene, oberhalb der Einzelnationen, aber unterhalb der Vereinten Nationen, entstand in den 1950er Jahren die »Europäische Union«, die es sich 33zur Aufgabe machte, friedliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie hat nicht nur im Euro eine gemeinsame Währung gefunden, sondern eigene Institutionen wie das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Europäischen Gerichtshof oder die Europäische Zentralbank ins Leben gerufen, und sie bekundet ihre Einheit symbolisch durch Europaflagge und Europahymne. Doch worauf beruht die Einheit dieser Union, die immer noch den transitorischen Charakter einer Baustelle hat? Für eine »Weltumschau«, die sich nicht einbildet, die Erfahrung überfliegen zu können, erscheint die Welt immer nur in der Relativität wechselnder »Lebensumwelten der jeweiligen Menschen, Völker, Zeiten« (Hua VI, 150). Eine Lebenswelt, in der wir uns leiblich befinden, die wir mit anderen teilen und die uns als Lebensumwelt umgibt, läßt sich nicht totalisieren. Bewohnt der sogenannte Weltbürger, der Kosmopolit, wirklich die ganze Welt? Spricht der Weltbürger eine einzige Weltsprache? Es kommt auf das Wie der Weltzugehörigkeit an. Die Sprache erscheint als besonders aufschlußreich; in ihr spiegelt sich eine Vielfalt von Lebensformen und Weltsichten; man spricht Deutsch, Französisch, aber nicht Europäisch. Das Pfingstereignis der Apostelgeschichte kündet nicht von der Erfindung einer Einheitssprache. »Sie sprachen in verschiedenen Zungen, und ein jeder hörte sie in seiner Sprache sprechen.« Von diesem Pfingstwunder bliebe nicht viel übrig in einem smarten Europa, in dem ein jeder den anderen englisch sprechen hört. Ein Monolinguismus verträgt sich nicht mit einer europäischen Lebenswelt, ganz zu schweigen von seiner Ausweitung auf außereuropäische Lebenswelten. Wenn die linguistische Hoffnungsgestalt eines Esperanto eine Einheit verspricht, so nur in Gestalt fortlaufender Übersetzungen.
Husserl berücksichtigt den impliziten Charakter der Lebenswelt, indem er die Welt nicht als reale Ansammlung von Dingen und Wesen begreift, nicht als omnitudo realitatis, sondern als Boden und Horizont unserer Erfahrung, also als ein offenes Ganzes, das nie ganz und gar gegeben und nie voll bestimmt ist und das sich nur indirekt aus dem jeweils hier und jetzt Erfahrenen erschließen und erraten läßt. Zugleich rekurriert er auf eine Urscheidung der Lebenswelt in Nahwelt und Fernwelt, in Heimwelt und Fremdwelt (vgl. Hua VI, 303; XV, 214-218). Dies entspricht der Scheidung in Eigen- und Fremdleib, in Eigen- und Muttersprache, in Eigen- und Fremdnation. Damit stellt sich die Frage, ob die versuchte 34Einigung Europas nicht falsche Erwartungen weckt, wenn sie eine endlose Ausweitung des Eigenen und eine restlose Vergemeinschaftung suggeriert. Die Kluft zwischen einem konkret Allgemeinen und einem abstrakt Allgemeinen, zwischen dem gelebten Gemeinsinn und einem abstraktiven Gesichtspunkt des Allgemeinen ließe sich nur überbrücken durch eine zweifelhafte Totalisierung, die mit dem Rekurs auf eine Alleinheit nicht nur das spezifisch Fremde, sondern auch das spezifisch Eigene, nicht nur das Fremdartige, sondern auch das Eigenartige abschaffen würde. Eine allseitige Erfahrung wäre nichts weiter als eine gedachte Erfahrung; ein »allseitiger Verkehr«, auf den auch Marx im Kommunistischen Manifest hinsteuert (MEW 4, 466), wäre lediglich ein Verkehrssystem. Wie Husserl ausdrücklich betont, hat selbst die Wahrheit als Wahrheit ihre begrenzten Horizonte und ihre unaufhebbaren Relativitäten (Hua XVII, 285, 288). Doch wie verträgt sich dies mit einem Europa als »ideale(r) Lebens- und Seinsgestalt« (Hua VI, 320)? Ist nicht jedes Ideal Produkt einer faktisch begrenzten Idealisierung? In seinen Ketzerischen Essays (1988, S.426) nähert Jan Patočka sich dieser Grenzproblematik in Form eines »negativen Platonismus«, der von der Idee nur noch ein »unendliches Objekt« festhält, das im strengen Sinne kein Gegenstand mehr ist.
4. Denationalisierung durch Globalisierung
Mit dem Prozeß der Globalisierung, der heute im planetarischen Ausmaß den Ton angibt, scheinen die Spannungen zwischen Besonderem und Allgemeinem, zwischen Eigenem und Fremdem zu verschwinden oder wenigstens abzunehmen. Das Konzept der Globalisierung erinnert zwar noch an den Erdball, den orbis terrarum, den Comenius in Zeiten der Weltentdeckung didaktisch ins Bild gesetzt hat. Auf einer Kugel findet alles seinen Platz; die wohlgerundete Seinskugel, in der es kein gesondertes Hier oder Dort gibt, ist eine alte Vorstellung, die bis auf Parmenides zurückgeht. Doch der Begriff der Globalisierung, der im 20. Jahrhundert, in den sechziger Jahren im Völkerrecht und dann in den achtziger Jahren in der Sozioökonomie aufkommt, hat mit der Kugelgestalt nur noch den Namen gemein. Er lehnt sich an den soziologischen Begriff einer Weltgesellschaft an, deren Wurzeln bis in die frühe Neuzeit 35zurückreichen.[6] Speziell steht er für »verdichtete Transaktionen«, die durch verschiedene Sachbereiche hindurchgehen und dazu führen, daß die Bedeutung nationaler Grenzen abnimmt.[7] Die schleichende Denationalisierung geht einher mit einer Deregulierung der Volkswirtschaften, die sich nicht länger in eine Nationalökonomie einbinden lassen; sie geht zusammen mit einem Gestaltwandel des Kriegs, dessen Fronten sich nach innen verlagern, ferner mit Klimaschäden, die an keiner Landesgrenze haltmachen, und mit einer digitalen Technologie, die alle Lebens- und Berufsbereiche elektronisch durchdringt. Hinter der sogenannten Echtzeit, die sich aus der Betriebsbereitschaft von Rechensystemen herleitet, verblaßt die gelebte Zeit. Die Globalisierung findet ihre Denkwerkzeuge in der neueren Systemtheorie, die auf der relativen Differenz von System und Umwelt aufbaut und formale Ordnungsprozesse auf das Ziehen von Grenzen und dessen Beobachtung zurückführt. Hierbei sind Leib und Leben keine systemtauglichen Instanzen. Für unsere spezielle Thematik ist entscheidend, daß die Ausweitung des Eigenen ersetzt wird durch eine Neutralisierung der Scheidung in Eigenes und Fremdes. Die Lebenswelt stellt sich dar als eine »Welt von Fremden«, in der jedermann fremd ist und in der sich folglich niemand mehr fremd zu fühlen braucht.[8] Die »transzendentale Obdachlosigkeit«, die der frühe Lukács der bürgerlichen Welt zuschrieb, verwandelt sich in ganz und gar untragische Formen von Funktionalität und Dysfunktionalität.
Der Globalisierung haftet eine Ambivalenz an, die Hans Blumenberg in kritischem Anschluß an Husserl als Technisierung der Lebenswelt thematisiert.[9] Der nicht zu leugnende Vorzug der Glo36balisierung, die allerdings ihrerseits okzidentale Wurzeln hat und von der weltweit die einen mehr, die anderen weniger profitieren, liegt in der Vervielfältigung von Möglichkeiten. Die zunehmende Mobilität und Flexibilität, die Goethe als »Gewandtheit« bezeichnet, erfaßt gleichermaßen die Sphären von Produktion, Kommunikation, Verkehr, Kunst und Politik, deren Eigengesetzlichkeit zudem unter dem Druck der Ökonomie zu erodieren droht. Der ökonomische Imperativ, der im Stile einer verallgemeinerten Ökonomie endloses Wachstum vorschreibt und in Form von Selbstoptimierung und Selbstvermarktung auch das eigene Subjekt erfaßt, führt nicht zwangsläufig zu Verbesserungen, wenn es um den Einsatz geeigneter Mittel und um die Befriedigung von Bedürfnissen geht. Im Bereich der Kunst warnte Paul Valéry beizeiten vor einer euphorischen Avantgarde, die sich in Form eines schieren automatisme de l’hardiesse (Œuvres, II, 321) an ihrer eigenen Kühnheit berauscht.[10] Die Stärkung des Möglichkeitssinnes könnte einer Lockerung des »Realitätsprinzips« zugute kommen wie im Falle von Musils Ulrich, der beschließt, ein Jahr »Urlaub von seinem Leben« zu nehmen. Doch diese Lockerung schützt nicht vor den Gefahren einer ungehemmten Steigerung des Möglichkeitssinnes, die auf Kosten des Wirklichkeitssinns geht und den unerläßlichen Kontakt mit der Wirklichkeit und den pathischen Charakter der Erfahrung über Gebühr schwächt. Die pathogenen Wirkungen einer drohenden Entwirklichung und Entpersönlichung