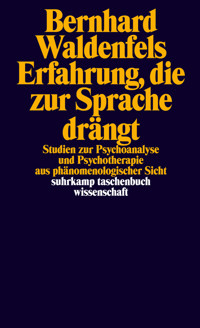
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Unbewusste, das als Fremdes zur Sprache drängt, steht für Nähe und Ferne zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse. Schlüsselthemen sind der Leib, der Andere, die Zeit, Vergessen, Verdrängen, Übergangsfiguren und Übertragung. Strittig ist der Kontrast zwischen Triebwünschen und Fremdansprüchen, der Umschlag von Fremdheit in Feindschaft. Als Kulturanalyse greift die Psychoanalyse über auf Kunst, Religion und Interkulturalität. Fluchtpunkt ist eine responsive Therapie mit dem Leitmotiv der Sorge. Neben Husserl und Freud spielen Goldstein, Merleau-Ponty, Levinas, Lacan, Laplanche, Klein, Winnicott sowie neuere Debatten der Psychoanalyse eine zentrale Rolle in Bernhard Waldenfels' neuem Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
3Bernhard Waldenfels
Erfahrung, die zur Sprache drängt
Studien zur Psychoanalyse und Psychotherapie aus phänomenologischer Sicht
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
Der gemeinsame Grundton der Erfahrung
Husserl und Freud als Initiatoren
Phänomenologische und psychoanalytische Bewegung
Interdisziplinäre Annäherungen
Am Leitfaden des Fremden
Phänomenologische und psychoanalytische Epoché
Eigene Zugangswege
Zur Disposition des Textes
1. Das Fremde und das Unbewußte
1. Jenseits des cartesianischen Dualismus
2. Das Unbewußte als inneres Ausland
3. Grade des Unbewußten
4. Spuren des Fremden
5. Störungen: Sinnentzug
6. Das entsetzte Selbst: Selbstentzug
7. Fremde Botschaft: Fremdentzug
2. Fremdheit in uns, außer uns und zwischen uns
1. Fremdheit als Defizit
2. Urmonade, dyadischer Ursprung und triadische Umwege
3. Fremdheit als Entzug
4. Zwischenleibliche Verflechtung innerer und äußerer Fremdheit
5. Übertragung und Gegenübertragung
6. Schillern zwischen Fremdheit und Feindschaft
7. Blicke und Stimmen aus der Fremde
8. Der Doppelgänger
9. Symbolisierung des Fremden in Bild und Name
3. Lust, Realität und Alterität im Widerstreit
1. Am Anfang war die Störung
2. Syngenese von Lust-Ich und Realität
3. Theorie und Therapie auf dem Boden der Lebenswelt
4. Protogenese und Archäologie
5. Angewiesenheit auf erste Hilfe
6. Die Rolle der Verneinung
7. Widerstand und Widerspruch
4. Psychoanalyse und Religion zwischen eigenen Wünschen und fremden Ansprüchen
1. Konfrontation von Glaube und Unglaube
2. An den Rändern der Normalität
3. Im Sog des Wünschens
4. Verkannte Alterität
5. Im Aufwind des Antwortens
6. Geburt und Tod als An- und Abwesenheit
7. Erfahrung im Rohzustand
5. Kulturanalyse im Reich der Illusionen und Phantasien
1. Nährboden für Illusionen
2. Linderungsmittel gegen die Unbilden des Lebens
3. Traum, Spiel und Kunst im Bannkreis von Wunschphantasien
4. Das Rätsel der ästhetischen Wirkung
5. Im Zwischenreich des Spiels
6. Phantasie in den Spielräumen der Erfahrung
7. Gebundene und freie Phantasien
8. Der Sog der Vergangenheit und die Zugkraft fremder Zukunft
6. Zwischen Kunst und Wahn
1. Kunstbilder und Patientenbilder
2. Urdifferenz von Normalität und Anomalität
3. Das Pathische als Fundus des Ausdrucks
4. Pikturale und klinische Epoché
5. Pathologische Spuren im Bild
6. Proben aus der Sammlung Prinzhorn
7. Bilder als Leidenssymptome
7. Doppelte Fremdheit in der Ethnopsychiatrie und Ethnopsychoanalyse
1. Fremdheit
2. Der Kranke als Fremder
3. Der Kranke als kulturell Fremder
4. Ein Fall von Menschenopfer
5. Der Ethnopsychiater in der Rolle des Dritten
8. Response, Resonanz und Resistenz
1. Vom Pathos zur Response
2. Response oder Resonanz?
3. Leibliche Ansprechbarkeit und Beweglichkeit
4. Resonanz der Sinne und Gefühle
5. Mitbewegung des Leibes
6. Nachmachen und Mitmachen
7. Synkretistische Sozialität
8. Echo und Spiegelung als Verdoppelung des Leibes
9. Response und Resonanz in psychoanalytischer Deutung
10. Responsivität, Irresponsivität und Resistenz
9. Responsive Therapie im Zeichen der Sorge
1. Heilkunde als gemischter Diskurs
2. Sorge als Elixier des Lebens
3. Sorge als Selbstsorge und Gemeinsorge
4. Widerstreit zwischen Selbstsorge und Fremdsorge
5. Therapie zwischen Pathos und Response
5.1. Krankheit als mangelnde Responsivität
5.2. Urszene der ärztlichen Behandlung
5.3. Zeitverschiebung in der Therapie
6. Von der Leiderfahrung zum Krankheitsfall
7. Wiederherstellung der Responsivität
Literatur
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
9Vorwort
»Der Anfang ist die reine und sozusagen noch stumme Erfahrung, die nun erst zur Aussprache ihres eigenen Sinnes zu bringen ist.« (Husserl, Cartesianische Meditationen)
»Das Es […] kann nicht sagen, was es will.« (Freud, Das Ich und das Es)
Anreiz und Anstoß für die folgenden Untersuchungen bilden Herausforderungen, die in erster Linie von der Psychoanalyse ausgehen, aber von da aus auf die weiteren Gebiete der Psychopathologie, der Psychiatrie und der Medizin als einer allgemeinen Heilkunde übergreifen. Philosophische Antworten auf solche Herausforderungen werden in einer Phänomenologie gesucht, die in der Beschreibung und Auslegung der Erfahrung Gestalt annimmt und dabei auf die Unzugänglichkeit von Fremdem stößt. Die wechselseitige Annäherung und Auseinandersetzung, um die es uns geht, wird dadurch erschwert, daß klinische Praxis, psychodynamische Forschung und philosophisches Nachdenken nicht in einem homogenen Raum, sondern auf verschiedenen Ebenen agieren. Doch dies schließt thematische und selbst methodische Überschneidungen nicht aus. Abgesehen davon hat der wechselseitige Austausch eine beachtliche Vorgeschichte, die es mit sich bringt, daß sowohl Psychoanalyse wie Phänomenologie im pluralen Gewande verschiedener Spielarten auftreten. Diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen. Die folgenden Studien versprechen denn auch keine Bestandsaufnahme, sondern Suchaktionen und gezielte Eingriffe.
Der gemeinsame Grundton der Erfahrung
Auf welche Weise lassen sich zwei so heterogene und vielschichtige Unternehmungen wie Phänomenologie und Psychoanalyse aufeinander einstimmen, ohne daß sie ihre Eigenart preisgeben? Die vorangestellten Mottos deuten auf Gemeinsames hin, das über die Maximen eines allgemeinen wissenschaftlichen Ethos hinausgeht. Für beide Ansätze gilt: Es gibt Verschwiegenes, das zur Sprache 10drängt, aber nicht schon von Grund auf in ihr beheimatet ist. Die Worte der Sprache sind Worte, die aus der Fremde kommen und deshalb nie ganz heimisch werden. Was sich in der Erfahrung zeigt, ruft nach einem Sinn, den es nicht vorweg schon hat und der den Widerständen des Nicht-Sinns abzuringen ist. Husserls Phänomenologie und Freuds Psychoanalyse bewegen sich gleichermaßen auf einer Schwelle, die Eigenes von Fremdem trennt und es zugleich an Fremdes bindet.
Doch kaum zieht man die Kontexte der eingangs zitierten Stellen in Betracht, schon sieht man, wie sich die Wege teilen. Bei Husserl geht es solchermaßen weiter: »Die wirklich erste Aussprache ist die Cartesianische des ego cogito.« (Hua I, 77) Also Cartesianismus? Vorsicht, bevor wir uns an Schranken der Egozentrik oder der Egologie ausrichten, sollten wir die Stolpersteine beachten, die Husserl sich selbst in den Weg legt. Das Cogito ist nichts ohne das cogitatum, es ist nichts ohne sein Anderes, von dem es sich in seiner Intentionalität abhängig macht. Und was das Ego betrifft, so beherrscht es nicht die Sprache, es kommt seinerseits zur Sprache; es spricht sotto voce zu sich selbst und über sich selbst, indem es Andere anspricht und Anderes bespricht, indem es von Anderen angesprochen und von Anderem angerührt wird. Dabei ist, sprachlogisch betrachtet, das performative Ich des Aussagens niemals identisch mit dem prädikativen Ich der Aussage. So stellt Jacques Lacan uns permanent vor die Frage: »Wer spricht?« Das qui parle ist mehr als eine Fangfrage, dahinter steht die Urfrage nach der maßgeblichen Instanz des Sprechens. Mit dem Versuch, Ungesagtes zur Sprache zu bringen und darüber hinaus Unsichtbares sichtbar, Unhörbares hörbar, Unauffälliges spürbar zu machen, beginnt das Abenteuer des sprachlichen und sinnlichen Ausdrucks, das die Bild- und Tonsprache ebenso einschließt wie die Körpersprache und die Sprache der Dinge. Wechseln wir über zu Freud, so geht es an der zitierten Stelle wie folgt weiter: Das Es hat »keinen einheitlichen Willen zustande gebracht. Eros und Todestrieb kämpfen in ihm« (Das Ich und das Es, GW XIII, 289). Das Es drängt sich vor, drängt sich uns auf, und dies gilt auch für das »es denkt«, das schon von Lichtenberg mit einem »es blitzt« verglichen wird. Das Ich wird kleinlaut, es ist ein Ich im Werden. Bei Husserl wird daraus ein Vor-Ich, das sich schon vorwagt, wenn »es raschelt«. Phänomenologen und Analytiker bewegen sich auf verschiedenem, aber nicht völlig ver11schiedenem Gelände. Es meldet sich ein gemeinsamer Grundton, wenn man nur genau hinhört. Aber es findet sich nicht leicht eine geeignete Stimmgabel.
Husserl und Freud als Initiatoren
Besinnen wir uns auf die Anfänge von Phänomenologie und Psychoanalyse, so stoßen wir auf zwei Gründerfiguren, die lebenslang kaum voneinander Notiz nahmen – und dies, obwohl sie nahezu gleichzeitig im österreichischen Mähren geboren wurden, Husserl 1859 in Proßnitz/Prostějov, Freud 1856 in Freiberg/Přibor; obwohl beide in den 70er und 80er Jahren die Wiener Lehrveranstaltungen des Philosophen Franz Brentano besuchten; obwohl beide genau um die Jahrhundertwende mit so grundlegenden Werken wie den Logischen Untersuchungen und der Traumdeutung an die zunächst wenig geneigte Öffentlichkeit traten; obwohl ihnen, nach langen Jahren der Forschung, als jüdischstämmigen Wissenschaftlern am Ende ähnliches widerfuhr, da der eine sein Freiburger Haus und seine Universität räumen mußte, der andere aus seiner Wiener Arbeitsstätte ins Ausland vertrieben wurde. Dazu paßt, daß die Gesamtausgabe ihrer Werke im Ausland, einerseits in Den Haag, andererseits in London, ihren Ausgang nahm. Hinzuzufügen ist, daß beide Forscher sich, im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossen – im Falle Husserls auch im Gegensatz zu engsten Mitarbeitern, im Falle Freuds im Gegensatz zu anpassungsbereiten Weggenossen – mit Entschiedenheit sowohl einer lebensphilosophischen Aufweichung wie einer nationalen Aufheizung und totalitären Verkehrung der Vernunft in den Weg stellten. Phänomenologie und Psychoanalyse, »sie scheinen sich zu fliehen«, doch in vielem finden sie sich. Diese Konstellation, in der Nähe sich mit Ferne paart, bietet Anlaß, mit Walter Benjamin über eine latente Ungleichzeitigkeit in der Gleichzeitigkeit nachzudenken, die alles in allem eher die Regel sein dürfte als eine Ausnahme. Was unter der Hand geschieht, entzieht sich der bewußten Planung und wird erst nachträglich im offiziellen Kalendarium verzeichnet, nicht selten auch ver-zeichnet. Die Erwartung, daß die Menschen einst »ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst machen«, beruht auf fragwürdigen Hochrechnungen der Geschichte. Die mangelnde Synchronie, der wir 12hier wie auch sonst begegnen, schließt keineswegs die Möglichkeit aus, verpaßte Gespräche nachzuholen, ja, sie ermuntert uns erst recht dazu.
Von Gründungen oder Stiftungen sprechen wir, wenn außerordentliche Ereignisse als eine Art historische Wasserscheide fungieren: danach fühlt, sieht, denkt, spricht es sich anders als zuvor, ohne daß messerscharfe Grenzen zu ziehen wären. Es sind Ereignisse, die »sich nicht vergessen«, wie Kant der französischen Revolution nachsagte. Als Diskursbegründer oder Diskursstifter, denen laut Foucault auch Freud zuzuzählen ist (2001, S. 1022), gelten jene, deren Wirken und Nachwirken in besonderem Maße dazu beiträgt, die Grenzen des Sagbaren, Denkbaren und Machbaren zu verrücken. Sie finden ihren Ort oder besser gesagt: ihren Nicht-Ort in Übergangszonen. Sie finden ihre Zeit in den Winkeln eines Langzeitgedächtnisses, das im Stillen weiterarbeitet, abseits einer monumentalischen Geschichtlichkeit, der wir spätestens seit Nietzsche zu mißtrauen gelernt haben.
Phänomenologische und psychoanalytische Bewegung
In den folgenden Untersuchungen soll es weniger darum gehen, herauszufinden, wer Husserl oder Freud waren, in welchem sozialen Umfeld und unter welchen Umständen ihr Wirken sich vollzog; dies ist weitgehend erforscht. Vielmehr werden wir uns fragen, wofür ihre Namen heute noch stehen, und diese Frage läßt verschiedene Antworten zu. Das »nach« Husserl und »nach« Freud, das in manche Titel eingegangen ist, hat die changierende Bedeutung von »danach« und »gemäß«, von après und selon. Wir haben es mit Bewegungen zu tun, deren Ursprung im Dämmerlicht liegt und deren Fortgang nicht feststeht. Maurice Merleau-Ponty, einer der Protagonisten der französischen Phänomenologie, schließt das Vorwort zu seiner 1945 erschienenen Phänomenologie der Wahrnehmung mit der Bemerkung, die Phänomenologie sei eher eine Bewegung als ein System und eine Doktrin; er vergleicht sie mit dem mühsam-langwierigen Werk, dem œuvre laborieuse, eines Balzac, Proust, Valéry oder Cézanne. Umgekehrt zieht Freud 1914 unter dem Titel Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung eine Zwischenbilanz, die unter dem Pariser Wappenspruch Fluctuat nec mergitur13steht. Ein solches Wogen bedeutet mehr als die Tatsache, daß etwas eine Weile en vogue ist. Bewegungen dieser Art sind voller Abweichungen, Abzweigungen und Abspaltungen. Wenn Paul Ricœur, der selbst nach Wegen zwischen Husserl und Freud suchte, 1953 in einem Artikel der Zeitschrift Esprit der Phänomenologie nachsagt, sie bestehe zu einem beträchtlichen Teil aus einer »Geschichte von Husserl-Häresien«, so dürfte ähnliches für die Freud-Häresien der Psychoanalyse gelten, bis hin zu den institutionellen Formen, in denen die Gründungsgeschichte ihre mitunter verwirrenden Spuren hinterlassen hat.
Doch wenn es etwas gibt, das imstande ist, solche Bewegungen in Gang zu setzen und in Gang zu halten, so sind es nicht allein, aber in entscheidendem Maße die »Sachen selbst«, jene αὐτὰ τὰ πράγματα, die schon Platon dem endlosen Meinungsstreit entgegensetzte (Gorg. 459b). Was in der Formel »Zurück zu den Sachen!« zum Ausdruck kommt, ist ein Forschungsimpuls, kein Forschungsbestand. Die Tatsache, daß Husserl auf den Höhen der Mathematik, Freud in den Niederungen der Physiologie begonnen hat, zeigt deutlich, wie wenig solch wirkungsmächtige Forschungsimpulse an bestimmte Gegenstände gebunden sind. Kurz nachdem Freud 1929/30 in Wien seinen Essay Das Unbehagen in der Kultur veröffentlichte hatte, hielt Husserl 1935/36 in Wien und Prag, im Vorschatten der deutschen Annexion, Vorträge, in denen er eine Krisis des europäischen Menschentums diagnostizierte, ausgehend von einer Krisis der europäischen Wissenschaften. In der Krisis-Schrift, die daraus hervorging, die 1936 in Belgrad als vorläufiges Fragment und erst 1954 in Den Haag als Band VI der Gesamtausgabe veröffentlicht wurde, erklärt er im Hinblick auf die schlichte Wahrnehmung: »Das ›Ding selbst‹ ist gerade das, was niemand wirklich gesehen hat, da es vielmehr immerfort in Bewegung ist […]« (Hua VI, 167). Heidegger stellt in Sein und Zeit die Phänomenologie vor die Aufgabe, das aufzuweisen, »was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt« (1953, S. 35). Doch das ›Ding‹, von dem hier die Rede ist, ist kein bloßer Grenzbegriff wie das kantische ›Ding an sich‹, sondern Index einer Grenzerfahrung, die darin besteht, daß wir nie gänzlich über das verfügen, was wir vor Augen oder zur Hand haben und was unsere Sinne preisgeben. Was umgekehrt Freud betrifft, so beharrt er in seiner Trieblehre ebenfalls auf den Grenzen der Erfahrung. In der Neuen Folge seiner Einfüh14rungsvorlesungen nennt er die Trieblehre in behutsamer Zurückhaltung »sozusagen unsere Mythologie«; weiter heißt es dann: »Die Triebe sind mythische Wesen, großartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in unserer Arbeit keinen Augenblick von ihnen absehen und sind dabei nie sicher, sie scharf zu sehen.« (GW XV, 101) Auch die Triebe hat also niemand wirklich gesehen. Phänomenologie und Psychoanalyse weisen gleichermaßen weiße Flecken auf, die sich sicherlich nicht decken, die aber doch eine Offenheit der Erfahrung erzeugen, die verwandte Züge aufweist.
Die entschlossene Weigerung, das Was der Erfahrung von dem Wie der entsprechenden Zugangs- und Erscheinungsweise abzutrennen, erzeugt einen Krebsgang, der dazu führt, daß die Forschung, ähnlich wie die zu erforschende Erfahrung, immer wieder auf ihre eigenen Schritte zurückkommt und sich nicht geradlinig einem Ziel zubewegt. Husserl spricht gelegentlich von einer »Zickzackbewegung«, Heidegger von einem »Schritt zurück«. Bei Roland Barthes, einem Grenzgänger zwischen Phänomenologie und Semiologie, gewinnt das Schema des Zickzack, im Gegensatz zur geraden Linie, eine buchstäbliche Bedeutung als »das Widerspiel, der Gegenmarsch, die Widrigkeit, die reaktive Energie, die Verleugnung, die Zurückbewegung einer Hinbewegung, die Bewegung des Z als des Buchstabens des Abweichens« (1978, S. 99). Über Grenzen hinweg zeichnet sich im Laufe der »Arbeit an den Phänomenen« (Husserl 2003) ein gemeinsamer Stil ab, der sich nicht in Thesen bündeln läßt, der jedoch vielfältige Resonanzen weckt.
Interdisziplinäre Annäherungen
Wenn Phänomenologie und Psychoanalyse in all ihrer Vielfältigkeit und Verschiedenartigkeit aufeinanderstoßen, so kann es nicht um einen Vergleich gehen oder um einen Ausgleich, wohl aber um eine wechselseitige Herausforderung und Erprobung, die einen Prozeß der Annäherung auslöst. Auf der einen Seite haben wir die Phänomenologie mit ihrer Analyse von Sinn und Bedeutung und ihrer Beschreibung dessen, was sich zugleich entbirgt und verbirgt, und auf der anderen Seite die Psychoanalyse mit ihrer Analyse, Deutung und Behandlung psychodynamischer Prozesse, die ihren Sinn mit sich führen wie eine Schmuggelware. Die beiden Bewegungen kon15vergieren nicht, da sie kein gemeinsames Ziel verfolgen, doch sie interferieren, sobald sie auf Themen stoßen, bei deren Behandlung ein Zugangsbereich sich mit dem anderen überschneidet. Phänomene sind von Hause aus interdisziplinär oder prädisziplinär; eine disziplinäre Monopolisierung und eine Reduktion auf pure Daten würde sie verkürzen und verfälschen.
Dies gilt für Grundthemen wie Leben und Tod, Liebe und Hunger, Sinnesfreude und Angst, Kindheit und Alter, Wahrheit und Lüge, Mitleid und Neid, Krieg und Frieden; es gilt für Formen der Geselligkeit, für Familienstrukturen, für politische Institutionen in all ihren speziellen Ausformungen. »Die Seele ist auf gewisse Weise alles«, so heißt es in der aristotelischen Schrift Über die Seele. Das Rätsel liegt bis heute in dem »auf gewisse Weise«. Man kann nicht der Philosophie, die das Leben und die Welt im Ganzen fragend umkreist, den Rücken kehren und dennoch Themen und Probleme in Angriff nehmen, die unsere Lebenswelt insgesamt prägen, die sich also nicht auf kulturelle Sonderwelten wie Politik, Ökonomie, Ökologie, Recht, Medizin, Kunst oder Religion aufteilen und nicht aus dem Untergrund einer physischen oder biologischen Natur herleiten lassen. Eine Verdrängung der Philosophie hätte zur Folge, daß die Psychoanalyse sich entweder auf außerklinische Amalgame aus Alltagsvorstellungen und Alltagswünschen verläßt oder sich an Spezialwissenschaften wie Physiologie, Biologie und heutzutage Neurologie anlehnt und sich einer Seelenmechanik oder Seeleninformatik annähert. Freud opponiert mit guten Gründen gegen eine verbreitete Form von Systemphilosophie, die allem und jedem seinen Platz zuweist; doch die Alternative kann nicht lauten: Nicht-Philosophie, sie müßte lauten: andere Philosophie, so wie schon Ludwig Feuerbach in seinen Thesen zur Reform der Philosophie fordert, man solle mit der »Nichtphilosophie« beginnen, um sie in den Text der Philosophie aufzunehmen (1966, S. 135, 244). In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß Maurice Merleau-Ponty eine seiner beiden letzten Vorlesungen, die er 1960/61 am Collège de France hielt und an die ich mich noch gut erinnere, unter den programmatischen Titel »Philosophie et non-philosophie depuis Hegel« stellte. Der französische Phänomenologe bezog sich dabei auf eine implizite oder spontane Form der Philosophie, die den Rahmen der offiziellen Philosophie sprengt und zu der Saussures Linguistik, Prousts Recherche oder Cézannes penser en peinture16ebenso zählten wie Freuds Psychoanalyse. Zu der anderen Art von Philosophie, die sich hier zu Wort meldet, können beide Seiten auf ihre eigene Weise beitragen: eine aus lebendiger Erfahrung schöpfende Philosophie ebenso wie eine methodisch reflektierte Analyse psychischer Prozesse und ihrer pathologischen Auswüchse. Andernfalls liefe die Psychoanalyse Gefahr, zu eng oder zu weit anzusetzen, so daß sie entweder zu einer psychologischen oder psychotechnischen Spezialdisziplin und zu einer kassentauglichen Therapie zusammenschrumpfen oder aber überzogene Ansprüche stellen und übertriebene Erwartungen wecken würde, als sei die Metapsychologie eine Art Fundamentaldisziplin. Der Hiatus, der sich zwischen Metapsychologie und analytischer Praxis mitsamt ihrem alltäglichen Vorfeld auftut, läßt sich weder von der einen noch von der anderen Seite her aufheben.
Die Stärke der Psychoanalyse scheint vielmehr darin zu liegen, daß sie, beginnend mit Traumdeutungen und alltäglichen Fehlleistungen und vordringend ins Feld psychosomatischer Symptome, einer Empirie folgt, die sich nicht in empiristischer Manier auf bloße Tatsachen stützt, und daß sie andererseits theoretische Kategorien und Modelle entwickelt, die sich nicht in rationalistischer Manier über die Erfahrung erheben. In der Psychoanalyse wiederholt sich auf eigentümliche Weise der zweideutige Status der Medizin als einer Disziplin, die zwischen naturwissenschaftlicher Techno-Science und humaner Therapie, zwischen Forschung und Kunstfertigkeit oszilliert. Auf der anderen Seite bietet ein Philosophieren, das als eine radikale Form von Phänomenologie oder Hermeneutik jedem ersten und jedem letzten Wort mißtraut, Chancen für denkerische Interventionen, die sich im Andersdenken, einem penser autrement üben, ohne Hegemonialansprüche zu stellen. Das Feld zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse, in dem sich unsere Überlegungen bewegen, wäre so besehen ein Erprobungsfeld. Für den Zwischenbereich von Philosophie, Psychopathologie und Humanmedizin, in dem die medizinische Anthropologie sich als Brückendisziplin etabliert hat, würde ähnliches gelten.
Vieles von dem Gesagten klingt nach methodologischem Postulat. Fassen wir jedoch die konkreten Bezüge von Phänomenologie und Psychoanalyse, von Philosophie und Medizin ins Auge, so stoßen wir auf wechselnde kulturhistorische und kulturgeographische Konjunkturen, die sich faktisch ergeben und zu verschiedenen 17Gewichtsverteilungen geführt haben. Die Psychoanalyse entfaltete sich bekanntlich im Schatten der Klinik, zunächst beschränkt auf den deutschsprachigen und den ostmitteleuropäischen Bereich, mit dem alten Österreich-Ungarn und der Schweiz als Kernländern. Wenn sich in diesem Anfangsstadium Bezüge zur Philosophie herstellten, so war dies in erster Linie das Verdienst philosophisch geschulter, oft auch phänomenologisch inspirierter Mediziner wie Ludwig Binswanger, Kurt Goldstein, René Spitz, Erwin Straus oder Viktor von Weizsäcker, die sich für die Psychoanalyse erwärmten, aber zumeist auf halbkritische Distanz bedacht waren. Diese spezielle Tradition setzte sich in Frankreich abseits des Mainstreams fort, so etwa bei Henri Maldiney und beim frühen Foucault. Aufs Ganze gesehen nahm die Rezeption in Frankreich jedoch einen anderen Verlauf. An der Freud-Rezeption, die sich mit Freuds Forschungsaufenthalt bei Charcot angebahnt hatte, waren von Anfang an Philosophen und philosophisch geschulte Psychiater wie Henri Ey, Angelo Hesnard, Daniel Lagache oder Eugène Minkowski beteiligt, und dies vor dem Hintergrund einer breiten intellektuellen Öffentlichkeit. Husserl und Heidegger, Hegel und Marx, Kierkegaard und Nietzsche, teilweise auch Bergson und eben auch Freud wurden oftmals im gleichen Atemzug gelesen und verarbeitet. Man lese dazu etwa die 1948 von Merleau-Ponty unter dem Titel Sens et non-sens veröffentlichten Aufsätze, die das Rezeptionsklima der Nachkriegszeit prägnant widerspiegeln. Lacan, seine Anhänger wie auch seine gemäßigten Abweichler haben an dieser Entwicklung großen Anteil, ohne daß die französischsprachige Allianz aus Philosophie und Psychoanalyse sich in der Lacan-Schule erschöpft. Die Weiterentwicklung der Psychoanalyse im englischsprachigen Raum, bei der die Phänomenologie nur eine Nebenrolle spielte, werden wir im folgenden von Fall zu Fall berücksichtigen, wenn Sachfragen dies nahelegen. Dies gilt vor allem für Melanie Klein, Michael Balint, Wilfred Bion und Donald Winnicott, die inzwischen auch in den deutschsprachigen Bereich Eingang gefunden haben. Der Versuch, Brücken zu schlagen zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse, zwingt in jedem Fall zur Selektion, die im vorliegenden Fall von den speziellen Sachinteressen und Vorkenntnissen des Autors mitbestimmt wird. Vieles andere möge weiteren und detaillierteren Untersuchungen überlassen bleiben.
18Am Leitfaden des Fremden
Der Versuch einer Annäherung zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse wirft die Frage auf, welche Art von Phänomenologen sich als besonders zugkräftig erweist und an welchen Stellen ein solcher Versuch anknüpfen könnte. Als Leitfaden bot sich mir das Phänomen des Fremden an, das ich seit langem in zahlreichen Schriften vielfach hin und her gewendet habe. Die Bemühungen um eine adäquate Phänomenologie des Fremden haben mich zunehmend an die Psychoanalyse herangeführt. Ich gehe dabei von der Annahme aus, daß das Unbewußte sich als eine besondere Form des Fremden verstehen läßt. Dies bedeutet, daß in meinem Falle eine bestimmte Spielart der Phänomenologie in den Vordergrund tritt, die ebenso wie die bekannten intentionalen, existentialen oder strukturalen Varianten vom leiblichen und zwischenleiblichen Verhalten ausgeht, darüber hinaus jedoch einen pathisch-responsiven Grundzug aufweist. Die grundlegende Frage lautet dann nicht mehr: auf welchen Sinn ist unser Verhalten gerichtet und nach welchen Regeln richtet es sich, sondern: wovon sind wir leibhaftig getroffen und worauf antworten wir, wenn wir uns in bestimmter Weise zur Welt und zur Mitwelt äußern und verhalten. Dabei stoßen wir auf ein anfängliches Doppelereignis aus Pathos und Response, aus Widerfahrnis und Antwort. Das Pathische weist überdies einen Zug zum Pathologischen auf; denn die Dissoziation beider Glieder, die sich in einer wechselnden Tendenz hin zum Pathos ohne Response oder zur Response ohne Pathos äußert, treibt diverse Pathologien hervor, die einer untilgbaren Verletzlichkeit entspringen.
Entscheidend ist dabei, daß der Bezug auf Fremdes sich nicht als bloßer Mangel darstellt, sondern als Entzug, das heißt als Abwesenheit in der Anwesenheit, als Ferne in der Nähe. Dieser blinde Fleck der Erfahrung ruft Antworten hervor, die sich dadurch auszeichnen, daß sie nicht im Eigenen beginnen, sondern anderswo. Nicht ich beginne, sondern es beginnt mit mir. Somit nimmt die phänomenologische Topik des Fremden Züge einer originären Atopie an. Umgekehrt gelten die Triebe, von denen die Psychoanalyse ausgeht, als unbewußt, sofern sie Kräften der Verdrängung ausgesetzt sind. Dann aber fragt es sich, wie das Un- des Unbewußten zu verstehen ist, ob als purer Mangel oder als ein Überschuß, als ein 19plus ultra. Es kommt also darauf an, wie sich die Freudsche Topik des Unbewußten mit der phänomenologischen Topographie des Fremden zusammenreimt. Die Dynamik, die in der Psychoanalyse freigelegt und freigesetzt wird und die von den tiefsten Tiefen bis in sublime Höhen vorstößt, bemißt sich nicht zuletzt daran, wie das Fremde einzuschätzen ist.
Es sind gewisse Kernmotive, die unsere phänomenologische Sichtung der Psychoanalyse in besonderem Maße bestimmen und sich ihr als eine Art Matrix unterschieben.
Als Basso continuo dient uns die Leiblichkeit, die sich der cartesianischen Scheidung von Geist und Natur, von Seele und Körper widersetzt. Die phänomenologische Differenz von fungierendem Leib und materiellem Körperding stellt uns ebenso wie die psychoanalytische Trieblehre mit ihrer Topik von Ich und Es vor die Frage, wie auftretende Konflikte und Spaltungen sich denken lassen, ohne daß wir in einen dualistischen Engpaß geraten oder umgekehrt in einem Ozean der Gefühle versinken. Das Verhältnis von Sinn und Kraft stellt eine besondere Nagelprobe dar.
Von heiklem Gewicht ist die Alterität, das heißt die spezifische, irreduzible Fremdheit des Anderen. Wiederum ergeben sich analoge Weichenstellungen. Die Phänomenologie, die das Konzept der Intersubjektivität geprägt hat, hatte anfangs mit den Aporien eines transzendentalen oder existentialen Solipsismus zu kämpfen, während sich die Psychoanalyse mit den Vorgaben eines primären Narzißmus und eines Uregoismus auseinanderzusetzen hatte. Eine besondere Rolle spielen hierbei Motive wie das fremde Angesicht, das uns frontal entgegentritt, und die Zwischenleiblichkeit, die uns in einer Zwischenwelt situiert. Die Verschränkung von eigenem und fremdem Erleben, von der die analytische Technik der Übertragung geprägt ist, hat ihr phänomenologisches Pendant in einer synkretistischen Phase des Selbst, in der die soziale Differenzierung nur schwach entwickelt ist. Fremdheit und Eigenheit bilden ein Geflecht, aus dem sich soziale Fäden aussondern. Die klassische Psychoanalyse stellt uns vor die Frage, ob psychopathologische Phänomene primär Symptome eines Triebkonflikts sind, der zu einem Realitätsverlust führt, oder ob sie nicht ebensosehr Symptome einer mangelnden Responsivität sind, die einen Alteritätsverlust nach 20sich zieht. Es gibt neuere Ansätze, die sich geradewegs als Objektbeziehungstheorie, relationale Psychoanalyse oder Interaktionismus, kurz: als Ausdruck einer intersubjektiven Wende zu erkennen geben; doch selbst sie sind daraufhin zu befragen, ob und wieweit sie den Ansprüchen des Anderen gerecht werden. Wiederum geht es um das zugebilligte Maß an Fremdheit.
Weitere Fragen betreffen die Zeitlichkeit der individuellen und gemeinsamen Erfahrung, nämlich das Vor und Zurück von Erinnerung und Erwartung, die Rolle der Nachträglichkeit, die wechselseitige Fremdheit der Generationen, die transgenerative Weitergabe von Traumatisierungen und die produktive Wiederholung im Kontrast zum Wiederholungszwang. Eine radikale Fremderfahrung, die nicht bei sich selbst beginnt, konfrontiert uns mit dem Paradox einer Wiederholung des Unwiederholbaren.
Die Transformation der Erfahrung, in der etwas als etwas vorgestellt und hergestellt und etwas in etwas begehrt wird, verwandelt Reize und Affekte in Wahrnehmungs- und Zielobjekte. Hier fragt es sich, auf welche Weise Freuds Mechanismen der Verschiebung und Verdichtung in einer phänomenologischen Sinnbildung Platz finden, wie Phantasie und Realitätssinn zusammenspielen und auf welche Weise sich die Medien von Bild und Wort sowie digitale Formen der Datenverarbeitung einschalten. Phänomenologie und Psychoanalyse nähern sich so den Künsten, die sich an den Rändern der Worte und Bilder bewegen und dabei die Wort- und Bildlosigkeit streifen.
Phänomenologische und psychoanalytische Epoché
Betreten wir den Boden einer praktizierten Phänomenologie und einer praktizierten Psychoanalyse, so fragt es sich, was den phänomenologischen Blick und die hermeneutische Auslegung mit einer klinischen Diagnose oder einer Gesprächskur verbindet. Wie verhalten sich Theorie und Therapie zueinander? Welche Verpflichtung geht der Dialogpartner ein, welche der Therapeut? Was hat das Irren mit dem Leiden, das Überzeugen mit dem Heilen zu tun? Daß es grundlegende Unterschiede gibt, liegt auf der Hand, dennoch zeigt sich eine bemerkenswerte methodische Verwandt21schaft. Der Einstieg in die phänomenologische Einstellung läuft bei Husserl über eine phänomenologische Epoché, die darauf abzielt, den Bann der natürlichen Einstellung zu durchbrechen und geläufige vorwissenschaftliche und wissenschaftliche Annahmen zu suspendieren. Die phänomenologische Einstellung entspringt einer Umstellung, einem Blick- und Sprachwechsel, durch den Vertrautes verfremdet wird. Der traditionelle Begriff der Urteilsenthaltung erfährt eine Radikalisierung. Die Epoché begnügt sich nicht mit einer Prüfung sachlicher Urteile, sie zielt ab auf eine Enthüllung vorprädikativer Erfahrung und auf eine fiktive Entwirklichung der Wirklichkeit, und dies nicht etwa in der Absicht, den primären Wirklichkeitsglauben umzustoßen, sondern in dem Bestreben, das Geglaubte in die Schwebe zu versetzen, es als solches zu prüfen und zu analysieren. Alte Motive wie die platonische doxa oder der Humesche belief rücken in ein neues Licht. Husserl bekennt sich als Phänomenologe zu einer eigentümlichen »Berufsepoché«, was keineswegs besagt, daß es gleich ist, »ob man Schuster ist oder Phänomenologe« (Hua VI, 140). Was hierin anklingt, sind Max Webers Überlegungen zur Wissenschaft oder zur Politik als Beruf, aber auch Freuds Reflexionen zur Lehranalyse und zur Laienanalyse sind nicht fern.
Wechseln wir über zur Psychoanalyse, so stoßen wir auf eine klinische oder therapeutische Epoché, die der phänomenologischen Variante bis zu einem gewissen Grad ähnelt. Die analytische Praxis stützt sich auf Techniken wie die »freie Assoziation« und die »gleichschwebende Aufmerksamkeit«, die verhindern, daß Analysanden immer nur wiederfinden, was sie bereits kennen oder zu wissen glauben. Hier spinnen sich Fäden an zu einer Phänomenologie der Aufmerksamkeit, die sich hütet, all das, was uns auffällt oder einfällt, was uns erstaunt und erschreckt, als bloße Vorstufe eines aktiven Aufmerkens, als ein bloßes Vorbemerken anzusetzen. Die klinische Epoché verhindert andererseits, daß Analytiker nur hören und sehen, was sie vorweg schon verstehen und begreifen. Wenn bei Husserl so gut wie bei Freud von Techniken die Rede ist, so kann es sich nur um Techniken handeln, die Zurückhaltung üben. Es geht nicht schlicht darum, Fremdes verstehend zu bewältigen und Fremdartiges einer fertigen Wirklichkeit anzupassen, sondern darum, Fremdes geradezu zu provozieren. Gehen wir davon aus, daß jede Berufstätigkeit auf Erlerntes angewiesen ist, so 22stellt sich die Frage, inwieweit Phänomenologie und Psychoanalyse sich tatsächlich professionalisieren lassen. Paul Feyerabends Parole »Wider den Methodenzwang« verdient auf beiden Seiten Gehör.
Die methodische Infragestellung des Selbstverständlichen bewährt sich darin, daß Phänomenologen und Psychoanalytiker sich, wenngleich auf verschiedene Weise, an die Grenzen des Normalen herantasten, indem sie die Scheidung in Normales, Anomales oder Pathologisches nicht als gegeben hinnehmen, sondern sie permanent hinterfragen, wie es uns einst »von ein paar griechischen Sonderlingen« vorgemacht wurde (Hua VI, 336). Die Grenzzonen zwischen dem Normalen und dem Anomalen entpuppen sich als ein Feld, wo Phänomenologie und Psychoanalyse aufeinandertreffen und sich stellenweise überkreuzen. Das Fremde könnte dabei als eine Art missing link fungieren. Die Grenzgänge, in denen Eigenes sich von Fremdem absondert, konfrontieren uns schließlich und endlich mit der alle Disziplinen übergreifenden Rolle des Dritten, der in das Geschehen, das sich zwischen Therapeut und Patienten oder zwischen Lehrer und Schüler abspielt, eingreift, aber nur als indirekter Mitspieler. Die sokratische Maieutik gehört ebenso wie die sokratische Atopie zu den Leitbildern eines Umgangs mit dem Fremden.
Eigene Zugangswege
Der vorliegende Buchtext fügt sich ein in einen größeren Forschungskontext. In ihm setzt sich ein Weg fort, der mich ganz allmählich von der Phänomenologie auf die Bahnen der Psychoanalyse geführt hat. Der Weg begann als ein Umweg. In meinem Fall, der ich aus einem nicht gerade erinnerungsfreudigen Nachkriegsdeutschland kam, wo Vertreibung vielfach durch Vergessen besiegelt wurde, führte der Weg über Frankreich, wo vieles überwintert hatte, was hierzulande keinen rechten Platz mehr fand. Um einige Namen zu nennen: zunächst waren es Maurice Merleau-Ponty und Paul Ricœur, bei denen ich in den frühen sechziger Jahren nach Abschluß meiner Münchener Promotion weiterstudierte; es folgten Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Cornelius Castoriadis, mit denen ich danach in persönlichen Kontakt trat; es ging weiter mit Autoren wie Michel Foucault, Jacques Lacan, Didier Anzieu, 23Jean-Bertrand Pontalis und Jean Laplanche, deren Schriften ich aufmerksam studierte. Auf den Letztgenannten, der meinem eigenen responsiven Ansatz sehr entgegenkommt und dem ich selbst noch 2004 auf einer vom Frankfurter Psychoanalytischen Institut ausgerichteten Tagung begegnet bin, werde ich mich besonders intensiv beziehen. Die breite Rezeption der Psychoanalyse in der französischen Phänomenologie und die gleichzeitige Rezeption der Phänomenologie in der französischen Psychiatrie und Psychoanalyse finden sich dokumentiert in meiner 1983 erschienenen, 1998 mit einem Nachtrag wiederaufgelegten Phänomenologie in Frankreich, insbesondere in Kapitel VIII, 9, in dem die Phänomenologie in Bezug gesetzt wird zur zeitgleichen Psychopathologie, Psychiatrie, Psychoanalyse und Daseinsanalyse.
Bei der Ausarbeitung einer responsiven Phänomenologie des Fremden beschäftigte mich auch das spezielle Verhältnis von Phänomenologie und Psychoanalyse. Dies geschah mit Beginn der achtziger Jahre im Rahmen einer Reihe von Bochumer Seminaren, in die Hans-Dieter Gondek seine besondere Kennerschaft mit einbrachte. Zeugnisse einer fortschreitenden Annäherung sind reichlich über meine Schriften verstreut. Systematische Anknüpfungen finden sich in verschiedenen Buchkontexten, in Antwortregister (1994), Kap. III, 10.9: »Der libidinöse Leib«; in Bruchlinien der Erfahrung (2002), Kap. VII: »Psychoanalytische Aufsprengung der Erfahrung«; in Idiome des Denkens (2005): Kap. 13: »Jean Laplanche: Der verführerische Andere«; in Sozialität und Alterität (2015), Kap. 3: »Angst und Furcht als Ausdruck des Pathischen«, Kap. 4: »Geburt und Tod als Grenzzonen des Mitseins« und Kap. 9: »Transformationen der Erfahrung«.[1] Die schriftliche Beschäftigung mit der Psychoanalyse wurde ergänzt und verstärkt durch Vortragseinladungen in verschiedene Institute der Psychiatrie: Marburg 1985, Essen 1990, Bochum 1995, Düsseldorf, Witten 1996, Stadtlengsfeld 2006, Heidelberg 2001, 2011, 2014-2016 und Liestal 2016. Hierbei standen vor allem der Kranke als eine Figur des Fremden und die Behandlung des Fremden in der Gesprächstherapie im Vordergrund. Diese Bemühungen fanden ihren Niederschlag in 24der Aufsatzsammlung Grenzen der Normalisierung (1998, erweiterte Ausgabe 2008), vor allem in Kapitel 5: »Response und Responsivität in der Psychologie« und Kapitel 6: »Der Kranke als Fremder. Therapie zwischen Normalität und Responsivität«. Eine Einladung an die Universität Bukarest gab mir 1995, nachdem die politischen Barrieren gefallen waren, Gelegenheit, vor rumänischen Kollegen über »Phénoménologie et psychanalyse en France« zu sprechen. Dieser Besuch gehört zu den Kontakten mit dem östlichen Teil Europas, das wie in Polen oder Rußland auf ältere Traditionen zurückblicken kann, die sich aber vor 1989 nur mit Mühe aufrechterhalten ließen. Von besonderer Bedeutung waren für mich Postgraduiertenkurse zum Thema »Phänomenologie und Marxismus«, die ich in den Jahren 1975 bis 1978 gemeinsam mit einem belgischen und einem kroatischen Kollegen am Interuniversitären Zentrum Dubrovnik abhielt.
Zur Disposition des Textes
In der Disposition des Buches spiegeln sich wichtige Etappen jenes Erkundungsganges, mit dem ich als Phänomenologe in das Feld der Psychoanalyse vorgedrungen bin. Grundlegend sind die Kapitel 1 bis 3. Diese Anfangskapitel kreisen um das Motiv des Fremden und das Spannungsverhältnis von Realität und Alterität; sie suchen von da aus nach einem speziellen Zugang zur Psychoanalyse. Das Jenseits des Lustprinzips, das der späte Freud ins Auge faßt, entspricht phänomenologisch gesehen einem Begehren des Anderen als einem zugleich Begehrten und Begehrenden. Freuds Realitätsprüfung schließt so besehen von vornherein eine Alteritätsprüfung mit ein. Das Fremde zerteilt sich seinerseits, wie meine früheren Fremdheitsstudien ausführlich darlegen, auf die verschiedenen Dimensionen einer Fremdheit von Sinn und Ordnung, einer Fremdheit meiner selbst und einer Fremdheit des Anderen. Dabei stellt sich, wie schon angedeutet, die Frage, inwieweit das, was in jüngerer Zeit in der Psychoanalyse als intersubjektive Wende ausgegeben wird, den Anforderungen einer radikalen Phänomenologie des Fremden gerecht wird. Das Phänomen des Fremden begegnet uns gespickt mit Widerhaken, die weiterer Überprüfung bedürfen, darunter das Ineinander von Eigenem und Fremdem in der Übertra25gung und Gegenübertragung, das Oszillieren zwischen Fremdheit und Feindschaft, das Motiv des Doppelgängers, die Verdoppelung von Blick und Wort, die fremde Urhilfe, ferner die Rolle von Verneinung und Widerstand.
In den nachfolgenden Kapiteln betreten wir mit dem späten Freud den Boden einer Kulturanalyse, deren Bezug zur Individualanalyse sich als ebenso problematisch erweist wie das Verhältnis des Ich/Es zum Wir und zum Man, mit dem sich die Phänomenologie des Sozialen und des Politischen abmüht. Die Kulturanalyse setzt in Kapitel 4 bei den Ursprüngen des Religiösen an. Der Freudschen Religionskritik, die der Religion generell pathologische Züge unterstellt, stellt sich eine Religionsphänomenologie entgegen, die das Heilige als ein Phänomen sui generis behandelt. Meine eigene Metakritik schlägt einen indirekten Weg ein, indem sie die Frage nach Gott und dem Göttlichen auf die Perspektive der Alterität verschiebt und das Religiöse als eine Form des Fremden betrachtet. Als maßgeblich erweist sich der Kontrast zwischen eigenen Wünschen und fremden Ansprüchen sowie der Anspruch, der uns aus dem fremden Gesicht entgegenschlägt, dazu die entsprechende Einschätzung des Jüdischen. Methodisch fragen wir uns, ob nicht ›das Religiöse‹ ebenso wie ›das Sexuelle‹ lediglich einen Gesichtspunkt der Erfahrung darstellt und ob wir nicht mit spezifisch mythogenen und religionsaffinen Phänomenen zu rechnen haben, die einer Grauzone angehören.
In Kapitel 5 wechseln die Kulturanalysen über zur speziellen Rolle der Kunst, die von Freud mit Traum und Spiel in eine Reihe gestellt wird. Phänomenologie und Psychoanalyse begegnen sich in der Frage nach der Rolle von Illusionen, nach der Einschätzung der Phantasie, nach ihrem Bezug zur Wirklichkeit, nach der Wirkkraft der Kunst und nach deren Zeitbezug, namentlich nach der Zugkraft einer Zukunft, die allen Planungen vorauseilt. Das anschließende Kapitel 6 zieht beispielhaft Werke aus der Heidelberger Sammlung Prinzhorn heran. Diese konfrontieren uns mit einem Pathos des Fremden, das in der Anomalität von Kunstbildern und Patientenbildern eine sowohl verwandte wie verschiedenartige Gestalt annimmt. So stellt sich die Frage nach einem Zusammenhang von Pathischem, Pathogenem und Pathologischem, der geeignet scheint, die Selbstgefälligkeit einer rein ästhetischen Kunst ebenso zu erschüttern wie die Selbstgenügsamkeit einer reinen Ver26nunft. Die Differenz von Normalem und Pathologischem bildet eine Brücke zwischen der von Husserl wie von Freud ausgehenden Abwehr eines Normalismus, der sich auf einer fertigen Normalität ausruht.
In den Kapiteln 7 bis 9 weitet sich der Blick. Von der Sonderdisziplin der Psychoanalyse, die zunächst im Vordergrund stand, wandert der Blick hinüber zu allgemeineren Fragen der Psychopathologie und der Psychiatrie, um beim generellen Status der Medizin als Heilkunde zu enden. Kapitel 7 befaßt sich mit der Ethnopsychiatrie, beiläufig mit der Ethnopsychoanalyse, wie sie sich von Georges Devereux her entwickelt hat. Das Thema der Fremdheit, das unsere Überlegungen leitet, potenziert sich, wenn Krankheiten die Grenzen der eigenen Kultur überschreiten. Der Fall eines fremdländischen Psychopathen, der seine Tochter als rituelles Opfer darbringt, wirft die Frage auf, ob und wie im Falle ethnischer Störungen das Unbewußte verschiedener Kulturen miteinander kommuniziert und wie interkulturelle Krankheitsphänomene sich beurteilen lassen, ohne daß sie universalistisch überspielt oder kulturrelativistisch eingeebnet werden.
Kapitel 8 bildet eine Einlage, die an eine aktuelle Debatte anknüpft. Response und Responsivität werden mit dem Thema der Resonanz kontrastiert, das von Hartmut Rosa aus soziologischer Sicht ins Zentrum der Weltbeziehung gerückt wurde. Im Gegenzug zu einer vagen Metaphorisierung und einer normativen Überfrachtung dieses Konzepts wird unterschieden zwischen anspruchsgerechten Antworten, die man gibt oder verweigert, und Resonanzen, die sich ausbreiten, immer wenn etwas in Schwingung gerät. Resonanzen werden gewürdigt als Verkörperungen kinetischer und affektiver Antworten, als Spiegelungen und Echowirkungen, denen es allerdings an jener Resistenz fehlt, die von fremden Ansprüchen ausgeht. Die Widerstandskraft konfrontiert uns mit einem Motiv, das in der Psychoanalyse, doch darüber hinaus in jeder kritischen Sondierung der Erfahrung eine wichtige Rolle spielt.
In Kapitel 9 greifen wir das alte Motiv der Sorge auf, das jeder Therapie zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund einer langen Tradition, die vom platonischen Sokrates über Hobbes bis zu Heidegger, Foucault und Levinas reicht, wird die Fremdsorge im Sinne eines professionellen Umgangs mit der Alterität von der bloßen Selbst- und Gemeinsorge unterschieden. Eine responsive Therapie, die 27sich auf Kurt Goldsteins Definition der Krankheit als mangelnder Responsivität stützt, führt mit Levinas, Lacan und Laplanche auf die Spuren einer responsiven Analyse, die ihren Schwerpunkt außerhalb des eigenen Selbst findet. Die Auseinandersetzung zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse erfährt hier eine letzte Zuspitzung.
*
Einige Kapitel dieses Buches gehen auf frühere Vorträge zurück. Die zugehörigen Texte wurden teilweise in einer ersten Fassung veröffentlicht und anschließend für den vorliegenden Band überarbeitet und ergänzt, teilweise sind sie unveröffentlicht.
Veröffentlicht: Kapitel 1: Sigmund Freud Vorlesung, Frankfurt Nov. 2012, veröffentlicht in: Zeitschrift für Psychoanalytische Theorie und Praxis 28 (2013), S. 310-324. – Kapitel 2: Vortrag in Bad Homburg auf der Herbsttagung 2016 der DPV, veröffentlicht als »Verfremdung der Erfahrung in der Psychoanalyse« in: G. Allert u. a. (Hg.), Das Fremde in uns – das Fremde bei uns, Gießen: Psychosozial-Verlag 2017. – Kap. 6: Vortrag auf einer Tagung zur Bilderfahrung anhand der Prinzhorn-Sammlung, Heidelberg 2012, veröffentlicht in: S. Frohoff, Th. Fuchs, St. Micaly (Hg.), Bilderfahrung und Psychopathologie. Phänomenologische Annäherungen an die Sammlung Prinzhorn, Paderborn: Fink 2014. – Kap. 7: Vortrag auf einer Tagung der Transcultural Psychiatry Section der World Psychiatric Association, Wien 2006, veröffentlicht auf englisch in: Schutzean Research, vol. 1 (2009), S. 51-65, auf deutsch in: M. Staudigl (Hg.), Gelebter Leib – verkörpertes Leben, Würzburg: Königshausen & Neumann 2012.
Unveröffentlicht: Kap. 4: Vortrag auf einer Tagung »Religion und Psychoanalyse« im Haus am Dom, Frankfurt 2016. – Kap. 8: Vortrag auf einem Symposium zum Thema »Resonanz« an der International Psychoanalytic University, Berlin 2017. – Kap. 9: Vortrag auf einer Tagung der Viktor von Weizsäcker Gesellschaft zum Thema »Sorge um den Menschen«, Freiburg 2015.
Mein abschließender Dank richtet sich an eine Reihe von Psychoanalytikern und Psychiatern, von denen ich, an verschiedenen Orten wie Berlin, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg, Köln oder Den 28Haag, aus persönlichen Kontakten und aus Einblicken in ihre Werkstatt lernen konnte. Ich nenne an erster Stelle Ilka Quindeau, mit dem jüngst verstorbenen Werner Schneider-Quindeau an ihrer Seite; sie hat mich mehrfach in die Arbeit am Frankfurter Sigmund Freud Institut einbezogen und mich auch zu der Sigmund Freud Vorlesung eingeladen, mit der dieses Buch beginnt. Ich denke ferner an Kolleginnen und Kollegen, die mich zu Tagungen der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung und der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft eingeladen, mit mir diskutiert und meine Versuche 2017 durch die Verleihung des Sigmund-Freud-Kulturpreises gewürdigt haben. Namentlich genannt seien: Gebhard Allert, Herbert Blaß, Werner Bohleber, Horst Brodbeck, Thomas Fuchs, Ortrud Gutjahr, Jürgen Hardt, Maria Johne, Vera King, Ewa Kobylinska-Dehe, Joachim Küchenhoff, Wolfgang Kupsch, Marianne Leuzinger-Bohleber, Johannes Picht, Christa Rohde-Dachser, Jörg Michael Scharff, Eva Schmid-Gloor, Gerhard Schneider, Martin Teising, Christoph E. Walker, Rolf-Peter Warsitz sowie der jüngst verstorbene Pariser Kollege Félix-Guy Duportail.
München, Juni 2018
291. Das Fremde und das Unbewußte
1. Jenseits des cartesianischen Dualismus
Phänomenologie und Psychoanalyse sind zwei Problemfelder von solchem Ausmaß und solcher Vielfalt, daß ein Vergleich ins Leere laufen würde. So geht es im folgenden nicht um einen Vergleich, sondern um eine wechselseitige Annäherung und Auseinandersetzung, die insbesondere in Frankreich eine lange Geschichte hat. In einem ersten Anlauf greife ich zwei Kernmotive heraus, auf seiten der Phänomenologie das Fremde, das Husserl in seinen Analysen der Fremderfahrung neu entdeckt hat, auf seiten der Psychoanalyse das Unbewußte, das für Freud den Angelpunkt von Analyse und Therapie bildet. Die Behandlung dieser Kernmotive verbindet sich mit einer Kritik an dem cartesianischen Dualismus, den Husserl mitverantwortlich macht für eine Krisis der europäischen Wissenschaften (Hua VI, § 67) und der bis heute in offener oder versteckter Form nachwirkt.
Dieser Dualismus, der das Aufkommen der modernen Naturwissenschaften begleitet, führt zu einer dreifachen Spaltung: einer Spaltung der Welt, des Menschen und der Sozialität. Die Welt zerteilt sich zunächst in eine psychisch-mentale Innenwelt und eine physische Außenwelt. Die Innenwelt, die sich von der res cogitans her bestimmt, ist eine Welt des Sinnes, der Ziele und Werte, während die Außenwelt, die von der res extensa geprägt ist, von mechanischen Kausalkräften beherrscht wird. Methodisch entspricht dem die Unterscheidung von Verstehen und Erklären, die für die Wissenschaftskultur des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts nahezu kanonisch ist. – Der Mensch wird sodann in diese Spaltung der Welt hineingezogen. Von innen her erfaßt er sich als Geist, Seele oder Bewußtsein, von außen her als Körperding unter anderen Dingen. Als Bürger zweier Welten gehört er einerseits zu einem Reich des Geistes oder der Kultur, andererseits zur geistesfremden Natur. Der Verkehr zwischen Geist und Natur, der über eine Kluft hinweg läuft, bleibt rätselhaft; er hat alle möglichen Spekulationen ins Leben gerufen, beginnend bei der Zirbeldrüse, der Descartes die Verknüpfung von Seele und Körper zuschrieb, und sich fortsetzend in esoterischen Phantasmen. – Schließlich greift der Dua30lismus über auf den Bereich des Sozialen. Die anderen denkenden Wesen, beginnend beim Alter ego, lassen sich weder in meine Welt integrieren noch in die Außenwelt verbannen. Wo sind sie dann zu finden? Der Weg zu ihnen läuft über eine Sozialwelt, die sich in Eigenwelt und Fremdwelt oder, wie es im 19. Jahrhundert heißt, in Eigenpsychisches und Fremdpsychisches zerteilt. Dabei liegt der Primat bei der jeweils eigenen Welt des Ichs, da nur die eigenen Erlebnisse direkt zugänglich sind und fremde Erlebnisse, die wir other minds zuschreiben, sich nur indirekt erschließen lassen. Noch die Einfühlung, die inzwischen in der sprachlichen Form der ›Empathie‹ zu uns zurückgekehrt ist und durch die Entdeckung von Spiegelneuronen großen Auftrieb erfahren hat, zehrt von dieser Erbschaft und kämpft mit ihr. Wie fühle ich mich in den Anderen ein oder hinein?
Jede Wissenschaft, die unsere gemeinsame Lebenswelt überspringt, nähert sich jedoch der Science-fiction, was keineswegs ausschließt, daß deren Folgen alles andere als fiktiv sind. In seiner Krisis-Schrift, die in den dreißiger Jahren entstand und sich aus phänomenologischer Sicht mit der Krisis der europäischen Wissenschaften befaßt, kommt Edmund Husserl auch auf die cartesianisch geprägte Ausgangslage zu sprechen. Der Begründer der Phänomenologie hat selbst als Mathematiker begonnen, und er weiß, wovon er spricht, wenn er feststellt: »Ein metaphysischer Rest liegt darin, daß die Naturwissenschaftler die Natur für konkret halten und die Abstraktion übersehen, in der ihre Natur zum wissenschaftlichen Thema gestaltet worden ist.« Was wir konkret erfahren, sind nämlich wir selbst als Menschen, die wir leibhaftig miteinander in einer natürlich vorgeprägten und kulturell gestalteten Welt leben. Der Ausdruck ›Lebenswelt‹, der sich inzwischen eingebürgert hat, stellt strenggenommen einen Pleonasmus dar. Er verdankt seine Bedeutung der Gegenstellung zu einer szientistisch ausgedünnten Welt. Solange die naturwissenschaftliche Abstraktion, die sich auf bloße Körperlichkeit beschränkt, den Lebensbereich ausspart, bedarf sie einer »ergänzenden Abstraktion«, aus der das verbleibende Innenleben als das rein Psychische hervorgeht (Hua VI, 231). Doch die Zusammenfügung zweier Abstraktionen führt zu keiner Konkretion. So bleibt nur die Bastelei. Es bilden sich Extremformen; dem Psychologismus oder Mentalismus tritt ein Physikalismus, dem Subjektivismus ein Objektivismus gegenüber, wobei 31beide Seiten einander das Feld streitig machen. Oder es kommt zu Mischformen wie in der Philosophie des Unbewußten von Eduard von Hartmann, die von einer »Phänomenologie des Unbewußten« zu einer »Metaphysik des Unbewußten« ansteigt, beginnend mit einer »Leiblichkeit«, die in der Annahme so monströser Dinge wie einem »Hirnwillen« und einem »Ganglienwillen« (1923, S. 55) mit der physiologischen Körperlichkeit verschmilzt. Das eigentümliche Kauderwelsch, das daraus entsteht, hatte einst einen vitalistischen Beiklang, der mit der Vieldeutigkeit des ›Lebens‹ spielte; heute kehrt es wieder in neurophilosophischem Gewande, wenn das Gehirn wie ein neu erdachter Homunkulus denkt, bewertet und entscheidet oder mit anderen Gehirnen kommuniziert. Kein neues Menschenbild, bemerkt Peter Janich zur neueren Sprache der Hirnforschung (2009). In die neuzeitliche Bastelstube gehört auch die Vorsicht, mit der Freud sich in seinem frühen Entwurf einer Psychologie (GW Nachtragsband, S. 426) an den »Nebenmenschen« heranpirscht; darunter versteht er ein »Objekt«, das »gleichzeitig das erste Befriedigungsobjekt, im ferneren das erste feindliche Objekt ist, wie die einzig helfende Macht. Am Nebenmenschen lernt darum der Mensch erkennen.« Dieses einzigartige Objekt schleppt zwei »Bestandteile« aus der cartesianischen Erbschaft mit sich, »von denen der eine […] als Ding beisammenbleibt, während der andere durch Erinnerungsarbeit verstanden, d. h. auf eine Nachricht vom eigenen Körper zurückgeführt werden kann«. Der Ausdruck »Nebenmensch« ist mit Bedacht gewählt; denn ein »Mitmensch« wäre schon des Guten zuviel, er würde mich meines zumindest methodischen Privilegs berauben.
Doch eine Revision des herkömmlichen Cartesianismus ist seit langem im Gange. Innerhalb der jüngeren Philosophie hat die Phänomenologie daran ihren großen Anteil, aber auch Autoren wie William James, Mead, Peirce, Whitehead, Bergson oder Wittgenstein haben zu einem Umdenken geführt. Maurice Merleau-Ponty, der renommierte französische Phänomenologe der Leiblichkeit, äußerte in einem Arbeitsentwurf von 1952 (dt. 2000, S. 13) die Erwartung, »daß sich uns, diesseits des reinen Subjekts und des reinen Objekts, so etwas wie eine dritte Dimension eröffnet, wo unsere Aktivität und unsere Passivität, unsere Autonomie und unsere Abhängigkeit einander nicht mehr widersprechen«. Diese dritte Dimension findet ihren adäquaten Ausdruck in einer Phänome32nologie der Leiblichkeit und der Zwischenleiblichkeit. Die Leiblichkeit bildet keinen Sonderbereich, der weiterhin der Ergänzung bedürfte, sondern ähnlich wie die Sprache bildet sie eine Sphäre der Vermittlung. Dies gilt auch für den Leib als Geschlechtswesen, dem Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung ein eigenes Kapitel widmet; der Leib weist als être sexué eine »erotische Struktur« auf, entfaltet eine »sexuelle Initiative«, versetzt uns in eine »erotische Situation« und zielt in der »erotischen Wahrnehmung« auf einen anderen Leib ab (Merleau-Ponty 1966, S. 187 f.); somit bildet er die Quelle einer permanenten »Metamorphose« (S. 197). Wie zuvor schon Husserl formuliert hat (Hua IV, 286), fungiert der Leib als eine »Umschlagstelle«, an der nicht nur Kulturelles und Natürliches, sondern auch Eigenes und Fremdes ineinander übergehen. Unser leibliches Selbst stellt sich dar als ein Leibkörper und Mitleib, das heißt als ein changierendes Gebilde aus Eigenleib und Fremdkörper, aus Eigenleib und Fremdleib. Für Phänomenologen resultiert daraus ein Austausch mit den Wissenschaften, und zwar derart, daß die Forschung ihren Platz findet zwischen den Extremen eines naturalistischen Fundamentalismus und eines sinnentleerten Funktionalismus oder eines Digitalismus, der produzierte Daten als Gegebenheiten des Bewußtseins oder der Erfahrung behandelt.
Im Bruchstück einer Hysterie-Analyse, einem besonders phänomennahen Text aus der Frühzeit, nähert sich Freud der phänomenologischen Sichtweise. Bezüglich der hysterischen Konversion, nämlich der Übertragung der rein psychischen Erregung ins Körperliche, die sich bei der Patientin Dora in Hustenanfällen und Stimmverlust äußert, spricht er von einem »somatischen Entgegenkommen«; dies besagt, daß somatische Vorgänge eine psychische Bedeutung, einen wiederholbaren Sinn und einen symbolischen Ausdruck annehmen. Die betont antidualistisch, aber dennoch nicht monistisch geprägte Passage lautet so: »Diesen Sinn bringt das hysterische Symptom nicht mit, er wird ihm verliehen, gleichsam mit ihm verlötet, und er kann in jedem Falle ein anderer sein, je nach der Beschaffenheit der nach Ausdruck ringenden unterdrückten Gedanken.« (GW V, 200) An anderer Stelle heißt es: »Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen« (ebd. 240). Ernest Jones sieht im »somatischen Entgegenkommen« eine Nähe zur »physiologischen Resonanz« im Sinne von Herbart 33(1984, Bd. 1, S. 430). Gleichwohl zeigen sich darin Spuren einer leiblichen Responsivität, die von Anfang an über rein körperliche Reaktionen hinausgeht. Hierzu paßt Freuds Konzeption des Triebs als eines Geschehens, das nicht bloß nach Kausalgesetzen abläuft und sich nicht wie bei Descartes als bloße permixtio mentis cum corpore (VI. Meditation, AT VII, 81) bestimmt, sondern als ein »Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinnern stammenden, in die Seele gelangenden Reize, als ein Maß der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist« (GW X, 214). Die Dynamik der Triebe verhält sich nicht nur neutral gegenüber dem Dualismus von Bewußtsein und Körper, sondern auch gegenüber der Unterscheidung von Sozialem und Biologischem (Pontalis 1968, S. 181). Darin nähert sich der psychoanalytische Trieb dem Status des phänomenologischen Leibes.
Paul Ricœur versucht diesen Grenzbereich mit methodischer Diskretion zu erschließen, indem er die Psychoanalyse als einen aus Energetik und Hermeneutik »gemischten Diskurs« versteht (1969, S. 79). Es fragt sich jedoch, wie diese Mischung zustande kommt. Der Weg dorthin führt über einen methodischen Doppelschritt. Der phänomenologischen Epoché als einer Reduktion auf das Bewußtsein, die alles Erfahrene auf seinen Sinn zurückführt, tritt eine umgekehrte, antiphänomenologische und antihermeneutische Epoché gegenüber, die als Reduktion des Bewußtseins alles auf sinnfreie Kräfte zurückführt (S. 132). Diese methodisch gefaßte Dualität bliebe jedoch in einem methodologischen Dualismus stecken, würden Hermeneutik und Energetik einander gleichgewichtig gegenübertreten. Die Kluft zwischen den beiden Diskursordnungen scheint überwunden, sobald man sich klarmacht, »daß die Energetik durch eine Hermeneutik hindurchgeht und daß die Hermeneutik eine Energetik entdeckt« (S. 79). Damit öffnet sich für Ricœur der Weg zu einer Semantik des Begehrens, die in einem ersten Schritt ein Loslassen (déprise) des Bewußtseins und ein Ablassen vom Sinn bewirkt, um in einem zweiten Schritt die Wiederaufnahme (reprise) des Sinns und das Bewußtwerden des Unbewußten zu bewerkstelligen (S. 434).
Diese wohldurchdachte Mischung aus Hermeneutik und Energetik, die auf eine Vermählung abzielt, hinterläßt jedoch die Frage, worin denn die gesuchte Wiedervereinigung von Sinn und Kraft, 34von Geist und Natur wurzelt, wenn nicht in einer vorgängigen, vom Geist bestimmten Einheit à la Hegel. Worin besteht denn die »Bindung der Kraft an den Sinn«, und was bedeutet die Annahme von »Kräften auf der Suche nach einem Sinn«, die den Anschein erweckt, den Kräften würde etwas ermangeln? (S. 161) Formulierungen dieser Art klingen nach einer Para-Physik. Gilbert Ryle sprach einst von einer »paramechanischen Hypothese«, die es uns mittels eines Kategorienfehlers erlaubt, Ausdrücke für geistige Vorgänge mit Ausdrücken für physische Vorgänge durch die Konjunktion »und« zu verbinden (Ryle 1969, S. 17-24). Was Ricœur betrifft, so gibt er sich keineswegs mit einem solchen psychophysischen Flickwerk zufrieden. Freuds Originalität sieht er darin, daß der »Punkt des Zusammenfallens von Sinn und Kraft« in das Unbewußte verlegt wird (S. 145). Bedeutet dies also, daß die Deckung beider Momente, jenseits von subjektivem Sinn und objektiver Kraft, im Bereich des Leiblichen zu suchen ist? Doch dazu äußert sich der Autor an einer anderen Stelle in einer immer noch recht cartesianisierenden Diktion: »Der Phänomenologe sagt nicht, daß das Freudsche Unbewußte Körper ist; er sagt lediglich, daß die Seinsweise des Körpers, insofern er weder Vorstellung in mir noch Ding außer mir ist, das ontische Modell für jedes denkbare Unbewußte ist.« (S. 391, Hervorhebung B. W.) Wäre es so, so wäre das Unbewußte am Ende realiter auf sich selbst angewiesen.
Die methodisch gefaßten Differenzen führen bis an eine Erfahrungsschwelle, die sie nicht überschreiten. Von dieser Verlegenheit können uns nur die ›Sachen selbst‹ heilen. Das Leibliche zeichnet sich nämlich gleich dem Unbewußten und dem Fremden dadurch aus, daß wir nur dann mit ihm in Berührung kommen, wenn wir von ihm ausgehen, ohne es binären Unterscheidungen wie Innen und Außen, Sinn und Kraft zu unterwerfen und ohne dauernd zwischen Klinik und Labor, zwischen Pathischem und Physiologischem hin- und herzuwechseln. Die Nähe von Leib und Unbewußtem würde schlichtweg daher rühren, daß es ein leibliches Denken gibt, genauso wie es ein unbewußtes Denken gibt, und zwar derart, daß eines sich mit dem anderen verschränkt. Was ›sich gibt‹ ist etwas, das ›sich zeigt‹, es ist aufweisbar, nicht beweisbar.
Der Zwischencharakter des Leibes, den wir im Auge haben und der mit der Fremdheit des Unbewußten korrespondiert, geht über den bloßen Leib hinaus. Er verdichtet sich in Form von Zwischen35dingen, von »Übergangsobjekten« im Sinne von D. W. Winnicott. Freud nähert sich dieser affektiven Besetzung von Dingen über den Fetischismus, der Fuß oder Schuh, Pelz oder Samt mit einer sexuellen Bedeutung ausstattet (GW XIV, 314). Daß diese Übergangszone über das individuelle Triebleben hinaus ökonomische, politische und allgemein kulturelle Formen annimmt, deutet sich an, wenn schon Marx die Ware mit einem der Ethnologie entlehnten sakralen Ausdruck als Fetisch bezeichnet.[1] Es ist bemerkenswert, daß Merleau-Ponty schon in seinem 1942 erschienenen Frühwerk Die Struktur des Verhaltens, lange vor der Ausrufung des cultural turn, den natürlichen mit dem kulturellen Leib zusammendachte, unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Husserls genetische Leibkonzeption (1976, S. 244), und daß er in der vorletzten Zeile von Das Sichtbare und Unsichtbare in Anschluß an Marx jeden historischen Gegenstand als Fetisch anspricht (1986 S. 344). Phänomenologisch betrachtet bedeutet der Zwischencharakter des Leibes, daß der Selbstbezug des eigenen Leibes mit einem Zugleich von Selbstentzug und Fremdbezug einhergeht. Der Leib ist immer nur mehr oder weniger unser eigener, wie sich schmerzlich zeigt, wenn er uns in der Müdigkeit oder der Altersschwäche seine Dienste versagt, wenn er durch Krankheit verunstaltet wird oder wenn er unter fremder Gewalt leidet. So beginnt die Fremdheit am eigenen Leib, und die Fremdheit der Anderen hat ihr Pendant in der Fremdheit meiner selbst.[2]
In der von Freud inaugurierten Psychoanalyse ist es das Unbewußte, das den cartesianischen Dualismus untergräbt. Der Mensch, der als Ich nicht Herr ist im eigenen Hause (GW XI, 295), sieht sich einer Selbsterfahrung ausgeliefert, die er niemals völlig beherrscht 36und durchschaut, so daß es ihm nicht gelingt, das Unbeherrschte und Undurchschaute von sich abzuschütteln wie einen bloßen Erdenrest. Als Unheimliches sucht uns das Fremde buchstäblich heim, es nistet heimlich im eigenen Heim. Freud macht sich die in der deutschen Sprache gegebene Verwandtschaft von ›heimisch‹ und ›heimlich‹ zunutze (GW XII, 231); schon das gewöhnliche Haus wird zum »Haus, in dem es spukt« (ebd. 255), in dem fremde Geister und Gespenster ihr Unwesen treiben.[3] Die Grundhypothese, an der sich unser Austausch zwischen Phänomenologie und Psychoanalyse ausrichtet, lautet demgemäß: Das Unbewußte läßt sich deuten als eine bestimmte Form des Fremden. In alltäglichen Fehlleistungen, in der Körpersprache der Symptome, in individuellen und kulturellen Leidensformen findet das Leben des affektiv besetzten Leibes seinen indirekten Ausdruck.
Diese Lesart kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß bei Freud eine Spannung besteht zwischen den Befunden der klinisch erschlossenen Erfahrung und den theoretischen Erklärungsmodellen, die vielfach vom Psychologismus und Physikalismus des 19. Jahrhunderts geprägt sind. Was die klinische Forschungspraxis angeht, so bekennt Freud im Nachwort zu dem zitierten Bruchstück einer Forschung: »Ich kann nur versichern, daß ich, ohne einem bestimmten psychologischen System verpflichtet zu sein, an das Studium der Phänomene gegangen bin, welche die Beobachtung der Psychoneurotiker enthüllt […].« (GW V, 276) Diese Versicherung ist, selbst wenn sie in mancherlei Hinsicht ein Versprechen bleibt, nicht meilenweit entfernt von Husserls Geist einer philosophischen ἐποχή





























