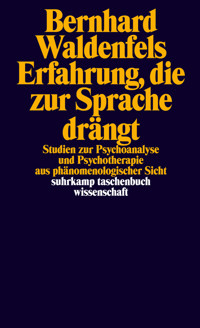21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hyperbolische Erfahrungen sind Steigerungsformen, in denen das, was sich zeigt, über sich selbst hinausgeht. Hyperphänomene überqueren Schwellen des Fremden, ohne sie zu überwinden. Sie tauchen in vielerlei Gestalt auf. Als Unendliches, Unmögliches, Unsichtbares oder Unvergessliches sprengen sie den Rahmen der Erfahrung. In der offenen Form von Gabe, Stellvertretung, Vertrauen und Gastlichkeit knüpfen sie soziale Fäden, die der normativen Regelung entgleiten und in den Exzessen der Gewalt zu zerreißen drohen. In der Fremdheit des Religiösen erreicht die Transzendenz ein eigenes, aber auch strittiges Gewicht. Methodisch verlangt die Hyperbolik nach einer indirekten Beschreibung, die aufzeigt, was sich dem direkten Zugriff entzieht. Sie bewegt sich an den Rändern der Phänomenologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hyperbolische Erfahrungen sind Steigerungsformen, in denen das, was sich zeigt, über sich selbst hinausgeht. Hyperphänomene überqueren Schwellen des Fremden, ohne sie zu überwinden. Sie tauchen in vielerlei Gestalt auf. Als Unendliches, Unmögliches, Unsichtbares oder Unvergeßliches sprengen sie den Rahmen der Erfahrung. In der offenen Form von Gabe, Stellvertretung, Vertrauen und Gastlichkeit knüpfen sie soziale Fäden, die der normativen Regelung entgleiten und in den Exzessen der Gewalt zu zerreißen drohen. In der Fremdheit des Religiösen erreicht die Transzendenz ein eigenes, aber auch strittiges Gewicht. Methodisch verlangt die Hyperbolik nach einer indirekten Beschreibung, die aufzeigt, was sich dem direkten Zugriff entzieht. Sie bewegt sich an den Rändern der Phänomenologie.
Bernhard Waldenfels ist Professor emeritus für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt erschienen: Sinne und Künste im Wechselspiel (stw 1973), Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen (stw 1952) und Antwortregister (stw 1838).
Bernhard Waldenfels
Hyperphänomene
Modi hyperbolischer Erfahrung
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 3-978-518-78940-7
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
1. Diesseits und Jenseits
1. Hinübergehen
2. Weltall ohne Außen
3. Über das Sein hinaus
4. Innen versus Außen
5. Selbstüberschreitung
6. Ambivalenz des Überschreitens
7. Hinübergehen und Herüberkommen
8. Überschreitungen und Überschüsse
9. Vielfältige Transzendenzen
2. Aporien des Unendlichen
1. Ambivalenz von Endlichkeit und Unendlichkeit
2. Endlichkeit der Erfahrung im Sog ihrer Verunendlichung
3. Erfahrungshorizonte
4. Erinnern und Vergessen
5. Sprachbarrieren
6. Unendliche Ansprüche
3. Spielräume des Möglichen und Überschüsse des Unmöglichen
1. Die Zwiespältigkeit des Unmöglichen
2. Allmacht des Gedankens
3. Privative Unmöglichkeit
4. Vorläufige Unmöglichkeit
5. Hyperbolische Unmöglichkeit
Wirkendes Pathos – Unmögliches als Enklitikon – Verfremdungsfiguren – Unausweichlichkeit und Abgründigkeit – Vorzeitigkeit und Nachträglichkeit
6. Das Paradox des Unmöglichen
4. Unsichtbares, das sich dem Blick entzieht
1. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit
2. Welt der begrenzten Sichtbarkeit
3. Die Unsichtbarkeit des Fremden
4. Sichentziehen
5. Entzug und Anziehung
6. Unfaßlichkeit des eigenen Leibes und des fremden Blicks
7. Sichtbarmachen des Unsichtbaren
5. Unvergeßliches, das sich dem Erinnern entzieht
1. Platon: Im Aufschwung der Anamnesis
2. Aristoteles: Verkörperung von Gedächtnis und Erinnerung
3. Augustinus: Allgegenwart der Memoria
4. Das verleugnete Vergessen
5. Urvergessen und Urwiederholung
6. Leibkörpergedächtnis
7. Primäres und sekundäres Erinnern und Vergessen
8. Gedächtnisstörungen und Erinnerungsleiden
9. Unvergeßliches und Unerinnerbares
6. Indirekte und paradigmatische Beschreibung
1. Direkt aufweisende Beschreibung
2. Konzepte indirekter Beschreibung
3. Phänomenologische Reduktionen
4. Proben indirekter Beschreibung
5. Zum Beispiel
6. Beispielhafte Erfahrungen
7. Beispiellose Widerfahrnisse
7. Mehr als nötig und geschuldet
1. Bedarf und Überschuß
2. Schmuck und Glanz
3. Geben, Nehmen und Haben
4. Tauschen und Schenken
5. Gabe ohne Tausch, Tausch ohne Gabe
6. Synkretismus des Gebens und Anökonomie der Gabe
8. An Stelle von…
1. Über Einfühlung und Mitgefühl hinaus
2. Das Rätsel der Stellvertretung
3. Normale Stellvertretung
4. Originäre Stellvertretung
5. Figuren der Stellvertretung
Rechtsanwalt – Therapeut – Übersetzer – Zeuge – Feldforscher
9. Im Vertrauen auf…
1. Vertrautheit und Glaubwürdigkeit
2. Kampf gegen das Mißtrauen
3. Verteiltes und gemischtes Vertrauen
4. Gefahr und Risiko
5. Riskantes Vertrauen
6. Mangelndes Fremdvertrauen
7. Vertrauen zwischen uns
Fremdeinstellung und Fremderwartung – Gefährdetes Vertrauen und Mißtrauen – Vertrauen schenken als Vertrauensvorschuß – Vertrauen wecken als Vertrauensbildung
8. Vertrauensgeschichte und Vertrauenssphäre
9. Institutionelles und habituelles Vertrauen
10. Fremdheit, Gastfreundschaft und Feindschaft
1. Der Fremde im Zwielicht
Relative und radikale Fremdheit – Zweideutigkeit des Fremden – Zweideutigkeit des Zwischen – Verflechtung von Eigenem und Fremdem – Iterierte Fremdheit – Fremdheit als Pathos
2. Der Gast – der Fremde auf der Schwelle
3. Der Feind – der Fremde am anderen Ufer
11. Metamorphosen der Gewalt
1. Paradox der vernichtenden Gewalt
2. Schleichwege hybrider Gewalt
Brutstellen der Gewalt – Mechanismen der Gewaltausübung – Wirkungsfelder der Gewalt
3. Ausbrüche exzessiver Gewalt
12. Vergleichen des Unvergleichlichen – eine interkulturelle Gratwanderung
1. Das Dilemma des Vergleichens
2. Der Prozeß des Vergleichens
3. Interkulturelles, das dem Vergleich vorausgeht
4. Transkulturelles, das den Vergleich übersteigt
13. Religiöse Transzendenz
1. Schwierigkeiten beim Reden von Religion
2. Religiöse Phänomene
3. Religiöse Leitdifferenz
4. Religiöse Erfahrung zwischen Pathos und Response
5. Religion zwischen Kultus und Logos und die Zweideutigkeit der Theologie
6. Rückzug der Götter und Desakralisierung der Welt
7. Religion unter Generalverdacht
8. Derivate und Residuen
9. Religion als Gefühl
10. Das Göttliche und der Gott
11. Weltordnung, Schöpfung und Erlösung
12. Mystik, Charisma und Institution
13. Das Dilemma einer Religionsphänomenologie
14. Religionsphänomenologie modo obliquo
Literatur
Namenregister
Sachregister
9Vorwort
Der vorliegende Band ist Teil einer Trilogie, deren Schwerpunkt in der Organisation der Erfahrung liegt. Es geht um Modi der Erfahrung, die sich weder auf vorgegebene Daten noch auf ein kategoriales oder normatives Programm zurückführen lassen. Erfahrung steht und fällt damit, daß sich etwas als solches zeigt. Dieses phänomenologische oder hermeneutische Als artikuliert sich in Sinngebilden, Strukturen, Gestalten, Praktiken und Affektionsweisen; es breitet sich aus in Sinnhorizonten, Kontexten, Handlungsfeldern und Stimmungslagen; es oszilliert zwischen Wiederholung und Überraschung. Die daraus resultierenden Ordnungen erweisen sich als kontingent in dem Maße, in dem etwas so und nicht anders erscheint, aber auch anders erscheinen könnte. Im Einklang mit James, Bergson und Husserl orientieren wir uns an einer starken Form der Erfahrung, die ihrer selbst nicht Herr ist, in der Anwesenheit und Abwesenheit sich verschränken und die uns immer wieder in Situationen führt, in denen wir mit Wittgenstein gestehen müssen: »Ich kenne mich nicht aus.« Während die zwei ersten Bände unserer Trilogie sich mit Verschiebungen in Ort und Zeit und mit dem Wechselspiel von Sinnen und Künsten befassen, geht es nun um Hyperphänomene, die einer Vielfalt hyperbolischer Erfahrungen entspringen. In Anlehnung an die phänomenologische und hermeneutische Grundformel, von der wir ausgingen, läßt sich das Hyperbolische wie folgt umschreiben: Etwas zeigt sich als mehr und als anders, als es ist. Darin liegt ein Paradox, das an die Identität von Dingen und Bezugsobjekten, aber auch an die Identität unserer selbst und aller anderen rührt: Jemand ist zugleich mehr und anderes, als er oder sie ist. Was hier auf dem Spiel steht, läßt sich weder als bloßer Teil einem Ganzen einordnen noch als bloßer Fall einem Gesetz unterordnen. Es steht quer zu allen Ordnungen. Damit nähern wir uns einem Gebiet, das höchst umstritten ist. Bei den einen erregt es den Verdacht, man wolle den harten Anforderungen des Hier und Jetzt ausweichen; bei anderen weckt es übertriebene Erwartungen, als sei drüben zu finden, was hier fehlt.
Die Hyperbolik, die wir im Auge haben, steht für eine Bewegung des Über-hinaus. Es handelt sich um ein altvertrautes Motiv, 10das unter verschiedenen Namen an den Rändern großer und kleiner Ordnungen oder auch in ihrer Mitte auftaucht. Die speziellen Formen der rhetorischen und der mathematischen Hyperbel sind nur die Spitzen eines Eisberges, der sich aus einem Meer religiöser Vorstellungen, metaphysischer Denkversuche, politischer Entwürfe und künstlerischer Gestaltungen erhebt. Nur einiges davon werden wir zur Sprache bringen. Dabei wird sich zeigen, wie schwierig es ist, für das Hyperbolische einen gemäßen Ort zu finden.
Dies gilt schon für die klassischen Formen der Metaphysik. Hier steht das Hyperbolische im Schatten eines allumfassenden Ganzen, das dazu tendiert, alles Überschüssige in einen Vorschuß zu verwandeln, der durch die Entfaltung des Ganzen eingelöst wird. Einem vollendeten Ganzen kann man nichts hinzufügen, noch kann man etwas von ihm wegnehmen. Das Hyperbolische wird ferner überschattet von einem alles überragenden Höchsten oder Letzten, das alle Überschritte zu Vorstufen einer auf ein letztes Ziel hinstrebenden Aufwärts- oder Vorwärtsbewegung herabsetzt. Die gleichzeitige Eingliederung und Mäßigung des Hyperbolischen ist Merkmal einer jeden Ordnung, die sich als allumfassend darstellt. Die Bewertung des Hyperbolischen ändert sich nur zum Teil, wenn in der Moderne der Mensch sein Schicksal in die eigene Hand nimmt und als autonomes Subjekt Grundrisse einer allgemeinverbindlichen Gesetzlichkeit entwirft. Bei Kant wird die transzendentale Analytik der Begriffe zwar überhöht durch eine transzendentale Dialektik der Ideen, doch regulative Ideen haben immer noch etwas von Vorschüssen auf Kredit. Eine transzendentale Hyperbolik wäre strenggenommen ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wenn das Hyperbolische darin besteht, daß etwas über die Grenzen der jeweiligen Ordnung hinausgeht, so läuft die Frage nach allgemeinen und notwendigen Möglichkeitsbedingungen ins Leere. Damit wächst die Neigung, sich an das Gegebene (datum) und Gebbare (dabile) zu halten und den Rest auf sich beruhen zu lassen. Ockhams Razor fungiert nicht nur, aber auch als ein Instrument der Dehyperbolisierung, ähnlich den Normalitätsrastern, die der pragmatischen Beschneidung der Phänomene dienen. Überschüssiges tendiert hin zum Überflüssigen, Zuviel und Zuwenig halten sich die Waage. Antipodisch zu diesem Ausgleichsstreben verhält sich eine entfesselte Form von Hyperbolik, die über alles hinausgeht. Hyperphänomene, die als Überschußphänomene zu 11verstehen sind, werden zu Superphänomenen, die ganz anders sind als alles uns Vertraute. In der Reaktion auf tatsächliche oder angebliche Unzulänglichkeiten des immer noch angängigen »Projekts der Moderne« greift man nicht selten auf religiöse und mythische Motive zurück, indem man Kehrtwendungen und Umkehrungen propagiert und Erfahrungen durch Gegenerfahrungen korrigiert. Heutzutage fällt es nicht immer leicht, neuartige Formen einer Post- oder Hypermoderne von den Rückzugsgefechten einer Antimoderne zu unterscheiden.[1]
Unser eigener Versuch befaßt sich mit dem Auftreten von Hyperphänomenen oder Überschußphänomenen.[2] Darunter verstehen wir keine höheren oder jenseitigen Sonderphänomene, sondern geläufige Phänomene, insofern sie in Form von Überschritten und Überschüssen über sich selbst hinausweisen. An Überschußphänomenen zeigt sich das Hyperbolische; es zeigt sich, daß und wie etwas mehr und anders ist, als es ist, ohne deswegen alles werden zu können und ohne in einem Jenseits des ganz Anderen zu entschwinden. Die Erforschung hyperbolischer Phänomene und Erfahrungen bleibt dem Ansatz der Phänomenologie verpflichtet, indem sie nach wie vor von dem ausgeht, was sich in der Erfahrung zeigt, und nur insofern darüber hinausgeht, als das jeweilige Mehr, das Anders und auch das Nicht des Sichzeigens sich als solches zeigt. Bezug und Entzug bilden keinen Gegensatz, sondern eine Kontrastfigur. Die »Bodenlosigkeit«, die Husserl methodisch für sich in Anspruch nimmt, bedeutet nicht, daß der Ausgangsboden sich in Nichts auflöst und wir vom Boden der Erfahrung in die Wolken überschwenglicher Erfahrungen entschweben. Das Hyperbolische berührt sich vielmehr eng mit dem Außerordentlichen, das auf erstaunliche oder erschreckende Weise vom Ordentlichen 12absticht, aber darauf bezogen bleibt. Es berührt sich ferner mit dem Fremden und Fremdartigen, dessen Ansprüche ohne den Kontrast des Eigenen und ohne das Eingreifen eines Dritten wirkungslos bleiben würden. Der Ort unserer Überlegungen liegt folglich in einem Zwischen: zwischen Ordentlichem und Außerordentlichem, zwischen Eigenem und Fremdem, zwischen Normalem und Anomalem, zwischen Anwesendem und Abwesendem. Das »Hyper-«des Hyperbolischen bildet keine Sinnklammer und keine Regelinstanz, die unsere Erfahrung kontinuierlich zusammenhält, es markiert vielmehr einen Spalt, eine Kluft, eine Schwelle, die unsere Erfahrung immer wieder überquert, ohne sie zu überwinden.
Überschritte und Überschüsse treten nur im Plural auf. So wie Fremdes nur fremd ist in bezug auf…, so ist Hyperbolisches nur ein Mehr in bezug auf… Das Hyperbolische lehnt sich anderswo an, ohne anderswo zu gründen. Im Unterschied zu den Gestalten des Ganzen, des Einen oder des Höchsten trägt es Spuren des Okkasionellen an sich. Dies spiegelt sich wider im Gang unserer Untersuchungen, die immer wieder neu ansetzen wie bei einem Thema mit Variationen. Ein systematischer Fluchtpunkt würde dem Charakter des Hyperbolischen zuwiderlaufen.
Kapitel 1 beleuchtet den Status quaestionis, ausgehend von Transzendenz und Immanenz als einem umstrittenen Begriffspaar, dessen Spuren von Platon, Aristoteles und Plotin bis in die Gegenwart führen. Kafkas gleichnishafte Aufforderung »Gehe hinüber« bildet den Auftakt zu dem Versuch, das Transzendieren mit einer Eigendynamik auszustatten. Dabei spielen elementare Raumbewegungen wie der Überstieg, der hinüberführt, und der Aufstieg, der hinaufführt, eine besondere Rolle; sie werden verstärkt durch das Moment der Steigerung, in der sich die Erfahrung intensiviert. Auffällig ist die Ambivalenz des Überschreitens, das einerseits als eigener Überschritt verstanden werden kann, andererseits als Übergang zum Anderen, wie bei Levinas, und als ein vom Anderen Herkommen. Mit dem prekären Ineinander von Selbst- und Fremdtranszendierung folgen wir den Bahnen einer von Anspruch und Antwort, von Pathos und Response geprägten Phänomenologie, die sich erneut zu bewähren hat.
In den Kapiteln 2 bis 5 kommen die klassischen Themen des Unendlichen, Unmöglichen und Unsichtbaren zur Sprache, letzteres in Anknüpfung an den späten Merleau-Ponty. Dabei geht es auf je 13spezifische Weise um das Verhältnis von Nicht und Mehr, von Begrenzung und Grenzüberschreitung, das uns aus der Tradition der negativen Theologie als Doppelweg von via negationis und via eminentiae vertraut ist und das auch in Hegels dreideutiger Figur der Aufhebung nachwirkt. Hinzu kommt eine Analyse von Erinnern und Vergessen, die auf ein Urvergessen zurückgeht und von daher das Unvergeßliche neu bedenkt. Hierbei spielt das Leibgedächtnis eine wichtige Rolle.
Kapitel 6 stellt eine methodische Zwischenbetrachtung dar. Es geht hier um die Frage, inwiefern Undarstellbares, das sich dem direkten Zugriff entzieht, einer indirekten und paradigmatischen Beschreibung zugänglich ist. Dabei unterscheiden wir zwischen beispielhaften Erfahrungen und beispiellosen Widerfahrnissen.
Es folgen die Kapitel 7 bis 9 mit drei Schlüsselthemen, in denen der Überstieg zum Anderen, also eine soziale Form der Transzendenz, Gestalt annimmt. Die Ungeselligkeit in der Geselligkeit, die weder mit einer Egozentrik noch mit einer Soziozentrik vereinbar ist, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das erste der drei Themen bildet die Überschüssigkeit derGabe im Kontrast zu den Äquivalenzen des Tauschs, wie sie bei und im Gefolge von Marcel Mauss und neuerlich von Jacques Derrida und Marcel Hénaff erörtert wird. Einseitigen Tendenzen, die entweder auf eine Gabe ohne Tausch oder auf einen Tausch ohne Gabe hinauslaufen, wird eine synkretistische Form des Gebens entgegengestellt. Es folgt als zweites das Rätsel einer originären Stellvertretung, das im Gegensatz zur normalen Stellvertretung darin besteht, daß ich meinen eigenen Stand gewinne, indem ich zugleich an die Stelle des Anderen trete. Dies berührt auch den Status von institutionellen Übergangsfiguren wie Anwalt, Therapeut, Übersetzer, Zeuge oder Feldforscher. Hinzu kommt als drittes Sozialphänomen das Vertrauen zwischen uns. Hier wird unterschieden zwischen dem riskanten Vertrauen einer Risikogesellschaft, das sich auf Selbstvertrauen und Risikoabwägung stützt, und einem Fremdvertrauen, das in der Vertrauensweckung, im Vertrauensvorschuß und im Schenken des Vertrauens Bindungen entstehen läßt, ohne die das institutionelle Vertrauen über eine kalkulierte Rollenerwartung nicht hinauskäme. Es gibt Gräben des Mißtrauens, die sich nicht rein vertraglich zuschütten lassen.
In den Kapiteln 10 und 11 treten die schwarzen Abgründe der 14sozialen Transzendenz in den Blick. Zunächst werden die drei paradigmatischen Figuren des Fremden, des Gasts und des Feindes miteinander konfrontiert. Die Feindschaft erscheint als Resultat eines Verfeindungsprozesses, der aus einer verdrängten Fremdheit und einer verweigerten Gastfreundschaft hervorgeht. Der Gast auf der Schwelle, der bei Simmel, Levinas und Derrida ein Ethos des Anderen entfacht, und der Rivale als Feind am anderen Ufer, den Pascal uns in Form einer moralischen Urszene vor Augen führt, geben dem Hyperbolischen eine besondere Färbung. Die Gewalt, aus der sich die Feindschaft speist, erweist sich als eine pointierte Form gelebter Unmöglichkeit, gipfelnd in einem Anreden und Antun, das auf die Vernichtung seines Adressaten abzielt. Sowenig es eine Liebe überhaupt gibt, sowenig gibt es eine Gewalt überhaupt. Einbrüchen der Gewalt, die sich in der Normalität einnisten und sich in fremde Kleider hüllen, stehen offene Ausbrüche exzessiver Gewalt gegenüber. Im Grunde aber ist jede Gewalt ein Zuviel an Gewalt.
Kapitel 12 setzt einen interkulturellen Schlußpunkt mit dem Motiv des Unvergleichlichen, das nochmals ins Methodische führt. Das Paradox eines Vergleichens des Unvergleichlichen, das allen interkulturellen Prozessen innewohnt, legt dem Vergleichen bei aller Unvermeidlichkeit deutliche Grenzen auf. Was dem Vergleich vorausgeht, ist ein interkulturelles Geflecht, das sich nur teilweise entwirren läßt. Was über den Vergleich hinausgeht, sind transkulturelle Überschüsse. Das Unvergleichliche, das sich inmitten des Vergleichens dem Vergleichen widersetzt, ist nicht zu verwechseln mit einem Unvergleichlichen, das sich gegen jeden Vergleich sperrt. Weder transkulturelle Universalien noch kulturelle Monaden, noch eine alles durchdringende Globalisierung, die ein omnipräsentes Netzwerk ausspannt, reichen heran an das Überschußphänomen des kulturell Fremden, das Kulturen über sich selbst hinausgehen und ineinander übergehen läßt.
Das letzte Kapitel behandelt Formen einer religiösen Transzendenz. Dies bedeutet kein »Sela, Psalmenende«. Ein Schlußpunkt würde dem Ostinato immer wieder neu ansetzender Überschreitungen widerstreiten. Ein Mehr taugt nicht als Letztes. Statt dessen geht es darum, religiöse Motive, die in den Überschritten und Überschüssen der Erfahrung anklingen, zum ausdrücklichen Thema zu machen. Im Brennpunkt dieser Überlegungen, die zwischen 15den Klippen von Vernunft- und Gefühlsreligion hindurchsteuern, steht das Religiöse, Heilige oder Göttliche als eine spezifische Variante des Fremden. Dies bedeutet nicht, daß das Fremde eo ipso religiös ist, wohl aber gilt umgekehrt, daß das Religiöse, wenn es mehr sein soll als ein Derivat, nicht anders vorstellbar ist denn als Fremdes. Somit taugt Religiöses weder als Fundament noch als Lückenbüßer. Zugänglich ist es wiederum nur einer indirekten Beschreibung. Eine Religionsphilosophie, die sich als Religionsphänomenologie versteht, ist weder religiös noch irreligiös. Sie kann nicht mehr tun, als Mißdeutungen abwehren und die Phänomene sprechen lassen, ohne das letzte Wort zu behalten.
*
Einige Buchkapitel sind bereits in einer ersten Fassung erschienen.[3] Sie gehen teilweise auf Tagungsbeiträge und Vorträge zurück. Zu erwähnen sind: Tagung der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung: »Das Unsichtbare dieser Welt«, Universität Leuven 1998. – Tagung: »Unmöglichkeiten«, Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, Universität Zürich 2005. – Tagung: »Topografia dell’estraneo: Confini e passaggi«, Goethe-Institut Rom 2005. – Tagung: »Pathische Repräsentation«, Institut für Kulturtheorie, Universität Lüneburg 2006. – Tagung: »Unendlichkeit«, Universität Tübingen 2006. – Tagung: »Phénoménologie comme philosophie première«, Universität Paris I 2007. – Tagung: »Zum Beispiel«, Graduiertenkolleg »Lebensformen und Lebenswissen«, Berlin 2008. – Tagung: »Gesichter der Gewalt«, Institut für Wissenschaften vom Menschen, Wien 2009. – Vortrag 16»Response and Trust«, Department für Philosophie, Stony Brook 2010. – Tagung: »Leibgedächtnis: Phänomenologie und Therapie«, Universität Heidelberg 2011.
München, Januar 2012
171. Diesseits und Jenseits
Limites transgressées dans leurs limites: notre quotidien. Les extrémités nous demeureront toujours inconnues.
Edmond Jabès, Le petit livre de la subversion hors de soupçon
Erfahrung, die sich nicht dogmatisch verhärtet und die nicht positivistisch verflacht, stößt von sich aus an ihre Grenzen, seien es regionale Grenzen, die partielle Erfahrungsbereiche voneinander absondern, seien es universale Grenzen, die sich der Erfahrung im Ganzen aufdrängen. Die Behandlung von Grenzen, die wir als Grenzen erfahren, ist niemals frei von Paradoxien, da die Erfahrung von Grenzen sich selbst in Grenzen hält. Andernfalls wäre die Grenzerfahrung keine Grenzerfahrung. Doch inwiefern sind Grenzen Bestandteil der Erfahrung? Wären sie der Erfahrung gänzlich fremd, so wären sie nicht mehr als Außengrenzen erfahrbar; wären sie ihr völlig zugehörig, so wären sie keine Grenzen der Erfahrung mehr, sondern nur noch Binnengrenzen. Als Grenzwesen ist der Mensch in einer heiklen Zwischenlage, die ihn weder im Innen noch im Außen zur Ruhe kommen läßt.[1]
In der Geschichte des westlichen Denkens artikuliert sich diese Problematik in der begrifflichen Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz. Doch dies sind Termini relativ jungen Datums, wofür letzten Endes auch ihre Herkunft aus dem Lateinischen spricht. Sie sind spekulativ aufgeladen und geraten in ein weltanschauliches Fahrwasser, sobald die spekulative Energie aus ihnen entweicht. Zeitweilig erstarren sie zu Kampfparolen, die in den Auseinandersetzungen zwischen Metaphysik und Positivismus, zwischen Religion und Irreligion, zwischen Jenseitsglaube und Diesseitsfreude, zwischen Vertröstung auf ein Jenseits und Kampf für ein besseres Diesseits die Fronten markieren. Es mischen sich bedächtige, zurückhaltende Stimmen ein wie die aus Faust II: »Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt; Tor! wer dorthin die Augen blinzelnd richtet«; Nietzsches Blinzeln des »letzten Menschen« kündigt sich 18bereits an. Es ertönt aber auch die kämpferische, frischweg auf das Diesseits setzende Stimme aus Heines Winterreise: »Wir wollen hier auf Erden schon / Das Himmelreich errichten… Den Himmel überlassen wir / den Engeln und den Spatzen.«
Die Begriffsworte, die wir an den Anfang gesetzt haben, bedürfen mehr als andere der Destruktion oder der Dekonstruktion. Wer sie geradewegs benutzt, läuft Gefahr, mit ungedeckten Schecks zu zahlen. Wir tun gut daran, den hohen Ton dieser Begriffssprache zu senken. Dabei kommen uns sprachliche Anklänge zu Hilfe, die vielfach überhört werden, die uns aber auf den fruchtbaren Boden der Erfahrung zurückversetzen, noch bevor die zugehörigen Metaphern zu Begriffen »verblassen«. Bedeutsame Kernworte, die dem Feld leiblicher und räumlicher Erfahrung entstammen, sind Verben wie gehen, schreiten oder steigen mitsamt ihren griechischen und lateinischen Äquivalenten, dazu Präfixe wie über-, hyper- oder trans- und entsprechende Präpositionen, zu denen das über hinaus gehört. Diese Dynamik kommt zum Stillstand, wenn man sich auf relationale Bestimmungen wie innerhalb/außerhalb (intra/extra) oder oberhalb/unterhalb (supra/infra) beschränkt. Auch das Verb bleiben, das in der Immanenz steckt, fordert Beachtung; es deutet hin auf eine an sich haltende Bewegung und nicht auf bloßen Stillstand. Eine solch weitläufige Sichtweise, wie sie sich in der Sprache andeutet, schafft Brücken hin zu älteren Texten, in denen die offiziellen Großworte vielfach fehlen, die uns aber dafür mit einem Reichtum erfahrungsnaher Nuancen entschädigen. Wie sehr die sprachliche Überprüfung den sachlichen Ansprüchen einer phänomenologischen Beschreibung zugute kommt, wird sich auf Schritt und Tritt zeigen. Wir beginnen mit einer Exkursion in das vielfach religiös gestimmte Vor- und Umfeld der Metaphysik und beschränken uns dabei auf wenige prägnante Denkfiguren, die besonders geeignet sind, Licht auf die Gesamtproblematik unserer Untersuchung zu werfen.[2]
191. Hinübergehen
»Geh hinüber«, so lautet der Rat des Weisen in Kafkas Miniaturtext »Von den Gleichnissen«.[3] Ein Grundmotiv des metaphysischen Denkens und des religiösen Lebens verwandelt sich in eine rätselhafte Bewegungsfigur. Den Vorgang des Transzendierens kann man kaum karger, aber auch kaum prägnanter fassen als in dieser Probe eines pensiero povero. Das schlichte Verb »gehen« läßt fürs erste alle raffinierten Begriffsangebote verblassen. Das Gehen, das »auf eine andere Seite« hinüberwechselt, schlägt nicht bloß eine bestimmte Richtung ein, es setzt nicht Schritt vor Schritt und steigt nicht von Stufe zu Stufe, vielmehr setzt es zu einem Sprung an, und sei es auch nur ein winziger, es bewegt sich anderswohin – wenn es sich bewegt. Der Weg führt von diesseits einer schwach markierten Grenze zu einem Ort jenseits von ihr. Das »hinüber« der Gehanweisung bleibt einer Zeigegeste verhaftet. Die Präposition »über« geht, ähnlich wie die Wortprägungen »daneben« oder »danach«, eine »Wortehe« mit einem Zeigewort ein (Bühler 1982, S. 107). Auf diese Weise verknüpft sich der Ort des fraglichen Übergangs mit den Orten der Rede und des entsprechenden Hörens. Er gestattet keinen Ausblick und keine Ausflucht in eine Welt reiner Ideen. Wer hinübergeht, geht von hier aus und nicht von irgendwoher. Zudem stiftet das »hier«, das in dem »hinüber« beschlossen ist, eine situative Gemeinsamkeit. Das Mitsein entsteht in der Rede selbst, es geht jeder konsensstiftenden Übereinkunft voraus. Wie der Wortwechsel dieser Parabel zeigt, verkehrt man mit Anderen, auch wenn man nicht mit ihnen einig ist. Die Conditio humana hat etwas Bedingt-Unbedingtes; so werden Wege zu Auswegen, die von der Ausweglosigkeit (ἀπορία) bedroht sind, bevor der sichere Pfad einer Methode (μέθοδος) sich Bahn bricht.
Spricht der Weise, der den Rat erteilt, von jenseits oder von diesseits der Linie? Diese Frage stößt in eine eigentümliche Leere. Der Weise hält sich nämlich im Hintergrund; er kommt nur indirekt zu Wort, nämlich in der Stimme des Gleichniserzählers, der von den »Worten des Weisen« berichtet, in den Stimmen der »Vielen«, die sich über die Nutzlosigkeit der Rede beklagen, und in der Stimme des Einen, der sich zu ihrem Fürsprecher macht. 20In dem kurzen Wortwechsel, der die Quintessenz dieser selbstbezüglichen Gleichnisrede liefert, nimmt die Differenz von Diesseits und Jenseits Konturen an, die sich aber nur schwach andeuten und zu keinem Lehrsatz taugen. Diesseits begegnen uns die bekannten Mühen des »täglichen Lebens«, was aber erwartet den Hinübergehenden »auf der anderen Seite«? Etwa ein »anderer Zustand«, wie Musils Geschwisterpaar ihn erkundet? Die Alltagsrealisten unserer Parabel können in der Gleichnisrede nichts weiter entdecken als »irgendein sagenhaftes Drüben«. Sagenhaft ist es deshalb, weil man zwar von alters her davon gehört hat, die Spuren sich aber längst verwischt haben; da ist keine Tradition, in die man »einrücken« könnte. Die Alltagspragmatiker halten diese vagen Vorstellungen für unbrauchbar, obwohl sie gestehen, daß sie sich hinüberwagen würden, »wenn das Ergebnis des Weges wert wäre«. Doch um dies entscheiden zu können, müßte man selbst oder jemand, dem man Vertrauen schenkt, schon drüben sein. Denkbar wäre, daß der Weise selbst dieser Jemand wäre; doch dann würde der Rat sich in eine Aufforderung verwandeln, die lautete: »Komm herüber!« So aber lautet sie nicht. Und müßte man nicht schon drüben stehen, um die Glaubwürdigkeit des jenseitigen Sprechers beurteilen zu können? Die »Vielen« in der Parabel begnügen sich mit einer Generalskepsis. »Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt.« Die tautologische Deutung, die das »Un« des Unfaßbaren auf ein Zeichen bloßer Negation reduziert und der Ignoranz jeden Schimmer von docta ignorantia raubt, läßt uns auf der Stelle treten. Alltagsweisheiten wie »Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach« drängen sich vor. Dennoch würde man die Pointe der Parabel mißverstehen, würde man alltägliches oder professionelles Wissen durch schlichte Ignoranz ersetzen und die Aufforderung herauslesen, man solle blindlings springen und rationale Begründungen gegen irrationale Willkür eintauschen. Wozu ein blinder Dezionismus taugt, haben wir in den ideologisch verbrämten Parteinahmen des 20. Jahrhunderts genügend erfahren. Doch schauen wir genau hin, so sehen wir, wie Kafka den Fürsprecher der Gleichnisrede in den Konditional ausweichen läßt. »Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.« Es ist also die Rede von einer Befreiung, auch von Gewinn und Verlust, von Verwand21lung in und durch Außeralltägliches, doch die Verwandlung »in Gleichnisse« läßt nur einen Gewinn im Gleichnis zu, nicht in der Wirklichkeit. Die alltägliche Wirklichkeit wird nicht durch eine höhere Wirklichkeit überboten, der Spalt zwischen Diesseits und Jenseits schließt sich nicht. Wer der Aufforderung »Geh hinüber!« folgt, gerät in Bewegung, aber er erzielt kein Ergebnis, das von der Bewegung abzulösen wäre, und die Bewegung läßt sich auch nicht in reine Eigenbewegung überführen; darin gleicht sie dem Hören, das sich nicht in reine Eigenrede verwandeln läßt, es sei denn, man friert das Hören ein in etwas Gehörtem.[4]
Kafkas Gleichnis von den Gleichnissen ist ein Schwellentext von einer eigentümlichen Stummheit, die nicht hermeneutisch überspielt werden sollte. Er läßt verschiedene Fortsetzungen zu und ruft verschiedene Echos wach.[5] Mancherlei klingt an, so etwa der biblische Satz: »Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren«, ein Satz, der Gewinn und Verlust nicht gegeneinander abwägt, sondern eines mit dem anderen verquickt. Was ebenfalls anklingt, aber eben nicht aufgegriffen wird, ist das christliche »Folge mir nach!«. Der Weise tritt weder als gottgesandter Prophet noch als gottgesalbter Messias auf. In seiner Zurückhaltung hat er etwas Sokratisches, vielleicht auch etwas Buddhistisches, wenn man an die indirekten Lehrpraktiken buddhistischer Meister denkt. Doch bei solchen Vergleichen ist Vorsicht geboten. Ich selbst werde einen Faden knüpfen, der zu Platon zurückführt, aber auch dies nur bis zu einem gewissen Grad.
Im Theaitet entwirft Platon das Porträt eines Philosophen, der sich den »Vielen« (πολλοί), die das Leben in der Stadt bestimmen, durch Flucht entzieht (176 a-177 a). Grund für die Flucht ist das Üble, »das sich unter der sterblichen Natur hienieden an diesem Ort herumtreibt, der Notwendigkeit gehorchend«. Unvermeidlich sind die Übel, da sich das dem Guten Entgegengesetzte nicht ausrotten läßt, ohne dieses selbst auszurotten; der Mangel an 22Gutem, die privatio boni, begleitet das Gute wie ein Schatten. Auch Platon nimmt also Bezug auf diesen Ort hier (τόνδε τòν τόπον), an dem sich das Üble herumtreibt, während es bei den Göttern, die an einem »von Übeln reinen Ort« (ὁ τῶν κακῶν καθαρòς τόπος) wohnen, keinen Platz hat. Man darf daraus schließen, daß das nomadisierende Üble, das sich immer nur »um anderes herum bewegt« (περιπολεῖ), überhaupt keinen festen Wohnsitz hat, an dem es beheimatet wäre. Der Kontrast zweier Orte von solch gegensätzlicher Beschaffenheit ermuntert zur Flucht: »Deshalb muß man versuchen, von hier nach dort (ἐνθένδε ἐκεῖσε) zu fliehen.«[6] Ähnlich wie das Hinweiswort »hinüber«, dessen sich Kafka bedient, hat auch Platons doppelte Ortsbestimmung einen deiktischen Charakter; man sieht förmlich die Zeigegeste. In der Formulierung »man muß« (χρή) kommt kein willentlicher Befehl, kein Sollen zum Ausdruck, sondern eine Zwangsläufigkeit, die dem Streben nach dem Guten und so auch dem Streben nach dem eigenen Glück innewohnt. Die Flucht selbst wird als »Angleichung an Gott« (ὁμοίωσις θεῷ) gefaßt, dies allerdings nur »soweit möglich«; eine Vergöttlichung oder Gottwerdung (θέωσις), wie sie uns bei Plotin, im Mittelalter und auf andere Weise auch bei Nietzsche begegnet, würde dem Status der Sterblichkeit zuwiderlaufen. Die Angleichung an Gott bedeutet, daß der Mensch gerecht und fromm wird, und zwar mit Einsicht, da Gott für das vollendete Gutsein und die vollendete Einsicht steht. Für den Fliehenden wandelt sich das Hier in das, wovor er flieht, und er selbst verwandelt sich in das, wohin er flieht. Es gibt nicht nur eine aristotelische Ontotheologie, sondern auch eine platonische Agathoontologie. Der Mensch, der von hier nach dort flieht, wird schließlich selbst zu einem lebendigen »Gleichnis«, nämlich zum Gleichnis Gottes. Dazu paßt, daß Platon das Leben des Philosophen nach zwei Vorbildern (παραδείγματα) ausrichtet, einem göttlichen (θεῖον), das höchstes Glück verheißt, und einem gottlosen (ἄθεον), das größte Mühsal und größtes Elend erwarten läßt. Auch das »Sagenhafte« kommt bei Platon nicht zu kurz in Gestalt von Mythen, die er aufgreift und neu erfindet. Auch diese Mythen sind solche »mit Einsicht«, sie bewegen sich auf den Spuren des Logos.
23Der zitierte sokratisch-platonische Text, der den Gedankengang des Dialogs unterbricht, ist ein weiterer Schwellentext. Die Fortsetzung findet sich bei Platon selbst. Es stellt sich die Frage, in welchem Maße Platon selbst und erst recht seine neuplatonischen Nachfolger als sokratisch anzusehen sind.[7] Im Hinblick auf unser Kernmotiv drängt sich die Frage auf, inwieweit das Hinübergehen an einen anderen Ort mit dem Hinaufgehen an einen höheren Ort zu vereinbaren ist. Was hierbei auf dem Spiel steht, ist nichts Geringeres als die Rolle und der Einfluß Platons in einem Denken, das in der Folge metaphysisch genannt wird.
2. Weltall ohne Außen
Das Entwicklungsdenken der neueren Philosophiegeschichte verführt dazu, zeitlich frühere Phasen einer jeweiligen Vorgeschichte zuzurechnen, so daß Platon als Vorläufer von Aristoteles zu betrachten wäre, ähnlich wie später Kant und Fichte als Vorfahren Hegels oder Husserl als Schrittmacher Heideggers ihren Platz finden. Von dieser simplen Linienführung ist man inzwischen gründlich abgekommen, aber vielleicht nicht gründlich genug. In meiner Suche nach den Grundmotiven eines Transzendenzdenkens werde ich bewußt bei Aristoteles ansetzen und von ihm aus auf Platon zurückgehen; ich tue dies in der Erwartung, daß bei dem früheren Denker gedankliche Überschüsse zu finden sind, die der spätere nicht zu integrieren vermochte. Die Denkfiguren, die in den weiteren Kapiteln umrißhaft nachgezeichnet werden, lassen sich schon deshalb nicht kontinuierlich aneinanderreihen, weil die Leitfragen sich wandeln und die entsprechenden Leitdifferenzen sich verschieben. Die Metaphysik macht einer Vielzahl von Metaphysiken Platz.
Wie schon für den Sokrates der platonischen Dialoge lautet auch für Aristoteles die Ausgangsfrage: Was ist das? Was ist das, was sich zeigt und was wir so oder so nennen? Auf die Was-Frage 24antwortet letzten Endes die noetische Einsicht in das Wesen. Für alle Prädikationen, die das, was ist, schrittweise erschließen, bedeutet die Bezeichnung von etwas als Etwas immer auch die Auffassung als Eines (Met. IV, 4, 1006 b 7). Etwas ist ein Selbes, sofern wir ihm bestimmte Attribute zu- oder absprechen. Ein Selbes ist es aber nur, indem es sich von Anderem unterscheidet und sich in ein regionales oder universales Ganzes einfügt. Ohne die Einfügung in ein Ganzes bliebe das Was-Sein letzten Endes unbestimmt. An zweiter Stelle steht die Grundfrage: Warum ist etwas so, wie es ist? Die Warum-Frage beantwortet sich durch die Angabe von Ursachen, von Wirk- und Zielursachen, die einen sowohl ontologischen wie epistemischen Charakter haben. Ursachen (αἰτίαι) und Gründe (λόγοι) sind nicht strikt voneinander geschieden. Die Kette der Begründungen reicht von ersten Gegebenheiten, die nach Begründung verlangen, bis zu letzten Beweg- und Zielursachen. Ohne den Aufstieg vom Ersten zum Letzten bliebe alles, was ist, letzten Endes grund- und ziellos. Das Letzte ist zugleich ein Höchstes, sofern es alles bewegt, ohne selbst wieder von anderem bewegt zu werden, und sofern es alle weiteren Was- und Warum-Fragen verstummen läßt. Ein unendlicher Regreß, der jeder Wesensbestimmung eine weitere Bestimmung und jeder Begründung einen weiteren Begründungsschritt abverlangen würde, hätte zur Folge, daß das Ganze in einem Meer schlechter Unendlichkeit verschwömme.
Die besagten Grundfragen beziehen sich letzten Endes auf ein Ganzes, das alle Einzelheiten und Sonderarten zu einem Stufengefüge zusammenfügt, und dieses Ganze kann letzten Endes nur Eines sein, da es sonst nicht das Ganze, sondern selbst Teil eines Ganzen wäre. Das Ganze ist ferner ein lebendiges Ganzes im Werden, dessen Glieder als Entelechien ihr Ziel in sich tragen und dessen Dynamis jeweils von der Wirk- und Formkraft der Energeia vorangetrieben wird und sich in ihr vollendet. Diese Ausrichtung auf eine zielgeprägte Ganzheit kennzeichnet alle Stufen des Lebens. Sie wirkt sich aus im Wachstum und in der Fortpflanzung alles Lebendigen. Sie steuert auch den Prozeß des Gehens, das wie das Fliegen oder Springen auf ein Ziel aus ist, da der Bewegte sich von irgendwoher irgendwohin bewegt und zu jedem Zeitpunkt der Fortbewegung »unvollendet« (ἀτελής) ist (Nik. Ethik X, 3).[8] Sie prägt unser 25Handeln, das im Glück als einem vollendeten und selbstgenügsamen Gut sein Ziel findet, und sie leitet unser Erkenntnisstreben, das differenzierten Aufgaben nachgeht, aber in der Weisheit gipfelt, die sich mit den letzten und göttlichen Dingen befaßt. Für jedes Einzelne, das sich an einem Ort befindet, gilt zwar, daß sich »außerhalb seiner (ἐκτòς αὐτοῦ) etwas anderes befindet« (Physik IV, 2, 209 b 32 f.), doch den Hintergrund aller Bewegungsabläufe bildet das Weltall als ein Ganzes, »das nichts außer sich hat« (οὗ μηδὲν ἔξω, III, 6, 207 a 8). Für eine große Transzendenz, die über die Grenzen des Alls hinausginge, bleibt buchstäblich kein Raum; jeder Versuch, die Grenzen des formvollendeten Ganzen zu überschreiten, würde in der Ordnungslosigkeit (ἀταξία), dem Chaos, enden. Der Mensch, der seine Grenzen mißachtet, erliegt seiner Hybris[9] wie Ikarus, der auf die Sonne zufliegt und schließlich am Boden zerschellt, oder er gerät in das Tretrad endlos zum Scheitern verurteilter Begierden wie Sisyphus und Tantalus. Eine Alternative, die im klassischen griechischen Denken allerdings nur vereinzelte Spuren hinterlassen hat, bietet das gnostische Weltbild, in dem eine Welt des Lichts sich einer Welt des Dunklen und Bösen entgegenstellt und das Heil in der Erlösung von der Welt gesucht wird. Die entsprechende Erlösungsmaxime würde nicht lauten: »Gehe hinüber«, sondern: »Gehe hinaus«, so, wie man aus einem brennenden Haus flieht. Bei einem modernen Autor wie Bert Brecht verwandelt sich das Elend dieser Welt in ein menschliches Elend, und der Ort der Flucht erweist sich als ein irdisches Anderswo. Im »Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus« fordert der Erzähler die Hausbewohner auf, »schnell hinauszugehen. Aber die Leute schienen nicht eilig. Einer fragte mich, während ihm schon die Hitze die Brauen versengte, wie es draußen denn sei […]«. Das Fazit lautet: »Wirklich Freunde, wem der Boden noch nicht so heiß ist, daß er ihn lieber mit jedem anderen vertausche, als daß er bliebe, dem habe ich nichts zu sagen.« Darin bezeugt sich ein Leidensdruck, der jeder Dezision vorauseilt.
26Doch bleiben wir zunächst bei Aristoteles und seiner Konzeption vom All. Man könnte zu deren Gunsten ins Feld führen, daß Aristoteles – in ausdrücklicher Abkehr von Platon – gegenüber jeder monotonen Einheit die Vielfalt und die Differenzen stark macht, daß er Platons Ideen in die Gestaltungskraft sinnlicher Wahrnehmung zurückholt, daß er die kontextuelle Sprechwirkung der Rhetorik neu entdeckt und anderes mehr. Als Denker der Kinesis und der Dynamis legt er großes Gewicht auf das Anderswerden (μεταβολή), das nicht nur allmähliche Übergänge, sondern auch plötzliche Umschläge zuläßt. Doch solche innerweltlichen Transzendenzen bieten keinen Anlaß zu einem Hinübergehen von hier nach dort, da alle Brüche durch eine alles durchdringende Teleologie geheilt werden. Man ist potentiell schon dort, wo man noch nicht ist.
Zur Endlichkeit unseres Strebens und Erkennens gehört zwar, daß wir mit dem beginnen, was für uns wirklich und gut ist, was uns als wirklich oder gut erscheint. Doch dieser quasiphänomenologische Ansatz ist nur der Anfang, nicht das Ende. Das Für-uns-Sein ist die Anfangsphase eines Prozesses, der im An-sich-selbst-Sein (καθ’αὑθό) kulminiert. Was für uns (πρὸς ῆμᾶς) wirklich und gut ist, ist es nicht schlechthin (ἁπλῶς). Wenn es etwas gibt, das diese Suchbewegung davor bewahrt, sich in der vergeblichen Suche nach einem unerreichbaren Ziel zu verlaufen, so ist es eine latente Inversion.[10] Das zeitlich Frühere für uns ist vorweg schon überholt durch das Frühere an sich, so daß wir suchen, was wir im Grunde schon kennen, und dort enden, wo wir begonnen haben. Wir bewegen uns, selbst wenn wir dies erst nachträglich bemerken, im Kreise. Es gibt im Grunde keine Erfindungen, nur Enthüllungen. Noch Hegel bewegt sich ganz auf dieser Linie, wenn er Fürsichsein und Ansichsein im Anundfürsichsein als in einem »Kreis von Kreisen« zusammenführt. Schwindet das Ganze dahin, so bleiben nur Schwundformen eines circulus vitiosus zurück, doch das gehört bereits zum neuzeitlichen Geschick der Metaphysik.
Allerdings gibt es Momente, in denen der aristotelische Holismus an den Rand seiner Möglichkeiten gerät, so in Buch XII der Metaphysik, in einem Text also, der Platon noch nahesteht. In Ka27pitel 10 zieht Aristoteles eine große Transzendenz in Erwägung, die sich nicht auf intramundane Übergänge beschränkt, sondern das Weltganze übersteigt. So wirft er die Frage auf, ob und auf welche Weise die »Natur des Ganzen« das Gute und das Beste enthält, ob als etwas Abgetrenntes (κεχωρισμένον) und für sich Seiendes, das also nur über einen Spalt hinweg zugänglich wäre, oder als Ordnung (τάξις), die dem Geordneten innewohnt. Die erste Möglichkeit entspräche dem Status des Nus, der als vom Körper getrennt (χωριστός) vorgestellt wird (De anima III, 4, 429 b 5) und der, wie die berühmte Formulierung lautet, »von außen, gleichsam durch die Türe« (θύραθεν) hereinkommt (De gen. et corr. II, 3, 736 b 27 f.).[11] Bei der zweiten Möglichkeit könnte man an die Harmonie denken, die der Leier und ihren Saiten zukommt, oder an die Seele, die dem Leib und seinen Gliedern innewohnt (vgl. Phaidon 85 e-86 d). Aristoteles zieht zum Vergleich nicht die musikalische Harmonie heran, sondern die militärische Taxis, indem er »wie beim Heer« beide der genannten Möglichkeiten gelten läßt. »Denn dort liegt das Gute sowohl in der Ordnung als auch im Feldherrn, und in ihm in höherem Grade. Denn dieser ist nicht durch die Ordnung bestimmt, sondern die Ordnung durch ihn« – gleich dem Hausvater, der sein Hauswesen zusammenhält, wie auch dem politischen Monarchen. So endet dieses Kapitel mit einem Vers aus der Ilias (2, 204), der zu denen gehört, die man einst im Griechischunterricht auswendig lernte: »Nichts Gutes ist Vielherrschaft, einer soll Herr sein, einer König«, jener nämlich, dem Zeus »Szepter und Gesetze verlieh«, wie der homerische Text fortfährt. An dieser Stelle rührt die Metaphysik an die politische Theologie. Zum Königsthron kann man nicht »hinübergehen«, vor ihm kann man sich nur beugen.
3. Über das Sein hinaus
Kann Platon weiterhelfen, wenn solche Hierarchisierungstendenzen auf Bedenken stoßen? Ist es nicht so, daß mit dem Phi28losophenkönig die Herrschaft erst recht untermauert wird? Die Herrschaft der Vernunft duldet keine Widerrede. Doch bei Platon kommt es in besonderem Maße darauf an, wo man als Leser die Akzente setzt. Würde man geradewegs der Wegkarte folgen, die sich in der Fluchtbewegung des Theaitet andeutet, so würde man vom Ort des Sichtbaren zum Ort des Denkbaren (vom τόπος ὁρατός zum τόπος νοητός) gelangen und sähe sich dann dem rätselhaften Chorismos gegenüber, der nach einem Syndesmos, nach einem Bindeglied und einer Bindekraft verlangt. Noch bei Kant begegnet uns eine »große Kluft, welche das Übersinnliche von den Erscheinungen trennt«, und es ist nicht möglich, »eine Brücke von einem Gebiete zu dem andern hinüberzuschlagen«, es sei denn mittels der Freiheit, deren Wirkung »in der Welt geschehen soll« (KU B LIII f.). Trotz seines Liebäugelns mit einem »abgetrennten« Ordner stünde Aristoteles, aufs Ganze gesehen, weltfreundlicher da. Ein Eidos, das sich als Morphe in der Hyle verkörpert, bietet keinen Anlaß zur Flucht aus der Sinnenwelt. Doch so schnell läßt Platon sich nicht aristotelisieren. Die zitierte Stelle aus dem Theaitet führt zunächst auf eine andere Fährte.
In Buch VI der Politeia (509 b) finden wir eine Kurzformel, die ebenso bekannt wie rätselhaft ist und für jede Platondeutung eine Klippe darstellt. Das Gute, das dem Erkannten nicht nur das Erkanntwerden, sondern auch Sein und Wesen verleiht, ist »über das Sein hinaus« (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), indem es dieses an Alterswürde und Kraft »übertrifft« oder »überragt« (ὑπερέχοντος). Glaukon, der als Gesprächspartner des Sokrates ein wenig die Rolle der »Vielen« aus Kafkas Parabel oder auch die der thrakischen Magd aus dem Theaitet spielt, reagiert auf »komische« Art: »Beim Apoll, ein wunderliches [ein außergewöhnliches, gottgewirktes] Übertreffen« (δαιμονίας ὑπερβολῆς). Platon setzt mit diesem komödiantischen Einschub alles Esoterische, Weihevolle beiseite; dennoch steht sie nun da, diese Hyperbel, die eine Kaskade weiterer Hyperbeln ankündigt und über Dionysios Areopagita weit in das Mittelalter vordringt. Kein Terminus also, der die Sache zu ihrem Ende bringt, sondern ein Wortkeim, eine Keimidee.
In dem in Buch VII nachfolgenden Bildungsprogramm verwandelt sich der Übergang an einen anderen Ort in das Hinaufgehen zu einem höheren Ort. Dies geschieht auf einem Weg, der über Stufen hinweg nach oben ans Licht führt: der Aufstieg (ἀνάβασις29oder (ἔπ)ανοδος), und in einem Hinabgehen, das in die Alltagswelt zurückführt: der Abstieg (κατάβασις oder κάθοδος).[12] Der transcensus begegnet uns also frühzeitig in der Doppelbewegung von ascensus und descensus, die eine Steigung bewältigt und sich in der Aufwärtsbewegung der Steigerungsform der Hyperbel annähert. Levinas (1961, S. 5, dt. S. 39) übernimmt von Jean Wahl das Begriffswort Transaszendenz, in dem die Übergangsbewegung mit der Aufstiegsbewegung verschmilzt; er gibt dem allerdings, wie sich noch zeigen wird, eine andere Wende. Bei Platon verbindet sich die aristotelische Figur des Ganzen und des Ersten mit der des Höchsten. Doch das Höchste wird nie rein extensiv vom Steigen her verstanden als endgültige Überwindung aller Höhenunterschiede, sondern immer auch intensiv als Steigerung, als ein »Mehr an Sein« (vgl. Politeia VII, 515 d), sowie auch das maius in Anselms Gottesbeweis in erster Linie als eine Steigerungsform zu verstehen ist. Sprachlich ist zu bemerken, daß im Lateinischen das Übersteigen (scandere) stärker von Formen des bloßen Hinübergehens und Voranschreitens (vergleiche die Komposita von ire, cedere, gradi) abgehoben ist als im Griechischen, das einen weiten Gebrauch von dem Verb »βαίνειν« und seinen Komposita macht. Was das griechische Verb »ὑπερβάλλειν« angeht, das für uns von besonderer Bedeutung ist, so erinnert es ebenso wie das deutsche Verb »übertreffen« an einen Wurf, der über das Ziel »hinausschießt«. Von daher unterliegt alles Hyperbolische einer gewissen Ambivalenz. Die Mesotes-Lehre der aristotelischen Ethik ist stark von den medizinischen Vorstellungen einer rechten Mischung der Körpersäfte geprägt. Bei der Erreichung der rechten Mitte gibt es zwar einen Höchstwert (ἀκρότης), der das für uns Mittlere vom bloß Mittelmäßigen unterscheidet (Nik. Ethik II, 6, 1107 a 8), doch dies steigert nicht die Qualität des Guten. Beim Hyperbolischen überwiegt in der Ethik ähnlich wie in der Ästhesiologie der negative Aspekt des Zuviel, der eine Zielverfehlung anzeigt, ähnlich wie wir im Deutschen von »Übermut«, von »Überreizung« und von einem »übertriebenen« oder »überladenen« Ausdruck sprechen. Anders steht es mit Platons Ästhetik, aber auch mit seiner Erotik. Hier ist es der positive Aspekt eines Mehr an Lebenskraft bis hin zur 30göttlichen Manie und zum Enthusiasmus, der den Ton angibt und das Gleichmaß des Ordentlichen durch Formen des Außerordentlichen überbietet. Dieser Platon bleibt auch für Nietzsche attraktiv, ungeachtet aller Kritik an der Zweiwelten-Lehre. Für uns stellt sich die Frage, ob und wieweit das Motiv des Hyper-, des Über-hinaus, sich von einer einheitlichen Hierarchisierung beziehungsweise von einer eindeutigen Finalisierung ablösen läßt.
Wenn Platon, allen Höhenflügen zum Trotz, die Schrittnähe zum Alltag wahrt und den aufkommenden Überschwang immer wieder ironisch dämpft, so mag man darin den sokratischen Stachel wiedererkennen, der verhindert, daß das Hier des Hinübergehens mit hinübergeht und dort drüben verschwindet. Im Neuplatonismus, der sich an der Leitidee eines transfiniten Einen orientiert, ist dies nicht mehr so; vieles, was sich bei Platon nur vorsichtig anbahnt, nimmt bei Plotin seinen ungehinderten Lauf.[13] Es häufen sich hyperbolische Ausdrücke wie »Übersein«, »Übergutes«, »Über-Eines« und »Über-Denken« oder Wendungen wie »über Vernunft, Denken und Energeiahinaus« oder »mehr als Gott«, die nur durch den fortwährenden Rückbezug auf eine wortlos sich vollziehende, ekstatische Übererfahrung vor dem Absinken in Leerformeln bewahrt bleiben. Ich beschränke mich hier auf Plotins Übernahme der platonischen Kernformel. In Enneade VI, 9, 11, dem Schlußkapitel jener Enneade, die sich mit dem Guten und dem Einen befaßt, ist es der »weise Priester«, der das Geleit gibt. Selbst wenn er das Innerste seiner Seele, das »Unbetretbare«,[14] nicht betritt, weiß er doch, daß ihn »dort« (ἐκεῖ) die wahre Schau des Einen als des Urquells und Urgrundes erwartet, sobald er einmal über alles, auch über das, was diese Welt an Schönem und Tugendhaftem zu bieten hat, hinweggeeilt und hinweggeschritten ist (ὑπερθεῖν, ὑπερβαίνειν). In dieser Schau gelangt die Seele nicht zu anderem, sondern zu sich selbst; sie findet ihre »Bleibe« (μονή) in sich selbst und nicht in Jenem (dem Einen) als einem separat Seienden. »Sofern sie mit Jenem umgeht, ist sie selbst nicht Sein, sondern über 31das Sein hinaus.« Wem dies widerfahren ist, der sieht sich selbst als »Gleichnis von Jenem« (ὁμοίωμα ἐκείνου) und ist so am »Ziel der Reise«; die Leichtigkeit bleibt, auch wenn man aus der Schau »herausfällt«. Das Leben der Götter und gottseliger Menschen besagt »Ablösung von allem übrigen hienieden (τόδε), ein Leben ohne Verlangen nach dem Hiesigen, Flucht des Einsamen zum Einsamen«. Die Transzendenz als Überstieg über das Sein hinaus wird überhöht und überströmt von einer fugenlosen Immanenz, einer in sich ruhenden, verharrenden Bleibe (μονή) der Seele, die in eins fällt mit der Bleibe des Urgrundes, der »als Ganzer bleibt«, gleich der Sonne mit ihrem Licht (Enn. VI, 9, 9, 6 f.). Was als Aufstieg begonnen hat und als Abstieg wiederkehrt, kreist um ein einsames Übersein, das alle Andersheit in sich aufsaugt und mit sich führt wie ein Feuerball. Aller Überschuß geht unter in der Unerschöpflichkeit eines sich verströmenden Ganzen. Die Überschwenglichkeit des Ganzen implodiert. Was die grandiose Vision zurückläßt, ist ein Seelenall ohne Außen. In einem gleicht es dem aristotelischen Weltall, nämlich in der Tilgung jedes Außenbezugs. Zeigewörter tauchen weiterhin als Merkwörter auf, doch sind sie kaum mehr als verblassende Leuchtmarken, Erinnerungen an die Stationen einer Reise, die immer schon am Ziel ist.
4. Innen versus Außen
Was wir »westliche Moderne« nennen, geht zusammen mit dem Schwinden eines großen allumfassenden Ganzen, sei es der Kosmos, die Physis oder eine göttliche Schöpfung. Jeder Blick auf das Ganze und jede Rede vom Ganzen wird zurückgeworfen auf einen variablen Ort, von dem aus Blick und Rede sich entfalten und der sich als blinder Fleck dem Ganzheitsblick und der Ganzheitsrede entzieht. Das für mich Erste bedeutet dann mehr als eine Etappe auf dem Weg zum Ganzen oder zum Höchsten. Diese Lehre, die sich aus Descartes’ Cogito ziehen läßt, reicht tiefer als das cartesianische Fundierungsprogramm. Doch zunächst hat diese Ordnungsdämmerung mit ihrem Einbruch von Kontingenz fatale Folgen. Die Entdeckung, daß diese unsere Welt auch eine andere sein könnte, führt einerseits zur Zersplitterung der Welt in individuelle oder atomare Einzelheiten, anderseits zu einem großen 32Schisma zwischen Innenwelt und Außenwelt. Der Gegensatz von Transzendenz und Immanenz gewinnt damit ein neues, ungeahntes Gewicht.
Für das griechische Denken stellt die Differenz von Innen und Außen keine Leitdifferenz dar. Platon spricht zwar beiläufig von einer nach außen (ἔξω) und einer nach innen gerichteten (ἐντός) Handlung (Politeia 443 c-d) sowie vom inneren Menschen als einem, der das Wilde im Menschen zähmt (589 a-b), doch alles beruht auf einer gerechten Ordnung, die im Bereich der Seele wie im öffentlichen Raum der Polis jedem das Seine gibt. Selbst die Lüge hat die Form eines Pseudos, das die Tatsachen verdreht und sein Versteckspiel treibt, ohne daß sich hinter dem sichtbaren Verhalten eine separate Innerlichkeit verbirgt. Die verschiedenen Formen der Ungerechtigkeit sind Abfallprodukte, die dem faktischen Bestehen der Ordnung, nicht aber dieser selbst Abbruch tun. Bei Aristoteles begegnet uns das Außen, aber als ein relatives Außen, so etwa in der Unterscheidung von natürlicher Selbstbewegung und künstlicher Außenbewegung oder in der Unterscheidung zwischen einer Handlung, die ihr Ziel in sich hat, und einer Hervorbringung, die in ein äußeres Ziel übergeht (vgl. Politik VII, 3), woraus im Mittelalter die Zweiheit von actio immanens und actio transiens wird. Die grammatische Unterscheidung von transitiven und intransitiven Verben ist damit verwandt. Doch solch relative Außenbezüge tun der Geschlossenheit des Ganzen keinen Abbruch, zumal in strittigen Fällen der Innenbezug vor dem Außenbezug rangiert. Die kosmische Ordnung ist letzten Endes, wie schon gezeigt, eine reine Binnenordnung, und die Ordnung des Lebendigen, die den Kosmos trägt, ist eine von innen gesteuerte Ordnung, die lediglich äußeren Störungen unterliegt. Allerdings verbirgt sich darin ein Problem, das deutlich zutage tritt, sobald in der Moderne die Ganzheitsorientierung fraglich wird. Wäre eine Gesamtordnung ganz und gar in sich geschlossen und wäre sie gänzlich ohne Außen, wie könnte sie dann als Ordnung bestimmt und erfaßt werden? Es bliebe bei dem kontradiktorischen Gegensatz von Ordnung und Unordnung, der für eine Vielfalt heterogener Ordnungen keinen Raum ließe. Die Annahme eines Ganzen ohne Außen führt in letzter Konsequenz auf die Bahnen eines totalitären Denkens, das keine grundlegenden Abweichungen duldet.
Bricht die Differenz von Innen und Außen auf, so bedeutet 33dies keine bloße Differenzierung von außen her, sondern eine Selbstdifferenzierung. Das Innen ist, systemtheoretisch gesprochen, markiert, nämlich als der Ort, an dem die Differenz entspringt. Das Selbst steht hier nicht nur für das Aus-sich-sein der spontanen Selbstbewegung, sondern es ist zugleich ein Grenzbegriff, der eine Differenz bezeichnet. Somit nimmt das Hinüber- und Hinausgehen die Form eines Heraustretens an oder umgekehrt die eines neuartigen Eindringens.
Eine prägnante Figur des Transzendierens, die schon in der (neu)platonischen Ekstasis vorgezeichnet ist, findet sich bei Augustinus. Der »innere Mensch« verweist auf einen Ausgangsort im Menschen, der aber nicht geradewegs der Zielort ist: »Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas.« Der Weisung, die den Gang nach innen lenkt, folgt eine zweite Weisung, die auf neue Weise hinausführt: »Wenn du findest, daß deine Natur der Veränderung unterliegt, so gehe über dich selbst hinaus – transcende te ipsum« (De vera rel. 39, 72). Keine Auskehr also ohne vorherige Einkehr, keine Einkehr ohne erneute Auskehr und keine symmetrische Vermittlung von Innen und Außen wie in Spinozas »Deus sive natura«. Husserl zitiert am Ende seiner Cartesianischen Meditationen den Anfangssatz, allerdings ohne den Zusatz, der zum Überschreiten auffordert, obwohl er ihn auf seine Weise beherzigt, wie sich noch zeigen wird.
Erst die Reduktion der Welt auf eine physikalisch meßbare und technisch beherrschbare Außenwelt, die noch außerhalb des Horizonts antiken und mittelalterlichen Denkens lag, provoziert im Gegenschlag den Rückgang auf eine geistige oder seelische Innenwelt. Die Verinnerlichung, die zuvor Ausdruck einer spirituellen Welt- und Selbsterfahrung war, dient fortan nicht nur, aber auch der Kompensation. Sie ist nicht frei von Zügen eines reaktiven Denkens, das sich gegen die Gefahren eines gleichzeitigen Welt- und Selbstverlustes zur Wehr setzt. Die »bodenlose Kluft« zwischen Innenwelt und Außenwelt,[15] die teils epistemisch, teils psychologisch und psychophysisch, teils sozialpsychologisch beschaffen ist, wird für die Neuzeit zu einem Dauerproblem, das immer wieder 34neue Brückenkonstruktionen hervorruft. Kant sucht diesem Streit einen Riegel vorzuschieben, indem er, in Umwandlung der alten Lehre von den Transzendentalien, das Transzendente als das Transzendentale konzipiert, das uns das »Dasein der Dinge außer uns« garantiert, aber nicht ihr Erkanntsein (KrV B XXXIX). Aristotelisch gesprochen ist das Ding etwas, das an sich ist, aber es ist für uns an sich. Diese paradoxe Spannung, die daher rührt, daß die eine Hand nimmt, was die andere gibt, enthält eine Menge Zündstoff, der den Streit zwischen Kants Nachfolgern schürt. Einen Ausweg bietet die Deutung der Grenzerfahrung als Entzugs- und Fremderfahrung, von der in Kapitel 4 die Rede sein wird. Zunächst jedoch ist die Garantie des äußeren Daseins erkauft mit einer Selbstbeschränkung der Vernunft. Der Gebrauch der Ideen beschränkt sich strikt auf den Raum der Erfahrung; zulässig ist nur der »einheimische« (immanente), nicht der »überfliegende« (transzendente) Gebrauch (KrV B 671). Die transzendentale Ermöglichung der Erfahrung, die unter Hinzufügung zweier Buchstaben an die Stelle transzendenter Erfahrungen tritt, führt zu einer Ernüchterung, die das Ausschwärmen ins Übersinnliche ächtet und auch Platon als den philosophischen »Vater aller Schwärmerei« nicht verschont (Werke, III, 387). Überschüsse der Erfahrung wie etwa das Pathos des Erhabenen, in dem die neuplatonische Tradition fortlebt, werden als »Idee des Erhabenen« geduldet, aber eben auch kontrolliert. Was in die Erfahrung eindringt, muß sich ausweisen; das Transzendentale funktioniert als eine Art Paß, der auch für die »Metaphysik der Natur« und die »Metaphysik der Sitten« verbindlich ist. Dieses Beispiel macht Schule. Bei Fichte verlagert sich das Gewicht auf die transzendentale Immanenz, wenn er den Kritizismus als immanent deklariert, »weil er alles in das Ich setzt«, den Dogmatismus dagegen als transzendent, »weil er noch über das Ich hinausgeht« (Gesamtausg. 2, 279 f.). Hegel verwendet die Begriffe »Transzendenz« und »Immanenz« nur noch als Versatzstücke einer alles vermittelnden Dialektik, indem er ihnen eine bloß relative Bedeutung zumißt. Das übersinnliche Jenseits besagt nichts weiter als die »Erscheinung als Erscheinung« (Werke 3, 118), und Hinausgehen bedeutet lediglich ein »immanentes Hinausgehen« (Werke 8, 172).
Vom Schwinden der großen Systementwürfe, vor allem von Hegels gigantischem Versuch, die antike Metaphysik mit der modernen Idee des Subjekts zu versöhnen, behält das 19. Jahrhundert 35vielfach bloße Splitter zurück. Die Idee der Transzendenz versandet in der Frage, ob und wie wir die »Realität der Außenwelt« oder das »Fremdpsychische« erreichen, wobei Idealisten und Realisten sich einen Grabenkrieg liefern. Andererseits bildet sich ein kritizistisch oder positivistisch gefärbter »Immanentismus« heraus; der »Satz des Bewußtseins« dauert fort als »Satz der Immanenz«. Es kommt zu weltanschaulichen Flügelkämpfen zwischen Kritikern und Apologeten der Religion. Die Bewegung des Transzendierens, die von sich aus durchaus für Erfahrungsexperimente offen ist und die Erprobung mystischer Zustände einschließt, verfestigt sich substantivisch in der Rede von der Transzendenz. Zurück bleibt ein Jenseits, das dem Diesseits entweder abgerungen oder geopfert wird. Die Erfahrung wird selbst zum Kampfplatz der Konzepte und Parolen.
5. Selbstüberschreitung
Mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert mehren sich die Versuche, Transzendenz und Immanenz von entsprechenden Erfahrungen her neu zu konzipieren. Einen Brennpunkt bildet das Motiv der Selbstüberschreitung, das sich als ein Charakteristikum der menschlichen Existenzweise herausstellt. Dies ist nichts völlig Neues. Zu erinnern ist an Pascals Idee, daß »der Mensch unendlich über den Menschen hinausgeht« (siehe unten, S. 57), an Kierkegaards Existenzdenken, das zum Glaubenssprung ansetzt, oder an Nietzsches »Selbstüberwindung des Menschen«, an sein Bekenntnis zum »Übermenschen«. Man kann mit Valéry das »Übermenschliche« als Steigerung verstehen, als Verwandlung in ein »mehr als Mensch« (Cahiers II, 539, dt. 5, 198). Der Übermensch taucht schon in der Spätantike als ὑπεράνθροπος auf, und er kehrt später immer wieder.[16] Bisweilen erhält er einen theologischen Klang, verwandt dem Prozeß der »Vergöttlichung«, der auch vor der Person Plotins, des Denkers der Hyperbolik, nicht haltmacht; oftmals mischt sich allerdings auch, wie in der Anrede des Erdgeistes in Goethes Faust, ein spöttischer Unterton ein. Der Vorwurf von Hybris, Superbia und Überheblichkeit liegt nahe. Dennoch wäre es verfehlt, die Figur eines Überwe36sens, das sich der kargen Figur eines Mängelwesens entgegenstellt, mit dem ideologischen Zerrbild gleichsetzen, in dem Übermensch sich auf Untermensch reimt. Es gibt auch einen jüdischen Nietzscheanismus, der einen »sittlichen Übermenschen« verkündet und das jüdische »Übervolk« mit einer gesteigerten Verantwortung für die Menschheit versieht.[17]
Hinter der Selbsttranszendierung steckt allerdings ein genereller Doppelsinn. Ist das Selbst ein Wesen, das anderes transzendiert, eines, das selbst transzendiert wird, oder gilt beides zugleich? Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Selbstheit und Fremdheit innerhalb dieser Bewegungsfigur. Die Phänomenologie, der unsere besondere Aufmerksamkeit gilt, müht sich seit langem mit diesen Fragen ab. Daraus ergeben sich Varianten von wechselnder Radikalität. Die Details sind bekannt, so daß es genügt, die entscheidenden Punkte hervorzuheben.
Husserl unterläuft den Gegensatz von Transzendenz und Immanenz, von Realismus und Idealismus, indem er das Geschehen der Intentionalität in den Mittelpunkt rückt. Von Anfang an unterscheidet er zwischen der reellen oder realen Immanenz von Bewußtseinserlebnissen und der Immanenz im Sinne einer klaren Selbstgegebenheit des Gemeinten, und ebenso unterscheidet er zwischen einer Transzendenz der Gegenstände, die das psychische Erleben überschreiten, und einer Transzendenz des Gegenständlichen, das über das direkt und anschaulich Gegebene hinausgeht (Hua II, 35). Das Bewußtsein ist keine »Schachtel«, die alles mögliche enthält (ebd., 71). Sie ist auch keine Bewußtseinsinsel, die uns vor die Frage stellt, wie wir da herauskommen, vielmehr gehört zum Ego ein »Seinssinn, mit dem es sein eigenes Sein ganz und gar transzendiert« (Hua I, 135 f.). Husserl verwendet dabei den komplexen Begriff einer »immanenten Transzendenz«, die nicht nur der Welt, sondern auf andere Art auch Gott zugesprochen wird (Hua III, § 58). In Heideggers Sein und Zeit (S. 350-369) ist es das Dasein, das sich im Zuge zeitlicher Ekstasen selbst überschreitet, das immer schon »in der Welt« ist und nicht erst nachträglich mit ihr in Bezug tritt; das Problem einer »Realität der Außenwelt« erledigt sich in actu durch den lebendigen Vollzug der Welt- und Selbsterfahrung. 37In Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung setzt sich dies fort. Der fraglichen Intimität des Bewußtseins, seiner angeblichen psychischen oder auch transzendentalen Immanenz, setzt der Autor eine Intentionalität entgegen, die wir nicht nur passiv über uns ergehen lassen, sondern aktiv vollziehen. So besteht das Cogito in einer »tiefgreifenden Bewegung des Transzendierens, die mein Sein selbst ausmacht, als gleichursprüngliche Berührung mit meinem Sein und mit dem Sein der Welt« (1945, S. 431 f., dt. S. 429 f.). In seinem Werk Die Gesellschaft als imaginäre Institution faßt schließlich Castoriadis die radikale Imagination »als immanentes Transzendieren, Über-sich-hinaus-gehen zum anderen«, worin sich zeigt, »daß das ›Seiende‹ [also auch das Bewußtsein] nicht es selbst ›sein‹ kann, ohne anderes sein zu lassen« (1984, S. 546).
Die Idee der Selbsttranszendierung nimmt allerdings paradoxe Züge an. Wären Transzendierender und Transzendiertes völlig eins, so käme die Selbsttranszendierung einer Aufhebung der Transzendenz gleich. Wie in den spekulativen Visionen des Einen, wie in der alten Lehre vom Nus, wie aber auch in einer Dialektik des Ganzen, die Substanz und Subjekt am Ende in eins fallen läßt, ginge die Erfahrung der Transzendenz auf in einem Denken der Transzendenz, das seine Situierung im Hier, Dort und Jetzt »überfliegt«. Sind Transzendierender und Transzendiertes jedoch nicht eins und bedeutet Transzendenz eine »Identität in der Differenz« (Merleau-Ponty 1964, S. 279, dt. S. 286), so stellt sich die Frage, wie das Selbst der Selbsttranszendierung zu verstehen ist. Entspricht es, grammatisch gesprochen, einem Genitivus subjectivus oder einem Genitivus objectivus, und wenn beides zugleich zutrifft, wie ist dann dieses »Zugleich« zu verstehen? Hier geraten wir an einen Punkt, wo Fremdheit als eigene Passivität und Fremdheit des Anderen die Selbsterfahrung durchdringen.
Dies ist zugleich der Punkt, um den das Denken von Levinas kreist. Dieser sucht zu zeigen, wie die Transzendenz in der Fremderfahrung ihre radikalste Form erreicht, ohne daß er dabei die Immanenz aus den Augen verliert. Bei Plotin findet das Selbst seine Bleibe in sich selbst und im Einen. Diese μονή begegnet uns auch bei Levinas als demeure; doch darunter versteht er das Haus, den Oikos, in dem wir den Anderen als Gast empfangen, wie er in Totalität und Unendlichkeit in seinem großen Kapitel über Innerlichkeit und Ökonomie zeigt. Die Ethik nimmt Züge einer verallgemeinerten 38