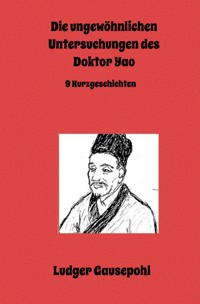Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Journalist erlebt als Korrespondent einer westdeutschen Zeitung die ersten Zeichen des Zerfalls des DDR-Regimes. Eines Tages ist alles anders: Offiziere der NVA putschen unter Androhung des Gebrauchs einer Atombombe, die sie aus den Lagern der Roten Armee gekapert haben. Sie zwingen die SED zur Übergabe der Macht und beginnen mit Reformen, die zu einem echten, demokratischeren Sozialismus führen sollen. Lukas verliebt sich in einen Leutnant der NVA, der sich dann als Sprecher des Revolutionskomitees erweist. Der Journalist erlebt private und gesellschaftliche Höhen und Tiefen und verfolgt die Ereignisse im Land bis zu ihrem dramatischen Höhepunkt und erlebt auch Veränderungen in seinem eigenen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Soziotopia
oder
eine andere Wende 1989
Roman
Von Ludger Gausepohl
Soziotopia
oder eine andere Wende 1989,
Ludger Gausepohl, 2017, 2., überarbeitete Ausgabe,
Berlin 2019
Inhaltsverzeichnis
Ostberlin
Der Putsch
Die Unruhe vor dem Sturm
November, Dezember 1989
Wohin DDR?
Aus der Traum?
Neue Wege
Oktober 2015
Anhang
Danksagung
Ludger Gausepohl (geb. 1954) stammt aus Münster und lebt seit 1987 in Berlin. Er war Chemiker, Heilpraktiker und vieles andere. Als Erstes veröffentlichte er die Kurzgeschichten „Die ungewöhnlichen Untersuchungen des Doktor Yao“. Es folgte der Roman:
„Die heimliche Liebe der Friedensboten zu Münster“.
Aus dem Niederländischen übersetzte er: von Capelle, van de Bovenkamp, „Berlin unter Hitler“ und teilweise von denselben, „Der Berghof“, beide Tosa, 2007
von Bernardus Gewin (Vlerk): „Die Reiseabenteuer des Joachim Polsbroekerwould und seiner Freunde “
Daneben schreibt er einen Reiseblog (Ludgers Reisen) und einen Blog zu verschiedenen Themen (Ludgers Ideen und Träume).
Ostberlin
Wie ungeduldig hatte ich die Abfahrt des Zuges nach Berlin erwartet! Als er dann verspätet losfuhr, kam bei mir auf einmal der Gedanke auf: Wohin bringt mich das hier? Mein gewohntes, etwas langweiliges Leben, blieb in Bremen zurück. Ich hatte wohl davon geträumt, in Washington, Paris oder London arbeiten zu dürfen. Auch Moskau und selbst Bonn wären eine Herausforderung für mich gewesen. Nun sollte es aber Ostberlin werden. Ich erwartete nichts Aufregendes dort zu erleben, aber immerhin lag Westberlin direkt daneben. Da war schon mehr los, vor allem was die lebhafte Schwulenszene anging. Vielleicht lernte ich endlich einen netten Mann kennen, mit dem mehr möglich war als schneller Sex.
Nach endlosem Warten hatte ich Mitte August 89 alle Formalitäten erledigt und bekam endlich mein Visum und meine Akkreditierung als Korrespondent der Bremer Zeitung in der DDR. Nach meinem Studium der Publizistik hatte ich mich mehrere Jahre als freier Reporter für verschiedene Zeitungen mit Lokalereignissen herumgeschlagen, etwa den berühmten Kaninchenzüchtervereinen und Ähnlichem. Darauf folgte ein Jahr bei der Bremer Zeitung, wo ich mir mit Berichten aus dem Kulturleben die Meriten für eine größere Aufgabe verdiente. Ich hoffte jetzt, dass das Ostberliner Regime wenigstens ab und zu ein wenig ins Wanken geriet. Hätte ich damals geahnt, wie sehr dies geschehen würde, wäre ich wohl aufgeregter gewesen, als mir die Stelle des Korrespondenten dort angeboten wurde.
Ab Hamburg fuhr ich mit einem Zug der Deutschen Reichsbahn, der Bahngesellschaft der DDR. Die Abteile wirkten altertümlich und die hellbraunen Kunstlederbezüge der Sitze rochen penetrant nach Desinfektionsmittel. Als die Bahn bei Lauenburg die Grenze zur DDR überfahren hatte, stiegen Grenz- und Zollbeamte zu. Die grau uniformierten Herren gingen von Abteil zu Abteil und begutachteten mit penibler Genauigkeit die Papiere. Der Beamte, der mich kontrollierte, schien sich besonders viel Mühe geben zu wollen. Er schaute mich gefühlt minutenlang ins Gesicht und händigte mir erst dann meinen Pass wieder aus:
„Eine gute Reise noch, Herr Holtkamp.“
Bei einer früheren Fahrt durch die DDR nach Westberlin hatten sich die Herren Grenzbeamten nicht so höflich gezeigt. Offensichtlich waren sie angewiesen, Medienvertretern gegenüber besonders korrekt zu sein.
Der Zug fuhr gemächlich weiter und die flache Landschaft zog an mir vorbei. Hier und da sah ich heruntergekommene Bauernhäuser oder kleinere Industriegebäude, ansonsten Felder, Wiesen und hie und da Gebüsch.
Dann erreichten wir Berlin-Spandau und sofort veränderte sich das Bild:
Fabriken, Wohnsiedlungen mit Einfamilienhäusern am Rande, dann Häuserblocks und schließlich der kleine Bahnhof und an der Seite der graue, hohe Turm des Rathauses. Nach kurzem Halt ging es weiter gen Osten. Immer mehr erfasste ich die Größe dieser Stadt, die nicht enden wollte. Wir ließen die Straßenzüge Charlottenburgs hinter uns und kamen als Nächstes am Bahnhof Zoologischer-Garten an. Ich nahm eine S-Bahn zurFriedrichstraße. Dort gelangte ich vom Bahnsteig der S-Bahn eine Treppe tiefer in eine große Halle. Von dort konnte man die U-Bahn ohne Grenzkontrolle erreichen, auch wenn hier schon Ostberliner Hoheitsgebiet war. Ich aber stieg noch eine Treppe tiefer hinab und kam in einen Komplex mit zig dunkelbraunen Kontrollhäuschen, wo ich die Grenzformalitäten über mich ergehen lassen musste. Bei dem einen oder anderen Besucher oder Einreisenden wurde auch das Gepäck durchsucht. Ich gehörte zu den Unglücklichen, musste alle Hosentaschen ausleeren und meine zwei Koffer öffnen. Dabei interessierten sich die beiden Beamten besonders für das Bedruckte, das ich mitführte. Alles wurde gründlich gelesen. Anschließend wurde ich zusätzlich aufgefordert, in eine abgetrennte Kabine zu gehen, wo ich auch körperlich abgetastet wurde. Am Ende musste ich auch noch eine Befragung über mich ergehen lassen. Mit welchem Auftrag ich in die DDR einreise, wo ich wohnen werde und was meine nächsten Pläne seien. Ich beantwortete alles wahrheitsgemäß, wenn auch sehr zurückhaltend. Nachdem ich meine Ausweispapiere und mein Gepäck zurückerhalten hatte, verließ ich erleichtert den Bahnhof und nahm mir ein Taxi zum Interhotel Stadt Berlin am Alexanderplatz. Es wurde, wie man mir gesagt hatte, überwiegend von russischen und anderen osteuropäischen Delegationen und Reisegruppen besucht. Das eher für westliche Gäste vorgesehene Palasthotel war mir zu teuer und außerdem schon ausgebucht.
Später wollte ich versuchen, ein kleines Apartment in einem der Hochhäuser in der Nähe des Alexanderplatzes zu bekommen, damit ich nahe am politischen Geschehen der DDR-Hauptstadt blieb.
Mein erster Wohnort in Ostberlin lag nahe dem Fernsehturm, dem Stolz des DDR-Regimes, das höchste Gebäude am Alexanderplatz. Das Personal des Hotels war höflich, aber sehr reserviert, als wenn man sich bei mir anstecken könnte. Ich ließ mich in meinem kleinen und recht einfachen Zimmer nieder und jetzt hatte ich erst mal nichts weiter vor, aber einen mächtigen Hunger. Die im Hause gelegenen Zillestuben sahen mir ziemlich bieder aus, aber ich hatte keine Lust etwas draußen zu suchen und so aß ich dort deftige deutsche Küche: Kartoffeln mit Leber und Zwiebeln. Am Nachbartisch saß eine Gruppe Russen, die zu ihrem Essen reichlich Hochprozentiges zu sich nahmen, was bald seine Wirkung zeigte. Einige begannen zu singen und alle wurden recht laut. Ich beeilte mich mit dem Essen und begab mich bald auf mein Zimmer. Die langen Flure wirkten irgendwie unheimlich und kalt. Das einfach eingerichtete Zimmer im 15. Stockwerk hatte immerhin eine prächtige Aussicht über den Bahnhof Alexanderplatz in Richtung des Fernsehturms.
Gegen Halbneun wusste ich nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte. In der Infomappe des Hotels fand ich einen Hinweis auf die Bar im 37. Stock. Dort würde die Aussicht noch besser sein als in meinem doch recht mickrigen Zimmer. Der verspiegelte Aufzug sauste mit unerwartet hoher Geschwindigkeit in die oberste Etage.
In dem Restaurant dort war nicht viel los. Die Bar nebenan war modern gestaltet, alles aus Kunststoff und Kunstholz, aber irgendwie doch schick und atmosphärisch. Der Ausblick durch die großen Fenster war überwältigend. Es war hier einiges los und ich wurde gewahr, dass nicht wenige Uniformierte sich dort aufhielten. Erstaunlicherweise waren das keine Russen, sondern Amerikaner. Was machten die denn hier? Russen gab es ebenso, aber die waren nicht uniformiert. Beide Gruppen waren etwa gleich lebhaft. Es herrschte auch kein Mangel an jungen Damen, die mich nicht so interessierten. Da ich nicht alleine an einem der kleinen Tischchen sitzen mochte, setzte ich mich an die Bar. Ein recht kerniger, blonder Barkeeper, etwa Mitte oder Ende zwanzig fragte mich sogleich:
„Wat soll‘s denn sein, junger Mann?“,
Ich bestellte einen Amaretto und ein Wasser, worauf er meinte:
„Se sind wohl ’n Süßer, wa?“
Ich grinste nur und nippte an meinem Glas. Der Bursche gefiel mir, aber man hatte mich gewarnt: Das gesamte Personal des Hotels sollte angeblich im Dienste der Stasi stehen, was mir doch etwas unwahrscheinlich erschien. Aber der Posten des Barkeepers konnte zur Ausforschung der Gäste sicher nützlich sein. Ich schaute mich um und sah einen sehr gut aussehenden GI an einem Tisch sitzen, der nah am Fenster stand.Er war schwer damit beschäftigt, einer jungen Frau den Hof zu machen. Zu schade, er hatte für mich die falschen Neigungen. Aber ich war eh viel zu schüchtern, um einfach so jemanden anzuquatschen. Mein Barkeeper nahm allerdings mein Interesse sehr genau wahr und riss mich mit der Bemerkung aus meiner Schwärmerei:
„Der könnte mir ooch jefallen. Aber is wohl nix zu machen. Biste neu hier in Berlin?“
Das plötzliche Du deutete daraufhin, dass er mich als schwul einsortiert hatte und es wohl ebenfalls war. Ich erwiderte:
„Bin heute erst hier angekommen, aber werde wohl eine Weile bleiben. Ich wohne hier im Hotel.“
„Is ja ulkich, det de hier wohnst und nich im Pallasthotel, da wohnen ja normalerweise die Westler. Aber hier isset ooch nich schlecht. Falls de wat wissen willst, wo de am besten ausjehst, kann ik dir ’n paar Kneipen uffschreibn. Ik bin übrijens der Thomas.“
„Angenehm. Ich heiße Lukas und komme aus Bremen in der BRD. Könnte schon gut ’n paar Infos über schwule Lokale in der Stadt gebrauchen.“
„Det Bremen im Westen is, wees ik natürlich, würd ik ooch ma jerne hin. Dürf’n wa bloß nich.“
Ich war ziemlich erstaunt über seine Offenheit. Ob das so eine Art Provokation sein sollte, um mich gleich aufs Glatteis zu führen? Ich ermahnte mich innerlich zur Vorsicht, aber gleichzeitig wuchs meine Sympathie für diesem Burschen, der etwas kleiner als ich, sportlich-drahtig und offensichtlich sehr kontaktfreudig war. Er schrieb mir dann auf einen Notizzettel, einige Adressen auf, aber kam auch gleich mit dem Angebot, mit mir den einen oder anderen Laden aufzusuchen, wenn er einen freien Abend hätte, was ich nur zu gerne annahm. Er war nicht mein Traummann, aber durchaus mein Typ. Er wirkte intelligent und charmant und hatte noch diese Prise Keckheit. Hätte nicht gedacht, dass ich gleich am ersten Abend eine Bekanntschaft mache. Er war vielleicht froh, mal keine lauten amerikanischen Soldaten oder wodkaseligen Russen vor sich zu haben.
Wir plauderten noch ein wenig weiter, immer wieder unterbrochen durch Bestellungen von anderen Gästen oder der resoluten Kellnerin, die an den Tischen bediente. Da ich ziemlich müde war, verabschiedete ich mich gegen Mitternacht mit dem Versprechen, mich bald wieder blicken zu lassen.
Trotz meiner Müdigkeit konnte ich dann aber nicht sogleich einschlafen, da mir die Begegnung mit Thomas noch im Kopf herumging. Mit Männern hatte ich bisher wenig Erfahrung und wusste auch nicht so genau, was ich überhaupt wollte. Sich auf einen Flirt einzulassen, konnte in diesem Fall heißen, mit der Stasi ins Bett zu gehen. Außerdem, falls Thomas kein Informant der Staatssicherheit war, konnte ich ihn eventuell mit meiner Tätigkeit in Gefahr bringen. Daneben machte mir auch das Programm des nächsten Tages Sorgen. Auf meinem Plan stand der Besuch des Amtes für Auslandskorrespondenten im Außenministerium der DDR sowie meine Anmeldung bei der Volkspolizei. Beide Aufgaben waren für mich äußerst unangenehm. Die Begegnung mit den DDR-Behörden hatten mir Kollegen bereits vor meinem Reiseantritt als schwierigsten Teil meines Jobs in Ostberlin beschrieben. So gut es ging, hatte ich mich darauf vorbereitet und alle nötigen Informationen beschafft. Aber wenn man so einem rabiaten und dienstbeflissenen Beamten gegenüberstand, war das sicher etwas ganz anderes als in der Theorie.
Die Anmeldung bei der Volkspolizei am nächsten Morgen empfand ich noch als relativ harmlos. Auch in bundesdeutschen Behörden konnte der Umgangston manchmal ruppig sein. Man kam sich quasi als Bittsteller vor. Das hatte ich recht eindringlich erfahren, als ich nach meinem Studium zunächst eine Weile arbeitslos war und Sozialhilfe beantragen musste. Meine Anmeldung bei der Volkspolizei war jedenfalls einigermaßen schnell erledigt. Länger dauerte dann der Besuch im Außenministerium. Ich musste endlos warten und bekam von einem höflichen Beamten mitgeteilt, an welche Vorschriften ich mich zu halten habe und was ich auf keinen Fall tun dürfe. Keine Recherche, kein Interview, keine Reise innerhalb der DDR dürfe ich ohne Erlaubnis des Ministeriums durchführen. Ansonsten stünden mir ja die Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur ADN und der übrigen Medien der DDR zur Verfügung. Weiterhin sollte ich die Pressekonferenzen im Internationalen Pressezentrum wahrnehmen. Anschließend wurde ich an einen weiteren Herrn verwiesen, dessen Funktion mir nicht ganz klar war. Er befragte mich ziemlich eindringlich über meinen Werdegang, über meine Funktionen in Bremen. Er wollte genau wissen, welche Planungen ich hatte und worin meine speziellen Interessen bestünden. Dabei blieb er ausgesprochen höflich, ja fast freundlich. Er bot an, mir auch mit Informationen auszuhelfen, wenn er von mir ebenfalls Auskünfte über Personen erhielte, die ich interviewte. Hier wurde mir klar, dass dies ein Anwerbeversuch für eine „freie“ Mitarbeit bei der Staatssicherheit war. Ich erwiderte, dass ich noch zu neu in Ostberlin sei, um solche Versprechungen machen zu können. Ich hätte auch die Anweisung, meine Informationsquellen zu schützen.
Am nächsten Tag besuchte ich das Internationale Pressezentrum, um mich über die Örtlichkeit zu informieren und mich dort anzumelden. Im Eingangsbereich wurden meine Papiere gründlich kontrolliert. In einer Vorhalle lagen Zeitungen der DDR aus und ich sah einige Leute dort herumstehen und miteinander reden. Ein älterer Mann mit knittrigen grauem Anzug und Krawatte kam auf mich zu und fragte:
„Neu hier?“
„Ja, das ist richtig. Mein Namen ist Lukas Holtkamp und schreibe für die Bremer Zeitung.“, erwiderte ich.
„Harry Barthold, angenehm. Ich bin hier für die WAZ.“
„Sie sind schon länger hier?“
„Ja, schon vier Jahre. Wir duzen uns übrigens hier im Allgemeinen. Dir wird man es zu Anfang ganz schön schwer machen und dich auf Herz und Nieren prüfen.“
„Tja, da habe ich bereits erste Erfahrungen sammeln können.“
„Am Besten konzentrierst du dich zunächst auf die DDR-Medien, besonders auch die lokalen außerhalb Berlins. Deine meisten Anträge auf Reisen und Interviews werden ohnehin erst mal abgelehnt. Aber du kannst durchaus auch „privat“ mit Leuten reden und einfach den Alltag in der Stadt, beispielsweise in Kaufhallen, Bibliotheken, Museen und Ähnlichem beobachten.“
„Danke, das werde ich machen!“
Das waren sehr wertvolle Hinweise für mich, ebenso wie der über die Kneipe, in der sich viele westdeutsche Korrespondenten abends trafen. Ich brauchte jedes kleine Fädchen, welches ich zu meinem eigenen Netz knüpfen konnte. Als der Kollege fragte, wo ich denn wohne und ich ihm meinen gegenwärtigen Standort nannte, meinte er nur, er fühle sich in Westberlin sicherer. Da müsse er auch nicht auf so vieles verzichten, das machten viele Kollegen so.
Ich meldete mich im Pressezentrum an und begann dort auch gleich mit dem Studium der DDR-Presse. Leider lagen dort nicht von allen Zeitungen die aktuellen Exemplare aus. Ich erhielt von einem anderen Kollegen den Rat, mir wichtige Zeitungen und Zeitschriften zu abonnieren. Ich wusste allerdings, dass mein Budget nur sehr begrenzt war. Ich hatte ja keine ARD, Bildzeitung oder FAZ im Rücken, sondern nur die kleinste Zeitung Bremens. Aufgrund der etwas unruhiger gewordenen Verhältnisse in der DDR und im gesamten Ostblock hatte man sich überhaupt entschieden, einen Korrespondenten hierher zu schicken.
Die nächsten Tage gehörten dem Kennenlernen der Stadt und verschiedener für mich wichtiger Einrichtungen. Gelegentlich hatte ich das Gefühl, das mich jemand verfolgte und und ein Kollege aus München gab mir später den Hinweis, dass in meinem Zimmer mit Sicherheit ein oder gar mehrere Mikrofone versteckt wären. Ich sollte dort nichts Wichtiges besprechen. Ich müsste ständig mit Überwachung rechnen. Das gab mir ein ziemlich mulmiges Gefühl, aber verschiedene andere Journalisten meinten, dass man sich schnell daran gewöhne.
Am Freitagabend hatte mein netter Barkeeper frei. Wir hatten verabredet, uns im Café Schönhauser Eck am U-Bahnhof Dimitroff-Straße zu treffen. Das Café war recht modern ausgestattet, mit tiefen Ledergarnituren, eher Hockern als Sesseln, die ich aber ziemlich unbequem fand. Die Gäste waren zumeist dem eigenen Geschlecht zugetan, manche von ihnen recht chic gekleidet. Wie ich später erfuhr, stand das Café unter staatlicher Leitung, und nur weil einige der Kellner schwul waren, fand sich die gleichgeartete Kundschaft hier ein. Außer Thomas hatten sich noch seine Freunde Sven und Sascha dazugesellt. Die beiden konnten nicht gegensätzlicher sein. Ersterer hatte hellblondes kurzes Haar und ein etwas vernarbtes Gesicht. Er trug über seinem T-Shirt eine Lederweste und Jeans, während Sascha eine Bundfaltenhose und ein feines Hemd trug, dazu ein leichtes Jackett. Er wirkte ein wenig tuntig mit seinem sorgfältig gekämmtem, aschblonden, etwas dünnem Haar. Aber beide waren mir direkt sympathisch. Sven wirkte eher schlicht und unkompliziert, Sascha hingegen eher empfindsam und bedürftig nach Aufmerksamkeit. Sie nahmen mich gleich mit Küsschen rechts und links in ihren Kreis auf. Ich hatte den Eindruck, dass mir meine Westherkunft einige Pluspunkte verschaffte. Ich freute mich einfach, so leicht Anschluss gefunden zu haben und hoffte, so leichter einen Blick ins Innere der DDR werfen zu können, aber natürlich auch, einfach Spaß mit den Leuten zu haben. Thomas wetterte ziemlich ungehemmt über das Regime der DDR und seine beiden Freunde stimmten größtenteils zu. Sascha erzählte, dass er sogar als Jugendlicher aus der FDJ, der staatlichen Jugendorganisation, ausgetreten sei. Das hätte ihm zwar einigen Ärger bereitet, aber letztendlich keine wirklichen Probleme. Thomas hatte immerhin die die Erweiterte Oberschule (entspricht etwa dem Gymnasium) besucht und nach einem dreijährigen Militärdienst begonnen, Tiermedizin zu studieren. Er bekannte:
„Es hat mich tierisch jenervt, dat ich andauernd Marxismus-Leninismus aufm Stundenplan hatte. Hat mir janich jepasst.“
Ich fragte:
»Hat der Sozialismus nicht auch seine guten Seiten?“ Sven meinte dazu ganz trocken:
„Ja, aber wohl nur in der Theorie. Außer Vorschriften, Beschränkungen und Mangelwirtschaft kommt für den Bürger nichts dabei heraus.“ In diesem Moment platzte Thomas mit der Bemerkung heraus:
„Ik hab vorn paar Monaten nen Ausreiseantrag jestellt. Nachdem se mich erst von der Betriebsleitung, dem Betriebsparteikomitee un ooch von der Stasi gelöchert haben, war jetzt lange nichts mehr davon zu hören. Aber kürzlich hat mein Chef mir ufjefordert, den Antrag zurückzuziehen. Sonst kann er meene Beschäftijung im Unternehmen nich jarantieren.“ Ich fragte ihn:
„Machst du dir denn keine Sorgen über deine Zukunft?“
„Nö. Wenn se mir kündijen, wären meene Chancen, dat der Antrag bewilligt wird, ja vielleicht noch jrößer.“ Auch die beiden anderen gaben an, so einen Antrag gestellt zu haben. Ich war ziemlich überrascht, so viel Ablehnung des eigenen Staates auf einem Haufen anzutreffen.
„Euch ist doch klar, dass ich euch dabei nicht offen unterstützen kann, oder? Ich würde meine Lizenz als Korrespondent verlieren. Dann heißt es tschüss DDR.“ Sven erwiderte:
„Is doch klar, dat kriegen wir ooch alleene hin.“
Ich fragte mich nur selbst, ob ich auch so handeln würde. War es nicht sinnvoll, für Änderungen im eigenen Land einzutreten. Immerhin gab es ja eine aktive Opposition in der DDR. Mit Robert Havemann, Rudolf Bahro und anderen hatten sich ja sogar SED-Mitglieder offen gegen das bestehende System erklärt. Aber es war mir auch verständlich, dass sie ihr persönliches Leben nach eigener Façon leben wollten. Alle drei erhofften sich als Schwule auch mehr Freiheit im Westen. Es gab zwar in der DDR einen fortschrittlicheren Schwulenparagrafen als in der Bundesrepublik, aber in der Anwendung sah es wohl doch ganz anders aus. Schwule Organisationen waren offiziell nicht zugelassen und die Einzige, die sich mal gegründet hatte, war zunächst beobachtet und dann verboten worden. Jetzt gab es nur im Rahmen der Kirche informelle Treffen. Aber damit hatten die Drei nichts zu tun. Sie waren eher unpolitisch, hatten nur ein allgemeines Unbehagen mit der politischen Situation und wünschten sich einfach mehr Bewegungsmöglichkeiten.
Als unser Gespräch langsam etwas verebbte, kam plötzlich ein neuer Gast herein, ein ziemlich gut aussehender, großer Mann mit lockigem, dunklem Haar und dunklen Augen. Thomas Gesicht begann zu leuchten und er sprang auf, ihm entgegen. Sven, der neben mir saß, flüsterte mir zu:
„Das ist Rico, Thomas neuer Schwarm, ein Tänzer vom Friedrichstadtpalast.“