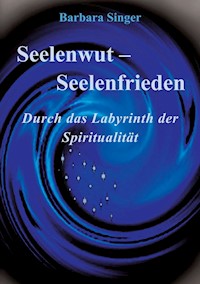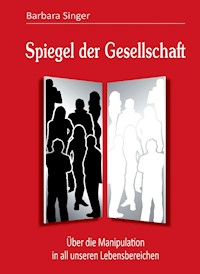
12,90 €
Mehr erfahren.
Der Spiegel der Gesellschaft behandelt aktuelle gesellschaftliche Themen, Werte/Wertewandel und wie wir in dieser Hinsicht manipuliert wurden und werden. Welches Bild entsteht, wenn wir uns unsere Gesellschaft ansehen? Was zeichnet unsere Gesellschaft aus? Welche Werte haben wir eigentlich? Vor allem - sind es unsere eigenen? Ob uns das bewusst ist oder nicht - wir werden manipuliert! Es wird vorgegeben, welche Werte wir haben, wie wir denken und wie wir leben sollen. Und das ist nicht immer zu unserem Besten. Doch warum geschieht das und wer profitiert davon? In einem Streifzug durch sämtliche Lebensbereiche werden die übergreifenden Zusammenhänge dargestellt: zwischenmenschliche Beziehungen, Medien, Werbung, Religionen, das Internet, die westliche Medizin und vieles mehr, mit psychologischer Analyse und Fallbeispielen. Das Buch zeigt auf, nach welchen Mustern wir heutzutage funktionieren und wie wir uns dahin bewegt haben oder besser gesagt bewegt wurden. Denn solange wir uns Illusionen hingeben und uns zu unserem Nachteil manipulieren lassen, haben immer andere die Kontrolle über uns. In diesem Buch lernen Sie einiges über die Werkzeuge der Manipulation. Kennt und durchschaut man diese, kann man von da an wachsamer durchs Leben gehen und sich auf diese Weise bereits größtenteils dem Einfluss entziehen. Die im Buch vermittelten Informationen sollen jedoch keine Angst auslösen. Der Weg soll fort von Angst und Hilflosigkeit hin zu mehr Bewusstheit führen. Dieses Buch kann teilweise aufwühlend, manche Wahrheiten vielleicht sogar erschreckend sein. Das letztliche Ziel ist jedoch, Erkenntnis, Bewusstheit und ein Gefühl der Selbstbestimmung zu hinterlassen und den Lesern Informationen und Hilfsmittel zu geben, wie man destruktive Energien und Absichten ins Leere laufen lassen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Barbara Singer
Spiegel der Gesellschaft
Über die Manipulation in all unseren Lebensbereichen
www.tredition.de
© Barbara Singer
1. Auflage 2012
Umschlaggestaltung, Illustration: © Berthold Sachsenmaier
Verlag: tredition GmbH, Mittelweg 177, 20148 Hamburg
ISBN: 978-3-8424-9603-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Ein Überblick über das heutige Gesellschaftsbild
Wertewandel – von der Vergangenheit bis heute
2 Die heutigen Rollen von Frauen und Männern
3 Beziehungen im Chaos
4 Wie wir uns weiterentwickeln können – die neue Frau, der neue Mann
5 Mediale Manipulation und Täuschungen
Unsere zugrunde liegenden Bedürfnisse, durch die wir manipulierbar sind
Mediale Verunglimpfungen von Kritikern des Systemsm
6 Soziale Netzwerke: Facebook und Co.
7 Manipulation durch Religion
8 Manipulation durch Politik
Kurzexkurs Massenpsychologie
9 Wissenschaft – zurechtgebogene Wahrheiten?
Die Wissenschaft im Dienste der Pharmaindustrie
10 Die psychischen Hintergründe – warum wir anfällig sind!
11 Wo ist die Wahrheit zu finden?
12 Was uns wirklich glücklich macht
13 Wie wir aus dem Spiel wieder aussteigen können
14 Der selbstbestimmte Mensch
Literatur
Einleitung
Wenn wir uns unsere Gesellschaft ansehen, zu welchem Ergebnis kommen wir dann wohl? Sind die Menschen im Allgemeinen besonders glücklich? Was zeichnet unsere Gesellschaft aus? Welche Werte haben wir?
Diese Fragen klingen nun etwas vereinheitlichend, aber genau um diese grundsätzlichen Fragen geht es auch. Denn ob uns das bewusst ist oder nicht – wir werden manipuliert! Es wird vorgegeben, welche Werte wir haben sollten, wie wir denken und wie wir leben sollen. Und glauben Sie mir: Das ist nicht immer zu unserem Besten! Nun werden Sie sicher denken, dass es sich bei diesem Buch wieder um so eine Verschwörungstheorie handelt. Doch das trifft es nicht. Ich möchte Ihnen zeigen, nach welchen psychologischen Mustern wir heutzutage funktionieren und wie wir uns dahin bewegt haben. Gleich vorweg, nicht alles ist schlecht, aber vieles hat sich auch nicht so entwickelt, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten – nicht wahr?
Sehen Sie sich unsere Beziehungen an – Trennungen, Scheidungen, Chaos. Man sieht sehr wenig von dem Bild einer glücklichen Beziehung, die wir uns doch eigentlich alle wünschen. Oder unser Berufsleben. Sind wir glücklich in unserem Beruf, tun wir, was wir tun wollen, oder fühlen wir uns mehr wie Roboter, die ihre Pflicht erfüllen, um ihre Lebensgrundlage zu finanzieren? Haben wir uns damit abgefunden? Wenn ja, warum – weil das alle tun?
In diesem Buch möchte ich Ihnen gerne aufzeigen, warum das wohl so ist. Warum sind wir nicht glücklich, wo wir uns das doch alle so sehr wünschen und eifrig danach streben? Ich möchte Ihnen in diesem Buch einen Spiegel vorhalten, der bisweilen etwas desillusionierend sein kann, aber Ihnen die Möglichkeit gibt, aus einem unangenehmen Traum zu erwachen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Dabei werde ich auf viele vertraute Dinge, die zu unserem Leben gehören, eingehen, wie die Medien, die Werbung, Religionen, das Internet und vieles mehr. Solange wir uns Illusionen hingeben und uns zu unserem Nachteil manipulieren lassen, können wir nicht wirklich glücklich werden, und wenn, sind wir immer davon abhängig, wann uns der „Glückshahn“ von außen wieder zugedreht wird. Aber leider wird er meist gar nicht aufgedreht…
In diesem Buch zeige ich Ihnen die Werkzeuge der Manipulation. Wenn Sie diese einmal kennen gelernt und durchschaut haben und von da an wachsam durchs Leben gehen, haben Sie sich bereits größtenteils davon befreit. Ich möchte jedoch mit den hier vermittelten Informationen bei Ihnen keine Angst auslösen, denn Angst gibt es schon zu viel auf dieser Welt, und viele bedienen sich dieser. Der Weg soll fort von der Angst und Hilflosigkeit hin zu mehr Bewusstheit führen. Es geht insofern nicht um Verschwörungstheorien, als dass wir Menschen nicht lediglich wie arme Opfer dargestellt werden, die für die Zwecke der Mächtigen missbraucht werden, selbst wenn das zum Teil nicht abzustreiten ist. Aber es geht vor allem um die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Darum zeige ich Ihnen, in welchen Bereichen wir uns gerne manipulieren lassen und warum. Denn unsere liebgewonnenen Gewohnheiten wollen wir nicht so gerne aufgeben. Aber keine Sorge – Sie müssen jetzt nicht gleich Ihr Leben komplett umkrempeln, Ihren Job kündigen oder Sonstiges. Ich lade Sie nur ein, sich offen dem „Spiegel der Gesellschaft“ zu stellen – es wird nicht zu Ihrem Nachteil sein!
Doch ich muss Sie auch warnen! Dieses Buch kann Sie aus Illusionen erwecken und Ihnen Anregungen geben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenn Sie das nicht wollen, sollten Sie dieses Buch nicht lesen, denn es könnte Ihnen schwerfallen, es wieder zu vergessen.
Hinweis: Die Namen der in den Fallbeispielen erwähnten Personen wurden zur Wahrung der Anonymität der Betreffenden geändert.
1 Ein Überblick über das heutige Gesellschaftsbild
Zunächst möchte ich in groben Zügen unser Gesellschaftsbild darstellen. In den darauffolgenden Kapiteln gehe ich dann genauer auf die einzelnen Themen ein.
Beginnen wir zunächst mit einer Zusammenfassung der Situation der Familien in der Jetztzeit. In Europa ist seit den 60er Jahren ein deutlicher Geburtenrückgang zu verzeichnen. Ich möchte Sie nun nicht mit Statistiken langweilen, darum fasse ich die Informationen inhaltlich zusammen. Dieser Rückgang soll durch die Immigration einer Bevölkerung ausgeglichen werden, die eine ganz andere Kultur hat und wo den Frauen ausschließlich häusliche Pflichten und Kindererziehung zukommen. Während in Europa Werte wie Gendersensibilität zunehmend thematisiert werden, steht das im Widerspruch zu einer verstärkten Zuwanderung einer kulturellen Schicht, wo die Frauenunterdrückung noch par exellence vollzogen wird. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau steckt hier noch nicht einmal in den Kinderschuhen.
Durch die Reduktion der Geburten in Europa kommt es zu einem verstärkten Anstieg von Familien mit Einzelkindern, sowie einem Anstieg an kinderlosen Ehen. Die Geburtenkontrolle, zum möglichen Erhalt der Erwerbstätigkeit der Frau, erfolgt sowohl durch deutlich verbesserte Verhütungsmethoden als auch durch Schwangerschaftsabbrüche. Die Anzahl der Eheschließungen ist ebenfalls deutlich rückläufig, und damit steigt wiederum die Zahl von nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Geburten an. Was früher noch als Schande galt, nämlich ein uneheliches Kind, ist heute bereits völlig unauffällig. Die Scheidungsrate ist deutlich gestiegen und in Folge die Anzahl der Einpersonenhaushalte. Es gibt mehr Alleinerziehende und deutlich mehr Scheidungskinder als in der Vergangenheit. Es dürfte nicht überraschen, dass die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern ebenfalls angestiegen sind, ebenso wie Überforderungen bei den Erziehungsberechtigten. Durch Scheidungen und Wiederverheiratungen kommt es zu einem deutlichen Anstieg an Stiefeltern, -kindern und Patchworkfamilien. Auch dies birgt neues Konfliktpotential, sowohl in der neuen Familie, als auch mit Ex-Partnern, also den Ursprungsmüttern und -vätern.
Genauere Statistiken finden Sie unter:
http://www.uni-regensburg.de
Sind die obigen Verhältnisse einfach Entwicklungsgeschehnisse oder wird uns in gewisser Weise vorgegeben, wie wir zu leben haben? Früher war es so – da wurde den Menschen genau übermittelt, welche Lebensformen akzeptiert sind und welche nicht.
Sehen wir uns nun an wie heutzutage, ein(e) typische(r) Bürger/in zu sein hat. Welches Gesellschaftsbild wird uns infiltriert? Beginnen wir mit den Frauen. Diese haben emanzipiert zu sein – doch was heißt das genau? Sie sollen selbst einen Beruf erlernen, sodass sie nicht von den Männern abhängig sind. So es sich mit Ausbildungen, Beruf, Karriere ausgeht, sollen sie Kinder bekommen, für die sie dann aber nicht viel Zeit haben. Damit es finanziell auch reicht, sollen sie möglichst schnell wieder zurück in ihren Beruf, denn sonst ist der Job fort. Darum müssen die Kinder schon sehr früh zu fremden Betreuungspersonen wie Tagesmüttern, Tagesstätten, Krippen, Ganztagskindergärten, Hort etc. Erzogen werden die Kinder also die meiste Zeit von anderen. Bei einer 38,5- oder 40-Stunden-Woche geht sich das auch kaum anders aus.
Nun zu den Männern. Auch wenn sie heute nicht mehr die Paraderolle als Ernährer und Versorger haben, so ist die Definition über den Beruf sehr wichtig für sie. Denn Männer werden immer noch stärker an ihrer beruflichen Position gemessen als Frauen – auch von den Damen, die meinen, keinen Versorger mehr nötig zu haben. Nebenbei haben sie beruflich noch unter einer Frauenquote zu leiden und in privater Hinsicht unter einer Konfusion ihrer männlichen Rolle. Mehr dazu aber in den nächsten Kapiteln.
Wie sieht es mit den Finanzen aus?
Die Lebenskosten sind heute extrem hoch, vor allem in Relation dazu, dass das durchschnittliche Einkommen seit Jahren stagniert oder sogar noch sinkt. Selbst Akademiker werden oft äußerst schlecht bezahlt. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen bei Akademikern die hohe Nachfrage an Arbeitsplätzen ausnutzen. So suchen sie zwar nach Akademikern, stellen diese dann offiziell aber unter einer anderen Berufsbezeichnung ein. Der Bewerber wird selbstverständlich davon zu Beginn informiert – ist er/sie nicht einverstanden, bekommt jemand anderes den Job, der bereit ist, sich unter seinem Wert zu verkaufen. Frei nach dem Motto: „Irgendeinen Trottel finden wir schon, der eine hohe qualitative Arbeit für einen Spottlohn macht!“ Der Erfolg gibt ihnen leider recht, und so gibt es heute Akademiker zu „Dumpingpreisen“. Wer sich nicht fügt, bleibt höchstwahrscheinlich arbeitslos. Die existentiellen Ängste sind heutzutage nahezu in allen Berufsgruppen vorherrschend. Hauptsache, man hat Arbeit – doch sollte es so sein? Wünschen wir uns tatsächlich so ein Leben? Oder müssen wir uns damit abfinden? Steckt vielleicht eine bewusste Strategie dahinter?
Wir werden zu einem Lebensstil gebracht, der von Pflichterfüllung geprägt ist. Von früh bis spät müssen wir arbeiten, damit die Lebensgrundlage gesichert ist. Die Wohnungen werden immer teurer, sodass sich viele Menschen mit zu kleinen Wohnungen zufrieden geben müssen. Es wird uns ein Minimum an Lebensqualität geboten und das Maximum an Einsatz verlangt. Dieser Trend ist immer deutlicher zu erkennen. Die vermeintlichen Sicherheiten, die wir in unserem Leben wähnten, werden immer weniger. Selbst unser mühsam erspartes Geld ist nicht mehr sicher vor zockenden Banken oder skrupellosen Politikern.
Abgesehen von der Pflichterfüllung dürfen wir uns natürlich mit unserem erworbenen Geld etwas gönnen. Modetrends in den unterschiedlichsten Bereichen geben vor, was wir unbedingt kaufen müssen. So sollte man immer das aktuellste Handy haben, oder gar ein I-Phone oder Smartphone, denn sonst gehört man nicht zur guten Gesellschaft. Dass wir von der Werbeindustrie dahingehend manipuliert werden, die perfekten Konsumenten abzugeben, die immer das Aktuellste haben müssen, dürfte wohl kaum jemand bestreiten. Hat uns dieses Konsumdenken jedoch glücklich gemacht? Zugegeben, es macht Freude, sich etwas zu leisten, worauf man gespart hat und was man gerne haben wollte. Nur wissen wir oft nicht, was unsere eigenen Wünsche sind und welche uns von außen suggeriert werden – zum finanziellen Wohl der anderen. Echte Wünsche spüren wir auch dann in unserem Inneren, wenn wir diese nicht irgendwo im äußeren Umfeld gesehen haben und sie uns schmackhaft gemacht worden sind. Doch leider haben wir verlernt, nach innen zu spüren, und sind es gewohnt, von außen verführt zu werden. Wir sind zu passiven, steuerbaren Robotern geworden. In dem Drang dazuzugehören, ja kein Außenseiter zu sein und uns in das vorgegebene Bild einzufügen, sind wir steuerbar. Wir haben uns zum sogenannten Homo oeconomicus, dem Wirtschaftsmenschen, entwickelt.
In den 60er Jahren beschrieb bereits der Soziologe Erich Fromm die Folgen und Risiken des sogenannten „Marketingcharakters“. Die Menschen würden die Werte, die von der Werbung und Marktwirtschaft vorgegeben werden, zunehmend annehmen und sich selbst daran messen. In weiterer Folge würde nur der wirtschaftliche Erfolg gewertet und als Maß aller Dinge verkauft. Erfolge, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen, zählen förmlich nicht. Auch das hat sich in den Köpfen der Menschen regelrecht festgesetzt und führt bei mangelndem wirtschaftlichen Erfolg leicht zu Minderwertigkeitsgefühlen. Letztlich ginge es nur noch um Macht und Geld, so Fromm – wobei sich die Macht über den Profit definiere. Womit sich der bekannte Ausspruch „Geld ist Macht!“ bewahrheiten dürfte.
Der „Homo oeconomicus“ ist eine Modellvorstellung der Wirtschaftstheorie. Diese beschreibt einen Menschen, der ausschließlich nach wirtschaftlichen Aspekten denkt und handelt. Nur ökonomische Ziele seien für ihn wichtig, und er ist gekennzeichnet durch Eigenschaften wie:
rationales Verhalten
das Streben nach größtmöglicher Gewinn- und Nutzenmaximierung
absolute Kenntnis wirtschaftlicher Entscheidungsmöglichkeiten sowie deren Folgen
vollständiges Wissen und weitgehende Informationen über sämtliche Märkte und Güter
Ebenso könnte man den Wirtschaftsmenschen als Inbegriff des Patriarchats bezeichnen. Denn wenn Sie sich die Eigenschaften genau ansehen, werden Sie merken, dass es stark männlich geprägte, patriarchale Werte sind. Doch Einseitigkeiten, seien es männliche oder weibliche Einflüsse, führen immer zu einem Ungleichgewicht. Wir brauchen aber ein harmonisches Zusammenspiel beider Werte. Davon sind wir noch weit entfernt, trotz oder auch wegen des Gendermainstreamings.
Deutlich zu merken ist, dass sich viele Menschen zu Egoisten und Egozentrikern entwickeln. Das spiegelt sich sehr drastisch in unserer Gesellschaft. Rücksichtslose Ellbogentechnik auf der Jagd nach Ressourcen jeder Art und nach Aufmerksamkeit kommt dabei zum Einsatz. Über Konsumgüter soll unser Ego befriedigt werden. Zugegeben, es funktioniert. Doch das Ego der Menschen wird dabei immer größer, während der Zusammenhalt und das Mitgefühl mit anderen immer geringer werden. Oft setzt man Letzteres auch nur als Mittel zum Zweck ein, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie man es schon oft von diversen Spendenorganisationen gehört hat. Wer bekommt das Geld? Jene, die ohnehin schon genug haben! Die wirklich Armen bekommen es nicht, sie werden nur benutzt, um bei den potentiellen Spendern Mitleid zu erregen!
Viele Menschen klagen über einen krassen Egoismus in der Gesellschaft und eine soziale Kälte, die immer mehr zu spüren ist. Ebenso sind viele mit ihrer beruflichen und/oder privaten Situation unzufrieden, was sich ebenfalls wie eine negative energetische Welle ausbreitet. Berufliche Unzufriedenheit bemerkt man beispielsweise an Menschen, deren Kundenverhalten stark verbesserungswürdig ist. Diese Unzufriedenheit resultiert daraus, dass viele Arbeitnehmer buchstäblich am falschen Platz, überfordert und unterbezahlt sind. Höfliche Kundenanfragen werden dann knapp und unfreundlich beantwortet. Das Resultat ist eine wachsende Kundenunzufriedenheit in zahlreichen Branchen, mehr Wechsel zur Konkurrenz, steigender Druck auf das Unternehmen und in weiterer Folge, gemäß der Hackordnung, steigender Druck auf die Mitarbeiter. Das Ergebnis bleibt jedoch dasselbe, da dies ein Teufelskreis ist. Druck, Drohungen und Strafen wirken sich nicht positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit sowie auf deren Psyche aus und infolgedessen auch nicht auf das Verhalten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der bereits während der Schulzeit nur die Rede von Mangel und vernünftigen Entscheidungen in Zusammenhang mit der Berufswahl ist, fernab jeglicher persönlichen Wünsche und Talente. Wie sollen Menschen eine gute Arbeit verrichten, wenn sie etwas tun müssen, das nicht ihrem Potenzial entspricht? Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Doch wenn sie ständig hören, dass sie nicht das tun können oder sollen, was sie gerne möchten und was ihren Talenten entspricht, ist es kein Wunder, dass unsere Gesellschaft so aussieht, wie sie heute aussieht. Sie könnten nun einwenden, dass dies immer oder auch früher schon so war. Das ist auch richtig. Aber vielleicht ist es heute schwieriger, seine Selbstbestimmung zu ignorieren, weil wir uns dieser zwischenzeitlich mehr angenähert haben, als je zuvor. Auf diesen Wandel gehe ich im nächsten Abschnitt noch genauer ein.
Was sich ebenfalls sehr deutlich zeigt, ist eine starke und immer mehr zunehmende Kritikunfähigkeit bei vielen Menschen – selbst bei konstruktiv geäußerter Kritik. Woher kommt das? Sind wir zu einer Gesellschaft von Egozentrikern mutiert, die wie Könige und Königinnen niemals kritisiert werden dürfen? Manchmal kommt es einem so vor. Auf Kritik folgen dann eben Rache, verbale Giftpfeile oder simples Beleidigtsein. Oftmals zeigt es sich auch bei nachweislichen Fehlern, dass die Betreffenden damit nicht konfrontiert werden wollen. Ein gutes Beispiel dafür sind Kunstfehler bei Ärzten. Gerade aus diesem Bereich habe ich besonders viel gehört. So sind Patienten, bei denen Ärzten ein Fehler unterlaufen ist, danach gänzlich unwillkommen. Häufig wird dann versucht, die Patienten möglichst schnell wieder loszuwerden. Selten sind ein Eingestehen von Fehlern und ein Bemühen, diese wieder auszugleichen, was eigentlich ihre Pflicht wäre. Doch der Patient als lebendes Beispiel ihrer Fehlbarkeit soll aus dem Blickfeld weichen und Ruhe geben. Auch in anderen Bereichen haben wir es mit teilweise heftigen Reaktionen zu tun, wenn auf ein Fehlverhalten hingewiesen wird. Beschweren Sie sich in einem Restaurant, dass das Essen nachweislich nicht in Ordnung ist, und Sie brauchen nicht mehr lange auf eine schlechte Behandlung zu warten. Wer Fehler aufzeigt, selbst wenn diese berechtigt sind, braucht für Feinde nicht mehr zu sorgen. Es wird also erwartet, dass man immer alles duldsam hinnehmen soll, egal mit welchen Unannehmlichkeiten man dadurch konfrontiert ist.
Das soll nun ein einleitender Überblick sein, wie sich unsere Gesellschaft derzeit offenbart. Mag sein, dass dies nun alles sehr düster klingt. Doch ich möchte einmal das Bild unserer aktuellen Gesellschaft so darstellen, wie es momentan aussieht. Die Vor- und die Nachteile dieser Entwicklungen besprechen wir noch. Ebenso, ob wir uns dahin entwickelt haben bzw. dahin entwickelt wurden – durch geschickte Manipulation. Das zu erkennen, ist sehr wichtig! Denn die Manipulation einer Gesellschaft wird selten zu deren Vorteil eingesetzt. Der Vorteil liegt bei den wenigen Mächtigen, welche die Gesellschaft zu steuern versuchen. Bisher ist ihnen das gut gelungen – ob es ihnen auch weiterhin gelingt, liegt jedoch an uns. Der erste Weg ist die Erkenntnis, zu der ich mit diesem Buch gerne einen Beitrag leisten möchte.
Wertewandel – von der Vergangenheit bis heute
Wir wollen nun anhand der gesellschaftlichen Entwicklung den Wandel an Werten genauer beleuchten. Dass sich die Werte im Laufe der Zeit immer wieder verändern und den aktuellen gesellschaftlichen Normen unterworfen sind, ist offensichtlich. Doch was sind Werte überhaupt? Wie entstehen sie und wofür brauchen wir Werte?
Andreas Schulz schreibt in seinem Abstract „Bürgerliche Werte“, dass es sich bei Werten um sprachliche Konstruktionen handelt.
„Ihre konkreten Inhalte erschließen sich in kommunikativen Situationen und Handlungen, deren Akteure sich wechselseitig Einverständnis über deren Geltung signalisieren. [… ] Werte setzen moralische Verhaltensstandards, an denen sich alle orientieren sollen. Ihre Funktion besteht darin, in einer Gesellschaft partikularer Interessen Gemeinschaft und Ordnung zu stiften. Eine solche als moralisch verstandene Wertordnung ist idealerweise durch Stabilität und zeitliche Dauer gekennzeichnet.“ (Schulz, A., 2008, S. 29)
Erhoben werden gesellschaftliche Werte und Meinungen durch Meinungsumfragen. Schulz fragt hierbei, wie aussagekräftig diese jedoch sind und sieht die zugehörigen Institute „selbst als Produzenten von Meinungen und Werten.“ (S. 30)
Aus der Psychologie ist bei wissenschaftlichen Untersuchungen der sogenannte Versuchsleitereffekt bekannt. Das bedeutet, dass die persönliche Meinung des Versuchsleiters einen Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Dies kann bereits durch eine bestimmte Formulierung von Fragen geschehen oder durch die Art und Weise, wie der Versuchsleiter die Teilnehmer instruiert. Auch bei Meinungsumfragen kann man manchmal die subjektive Meinung des Interviewers deutlich spüren. Verstärkt wird dieser Effekt vor allem im persönlichen Interview. Hier reichen bereits nonverbale Gesten, wie ein verstärkendes Nicken bei sozial erwünschten Antworten oder eine steinerne, missbilligende Miene bei sozial unerwünschten Antworten. Auf diese Weise können Wertvorstellungen geprägt werden, zumal das Ergebnis der Meinungsumfragen medial verbreitet wird. Damit kann man einer Gesellschaft vermitteln, welche Werte gerade wichtig und akzeptiert sind, ebenso umgekehrt.
Man unterscheidet materielle Werte (Geld, Besitztümer) und immaterielle, wie geistige, religiöse oder moralische Werte. Die Beeinflussung bezieht sich meist auf die immateriellen Werte, wobei durchaus materielle Werte als Lockmittel dienen können. Werte sollen das Verhalten der Menschen prägen. Die Befolgung von Werten basiert auf freiwilliger Basis, sie werden jedoch kollektiv attraktiv gemacht durch die soziale Akzeptanz bzw. die soziale Abwertung bei Nicht-Einhaltung. So können aus Werten sehr leicht Verhaltensnormen werden. Werte sind gesellschaftlich normierte Einstellungen. Der Mensch muss dann für sich entscheiden, welchen Werten er sich verstärkt zuwenden möchte. Dabei kann es durchaus zu inneren Widersprüchen und Wertekonflikten kommen, insbesondere bei aufgesetzten Werten, die nicht der wahren Einstellung des Betreffenden entsprechen.
Werte können sehr positiv sein und Menschen Halt und eine Richtung vorgeben. Sie können jedoch auch missbräuchlich zur Manipulation einer Gesellschaft eingesetzt werden. In diesem Fall würden die scheinbar guten Werte letztlich zum Nachteil der Gesellschaft oder Einzelner angewendet werden. So verwenden beispielsweise radikale religiöse Gruppierungen Wertehaltungen dazu, um Menschen zu Taten zu bewegen, die absolut destruktiv sind, wie z. B. bei Selbstmordattentätern.
Die Psychologen Shalom H. Schwartz und Wolfgang Bilsky (1987) haben eine Theorie über universelle Werte entworfen, die allen Menschen, wenn auch in unterschiedlichem Grade, gemeinsam sein müssten. Sie untersuchten das Modell in verschiedenen Kulturen (in dieser Studie Deutschland und Israel). Sie fanden heraus, dass es Werte gibt, welche Menschen in verschiedenen Kulturen innehaben, wenn auch die Ausprägung der einzelnen Werte sehr verschieden sein kann. Es gibt folglich grundlegende Werte, die auch über die Zeit ziemlich stabil bleiben. Doch auch hier ändern sich die Ausprägungen. So ist beispielsweise die Selbstbestimmung ein Konstrukt, dass sich im Laufe der Geschichte sehr verändert bzw. sich erst richtig deutlich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hat.
Sehen wir uns nun einmal jene Werte an, die sich im Laufe der Zeit deutlich verändert haben. Dazu zählt vor allem die Werteverschiebung im privaten Bereich und in der Familie. Wirsching (2008) schreibt, dass sich das Wort „Familie“ im Deutschen erst um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert eingebürgert hat. Im 18. Jahrhundert stand „Familie“ wie das Wort „Haus“ für Angehörige einer Hausgemeinschaft, dazu konnten unmittelbare Verwandte ebenso wie Stiefeltern und -kinder sowie Bedienstete zählen. Es konnte einen adeligen Grundbesitz genauso meinen wie eine Bauernfamilie, also Hofbesitzer.
Maihofer, Böhnisch und Wolf (2001) beschreiben die Familienstruktur des 18. Jahrhunderts wie folgt: Die Ehe war stark durch die patriarchale Struktur geprägt. Der Mann war das Oberhaupt der Familie und die Frau musste sich ihm unterordnen, ihm nachgeben und ihm Recht geben. Die Beziehung zu den Kindern war von Seiten der Eltern emotional eher verhalten. Kinder wurden als Esser gesehen oder als Arbeitskräfte, die schon in sehr frühen Jahren zupacken mussten. Die Kinderanzahl war sehr hoch, aber auch die Kindersterblichkeit.
Mit der Zeit beschrieb das Wort „Familie“ immer mehr die eigentliche Kernfamilie. Waren früher die Familien eines „Hauses“ mit wirtschaftlichen Funktionen verbunden wie Produktion, Erwerb etc., so bildeten sich die Funktionen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück. Der Lebenserwerb fand zunehmend außerhäuslich statt. Infolgedessen entstand eine Trennung in privat und öffentlich. Die Familie wurde zur Privatsphäre und gewann an „emotionaler Bedeutung“. (Wirsching, 2008)
Daraus entstand weiter eine Polarisierung der Geschlechter. Die Aufgabe des Mannes war der Erwerb des Lebensunterhalts, der meist außer Haus stattfand, und die Aufgabe der Frau war die Führung des Haushalts und die Kindeserziehung. Ende des 19. Jahrhunderts war das Leitbild stark von Ehe und Familiengründung geprägt, sodass „Singles“ zur damaligen Zeit „rasch außerhalb des herrschenden bürgerlichen Konsenses“ standen.
„Zu einem großen Teil also – und dies bis in die sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein – basierte die moderne europäische Gesellschaft auf der Familie und war auf bürgerliche Werte und Geschlechterrollen gegründet. Der entsprechende Wertekanton liegt zum Teil bis heute unseren Vorstellungen davon zugrunde, wie das Privatleben zu organisieren sei: zumindest implizit, oder sei es bloß als Negativfolie ‚moderner‘ emanzipativer Forderungen.“ (Wirsching, 2008, S. 71)
Nachdem die Auswirkungen des zweiten Weltkrieges überwunden waren, erfolgte ab den 60er Jahren ein Aufschwung, der den Wohlstand der Gesellschaft deutlich anhob. Plötzlich konnte man sich nicht nur das Nötigste zum Leben leisten, sondern sich auch darüber hinaus etwas gönnen. Es gab zwar nach wie vor unterschiedliche Schichten an Einkommen und Wohlstand, aber insgesamt war es für alle Schichten möglich, sich mehr zu leisten als in den Jahren davor. Die Lust am Konsumieren und Genießen wurde ausgekostet, wodurch die Wirtschaft weiter florierte. Hier entstand ein gewisser Gewöhnungseffekt, und nachdem das Konsumverhalten für viele Menschen existentiell notwendig war, wurde das Rad durch Medien und Werbung am Laufen gehalten. Doch der Wohlstand ist mittlerweile rückläufig, durch steigende Lebenskosten und unsichere Arbeitsplatzverhältnisse.
Am Arbeitsmarkt zeigt sich heute bei den Menschen ein ähnlicher Trend wie bei den Beziehungen und Familien. Es wird mehr gewechselt. Während es früher noch normal war, die ganze Zeit der Berufstätigkeit oder zumindest einen Großteil davon bei einem Unternehmen zu verbringen, ist das heute schon beinahe die Ausnahme. Es herrscht fast überall eine höhere Fluktuation.
Was sich ebenfalls verändert hat, ist die Bildung und die damit verbrachte Zeit. Nachdem heutzutage der Druck, eine Familie schon in sehr jungen Jahren ernähren zu müssen, meist wegfällt, bietet es mehr Gelegenheit, sich Zeit für Ausbildungen zu nehmen, bevor eine Familie gegründet wird. Die Bildungsangebote wurden deutlich erhöht, insbesondere die Angleichung für Frauen. Der Grad der Ausbildung bestimmt vielfach über die weiteren beruflichen Chancen. War es in den 60er und 70er Jahren noch verhältnismäßig einfach, einen Job zu bekommen, wird das heute nicht nur zunehmend schwieriger, sondern ist auch an immer mehr Bedingungen geknüpft. Viele Aus- und Weiterbildungsinstitute machen sich diesen Trend stark zu Nutze. Konnten früher beispielsweise Akademiker sofort nach dem Studium (nebst Pflichtpraktika) sicher mit einem Job rechnen, so stehen sie heute noch vielen Hürden gegenüber. Ein Mangel an Plätzen geht quer durch sämtliche Berufsgruppen. Ob es sich dabei um Lehrstellen, Studienplätze, Praktikumsplätze oder verfügbare Jobs handelt, macht fast keinen Unterschied mehr. Obendrein wird diese Situation wirtschaftlich ausgenutzt und das Gehalts- und Lohnniveau deutlich gedrückt. Viele Akademiker verdienen heute im Verhältnis ungefähr ein Gehalt, das früher bisweilen ohne Studienabschluss erreicht und sogar übertroffen wurde – und das bei steigenden Lebenserhaltungskosten!
Auch durch die Frauenbewegung hat sich viel gewandelt. Bruggmann (2004) fasst zusammen, dass sich dadurch Veränderungen in den Einstellungen, aber auch in den Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen ergeben haben. Folglich habe sich der „weibliche Handlungsspielraum“ erweitert. Es ergaben sich für Frauen mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Ihre Funktion bestand nun nicht mehr nur darin, Kinder zu bekommen und den Haushalt zu führen, sondern sie konnten selbständig die Familienplanung, so gewünscht, in die Hand nehmen. Daraus entstanden weitere Herausforderungen, nämlich Beruf und Familie miteinander zu vereinen.
In den vergangenen Jahrzehnten war ein Wechsel von Pflichterfüllung zu Selbstverwirklichung zu erkennen – der sich heute wieder in Richtung Pflichterfüllung umkehrt. Arbeit war früher meist verbunden mit der notwendigen Pflicht, den Lebensunterhalt zu verdienen. Freude an der Arbeit war „Luxus“. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung ab den 60er Jahren und den ansteigenden Bildungs- und Arbeitsplatzchancen konnten die Menschen auch verstärkt auf ihre Selbstverwirklichung im Beruf achten. Für viele Menschen wurde es zunehmend wichtiger, dass der Beruf auch Freude bereiten sollte. Durch die heutige Tendenz hin zu steigenden Lebenskosten, weniger Arbeitsplätzen und erneut sinkenden Löhnen quer durch sämtliche Berufsgruppen rutschen wir unversehens wieder in den Pflichterfüllungsmodus. Überall ist die Rede von Mangel, bei den Lehrstellen, bei den Studienplätzen, bei den Arbeitsplätzen. So betrifft es heute erneut immer mehr Menschen, welche sich nicht in jener Ausbildung wiederfinden, die sie eigentlich machen wollten, und in weiterer Folge dann auch nicht im erwünschten Beruf landen. Das Problem dabei ist, dass man sich jedoch längst an den Gedanken der Selbstverwirklichung gewöhnt hat, der früher noch kaum in den Köpfen der Menschen vorherrschte. Aus diesem Bedürfnis heraus wieder im Pflichterfüllungsmodus zu landen, ist viel schwieriger, wodurch auch viele psychische Probleme entstehen. Das mittlerweile allseits bekannte Burn-out-Syndrom hängt nicht zuletzt mit Überlastung und fehlender Selbstverwirklichung zusammen. Aber auch Unterforderung kann krank machen, wodurch der Begriff „Boreout“ (Rothlin & Werder, 2007) geprägt wurde. Hier spielt die fehlende Selbstverwirklichung eine ebenso große Rolle. Ein Zustandsbild, mit dem wir uns künftig mehr und mehr befassen müssen.
Die Tendenz zu mehr Selbstverwirklichung war neben dem angestiegenen Wohlstand der Gesellschaft und den daraus resultierenden Möglichkeiten auch auf die zunehmende Individualisierung zurückzuführen. Bruggmann (2004) beschreibt, dass es durch den Individualisierungsprozess zu einer Zunahme an Selbstverantwortlichkeit kam. Leitende Normen und Werte von Seiten der Religionen oder vorgegebene Moralvorstellungen verloren immer mehr an Bedeutung. Durch die Ablösung von Norm und wertgebenden Instanzen müssen die Menschen lernen, für ihre Entscheidungen selbst einzustehen und die Konsequenzen zu tragen.
„Der Individualisierungsprozess brachte also einerseits neue und größere Freiheiten und einen markanten Zugewinn an Gestaltungsmöglichkeiten, er bedeutet aber auch Verunsicherung und Orientierungslosigkeit und zwingt die Individuen, zu Selbstgestaltern ihres Schicksals zu werden.“ (Bruggmann, 2004, S. 9)
Daraus ergeben sich laut Bruggmann nicht nur Entscheidungsmöglichkeiten, sondern auch ein Druck oder Zwang, Entscheidungen in beruflicher und privater Hinsicht zu treffen. Das kann zu einer Akzeptanz oder einer Verweigerung der vorgegebenen Werte führen. Die Möglichkeit, sich an vorgegebene Strukturen festzuhalten, wird dadurch geringer. Die Entscheidungsfreiheit, aus gegebenen Verhältnissen auszubrechen, privat wie beruflich, erhöht sich dadurch. So wie eine Scheidung früher noch ein großes Hindernis darstellte, das mit viel Schande einherging, ist dies heute schon fast normal, wenn man sich die Statistiken ansieht.
Durch die Individualisierung ergibt sich zwar einerseits eine größere Selbst- bzw. Eigenständigkeit – insbesondere bei Frauen hat sich das neu entwickelt –, aber auch eine stärkere Ichbezogenheit. Vor allem diese Ichbezogenheit beeinträchtigt die Beziehungsfähigkeit. Beziehungsfähig zu sein bedeutet zwar nicht, sich alles gefallen lassen zu müssen und sein eigenes Ich bzw. seine Bedürfnisse zurückzustellen, doch das Gegenteil davon ist einer Beziehung ebenfalls nicht zuträglich.
In Bezug auf Familie und Partnerschaften sind verschiedene „Privatheitstypen“ entstanden. Meyer (1992) nennt den individualistischen, den partnerschaftsorientierten und den kindorientierten Privatheitstyp. Auch diese Kategorien können noch weiter ausdifferenziert werden. Im Gegensatz zu früher, wo die klassische Familie eine vorgegebene Norm darstellte, sind heute viele Arten akzeptiert. Es kam zu einer „Pluralisierung“ von unterschiedlichen Lebensformen. Nichtsdestotrotz ist der klassische familiäre Typ mit Kindern noch überwiegend. Die Familiengründung erfolgt durchschnittlich jedoch später als noch vor ca. 40 Jahren. Während manche diese Tendenzen künstlich als Krise darstellen wollen, sehen andere darin nur ein Aufbrechen eines zu starren Systems.
Was sich ebenfalls verändert hat, ist der Stellenwert der Kinder. Während es noch bis in die 50er Jahre normal war, Kinder zu strengem Gehorsam zu erziehen und diese schon sehr früh zu diversen Hausarbeiten heranzuziehen, haben Kinder heute viel mehr Möglichkeiten, auch ihren eigenen Willen zu zeigen und einzubringen. Peuckert (2002) spricht in diesem Zusammenhang von der „Emanzipation“ des Kindes und dem Wandel vom Befehlshaushalt zum Verhandlungshaushalt. Die einzelnen Familienmitglieder inklusive der Kinder agieren nicht hierarchisch, sondern partnerschaftlich miteinander. Dabei sind alle gleichberechtigt, die Eltern nehmen keinen autoritären Status mehr ein. Dadurch, dass eine Schwangerschaft heutzutage auch kontrollierbarer ist, als in Zeiten vor der Pille, basiert nun Elternschaft viel häufiger auf Basis der freien Entscheidung als auf Basis eines „ungeplanten Unfalls“. Weil es viel mehr „Wunschkinder“ gibt, bekommen Kinder auch einen höheren Stellenwert als beispielsweise in den 40er und 50er Jahren. Kinder werden dadurch viel seltener als zusätzlicher, nicht eingeplanter Kostenfaktor oder als Altersversorgung gesehen, sondern als Bereicherung und Bestandteil zum Glück.
Leider zeigt sich auch an dieser Entwicklung die Tendenz, von einem Extrem ins andere zu fallen. Die starke Unterdrückung von Kindern war genauso wenig gut für ihre Entwicklung wie der heute immer mehr verbreitete „Laissez-faire-Erziehungsstil“. Dieser ist nämlich davon geprägt, dass letztlich keine Erziehung stattfindet. Vor lauter Vermeiden von Autorität passiert das ebenso schlechte Gegenteil. Die Eltern verhalten sich dabei ausgesprochen passiv, was auch einen gleichgültigen Eindruck hinterlassen kann. Die Kinder wachsen ohne große Lenkung einfach auf und werden sich im Allgemeinen selbst überlassen. Die Eltern versuchen hierbei mit einem Minimalaufwand an Erziehung durchzukommen. Es überrascht nicht, dass solche Kinder meist ab der Schule, aber spätestens im Jugend- und Erwachsenenalter große Probleme haben. Sie kennen keine emotionale Bindung und sind infolgedessen unfähig, eine solche herzustellen und aufzubauen. Sie haben Probleme, sich an Regeln zu halten und Grenzen zu berücksichtigen.
Durch die Gleichgültigkeit, welche die Eltern bei diesem Erziehungsstil häufig vermitteln, kommt es zu einem sehr geringen Selbstwertgefühl des Kindes. Im Erwachsenenalter sind sie verstärkt gefährdet, von Suchtmitteln Gebrauch zu machen oder kriminell zu werden. Jene Grenzen, die ihnen als Kinder nicht gesetzt wurden, können im Erwachsenenalter erst recht nicht eingehalten werden. Kinder brauchen jedoch auch Grenzen, selbst wenn diese nicht in gewalttätiger oder zu rigider Art und Weise gesetzt werden sollten. Methoden, die physische oder psychische Grausamkeiten miteinschließen, sind damit sicher nicht gemeint. Aber Kinder testen Grenzen aus; bekommen sie keine, weil die Eltern zu schwach darin sind, kann erst recht wieder eine Hierarchie in der Familie entstehen. Diesmal sind allerdings die Kinder oben, und die Eltern werden unterworfen. Es gibt nicht wenige Beispiele, wo Kinder im Befehlston den Eltern Anweisungen erteilen, welche dann von diesen folgsam ausgeführt werden. Steht die Hierarchie auf dem Kopf, so ist das noch schlechter als der autoritäre Erziehungsstil. Die Eltern sollten schließlich noch eine Vorbildfunktion erfüllen, die aber nicht eintreten kann, wenn das Kind die Eltern nicht respektiert.
Woran sollen sich die Kinder dann orientieren? Auch die Lehrer bekommen zunehmend mehr Probleme mit Kindern, denen nie Grenzen gesetzt wurden. Bemerken die Eltern einmal, dass ihnen die Kinder über den Kopf gewachsen sind, ist es meist schon zu spät. In ihrer Hilflosigkeit greifen sie dann wieder zu den stark autoritären Methoden, die ihnen aus ihrer Kindheit bekannt sind, mitunter werden auch Schläge eingesetzt. Doch selbst wenn sie diesen Laissez-faire-Stil durchziehen, hat das keinen guten Einfluss. So hat Gerhardt (1995) untersucht, dass Jugendliche mit Gewaltneigung einer Atmosphäre des „Gewährenlassens und der Bindungslosigkeit“ ausgesetzt waren. Die Jugendlichen berichteten in Interviews von „einem innerfamiliären Klima der Gleichgültigkeit“. Laut Heitmeyer (1997) folgt einem zu großen Mangel an Disziplin von Seiten der Eltern ein Defizit an Normen und Werthaltungen bei den Jugendlichen. Die Folge davon seien Gewaltbereitschaft und Aggression. Eisenberg (2000) konnte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen einem, wie er es nennt, permissiven Erziehungsstil und Gewalttaten von Jugendlichen aufzeigen. Auch wenn die gewaltsamen Methoden mit Schlägen als Erziehungsmaßnahme zurückgegangen sind, was ebenfalls als Ursache für Gewalttätigkeit angesehen wurde, so bringt das Abdriften ins Gegenteil offenbar denselben Effekt. Durch die zu frühzeitige Selbständigkeitserziehung verlieren die Kinder oft den Halt und die Fürsorge, die sie zu diesem Zeitpunkt noch brauchen würden. Dieses Gewährenlassen signalisiert oft keine Zuneigung, sondern die Abwesenheit davon – dies sollten Eltern bedenken, wenn sie sich für einen zu antiautoritären Erziehungsstil entscheiden.
Natürlich kann man in diesem Zusammenhang nur allgemeine Aussagen machen. Es gibt nach wie vor Eltern, die von Beginn an immer noch einen sehr strengen autoritären Erziehungsstil gebrauchen, und solche, die ein gutes Mittelmaß gefunden haben. Es ist gut, dass Kinder einen höheren Stellenwert bekommen haben und nicht wie kleine Idioten behandelt werden, die nichts zu melden haben – aber ins Gegenteil sollte man es auch nicht übertreiben.
Nun wollen wir uns noch die heutige finanzielle Situation insbesondere für Familien oder Alleinerziehende ansehen.
Über die derzeit hohen finanziellen Belastungen für die Bürger haben wir bereits gesprochen. Dies betrifft Familien mit Kindern, trotz Familienbeihilfe, noch stärker. Noch mehr betrifft es alleinerziehende Mütter, die nach der Schätzung von Peuckert (2002) zu ca. 40 Prozent in relativer Armut leben. Mayer meinte bereits 1995, dass junge Erwachsene „aufgrund der gestiegenen Ausbildungsdauer oft viel länger von den Eltern abhängig“ wären. Dieser Effekt verstärkt sich in den letzten Jahren zunehmend, da die Preise für Wohnungen stetig steigen und der Arbeitsmarkt auch für junge Menschen bereits sehr schwierig geworden ist. Hatten junge Leute in den 70er und 80er Jahren bei einer fundierten Ausbildung kein Problem, eine Stelle zu finden, so ist heute auch der Anteil an hochqualifizierten und gut ausgebildeten Menschen auf Arbeitssuche ziemlich hoch.
Doch nun zu den alleinerziehenden Müttern. Diese sind nicht nur häufig durch die finanzielle Situation belastet, sondern auch durch die Verantwortung und mögliche Sorgen bezüglich ihrer Kinder, die sie nicht mit einem Partner teilen können. Hinzu kommen noch etwaige Sorgerechtsstreitigkeiten zu Beginn einer Scheidung oder Trennung, sowie mögliche Konflikte mit dem Ex-Partner. Aufgrund der Notwendigkeit, arbeiten zu gehen, auch im Vollzeitausmaß, ergeben sich weitere Aufgaben wie das Finden von Betreuungsmöglichkeiten und mangelnde Zeit für das eigene Kind. Die Kinder selbst sind dabei oft schon sehr früh involviert in Partnerschaftsproblematiken, zeitlichen Stress der Eltern, und sie bekommen häufig sehr früh die finanziellen Schwierigkeiten mit. Dass dies Auswirkungen auf die Seele eines Kindes hat, dürfte jedem klar sein. Aus dem heraus können sich Beziehungsängste und -probleme herausbilden, sowie ein Mangeldenken in Bezug auf Geld und Ressourcen.
Napp-Peters (1995) hat hundertfünfzig Scheidungsfamilien im Rahmen einer Langzeituntersuchung von zwölf Jahren beobachtet. Eine Scheidung sei für Kinder zu Beginn immer eine traumatische Erfahrung. Jedes vierte Kind wies in den ersten beiden Jahren anhaltende Verhaltensstörungen auf. Nach zehn Jahren haben 75 % dieser Kinder immer noch große Probleme.
Lüscher und Pajung-Bilger (1998) kamen zu dem Schluss, dass das Eltern-Kind-System auch nach einer Scheidung nicht aufgelöst werden kann. Aus dem heraus ergebe sich die Aufgabe, die familiale Beziehung in irgendeiner Form zu gestalten. Dies birgt natürlich Konfliktpotential, dem sich die Betroffenen jedoch stellen müssen. Lüscher und Pajung-Bilger führten Interviews mit Geschiedenen und fanden heraus, dass es bei einer Scheidung entscheidend sei, wie die Beziehungsgestaltung in der Familie und die Krisenbewältigung stattfand. Gemeint ist damit, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Ursprungsfamilie der jeweiligen Betroffenen, also das Lernen am Modell der eigenen Familie, selbst wenn in dieser keine Scheidung vorkam.
Partnerschaften stehen heute vor der Herausforderung, die auf Selbstverwirklichung basierten Interessen und Lebensvorstellungen, die bei einem Paar sehr unterschiedlich sein können, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Beziehungen sind heutzutage weniger geprägt durch eine finanzielle Abhängigkeit der Frauen, dadurch ergeben sich andere Konstellationen. Bruggmann spricht in diesem Zusammenhang von einer „pragmatischen Verhandlungspartnerschaft“ oder von einer „Konsensualpartnerschaft“. Trotzdem ist bei vielen Menschen noch das Bedürfnis nach Stabilität vorhanden, auch fern von jeglichen finanziellen Abhängigkeiten. Je mehr die Stabilität in der äußeren Welt, zumindest subjektiv verloren geht, desto wichtiger wird die Stabilität für die Menschen im Privatleben (Beck & Beck-Gernsheim, 1990).
Weil Frauen nicht mehr so häufig von Männern finanziell abhängig sind, hat die Ehe ihre Funktionalität in Sachen Absicherung verloren. Für viele hat die Ehe nur in Zusammenhang mit Familiengründung einen Sinn. Nach Nave-Herz (2002) legitimieren Kinder heutzutage die Ehe, während es früher umgekehrt war. Obendrein sind die Ansprüche an Paarbeziehungen gestiegen, insbesondere bei den Frauen. Es reicht nicht mehr, nur einen „Ernährer“ zu finden – das wird in diesem Sinne auch meist gar nicht gesucht –, dafür wird mehr Liebe und Nähe erwartet, sowohl in Bezug auf die Beziehung selbst, als auch bei den Kindern. Väter sollen heute mehr an der Erziehung teilhaben. Das Angebot an potenziellen Beziehungs- oder Intimpartnern ist heute durch das Internet sehr viel größer, da man auch mit Menschen am anderen Ende der Welt zumindest einen Flirt aufrechterhalten kann. Oftmals spielt sich das neben einer bestehenden Beziehung ab. Darauf gehe ich später noch näher ein. Die höheren Ansprüche an Beziehungen und das breite Spektrum an Möglichkeiten bringen Partnerschaften häufig in Konflikte und führen vermehrt zu Trennungen. Nach Peuckert (2002) hat sich die Zahl der Scheidungen im Zeitraum von 1960 bis 2000 verdreifacht. Diese Tendenz ist bis heute ungebrochen und bewegt sich eher noch nach oben. Obwohl bei vielen Menschen ein Bedürfnis nach Stabilität vorhanden ist, sind die Beziehungen instabiler als je zuvor. Es ist jedoch nicht nur ein Nachteil, dass Partnerschaften heute schneller aufgelöst werden, denn es zeigt auch, dass Menschen erkennen, wenn eine Beziehung nicht mehr passt und sie nicht glücklich macht. Während sie früher in Beziehungen geblieben sind, obwohl sie unglücklich waren, geben sie sich heute mit diesem Status nicht mehr zufrieden. Viele sind jetzt eher bereit, Veränderungen auf sich zu nehmen, und finden sich nicht einfach mit einem unglücklichen Zustand ab. Auch wenn für Kinder Trennungen und Scheidungen traumatisch sind, so sind fortwährende Streitereien und Disharmonien in einer Beziehung noch schlimmer für sie. Inwieweit sich ein Trauma bei den Kindern festsetzt, hängt auch davon ab, wie die Zeit nach der Trennung verläuft und ob die Kinder als Macht- und Druckmittel benutzt werden.
Was sich verringert hat, ist oftmals die Rücksichtnahme auf familiäre Bedürfnisse. Laut Wilk und Beham (1990) sind Eltern häufig von dem Gebot der optimalen Förderung in Kombination mit einer eher kinderfeindlichen Umwelt überfordert.
Dazu zählen folgende Aspekte:
es fehlt oft ein ausreichender Wohnraum;
die öffentliche Infrastruktur für Kinderbetreuung ist vielfach nicht ausreichend;
Teilzeitbeschäftigungen sind schwierig, weil sie kein ausreichendes Einkommen sichern und damit verbunden zu einer zu geringen Pension oder Rente führen.
Von den meisten Menschen wird innerhalb ihrer Erwerbstätigkeit verlangt, dass man für den Beruf alles gibt und private Bedürfnisse weitgehend zurückzustellen habe. Selbst wenn das oft nicht ausgesprochen wird, so ist dennoch diese Grundhaltung bei vielen Unternehmen und Arbeitgebern offensichtlich. Frauen wird vermittelt, dass sie nach einer Schwangerschaft möglichst schnell wieder zurück in den Beruf kommen und ihre Kinder frühzeitig zu Tagesmüttern oder in Krippen geben sollten.
Diesbezüglich äußerte sich auch der Kinder- und Jugendpsychologe Wolfgang Bergmann sehr kritisch. Dieser hat eine Stiftung mit dem Titel „Für Kinder!“ gegründet. Seine Botschaft ist „Kinder brauchen Liebe“. Er spricht sich ganz klar gegen das Abschieben von Babys und Kleinkindern in staatliche Institutionen aus und gegen auf Leistung getrimmte Kinder. Dies habe nicht nur schwerwiegende emotionale Auswirkungen auf die Kinder, es beeinträchtige auch die Fähigkeit zu lernen und sich zu entfalten, trotz kognitiver Frühförderung. Das ständige Trimmen auf Leistung mache die Kinder letztlich bindungsunfähiger und auch dümmer.
Bergmann (10.03.2011) appelliert in einer Videobotschaft an die Menschen:
„Mitunter kommt es einem so vor, als sei ein Kind zu haben ein Opfergang für die Gesellschaft. Überall Klagen, Probleme, Hyperaktivität und vieles mehr. Dabei ist das gar nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist: Kinder sind das größte Glücksversprechen, das wir auf Erden haben. Ohne die Liebe der Kinder zu uns wüssten wir gar nicht, wie wir intensive Liebe entgegennehmen sollen.“
Er spricht davon, dass das Urvertrauen der Kinder die Grundlage für Ethik und Mitgefühl in einer Gesellschaft sein sollten, die aber gegenwärtig kaum noch vorhanden wären – in jedem Fall seien sie beschädigt! Die Ursachen dafür sieht er darin, dass in der Politik und Wissenschaft Kindheit ausgegrenzt werden soll. Er spricht sich deutlich gegen die Aussagen diverser Forschungsinstitute aus, dass Kinder besser in einer staatlichen Institution aufgehoben wären. Dies sei auf allen Ebenen falsch. Die Eltern seien die Quelle der Liebe, bzw. sollten sie das zumindest sein. Bergmann ruft auf, dass man objektive Befunde bräuchte. Die Befunde, welche die derzeitige Wissenschaft liefere, seien zurechtgedreht, bis sie in das politische Metrum passen. Er bezeichnet Aussagen, dass Kinder Schaden nehmen, wenn sie zu lange bei den Eltern bleiben würden, als „glatte Lüge“. Ein Kind braucht die Verlässlichkeit, dass Mama und Papa da sind. Erst auf dieser Basis kann sich bei einem Kind Selbständigkeit entwickeln, jedoch nicht umgekehrt. So lernen Kinder Bindung, im nächsten Schritt Bildung, danach Ethik und das Verlangen mit anderen Kindern zusammen zu sein.
Seine Stiftung widmet sich der Gründung des Ethischen, der Bildung, der Intelligenz und des Mitgefühls, sowie der Aufgabe, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft in diesem Zusammenhang an Väter und Mütter zu bringen. Eine weitere wichtige Aufgabe sei es, diese Erkenntnisse möglichst schnell in politische Diskussionen zu bringen.
„Es ist für nichts anderes als für unsere Kinder und das heißt nicht nur für unsere Zukunft, sondern für das Liebesvermögen dieser Gesellschaft. Die Realität der Liebe findet sich bei den Kindern. Sie darf nicht verloren gehen!“