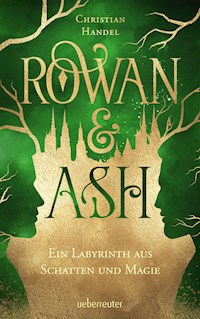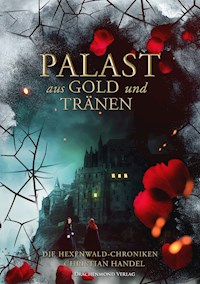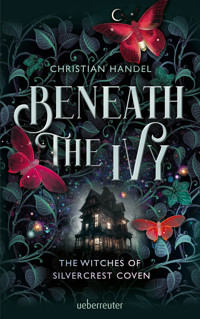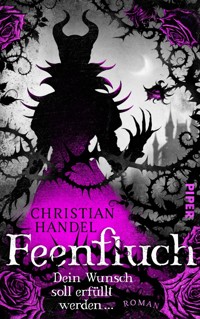6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelstadt
- Sprache: Deutsch
»Babylon Berlin« goes Fantasy: Ein magisches Berlin in den 20er-Jahren, ein zerstörerisches Familiengeheimnis und eine Liebe, die alles verändert, sind die Zutaten für den Urban-Fantasy-Roman »Spiegelstadt. Tränen aus Gold und Silber« von Christian Handel und Andreas Suchanek. In den Schatten unserer Welt existiert eine andere Wirklichkeit: die Spiegelstadt, ein magisches Berlin, erstarrt in den glamourösen 1920er-Jahren und bewohnt von vielgestaltigen Feen-Wesen. Reisen zwischen den Welten sind streng verboten und nur mithilfe magischer goldener Tränen möglich. Auf einer wilden Party in Berlin, die ganz im Motto der 20er-Jahre steht, begegnet Max dem ebenso attraktiven wie geheimnisvollen Lenyo – und gerät damit mitten hinein in einen blutigen Konflikt um die Herrschaft in der Feen-Welt. Verfolgt von gnadenlosen Kreaturen und gefangen in einem Netz aus Intrigen und Machtgier, ahnt keiner von ihnen, dass sie längst zum Spielball einer gefährlichen Macht geworden sind, die die Barriere zwischen den Welten bedroht … Die Zusammenarbeit der beiden preisgekrönten deutschen Fantasy-Autoren Christian Handel und Andreas Suchanek ist ein echter Glücksfall für alle Urban-Fantasy-Fans: »Spiegelstadt. Tränen aus Gold und Silber« ist eine mitreißende Story in einem betörenden Setting mit einer wunderschönen queeren Liebesgeschichte. »Spiegelstadt. Tränen aus Gold und Silber« ist der Auftakt einer romantisch-queeren Fantasy-Dilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christian Handel / Andreas Suchanek
Spiegelstadt
Tränen aus Gold und Silber
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Babylon Berlin« goes Fantasy:
Ein magisches Berlin in den 20er-Jahren, ein zerstörerisches Familiengeheimnis und eine Liebe, die alles verändert, sind die Zutaten für den Urban-Fantasy-Roman »Spiegelstadt. Tränen aus Gold und Silber« von Christian Handel und Andreas Suchanek.
In den Schatten unserer Welt existiert eine andere Wirklichkeit: die Spiegelstadt, ein magisches Berlin, erstarrt in den glamourösen 1920er-Jahren und bewohnt von vielgestaltigen Feen-Wesen. Reisen zwischen den Welten sind streng verboten und nur mithilfe magischer goldener Tränen möglich.
Auf einer wilden Party in Berlin, die ganz im Motto der 20er-Jahre steht, begegnet Max dem ebenso attraktiven wie geheimnisvollen Lenyo – und gerät damit mitten hinein in einen blutigen Konflikt um die Herrschaft in der Feen-Welt. Verfolgt von gnadenlosen Kreaturen und gefangen in einem Netz aus Intrigen und Machtgier, ahnt keiner von ihnen, dass sie längst zum Spielball einer gefährlichen Macht geworden sind, die die Barriere zwischen den Welten bedroht …
Die Zusammenarbeit der beiden preisgekrönten deutschen Fantasy-Autoren Christian Handel und Andreas Suchanek ist ein echter Glücksfall für alle Urban-Fantasy-Fans: »Spiegelstadt. Tränen aus Gold und Silber« ist eine mitreißende Story in einem betörenden Setting mit einer wunderschönen queeren Liebesgeschichte.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Prolog
Morgendlicher Nebel umwogte die Bäume hinter dem Haus.
Der Anblick ließ Imgard lächeln. Als hätte jemand ein Gespinst aus flüssiger Seide über die Landschaft gegossen, eingerahmt in ein Gemälde aus gefrorener Zeit.
Sie nahm die schwere Porzellankanne mit ins Wohnzimmer und stellte sie auf ein Stövchen. Ein Fingerschnippen genügte und das winzige Teelicht loderte.
Im Alltag verzichtete sie weitgehend auf Magie, doch ab und an genoss sie die damit einhergehenden Annehmlichkeiten. In den kurzen Augenblicken, die Erinnerungen bargen.
Im Schneidersitz sank sie auf die Kissen neben dem kniehohen Tisch, goss den dampfenden Tee in die Tasse. Unweigerlich musste sie lächeln. Die bunten Striche aus wasserfester Farbe auf dem Porzellan zeigten einen Jungen, der die Hand seiner Großmutter hielt. Dünne Linien waren über das Gesicht der Großmutter-Figur verteilt.
Damals hatte sie gefragt: »Was soll das denn darstellen?«
Daraufhin hatte ein neunjähriger Max mit gewichtiger Miene erklärt: »Das sind deine Falten.«
Ein Stück Porzellan war abgesprungen, doch sie liebte die Tasse innig. Sie war das Symbol vergangener Tage, die weitaus unbeschwerter gewesen waren.
Der Duft des Lavendeltees stieg ihr in die Nase. Andere tranken den Tee, damit er ihnen beim Einschlafen half. Imgard hingegen genoss es, damit in den Tag zu starten. Als sei sie der lebende Spiegel eines gewöhnlichen Menschen.
»So viele Dinge sind im Fluss«, murmelte sie zu sich selbst und wunderte sich darüber, wie schwer ihre Stimme klang.
Sie nippte an dem Tee, nahm sich Zeit, leerte die Tasse. Stellte sie zurück auf den Tisch und widmete sich ihrer Aufgabe.
Mit langsamen Bewegungen schraubte sie den Verschluss vom Füllfederhalter und begann zu schreiben. Außer dem Kratzen der Metallfeder und dem Klacken des Sekundenzeigers der Standuhr herrschte Stille. Die Linien aus Königsblau sickerten in das Papier. Immer wenn sie einen Satz mit einem Punkt beendet hatte, glitt ein goldener Schimmer über die Worte – und sie verschwanden.
An einem anderen Ort, in einem Tresor, lag ein ledergebundenes Buch. Mit jeder Zeile, die hier verblasste, füllte sich dort eine weitere. So schrieb sie und schrieb, während die Feder kratzte und die Standuhr tickte.
Eine Stunde verstrich. Das letzte Wort fand seinen Platz, der letzte Punkt wurde getupft. Sorgfältig schraubte Imgard den Verschluss auf den Füllfederhalter. Damit blieb nur noch eines zu tun.
Die pastellrosa Dose mit den Tränen war sicher, nur eine hatte sie entnommen. Jetzt musste sie die Träne füllen. Leise intonierte sie Worte, ihre Finger verwoben uralte Magie. Die Verbindung entstand.
Doch bevor sie es beenden konnte, erklang ein Knall. Die Eingangstür flog auf.
»Du hast mich belogen.« Die tiefe Stimme kündete von Wut. »Gib mir den Schlüssel!«
»Was du suchst, wirst du niemals finden«, sagte sie. »Diese Macht ist nicht für deine Hände bestimmt.«
»Du bist genau wie sie! Ihr seid der Untergang für jedes Glück.«
»Meine Fesseln habe ich abgestreift und ich gebe niemandem die Macht, sie anderen überzuwerfen.«
»Dann hole ich sie mir einfach selbst. Wenn deine Bindung gelöst ist, liegt der Schlüssel frei.«
Sie wollte noch etwas sagen, doch es war zu spät. Ein Dolch flog heran, die Klinge schimmerte im Licht, bohrte sich lautlos in ihren Körper.
In ihr Herz.
Imgard kippte nach hinten, ihre Hand erschlaffte. Der tropfenförmige Kristall, der ihre Erinnerung aufgenommen hatte, fiel herab, kullerte unter die Couch.
Schritte entfernten sich.
Mit brechendem Blick sah sie in die Höhe. Vor dem Fenster hatte sich der Nebel zurückgezogen. Das Blau des Himmels war ein wunderschöner Anblick.
Sie hauchte ihren letzten Atem aus.
Und ließ diese Welt hinter sich.
1. Kapitel
Max
Mit einem Quietschen fiel das Gartentor hinter ihm ins Schloss. Max lehnte sich dagegen, ließ den Blick über das alte Herrenhaus in Grunewald wandern, in dem er so viele glückliche Jahre verbracht hatte. Die stuckverzierte Fassade, die gepflegten Beete, dahinter das weite Grundstück, auf dem dichter Nebel wallte.
Es war gerade mal sechs Uhr und die Morgendämmerung zog herauf. Es war noch recht frisch, obwohl der Tag wieder Wärme versprach. Hinter den Fenstern des Hauses brannte kein Licht. Ein schrecklicher Anblick. Dieses Haus war für ihn stets ein Sinnbild für Wärme und Geborgenheit gewesen, jetzt war es nur noch kalter, toter Stein.
Max zog den Trolley hinter sich her in Richtung der Eingangstür und das Rattern der Räder auf den Platten hielt seine Gedanken an das Gestern fern.
Er zog das braungelbe Luftpolsterkuvert aus der Jackentasche und pfriemelte den Schlüssel draus hervor. Er glitt in das Schloss, als hätte er nur darauf gewartet, dass Max endlich hier auftauchte und die Tür aufsperrte.
Es klackte, ein kurzer Ruck und der altbekannte Geruch von Lavendel und Küchenkräutern stieg ihm in die Nase, als er das Herrenhaus betrat.
Seine Großmutter hatte dies zeit ihres Lebens vorbereitet, ihr Anwalt hatte genaue Anweisungen erhalten. Nachdem die Polizei ihre Arbeit getan und den Tatort freigegeben hatte, war eine Putzfirma hier durchmarschiert, wie Max an den gebohnerten Dielen des weitläufigen Wohnzimmers sehen konnte, das sich direkt hinter dem kurzen Flur erstreckte.
Die notwendigen Unterlagen waren Max zugestellt worden, alles war geklärt. Das hier war jetzt sein Haus. Nicht, dass er es je gewollt hatte. Er hätte alles gegeben, um seine Großmutter zurückzubekommen.
Seltsam. Obwohl er gewusst hatte, dass sie den Papierkram vorbereitet hatte, war er davon ausgegangen, dass sie ewig lebte.
Er stellte den Koffer ab, schälte sich aus der Jacke und hängte sie an einen Haken an der Wand. Bei jedem Schritt knarzten die Dielen. Das heraufziehende Tageslicht verwickelte die Pflanzen und Möbel in ein Schattenspiel.
Max kickte seine Schuhe beiseite und trat ins Wohnzimmer. Alles hier wirkte so vertraut und jetzt doch so fremd. Dieser Ort hatte seine Seele verloren. Der Gedanke ließ die Schatten unweigerlich bedrohlicher wirken.
Er betätigte den Lichtschalter. Hier fehlte es an menschlicher Wärme, die in seiner Erinnerung untrennbar mit diesem Haus verknüpft war. Mit einem Gesicht, auf dem stets ein Lächeln lag. Einer gut gefüllten Keksdose und einem Tropfen Honig im Tee.
Mit einem Seufzen sank er auf die Couch, um ihn herum breiteten sich Leere und Stille aus. Genau wie in seinem Inneren.
Es war niemand mehr da.
Sein Blick fiel auf die Bilderrahmen gegenüber der Couch. In ihnen steckten Fotografien, die glücklichere Zeiten zeigten. Nach dem Tod seiner Eltern – da war er so jung gewesen, dass er sich selbst nicht an sie erinnern konnte – hatte seine Großmutter alles getan, Vater und Mutter und beste Kuschelfreundin zu sein.
Bei dem Gedanken grinste er traurig. Ja, so hatte er seine Großmutter genannt. Sie hatte einem naseweisen Siebenjährigen versprechen müssen, dass sie immer seine Kuschelfreundin bleiben würde. Und weil die Helden in jedem Buch auch einen vierbeinigen Freund hatten, war es völlig normal gewesen, dass nach dem gemeinsamen Besuch der Hunderettung sein Rucksack gebellt hatte. Er hatte den Mischling Flummi eingesteckt, und er war tagelang wütend auf seine Großmutter gewesen, weil sie ihn zurückgebracht hatte.
Bis heute hatte Max nicht so ganz begriffen, warum sie ihn auf das Internat in der Schweiz geschickt hatte. Berlin hatte doch gute Schulen. Aber immerhin hatte er dort René kennengelernt.
Unweigerlich wurden seine Wangen heiß bei dem Gedanken an den Jungen, mit dem er sich das Zimmer geteilt hatte. Und später das Bett. Die ersten zaghaften Küsse, das Ausprobieren mit allen zugehörigen Katastrophen.
»Wir sollten noch aufräumen«, hatte er im Halbschlaf genuschelt, eng an René gekuschelt.
»Ist doch unser Zimmer. Machen wir morgen.«
So waren sie eingeschlafen. Am kommenden Morgen war er natürlich auf dem Kondom ausgerutscht, durch das halbe Zimmer gesegelt und hatte dabei das Regal abgeräumt. Das hatte ihm den Spitznamen Chaos-Max eingebracht.
Er und René waren zwei Jahre ein Paar gewesen. In den Sommerferien hatte Max – nach wochenlangem Überlegen – seiner Großmutter alles erzählt. Vor Aufregung hatte er sein Outing quasi herausgeschrien. Sie hatte ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben, ihm gesagt, dass Liebe immer in Ordnung sei, und dann einen Lavendeltee gemacht.
Fahrig wischte Max die Tränen beiseite. Verdammte Erinnerungen. Überall in diesem Haus lauerten sie. Bilder mit lachenden Gesichtern, Gerüche, die an schöne Augenblicke erinnerten. Es fiel ihm schwer, die Treppen nach oben zu steigen, um sein altes Zimmer zu betrachten.
»Weglaufen bringt nichts«, hatte seine Großmutter einmal traurig geflüstert. »Irgendwann holt die Vergangenheit einen ein und schlägt aus den Schatten zu. Also bereite dich vor und dann stelle dich der Herausforderung.«
Sie hatte eindeutig noch nie eine Matheklausur in einem Schweizer Internat geschrieben. Da half keine noch so gute Vorbereitung.
Max stieg über die quietschende Treppenstufe, wie er es früher immer getan hatte, um heimlich noch ein wenig neben der Couch zu sitzen. Es gab eine kleine Lücke zwischen Couch und Wand, in der er abends – total unauffällig – Milch und Kekse unter einer Decke versteckt hatte. Wenn dann Bettgehzeit war, hatte er überlaut gegähnt, war nach oben gestampft, nur um kurz darauf wieder nach unten zu schleichen. Hier hatte er sich dann zusammengekauert, Kekse geknabbert und den Film mitgeschaut, den seine Großmutter gerade laufen ließ. Es war natürlich stets ein Kinderfilm gewesen. Und sie hatte ihn total gar nicht bemerkt, wie er laut knabbernd und trinkend in seinem »Versteck« gesessen hatte. Am nächsten Morgen war er dann in seinem Bett aufgewacht.
Er musste erneut Tränen wegwischen.
Sein Zimmer hatte noch immer einen Teenager-Touch, obwohl er die zwanzig längst überschritten hatte. Nach dem Internat war er nach Mannheim gegangen, um dort BWL zu studieren. Bereits nach einem Semester hatte er abgebrochen. Zahlen waren einfach nichts für ihn. Stattdessen hatte er ein Kunststudium in Karlsruhe begonnen. Er wollte ins Produktdesign und der Start war geglückt. Nicht zuletzt dank Stefan. Nach der Probezeit in Frankfurt kam die feste Stelle und bei der feuchtfröhlichen Feier war aus dem Junior-Chef sein Liebhaber geworden. Stefan. Irgendwie war alles perfekt gewesen.
Max blieb im Türrahmen stehen und betrachtete die alten Poster. Da waren Sänger, auf die er eine Zeit lang gestanden hatte. Auch ein paar Schauspieler. Der Schreibtisch war bedeckt mit kreativem Chaos, die alten Klamotten noch immer in den Schubladen des Sideboards. Sein Ex hätte es gehasst. Bei Stefan musste penible Ordnung herrschen, und die letzten Jahre hatte Max geglaubt, ihm selbst sei das auch wichtig. Damit ihm niemand nachsagen konnte, er habe sich hochgeschlafen, hatte er sich doppelt so sehr ins Zeug gelegt wie seine Kollegen. Stefan war stolz auf ihn gewesen. Ein bitterer Geschmack stieg in Max auf. Er setzte sich nachdenklich auf sein altes Kinderbett und starrte in das Bücherregal, von dem ihm die schwarzen Rücken der Jugendbuchkrimis entgegenblitzten, die er mit zwölf oder dreizehn gelesen hatte. Auf dem Regal standen zwei Fotos: eines von ihm und seiner Großmutter, das andere von ihm und Robin, seiner besten Freundin seit Kindertagen.
Weihnachten, Silvester, ein paar Wochen im Sommer – er hatte viel Zeit hier verbracht, aber nie genug, um groß etwas zu verändern. Irgendwann war sein Lebensmittelpunkt gewandert und das Leben hier zurückgeblieben.
Anfangs hatte er sich schlecht gefühlt, doch seine Großmutter schien sogar froh darüber gewesen zu sein. Immer wenn er die Sprache darauf gebracht hatte, doch auch hier in Berlin – dem kreativen Mekka in Deutschland – einen Job suchen zu können, hatte sie abgewunken. Berlin sei ganz wunderbar für Urlaub, doch er solle sein Glück dort draußen suchen. Außerhalb der Hauptstadt. Als berge Berlin in den Schatten von morgendlichem Nebel und Dämmerung eine Gefahr, die ihn verschlingen wolle. Und Max hatte genickt, denn er hatte ja Stefan in Frankfurt.
Doch das Schicksal hatte wie so oft andere Pläne. Stefan jettete beruflich durch die Welt und hatte dort eine Menge Spaß, von dem Max nichts gewusst hatte. Bis einer seiner Lover plötzlich vor der gemeinsamen Tür gestanden hatte. Es gab Drama, laute Worte, Flehen und Tränen. Und Max begriff, dass er sich in dem Einerlei namens Routine viel zu lang von Stefan hatte lenken lassen. Er hatte das eigene Leben dem seines Partners angepasst, ohne es zu merken. Mit dem Ende der Beziehung hatte es auch in der Firma nicht mehr richtig funktioniert und schließlich war Max – mit einer großzügigen Abfindung – gegangen. Wenigstens das war ihm von seinem Ex geblieben: einige Zehntausend Euro nach fast zwei Jahren Beziehung.
Nach seinem Auszug bei Stefan war er erst mal im Gästezimmer einer Arbeitskollegin untergekommen. Und so hatte er die letzten zwei Wochen in einem Zimmer verbracht, das kaum größer als ein Schuhkarton war, und sich gefragt, was er mit seinem verkorksten Leben anstellen sollte. Seine Freunde in Frankfurt waren Stefans Freunde gewesen. Seine Lieblingscafés waren die, in denen er mit Stefan immer gewesen war.
Und er hasste es, nachts allein im Bett zu liegen. Kein warmer Körper mehr neben sich. Wen er nicht vermisste, war Stefan. Der Arsch konnte ihm gestohlen bleiben. Max war frei, tausend Wege lagen vor ihm. Doch welchen sollte er nehmen? Wohin wollte er überhaupt?
Während er mit hinter dem Kopf verschränkten Armen auf dem schmalen Bett gelegen und an die Decke gestarrt hatte, hatte er sich gefragt, ob nun endlich doch die Zeit gekommen war, zurück nach Berlin zu ziehen, zu seiner Großmutter. Die wurde schließlich auch nicht jünger.
Dann war vor drei Tagen der Anruf gekommen. Ein Überfall, hieß es, und seine Großmutter sei tot. Die Polizei ermittele, doch bisher gebe es keine Spuren.
Der Brief seiner Großmutter, den der Anwalt ihm hatte zukommen lassen, hatte ihm endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen.
Lieber Max,
wenn Du das hier liest, weile ich nicht mehr an Deiner Seite. Ich hoffe, das Schicksal hat uns viele gemeinsame Jahre beschert und ich bin im hohen Alter – also dem richtig, richtig hohen Alter – friedlich eingeschlummert. Das Haus und alle meine weltlichen Besitztümer gehören damit natürlich Dir. Das Wichtigste ist ein Schließfach, in das Du bitte einen Blick wirfst, sobald Du bereit dazu bist. Ich hoffe, Du hast Dir ein schönes Leben aufgebaut. Eines voller Freiheit und Abenteuer und einem Mann, mit dem Dich Liebe verbindet.
Ich werde Dich auf jeden Fall immer lieben. Über jede weltliche Grenze hinaus.
Deine Kuschelfreundin.
Der Gedanke an den Brief erzeugte neue Tränen, der Verlust Übelkeit. Am liebsten hätte er das Haus von oben bis unten geputzt, leider war das ja schon geschehen. Also schleppte Max seinen Koffer nach oben, schlüpfte in Jogginghose und Hoodie, warf sich vor den Fernseher und versank in Selbstmitleid.
So vergingen die nächsten beiden Tage. Die notwendigen Einkäufe rissen Max nur für wenige Stunden aus der Abgeschiedenheit. Sein Bart wurde von einem Zwei- zu einem Dreitagebart, er trieb durch die Stunden.
Bis es klingelte.
In Erwartung des Pizzalieferanten schlurfte er zur Tür. Fast wie in Trance drehte er den Schlüssel und öffnete.
»Wow, Maximus, du siehst aus wie ein Oger! Du weißt schon, groß, grün und schmutzig. Wobei schmutzig wirklich kein Kompliment ist.«
»Ro… Robin?«
Sie stand vor ihm, die Lippen geschürzt, mit einem mitleidigen Ausdruck im Gesicht. In der Hand hielt sie eine Chipstüte. Selbst in Jeans und Rollkragenpulli wirkte sie elegant und voller Energie.
»Weißt du, ich dachte: Der arme Max braucht ein oder zwei Tage, aber dann meldet er sich bestimmt bei seiner ehemals besten Freundin. Die Chipstüte lag schon bereit. Wie in alten Zeiten.«
»Es tut mir leid.« Er machte einen Schritt beiseite.
Robin betrat das Haus und rümpfte die Nase. »Hast du den Internatsmief irgendwie aus der Vergangenheit mit hierhergebracht?«
Max blieb mit hängenden Schultern unschlüssig im Flur stehen. »Tja.«
»Ach, Maximus.« Robin warf die Chipstüte ins Wohnzimmer und zog ihn in eine Umarmung. »Ich hab dich vermisst. Und es tut mir leid.«
»Danke.«
»Und jetzt geh duschen, sonst umarme ich dich nie wieder. Ich verstecke in der Zwischenzeit dieses ganze ungesunde Zeug. Glaub nur nicht, ich lasse dich ohne Aufsicht an die Chipstüte!«
Max konnte den Anflug eines Lächelns nicht unterdrücken. »Danke.«
»Nicht dafür. Ist Stefan oben? Hat er mitgemacht bei dieser Kalorienorgie?«
Max verdrehte die Augen. »Bei Orgien vermutlich ja. Aber ohne mich. Und ohne Kalorien.«
»Was?«
»Er hat mich betrogen und das nicht nur einmal. Ich hab Schluss gemacht.«
»Wann?«
»Vor ein paar Wochen. Gekündigt habe ich übrigens auch. Oder, na ja, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben.«
Das brachte ihm einen Rippenstoß ein. »Und wieso erzählst du mir das nicht? Ich dachte, die Funkstille ist wegen deiner Großmutter. Das Zugticket hatte ich schon gebucht, bis ich dank unserer gegenseitigen Standortfreigabe bemerkt habe, dass der Herr auf dem Weg hierher ist!«
»Es ist alles scheiße.«
»Hm. Na gut, ich kann dir gerade nicht böse sein. Nicht in diesem Zustand. Abgesehen davon: Sei froh, dass du den Fuzzi los bist. Der war eh nicht gut genug für dich.« Robin ging zur Couch, öffnete die Tüte, zog einen einzelnen Chip heraus und legte ein Gummibärchen darauf. »Hier, für einen letzten Endorphin-Kick und zum Abgewöhnen.«
Max öffnete den Mund und schob das Gummibärchenchip hinein. Die Geschmacksexplosion in seinem Mund rüttelte ihn ein bisschen wach. »Ich geh duschen.«
»So ist’s recht.« Robin stemmte die Fäuste in die Hüfte. »Und ich werde hier – ausnahmsweise – das Gröbste beseitigen. Später will ich alles wissen. Über Stefan und … na ja, allem eben.« Die letzten Worte klangen traurig.
Robin und er waren seit Kindertagen befreundet. Sie hatte seine Großmutter ebenfalls gemocht. Er fühlte sich schuldig, dass er sich nicht bei ihr gemeldet hatte.
»Manchmal kommt das Leben dazwischen«, murmelte er und schlurfte ins Bad.
»Ich habe genau die richtige Idee, wie wir dich wieder in die Spur bringen«, rief sie von unten.
»Spuck’s schon aus!«, rief Max zurück.
Ein paar Stunden später bekam er die Antwort – in ihrer ganzen Wucht und Vielfalt.
2. Kapitel
Dein Ernst?«
Max blickte skeptisch auf die Fassade des Siebzigerjahre-Baus. Der Putz bröckelte von der Wand, und das Giftgrün darunter lud nicht unbedingt dazu ein, hier zu verweilen, geschweige denn, eine Party zu feiern.
»Vertrau mir, Maximus«, sagte Robin und setzte diesen elenden Femme-fatale-Blick auf, der jeden Hetero in die Knie zwang.
Max zuckte mit den Schultern. »Ist ja nicht so, als hätte ich was Besseres vor.«
»Charmant«, parierte Robin. »Los, stell dich nicht so an, du brauchst einen Tapetenwechsel!«
Und wenn diese Tapete in einem heruntergekommenen Bau in Friedrichshain hing, war das halt so. Sie reihten sich in eine kunterbunte Schlange ein. Vor ihnen standen Teenager, Leute in den frühen Zwanzigern und auch die ältere Fraktion, zu der jeder über dreißig gehörte. Mit ihren Mitte zwanzig waren Max und Robin hier offenbar nicht ganz falsch.
»Jetzt lächle wenigstens mal kurz«, forderte Robin ihn auf. »Die Frau dort vorne wäre beinahe davongelaufen, als du sie angestarrt hast.«
Unweigerlich lachte Max auf. Ja, das konnte Robin: die Schwere eines Tages vergessen machen. Irgendwie wirkte bei ihr alles leicht. So war sie schon immer gewesen. Als sie sich vor fünfzehn Jahren kennengelernt hatten, hatte ihm ein anderer Schüler aufgelauert. Robin hatte dem Typ eine Ohrfeige verpasst, und seitdem war sie seine beste Freundin. Max musste bei dem Gedanken schmunzeln.
Sie erreichten die Tür, wo zwei grimmig dreinblickende Männer mit breiten Schultern und fast ebenso breiten Hüften standen. Sie trugen Schnauzbärte und Kleidung im Peaky-Blinder-Style: weißes Hemd, Krawatte, darüber eine karierte Weste und ebensolche Hosen.
»Hat diese Party ein Motto?«, fragte Max und schaute zweifelnd an seinem bestenfalls legeren Outfit hinab.
Robin grinste breit. »Wart’s nur ab.«
Die schrankgroßen Männer musterten sie eingehend, schließlich deutete einer ein Nicken an. Die Tür wurde geöffnet, dahinter wartete ein Vorhang. Max teilte ihn und sah sich Auge in Auge einer Dame gegenüber, die offenbar dem großen Gatsby entsprungen war. Ihr silbernes Kleid mit der schwarzen Schärpe fiel gerade bis zum Knie. Die Arme steckten in Seidenhandschuhen, die bis zum Ellbogen reichten. Sie stand an einem Tisch und lächelte ihnen sphinxhaft entgegen.
»Willkommen im Twenty-Heaven«, hauchte sie und Max hätte schwören können, dass violetter Nebel aus ihrem Mund aufstieg.
Er blinzelte. »D…danke.«
Sie reichte ihm eine kleine Karte aus gestärktem Papier, auf der eine Nummer stand.
Robin nahm ebenfalls eine entgegen und schob Max weiter. »Danke.«
»Was sollen wir mit der Karte?«
Ohne ein Wort führte ihn seine Freundin durch einen schmalen Gang und eine Treppe hinunter bis zu einem Raum, der einem Modekaufhaus aus den 1920ern entnommen schien. Sie betraten ihn durch eine Flügeltür, von der sich zwei Rundtreppen in die Tiefe wanden. Dort standen Tische mit Schals, Schuhen und ausgelegten Hemden. Modepuppen ringsum waren mit Anzügen im Stil der damaligen Zeit bekleidet. Auf einigen saßen Hüte und Schirmmützen.
»Sollen wir hier jetzt was kaufen?«, fragte er.
Robin winkte ab. »Wir suchen uns etwas aus, und am Ende der Party geben wir es zurück.«
»Echt jetzt?« Während Max noch mit großen Augen die Auslagen betrachtete, begann sie bereits mit der Auswahl.
Überall standen kleine Grüppchen herum, die es ihr gleichtaten.
Kurz darauf fand sich Max mit allerlei Kleidungsstücken auf den Armen wieder. »Das ist jetzt ein Joke.«
»Eintritt im Partysaal nur in passender Garderobe.«
Er fuhr sich über die Wangen, die er erst am Nachmittag auf Robins Wunsch hin rasiert hatte. »Hättest du mir gesagt, wohin wir gehen –«
»… wärst du gar nicht mitgekommen«, unterbrach ihn Robin. »Zu müde, keine Lust, ungewaschen.«
»Stimmt alles.« Also fast.
Ein paar Minuten später trug er Anzughose, Hemd und sogar einen Hut. Die Armmanschetten funkelten, und Max war, als stiege goldener Nebel von ihnen auf.
»Was ist das?«, fragte er.
»Was ist was?« Robin zog gerade ihr Hemd straff und schob ihr rotes Haar unter den Hut. Heute wollte sie eindeutig eher ihren maskulinen Teil präsentieren.
»Ich …« Der Nebel war fort. »Ach, nichts.«
Wie kam es, dass die Hose perfekt saß, das Hemd wie angegossen? Max trug nie Hüte, doch dieser Hut rundete das Bild passgenau ab.
»Wollen wir?«, fragte Robin.
Max stolperte ihr einfach hinterher. Sie verließen die Garderobe durch eine Flügeltür am unteren Ende der gewundenen Treppen.
Was dahinter auf sie wartete, ließ ihn erstarren. Es war unmöglich zu begreifen, dass außen am Gebäude schmucklose Fassaden in fader Einheitsbauweise emporwuchsen, während hier drinnen die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts lebendig geworden zu sein schienen.
Männer und Frauen standen auf der Tanzfläche und bewegten sich im Takt eines Charleston, wie ihn auch seine Großmutter so geliebt hatte. Über ihnen schimmerte ein Kronleuchter, an den Wänden zogen sich eigenartige Bemalungen hinauf. Auf der Bühne stand eine Frau in langem Kleid und Hut, das geschminkte Gesicht von in Wellen gelegtem Haar eingerahmt. Sie sang.
»This World or their World.
A Glimpse of Golden Haven …«
Die Stimme der Sängerin war samtig und rau, zog Max sofort in ihren Bann.
An der Bar gegenüber saßen illustre Gestalten, betrachteten die Tanzenden und tranken Cocktails. Ein wenig abseits der Tanzfläche gab es kleine Erker, in die man sich zurückziehen konnte. Max sah dort zwei Männer, die sich küssten. Wie gern wäre er jetzt einer der beiden gewesen.
Vor dem Erker daneben waren die Vorhänge zugezogen, nur die Beine einer Frau lugten hervor.
»Na, was sagst du jetzt, Maximus?« Robin grinste breit.
Er ließ seinen Blick nach oben wandern. Der Raum nahm vier Stockwerke ein, auf allen Ebenen sah er Balkone und Sitzgelegenheiten, und auch dort wurde getanzt. Die Kleider der Frauen glitzerten geheimnisvoll im Licht des Kronleuchters, an den Wänden leuchteten Farbstreifen.
»Das ist wie eine andere Welt«, hauchte er.
»Suchst du uns mal einen Platz«, bat Robin. »Ich sorge für Flüssignahrung.«
Glücklicherweise erhob sich genau in diesem Augenblick ein Pärchen von ihren Sitzen. Max warf sich förmlich auf einen der frei gewordenen Plätze und legte kurzerhand den Hut auf den zweiten. Sein Blick wurde wie magisch von der Tanzfläche angezogen.
Er sah leidenschaftliche Blicke, Körper, die sich eng aneinanderschmiegten. Die Musik umgab alles wie ein weicher Kokon aus flüssigem Honig.
»Hier.« Robin hielt ihm ein Glas hin.
Max zuckte zusammen und nahm es entgegen. Ein Schluck und er hustete. »Was ist das?«
»Ein Cocktail namens Three Mile. Irgendwas mit Rum, Cognac, Zitronensaft und Grenadine.«
»Der Fruchtanteil ist doch eher Alibi«, sagte Max, trank noch einen Schluck.
Er hatte sich schon lange nicht mehr so locker gefühlt, richtiggehend beschwingt. Automatisch wippte sein Körper im Takt der Musik.
»Der Kerl dort schaut ständig zu dir herüber«, sagte Robin.
Max blickte verwirrt von seinem Cocktail auf. »Was hast du gesagt?«
»Na, der Kerl dort.« Sie zwinkerte.
»Another World, another Life.
A Glimpse of Freedom …«
Max drehte den Kopf und entdeckte einen Kerl mit kräftigen Schultern und Dreitagebart. Mit seinem dunklen Haar und der lässigen Kleidung war er vom Typ her ein Anti-Stefan und damit genau das, was er jetzt brauchte. Als sich ihre Blicke trafen, zwinkerte der Fremde ihm zu.
Max hätte nicht sagen können, wann er aufgestanden war. Irgendwie bewegten sich seine Beine und trugen ihn durch die tanzende Menge. Körper wiegten sich eng umschlungen neben ihm, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, nur selten allein.
Der Fremde hob eine Augenbraue, als Max endlich vor ihm stand.
»Du bist neu hier.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
Max zuckte mit den Schultern. »Sieht man mir das so deutlich an?«
»Du bist überarbeitet und müde, das sieht man dir an.«
Klasse, ging es Max durch den Kopf. Er lachte bitter. »Stimmt, ich bin zum ersten Mal hier.«
Der Blick des Fremden fiel kurz auf die goldenen Manschetten. »Auf der Party oder in der Stadt?«
»Beides. Irgendwie. Ich wohne in Grunewald … also jetzt.« Wie sollte er ihm über die Lautstärke hinweg den Roman seines Lebens erzählen? »Ich hab früher schon mal hier gewohnt«, fügte er dann hinzu, unsicher, was er sagen sollte.
»Verstehe.« Sein Gegenüber musterte ihn. »Irgendwie. Du bist einer von den Braven, oder?« In den braunen Augen funkelte es provozierend.
Max spürte, wie es in seinem Bauch zu prickeln begann. »Brav«, sagte er leichthin. »Nicht in jeder Situation.«
Hitze kroch ihm den Hals hinauf, doch er hielt dem Blick des Fremden stand. Irgendetwas hatte dieser an sich, das die düsteren Wolken in seinem Geist vertrieb. Max wollte ihn an sich ziehen, seine Lippen spüren, seinen Körper berühren, ihn …
Der Fremde grinste, als könnte er seine Gedanken lesen. »Ich bin Lenyo.«
»Maximilian. Max.«
»Und wie gefällt es dir hier, Maximilian Max?«
Kurz linste Max nach links, wo eine zierliche Blondine eine attraktive Brünette an der Perlenkette zu sich zog und küsste.
»Es ist … interessant«, stotterte er.
Lenyo lachte. »Interessant?«
»Nein … wirklich. Ich habe noch nie so viel Zwanzigerjahre-Zeug gesehen. Alles wirkt so echt, als wären wir durch die Zeit gereist.«
»Sie waren schon damals gut darin, ihre Ängste mit Partys zu übertünchen.« Plötzlich klang Lenyo bitter.
Max blinzelte. »Was?«
»Nichts, alles gut. Ich habe ein paar schwere Tage hinter mir.« Er zögerte. »Es gibt noch viel mehr zu sehen.«
»Was denn? Hey, wo willst du hin?«
Lenyo hatte sich abgewandt und tauchte tiefer in die Menge ein. »Komm einfach mit, Stadtrandkerl.«
Um ihn nicht zu verlieren, setzte Max sich in Bewegung. Ein Blick über die Schulter verriet ihm, dass Robin noch immer an der Bar saß und mittlerweile an seinem Cocktail nippte. Als er kurz zögerte, nickte sie ihm auffordernd zu. Wie immer kam Robin ganz gut allein klar.
Beinahe wäre Max gegen die erste Stufe einer Treppe gestolpert, die Lenyo soeben erklomm. Er folgte ihm und wich dabei den Entgegenkommenden aus.
»Na, was sagst du jetzt?« Lenyo trat auf einen der Balkone und machte eine ausladende Armbewegung, die alles unter ihnen einschloss.
»Das ist … wow.«
Der Raum entpuppte sich von hier oben als riesiger Dom, dessen Wände mit Graffiti verziert waren. Was von unten wie seltsame Striche gewirkt hatte, bildete nun ein Gemälde aus Fabelwesen. Die zahlreichen Kristalle des Kronleuchters besprenkelten die Tanzenden mit mosaikartigen Reflexionen.
Max hat noch nie zuvor etwas Derartiges gesehen und fühlte sich eins mit allem. Als sei er eine Note, ein Ton der allgegenwärtigen Musik.
Er spürte, wie Lenyo hinter ihn trat, und sah, wie er die Hände zu Max’ beiden Seiten auf das Geländer legte. An seinem linken Handgelenk trug er eine Ledermanschette.
Max hielt ganz still. Er wagte nicht, sich zu bewegen. Lenyo kam näher. Sein Duft stieg ihm in die Nase, leicht minzig und mit einer Spur Rosmarin.
Irgendwie entspannte ihn das. Er atmete tief ein und ließ den Rücken ein bisschen zurücksinken, bis er wie zufällig – ja, klar – Lenyos Brust berührte.
Das fühlte sich gut an.
Er begann, im Takt der Musik zu wippen.
»Kommst du denn öfter hierher?«, fragte er schließlich.
Statt zu antworten, drückte Lenyo ihm die Lippen in die Halsbeuge, zuerst sanft, dann fester. Und er kam noch näher. Max spürte die Hitze, die von ihm ausging. Er hielt den Atem an, auch, um jetzt bloß nichts Dummes zu sagen. Ein Gedanke an Stefan durchzuckte ihn, doch Max schüttelte ihn ab, das hatte der Mistkerl nicht verdient. Sie waren nicht mehr zusammen und das, was Lenyo machte … Was Lenyo machte. Das sanfte Saugen an seinem Hals, der leichte Druck seines Unterleibs an seinem Hintern – beides sorgte dafür, dass es in Max’ Hose ziemlich eng wurde. Schnell griff er selbst nach dem Geländer und klammerte sich daran.
Doch in dem Moment, in dem er den Kopf zurücksinken ließ, um sich an seine attraktive Clubbekanntschaft zu drücken, wich diese vor ihm zurück.
»Was …?«
Er spürte, wie sich Lenyo versteifte, dann hektisch von ihm zurückwich.
Hatte er etwas falsch gemacht? Max drehte den Kopf, sah Lenyo an.
Auf dessen Gesicht gab es nur einen Ausdruck: Schock.
»Alles in Ordnung?« Er folgte dem Blick des anderen schräg hinunter zur Flügeltür. Unter den Partygästen dort war Unruhe entstanden. Max versuchte, mehr zu erkennen, aber das war in dem Gewusel unmöglich. »Was ist denn los?«
»Tut mir leid, ich muss weg.« Lenyo klang jetzt völlig anders. Von seiner Unbeschwertheit und seinem Lachen war nichts geblieben. »Such nach deiner Freundin und verschwinde.«
Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und drängte sich zwischen den Menschen hindurch in Richtung Treppe.
Max starrte ihm ein paar Sekunden lang hinterher. »Warte, wohin willst du?«, rief er viel zu spät.
Lenyo sprang bereits die Stufen hinunter, rempelte ein Pärchen grob beiseite. Max überlegte drei weitere kostbare Sekunden, dann setzte er ihm nach. Er hatte ihn auf zwei Armeslängen eingeholt, als am unteren Ende der Treppe ein Typ auftauchte, der nach Ärger aussah: bullig, in Lederhose und Muskelshirt. Es wirkte, als wolle er den Clubbesuchern den Weg versperren.
In einer geschmeidigen Bewegung holte Lenyo aus und donnerte die Faust gegen das Kinn des Bullen. Der stolperte, taumelte und versuchte, nach ihm zu greifen. Lenyo wich geschickt aus, die Hände des Grobians verfehlten ihn. Stattdessen streiften sie Max, griffen nach dessen Kleidung und zerrten ihn daran zu sich. Max entwich ein erschrockener Laut.
»Shit!«, hörte Max Lenyo rufen.
Das Gewicht des Bullen drückte ihn zu Boden. Beißender Atem drang in Max’ Nase, vermischte sich mit dem Geruch von Schweiß. Ein weiterer Schlag erklang, das Gewicht verschwand, und der Kerl war außer Gefecht gesetzt. Ächzend setzte sich Max auf.
Mit panischem Gesicht kam Robin herbeigerannt. »Was ist hier los?«
Lenyo betrachtete Max mit einem entsetzten Blick. »Er hat dich markiert.«
»Das ist ja ekelhaft!«
»Sein Geruch umgibt dich noch mindestens eine Stunde«, sagte Lenyo hastig. »Dadurch können die anderen dich finden.«
»Wovon redet er?« Robin rümpfte die Nase. »Na ja, mit dem Geruch hat er recht.«
Jetzt nahm auch Max den Schweißgestank wahr, der plötzlich an ihm haftete.
»Ihr kommt mit mir«, sagte Lenyo bestimmt. »Der Kerl weiß, dass du in meiner Nähe warst. Die nehmen euch mit, foltern euch und dann landet ihr als blutige Kadaver im nächsten Rinnstein. Und falls sie dich nicht finden« – er deutete auf Max, dann auf Robin –, »halten die sich an dich. Die haben euch garantiert zusammen gesehen.«
»Hat er gerade Kadaver gesagt?« Robin schluckte.
»Los!« Lenyo bedeutete Max, ihm zu folgen.
»Dort hinten gibt es nur den Zugang zum alten U-Bahn-Tunnel«, sagte Robin.
Max rannte Lenyo bereits hinterher. Die Worte Blut, Folter und Kadaver hatten ihm gereicht. Erst einmal raus hier, dann konnten sie weitersehen.
Immer wieder rempelten sie andere Besucher an. »Sorry, tut mir leid.«
Vor ihnen tauchte eine graue Metalltür auf. Lenyo schlüpfte hindurch, Robin und Max hinterher.
»Hallo, können wir zuerst mal erfahren, was eigentlich los ist?«, fragte Robin.
»Nein«, stellte Lenyo klar. »Das dauert zu lange. Wir müssen abhauen, jetzt. Und macht die goldenen Manschetten ab, dann fallt ihr nicht so auf.«
»Was soll das denn heißen?« Max zog seine aus dem Hemdaufschlag. Der goldene Schimmer kehrte zurück und verblüfft bemerkte er, dass er wieder seine Alltagskleidung trug. »Was … wie?«
»Hier entlang«, wisperte Lenyo.
Sie liefen in den Stollen, eine weitere Treppe hinunter. Max hielt das für eine ziemlich dumme Idee, doch sein verräterischer Körper überließ sich dem Fluchtinstinkt. Zu dritt stolperten sie durch die Schwärze. Sie tauchten ein in einen Schacht, der sich als Gleisbett eines stillgelegten U-Bahn-Tunnels entpuppte. Jedenfalls hoffte Max, dass er stillgelegt war.
Gerade wollte er sein Smartphone aus der Tasche ziehen, als in Lenyos Hand etwas aufleuchtete. Eine Phiole lag darin. In ihr schimmerte eine blaue Flüssigkeit.
»Wow«, sagte Robin. »Was ist das?«
»Bakterien«, erklärte er kurz angebunden.
Max glaubte ihm kein Wort. Da er jedoch Stiefelschritte hinter sich vernahm, war jetzt offenbar wirklich keine Zeit für Diskussionen. Im Schein der Phiole bestand wenigstens nicht die Gefahr zu stolpern.
Die Wände zogen vorbei, im Zwielicht sah er Kabelstränge. Der allgegenwärtige Geruch von Gummi erinnerte ihn an die zahlreichen U-Bahn-Haltestellen Berlins. Mittlerweile brannte seine Kehle, er keuchte laut. Robin ging es ähnlich. Einzig Lenyo schien Leistungssportler zu sein, er wirkte kein bisschen angestrengt.
»Dort vorne.« Er deutete auf den Bahnsteig, der im Licht auftauchte.
Die Station lag verlassen vor ihnen, als sie sich aus dem Gleisbett nach oben zogen auf alte, staubbedeckte Steinplatten.
»Er hat uns gleich eingeholt«, sagte Lenyo. »Der Ausgang ist zu weit weg. Wenn ich das Portal nicht öffne, ist es zu spät.«
»Was meinst du mit ›Portal‹?«, fragte Max.
Robin rang nach Luft und stemmte sich mit den Händen an den Knien ab, schaffte es aber dennoch, ihm einen eindeutig zweideutigen Blick zuzuwerfen. Sie ging wohl davon aus, dass sie es hier mit einem Verrückten zu tun hatte. Immerhin hätte das bedeutet, dass es gar keinen Verfolger gab. Aber Max hatte die Schritte doch auch gehört?
Er starrte auf die leuchtende Phiole und begriff instinktiv, dass Lenyo sie weder auf den Arm nahm noch den Verstand verloren hatte. Etwas umgab dieses Licht, genau wie die Manschetten. Eine Kraft, die fremd war. Und voller Hoffnung.
»Da!« Robin deutete in den Gang.
Ein Schatten bewegte sich auf sie zu, unsichtbare Augen warfen ihren tödlichen Blick auf Lenyo, fixierten schließlich Max. Er konnte es spüren. Sein Innerstes verkrampfte sich, Angst ließ jeden Muskel seines Körpers erstarren.
Lenyo warf etwas in die Höhe: ein schillernder Tropfen, wie aus Glas gegossen. Er blitzte auf, schickte Goldfäden in alle Richtungen. Ein Riss entstand in der Luft.
Max starrte gebannt darauf. Hatte ihm jemand etwas in den Cocktail gemischt? Bildete er sich all das lediglich ein?
Ein schwappendes Geräusch erklang aus dem Riss, leuchtender Nebel stieg von den Rändern auf.
»Wenn ihr am Leben bleiben wollt, folgt mir«, sagte Lenyo. »Es ist eure einzige Chance.«
»Dort durch?« Robin klang skeptisch. »Ich springe doch nicht in einen Riss, der mitten im Raum schwebt.«
»Er wird nicht mehr lange offen bleiben.«
Das Flimmern aus dem U-Bahn-Tunnel kam näher und näher.
»Los!«, brüllte Lenyo.
»Komm schon.« Max packte Robin am Arm.
»Das ist doch total …«
Was auch immer Robin sagen wollte, sie bekam nicht mehr die Gelegenheit, ihren Satz zu beenden. Die Dunkelheit des Tunnels selbst sprang auf sie zu wie ein Raubtier. Noch in der Luft verdichtete sie sich und die flimmernde Schwärze nahm die Gestalt eines bulligen Mannes an, der Robin zur Seite stieß, gegen Lenyo prallte und mit ihm zu Boden ging.
Max spürte einen schmerzhaften Stich und blickte verwirrt an sich herunter. In seinem Shirt klaffte ein Riss. Blut drang daraus hervor.
»Max!«, brüllte Robin.
Lenyo rappelte sich auf, trat dem Fremden in den Unterleib und griff dann nach Max, zerrte ihn in die Höhe. »Wir springen gemeinsam, mach mir nicht schlapp.«
Aus schreckgeweiteten Augen sah Max zu ihm auf. Ein besorgter Ausdruck lag in Lenyos Blick.
Robin schrie auf, als ihr Gegner sich wieder erhob.
»Los!«, rief Lenyo.
Robin stolperte in den wabernden Riss, der sich an den Rändern bereits zusammenzog.
Max spürte Lenyos festen Griff. Gemeinsam sprangen sie.
3. Kapitel
Zwei Herzschläge lang glaubte Max, durch einen von Blitzen durchzogenen Nachthimmel zu fallen. Dann presste ihm der Aufprall auf die Steinplatten der U-Bahn-Station die Luft aus der Lunge. Nein, nicht nur der Aufprall – Lenyo begrub ihn mit seinem ganzen Körpergewicht unter sich. Das Stechen in seinem Brustkorb drohte ihn zu zerreißen. Einen Moment lang starrten sie sich an, dann rollte sich Lenyo von ihm herunter und Max sog gierig Luft in die Lunge.
Das Stechen verschwand nicht. Vorsichtig tastete er seine linke Seite ab. Sein T-Shirt klebte warm und feucht an ihm. Die Wunde! Noch ehe seine Fingerspitzen den Schlitz im Stoff und die darunterliegende Verletzung berühren konnten, zuckte er zurück. Jemand hatte ihn verletzt. Ihr Verfolger!
»Wo sind wir hier?«, drang Robins Stimme wie durch Watte zu ihm. »Was war das gerade?«
»Wir müssen hier weg«, entgegnete Lenyo. Er beugte sich über Max und streckte ihm die Hand entgegen. »Kannst du aufstehen?«
Max versuchte, sich hochzustemmen, doch sobald er sein Gewicht verlagerte, explodierte der Schmerz. Gleißende Lichtfunken tanzten vor seinen Augen.
»Max«, drängte Lenyo.
»Was ist mit ihm?« Robin schob Lenyo beiseite und kniete sich neben Max auf den Steinfußboden. Als ihr Blick auf sein T-Shirt fiel, wurde sie kalkweiß. »Was ist passiert?«
Max versuchte sich an einem schiefen Lächeln. »Unser Verfolger hat mich erwischt.«
»Shit!«
Lenyo ging neben ihm in die Hocke und drückte einen dunklen Stofffetzen auf die blutende Wunde. Max schrie auf, dann hatte er das Gefühl, dass der Schmerz etwas schwächer wurde.
»Kannst du ihm helfen?«, fragte Robin.
»Das tue ich gerade.« Lenyo konzentrierte sich auf Max, seine Stimme war rau. »Press das Einstecktuch auf die Wunde. Und beiß die Zähne zusammen. Das wird jetzt wehtun.«
Ehe Max fragen konnte, was er meinte, schob ihm sein Gegenüber den Arm unter die Schulter.
»Hilf mir«, bat Lenyo Robin, die ihm sofort zur Seite eilte.
Gemeinsam gelang es ihnen, Max auf die Füße zu bekommen, während dieser damit zu tun hatte, die Lippen aufeinander und das Stoffbündel auf seine Wunde zu pressen.
Lenyo zog ihn Richtung Treppenaufgang. »Wir müssen hier weg«, wiederholte er. »Ehe die Jäger auftauchen.«
»Jäger?«, stieß Max zwischen zwei Atemzügen hervor.
»Später.«
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sie sich die beiden Treppen hochgequält hatten, die aus der U-Bahn-Station ins Freie führten. Als kühle Luft sein Gesicht streifte, atmete Max erleichtert auf. Dann blinzelte er überrascht. Es kam ihm ungewöhnlich dunkel vor. In Berlin gab es nicht viele Ecken, die man als stockfinster bezeichnen konnte. Diese gehörte dazu.
»Was jetzt?«, fragte er.
Robin strich ihm eine schweißnasse Haarsträhne aus der Stirn. »Wir bringen dich in die Notaufnahme. Und falls es dir hilft, du stinkst überhaupt nicht mehr.«
»Die Passage hat die Markierung getilgt«, sagte Lenyo. »In die Notaufnahme können wir aber leider nicht.«
»O doch.« Robin klang fest entschlossen. »Du musst ja nicht mitkommen, die Landsberger Allee ist gleich dort hinten.«
Lenyo löste seinen Griff, und Max vermisste sofort den starken Arm. Lenyo verschwand allerdings nicht in der Nacht, sondern durchsuchte hastig seine Taschen. »Das ist zu gefährlich, dort könnt ihr nicht hin. Ich bring euch jetzt zu jemandem, der Max helfen kann, einverstanden? Und morgen dann nach Hause.«
Robin öffnete den Mund, zweifellos um Lenyo in aller Deutlichkeit zu sagen, was sie von seinem Vorschlag hielt, doch Max war schneller. »Nicht streiten, okay? Mir geht es gerade wirklich nicht gut. Es wäre ganz cool, wenn wir uns darauf konzentrieren könnten.«
Auf Robins Gesicht zeichnete sich Sorge ab. »Aber meinst du nicht, ein Krankenhaus …«, begann sie, doch Max schüttelte den Kopf.
»Dein Freund kann mir wirklich helfen?«, fragte er Lenyo, der aussah, als habe er ein sehr schlechtes Gewissen.
»Kein Freund. Meine Schwester.«
»Ist sie Ärztin?«, fragte Max.
»So etwas Ähnliches.«
»Und wo ist deine Schwester?« Robin klang resigniert.
»In Mitte.«
»In Mitte?!« Ihr Griff um Max’ Oberkörper wurde fester. »Und wie sollen wir schnell genug dort hinkommen?«
Lenyo hob eine Braue. »Wir fahren.«
Durch die Dunkelheit schleppten sie sich in Richtung einer Straßenkreuzung. Max drückte immer noch das zusammengeknüllte Einstecktuch auf die Wunde. Es war inzwischen durchtränkt, aber immerhin schien die Wunde nicht mehr so stark zu bluten.
»Schaffst du es allein mit ihm bis zur Straße?«, fragte Lenyo Robin.
»Klar.« Sie klang nicht so überzeugt, wie Max es von ihr gewohnt war.
»Dann organisiere ich uns eine Droschke.« Er drehte sich um und eilte davon.
»Droschke?«, sagte Max. »Sind das nicht diese offenen Pferdekutschen?«
Robin schnaubte. »Ich glaube, er hat einfach nur ein Taxi gemeint.«
»Dann hätte er doch Taxi gesagt.«
»Früher nannte man Taxis Motordroschken. Berlin war voll davon.«
Auf seinen verblüfften Gesichtsausdruck hin zuckte Robin mit den Schultern. »Lesen bildet, Maximus. Solltest du auch mal versuchen.«
Max erwiderte ihren Blick zweifelnd. »Früher! Wann soll das denn gewesen sein? Und überhaupt: Wer spricht heute noch so?«
Robin ging nicht darauf ein. »Max …« Sie suchte nach Worten. »Irgendetwas ist nicht in Ordnung hier.«
»Glaubst du, das habe ich nicht bemerkt? Irgendein Assi hat auf mich eingestochen!«
»Das meine ich nicht.« Sie deutete nach rechts, wo sich die Konturen eines Altbaus aus der Dunkelheit schälten. Nur aus einem einzigen Fenster im zweiten Stock drang flackerndes Licht.
»Du hast uns in diese Gegend geschleppt«, erwiderte er.
»Nicht hierher.«
Max wurde kalt. »Wie meinst du das?«
Robin seufzte. »Kaum Straßenbeleuchtung. Keine anderen Menschen. Und … riechst du das nicht?«
Max schnupperte. »Ich riech nichts.«
»Eben.«
Er holte tief Luft und seine Augen weiteten sich. Robin hatte recht. An den meisten Tagen roch Berlin nach Großstadt: nach abgestandener Luft in engen Straßenzügen, den Abgasen aus den Fabriken, an manchen Ecken nach verrottendem Müll oder Urin. Jetzt hingegen roch es frisch, fast süßlich.
»Seltsam.«
Knatternde Motorengeräusche rissen ihn aus seinen Gedanken. Auf die Kreuzung vor ihnen bog ein dunkler Wagen ein. Die Scheinwerfer warfen klägliche Lichtkegel auf die Straße. Selbst das Abblendlicht des Corsas seiner ehemaligen Mitbewohnerin war greller gewesen.
Lenyo trat an den Wagen und sprach mit dem Fahrer. Noch während Max seine Anstrengungen verdoppelte und sich mit Robin zum Straßenrand vorkämpfte, öffnete er die hintere Wagentür und machte Platz.
Der Wagen sah aus, als habe man ihn der Filmkulisse eines Historiendramas entwendet: kantiges Design, schwarz lackiertes Blech, dünne Reifen, durch deren Speichen man hindurchsehen konnte wie durch die eines Fahrrads. Da sollten sie einsteigen? Die Wunde in Max’ Seite schmerzte allerdings zu sehr, als dass er mit Lenyo hätte diskutieren wollen. Ächzend ließ er sich auf die Rückbank des Wagens fallen. Der Droschke. Ledergeruch füllte den Innenraum aus. Robin und Lenyo stiegen hinter ihm ein.
»Los«, forderte Lenyo den Fahrer auf, kaum dass er die Tür zugezogen hatte.
»Immer mit der Ruhe!«, erklang es behäbig, doch der Wagen setzte sich ruckartig und knatternd in Bewegung. Max linste nach vorn, konnte auf dem Fahrersitz jedoch nur einen dunklen Umriss erkennen. Die Stimme hatte männlich geklungen.
»Blutet es noch?«, fragte Lenyo.
Max hob vorsichtig den Stoff an. »Ich glaube nicht.«
»Blut?«, erklang es ungehalten von vorn. »Wenn ihr ma det Leder versaut, jibt’s Ärger, verstanden?«
»Schon gut«, erwiderte Lenyo abweisend. Dann wandte er sich an Robin. »Lass mich mal rüber. Ich schau mir das näher an.«
Aus seiner Anzughose holte er wieder die Phiole mit der schimmernden Flüssigkeit. Dann machte er sich daran, mit Robin Plätze zu tauschen.
»Ey«, erscholl erneut die empörte Stimme des Taxifahrers. »Macht ma keene Fisimatenten hier drin!«
Im türkisfarbenen Licht, in das die Phiole den hinteren Teil des Wagens tauchte, sah Max, dass sein Begleiter genervt die Augen verdrehte. »Fahren Sie einfach. Keine Fragen und Sie bekommen bei Ankunft das Doppelte.«
»Solange –«
»Ihrer Droschke passiert schon nichts. Entspannen Sie sich.«
Das schien dem Fahrer zu genügen.
Lenyo wandte sich Max zu und beleuchtete die Verletzung mit der Phiole. Er sog scharf die Luft ein.
Max wurde schlecht. »Das klingt nicht gut.«