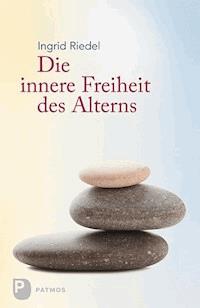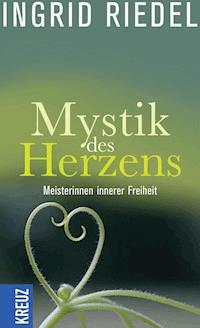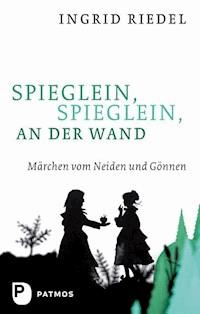
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer kennt sie nicht, die Königin aus dem Märchen Schneewittchen, die "gelb und grün vor Neid" wurde, als sie hören muss, dass ihre Tochter schöner ist als sie selbst. Dieses und viele weitere Märchen stellen symbolisch dar, wieso manche Menschen eher neidisch rivalisieren, während andere sich am Glück ihres Gegenübers freuen können. Die bekannte Jung'sche Analytikerin Ingrid Riedel interpretiert fünf Märchen, darunter Schneewittchen und Die Gänsemagd, die zeigen, wie Neid und Missgunst überwunden werden und Menschen zu einem wohlwollenden Miteinander finden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Ingrid Riedel
Spieglein, Spieglein an der Wand
Märchen vom Neiden und Gönnen
Patmos Verlag
INHALT
Einführung
Die Gänsemagd
Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein
Zottelhaube
Die zwei Brüder
Schneewittchen
Anmerkungen
Einführung
»Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«, diese beschwörende Frage der Königin vor ihrem Spiegel ist denen unter uns, die noch mit Märchen aufgewachsen sind, wohl von Kindheit auf vertraut. Vielleicht haben wir angesichts dieser Königin vor ihrem Spiegel zum ersten Mal darüber nachgedacht, was Neid ist. Neiden heißt Nicht-Gönnen: Die Königin kann nicht damit leben, dass nicht nur sie selbst, sondern auch andere schön sind, noch schöner vielleicht als sie.
Dieser immer wiederholte Spruch aus dem Schneewittchen-Märchen kann zum Leitmotiv der fünf Märchen werden, in denen uns das Thema »Neiden« in seinem Kontrast zu »Gönnen« besonders anschaulich entgegentritt. Offensichtlich sind diese starken Emotionen und das entsprechende Verhalten seit Menschengedenken bekannt, sind es wichtige Themen, die schon zu den Zeiten, in denen die Märchen entstanden, betroffen machten. Auch sorgfältiges Nachdenken über die möglichen Ursachen solcher Emotionen finden sich in den Märchen und fordern auch uns selbst zum Blick in den Spiegel heraus.
Ein Blick in den Spiegel kann uns das Thema nahe bringen: Denn was bedeutet solch ein Blick? Da sehe ich mich auf einmal von außen, als ganze Gestalt, während ich mich, jedenfalls im Hinblick auf mein Gesicht, sonst nur von innen kenne, als diejenige, die dieses Gesicht hat, die in diesem Gesicht wohnt.
Im Allgemeinen sehe ich die Welt, auch einen Teil meines Körpers, durch meine Augen, doch meine Augen selber sehe ich nicht. Meine Augen wie mein ganzes Gesicht sehe ich nur in einem Spiegel. Nur mit Hilfe eines Spiegels werde ich mir meines Gesichts, meines Aussehens, meines Ausdrucks, ja meiner Identität überhaupt, bewusst.
Als kleines Kind von etwa zwei Jahren erkennt jeder Menschen sich selbst im Spiegel und beginnt, »Ich« zu sagen. Nur durch den Spiegel lernen wir das Wesentliche an uns selber kennen, unsere Identität. Erst jetzt kann das Vergleichen mit jemand anderem beginnen – ich habe braune Augen, du hast blaue –, das zunächst einfach eine Unterscheidung ist, die deutlich macht, dass ich anders bin als du, dass diese Nase, diese Stirn nur mir eigen sind, deine Nase und Stirn sind anders. Du lachst anders als ich, du hast dann vielleicht Grübchen in den Wangen. Zuerst ist das alles wertfrei. Ich mag dein Gesicht, ich mag auch mein Gesicht, und es hängt viel davon ab, ob ich früh genug und tief genug erfahren kann, dass auch andere, mir wichtige Menschen mein Gesicht mögen. Dass sie mich anlächeln und dass wiederum ich, wenn ich lächle, auch einen Widerschein von Freude auf ihr Gesicht zaubern kann, dass sie aufstrahlen, wenn sie mich sehen.
Denn schwierig wird es, wenn ich vor dem Spiegel selber finde, dass andere viel schöner sind als ich. Was der Märchen-Spiegel der alten Königin sagt, das sagt sie sich im Grunde selbst. Bei dem Vergleich »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier, aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr« springt der Neid in ihr auf, denn es ist ihr, als könne sie der Schönheit der anderen niemals standhalten. Und angesichts dieser Ansicht, die vielleicht auch eine Einsicht ist, kommt eine namenlose Angst in ihr auf. Angst wovor?
Vor der Selbstentwertung wohl, die bei einem Vergleich mit der anderen für sie herauskommen könnte? So reagiert diese Königin, so reagiert der Neid. Selbstentwertung beim Vergleich mit anderen ist die Wurzel des Neides und der Eifersucht. Selbstüberhebung könnte andererseits zu einer Selbstverliebtheit führen wie bei Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild im Wasser so sehr verliebt, dass er der Liebe zu jemand anderem nicht mehr fähig ist.
Beides – Selbstabwertung wie Selbstüberhebung – sind Formen eines Ungleichgewichts beim Vergleich seiner selbst mit den anderen, sind Formen eines ungesunden Narzissmus, bei beidem stimmt die Proportion der Selbstliebe im Vergleich mit der Einschätzung der anderen nicht. Beides kommt aus dem Mangel aus echter Selbstachtung.
Im rechten Sinne angeschaut kann das Spiegelbild stattdessen zur Wurzel des Selbstwertes werden, kann es uns unsere unverwechselbare Eigenart und die Schönheit dieser Eigenart zum Bewusstsein bringen, auch das Liebenswerte dieser Eigenart. Wo uns das Liebenswerte dieser Eigenart gespiegelt wurde – wir sprechen ja auch im übertragenen Sinne von »Spiegelung« –, da ist dies ein großer Gewinn und ein sicherer Schutz vor Selbstentwertung, wie es z. B. die positive Spiegelung der Gestalt »Zottelhaube« in dem norwegischen Märchen durch ihre schöne Schwester ist. Werden wir hingegen abwertend gespiegelt – wie »Zweiäuglein« durch ihre Mutter und Schwestern –, dann bedarf es vertiefter Verwurzelung im Eigenen, wie sie der wunderbare Baum hat, der ihr erwächst und der nur ihr Früchte bringt, am Schluss jenes Märchens.
Der Blick in den Spiegel ermöglicht vertiefte Selbstreflexion – Reflektieren hängt, bildhaft gesehen, immer mit Spiegelung zusammen – und ermöglicht mir im umfassenden Sinne Selbsterkenntnis, die Fähigkeit, ich selbst zu sein, Authentizität. Diese wiederum ist die stärkste Gegenkraft gegen Neid und Eifersucht. Selbstwert zu haben, bewahrt vor aller Selbstentwertung beim Vergleich, so wie es die wilde »Zottelhaube« in dem gleichnamigen Märchen eindrucksvoll vorlebt, in ihrer unverbrüchlichen Liebe zu der auffallend schönen Schwester, während sich die Königstochter eines anderen Märchens zur »Gänsemagd« degradieren lässt, als sie durch den Neid ihrer Kammerjungfer negativ gespiegelt und abschätzig behandelt wird. Auch in dem Märchen »Die zwei Brüder« ereignet sich gegen Ende eine Versteinerung des einen Bruders, der sich unter dem Blick der Hexe entwertet sieht.
Der Blick in den Spiegel hat also nicht nur mit einer Erkenntnis des eigenen Gesichts zu tun, sondern auch mit einer Erkenntnis des Wesens, er kann uns zeigen, wo wir jetzt in unserer persönlichen Entwicklung stehen und uns damit auch einen Blick in Vergangenheit und Zukunft gewähren. So weiß der Spiegel der neidischen Königin immer, wo sich Schneewittchen befindet. Tiefe Selbstreflexion weiß dies auch, sieht sowohl kristallklar die eigene Befindlichkeit als auch die der Beneideten. Selbstreflexion und Selbsterkenntnis aber gelten als Schlüssel der Weisheit.
Spiegelneuronen wiederum bilden, wie die neuere Gehirnforschung herausgefunden hat, die Grundlage für unser Mitgefühl füreinander. Auf Grund der Spiegelneuronen, die uns den Schmerz des anderen spiegeln, zucken wir zusammen, wenn ein anderer sich verletzt. So sind die Spiegelneuronen Basis für unser Mitempfinden mit den anderen und damit auch für das Gönnen, in dem wir den anderen das gleiche Heilsein und Wohlsein im Leben wünschen wie uns selbst. Neid, so können wir jetzt sagen, kommt aus dem Mangelerleben, dem Mangel an Selbstwert und Selbstwirksamkeit, Gönnen dagegen aus dem Gefühl des Genügens, genug zu sein und zu haben, sich selbst zu genügen, sich selbst zu mögen mit dem Gesicht, das man hat, und der Wirksamkeit, die einem gegeben ist.
Die Schönheit der Königin wird ja in dem Spruch des Spiegels, »Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier« überhaupt nicht bestritten, sondern bestätigt. Das könnte ihr genügen. Lernen müsste sie, dass es nur um eine Relativierung geht, die einer Anderen zugesteht, ebenso schön, und dort, an deren Ort, vielleicht auch schöner zu sein. Hier ist diese Königin ja unbestritten die Schönste.
In dem folgenden Nachdenken über Gönnen und Neiden am Beispiel von fünf Märchen, in denen beides eine Rolle spielt , soll es nun auch nicht um eine exklusive oder durchgehende psychologische Interpretation gehen, wie sie vielfach schon vorliegt, sondern um eine spezifische Beleuchtung der Situationen des Neidens und des Gönnens, wie sie in dem jeweiligen Märchen gesehen und dargestellt werden. Die Märchen wurden unter dieser Thematik im Rahmen eines Seminars bei der Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie 2011 in Lindau vorgestellt und ihre Bedeutung erarbeitet. Herzlich danke ich den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die inspirierende Begegnung und Auseinandersetzung mit den Bildern und Vorstellungen der Märchen.
Ingrid Riedel
Konstanz, im Mai 2012
Die Gänsemagd
Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter, wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld auch an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen musste, packte ihr die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein: Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte, denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjungfer bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte, und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, dass sie bluteten; darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach: »Liebes Kind, verwahr sie wohl, sie werden dir unterweges Not tun.«
Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied, das Läppchen steckte die Königstochter in ihren Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und rief ihrer Kammerjungfer: »Steig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, den du aufzuheben hast, Wasser aus dem Bach, ich möchte gern einmal trinken.«
»Ei, wenn Ihr Durst habt«, sprach die Kammerjungfer, »so steigt selber ab, legt Euch ans Wasser und trinkt, ich mag Eure Magd nicht sein!«
Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wässerlein im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldnen Becher trinken.
Da sprach sie: »Ach Gott!« Da antworteten die drei Blutstropfen: »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Aber die Königsbraut war demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd.
So ritten sie etliche Meilen weiter fort, und der Tag war warm, dass die Sonne stach, und sie durstete bald von Neuem; da sie nun an einen Wasserfluss kamen, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer: »Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken!« Denn sie hatte aller bösen Worte längst vergessen.
Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger: »Wollt Ihr trinken, so trinkt allein, ich mag Eure Magd nicht sein.«
Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst und legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach: »Ach Gott!« Und die Blutstropfen antworteten wiederum: »Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen!«
Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrer großen Angst merkte.
Die Kammerjungfer hatte aber zugesehen und freute sich, dass sie Gewalt über die Braut bekäme, denn damit, dass diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau: »Auf Falada gehör ich, und auf meinen Gaul gehörst du«, und das musste sie sich gefallen lassen. Dann hieß sie die Kammerfrau auch noch die königlichen Kleider ausziehen und ihre schlechten anlegen, und endlich musste sie unter freiem Himmel schwören, dass sie am königlichen Hof keinem Menschen davon sprechen wollte, und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahm’s wohl in Acht.
Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Ross, und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft, und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin, und sie wurde die Treppe hinaufgeführt, die wahre Königstochter aber musste unten stehen bleiben. Da schaute der alte König aus dem Fenster und sah sie im Hofe halten, wie sie fein war, zart und gar schön; und ging alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hofe stände, und wer sie wäre?
»Ei, die hab ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft, gebt der Magd was zu arbeiten, dass sie nicht müßig steht.«
Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wusste nichts, als dass er sagte: »Da hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen!« Der Junge hieß Kürdchen, dem musste die wahre Braut helfen Gänse hüten.
Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König: »Liebster Gemahl, ich bitte Euch, tut mir einen Gefallen!«
Er antwortete: »Das will ich gerne tun.«
»Nun, so lasst mir den Schinder rufen und dem Pferd; worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat.« Eigentlich aber fürchtete sie sich, dass das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen wäre.
Nun war das so weit geraten, dass es geschehen und der treue Falada sterben sollte, da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch musste. Unter das finstere Tor möchte er dem Falada seinen Kopf hinnageln, dass sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter dem finsteren Tor fest.
Des Morgens früh, als sie und Kürdchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen:
»O du Falada, da du hangest«,
da antwortete der Kopf:
»O du Jungfer Königin, da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
ihr Herz tät ihr zerspringen.«
Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie hier und machte ihre Haare auf, sie waren eitel Gold, und Kürdchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar ausraufen. Da sprach sie:
»Weh! Weh! Windchen,
nimm Kürdchen sein Hütchen,
und lass’n sich mit jagen,
bis ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürdchen sein Hütchen wegwehte über alle Land, dass es ihm nachlief, und bis es wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig, und er konnte keine Haare kriegen. Da es Abend wurde, dann gingen sie nach Haus. Den andern Morgen, wie sie unter dem finstern Tor hinaustrieben, sprach die Jungfrau:
»O du Falada, da du hangest«,
es antwortete:
»O du Jungfer Königin, da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
das Herz tät ihr zerspringen!«
Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen, und Kürdchen lief und wollte danach greifen, da sprach sie schnell:
»Weh! Weh! Windchen,
nimm dem Kürdchen sein Hütchen,
und lass’n sich mit jagen,
bis ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, dass es nachzulaufen hatte, und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen, und sie hüteten die Gänse, bis es Abend wurde.
Abends aber, nachdem sie heimkamen, ging Kürdchen vor den alten König und sagte: »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.«
»Warum denn?«, sprach der alte König.
»Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.«
Da befahl ihm der alte König zu erzählen, wie’s ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürdchen: »Des Morgens, wenn wir unter dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie:
›Falada, da du hangest’,
da antwortet der Kopf:
›O du Königsjungfer, da du gangest,
wenn das deine Mutter wüsste,
das Herz tät ihr zerspringen!«
Und so erzählte Kürdchen weiter, was auf der Ganswiese geschähe und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen müsste.
Der alte König befahl ihm aber, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, wie es Morgen war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Falada sprach; und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemagd und der Gänsejunge die Herde getrieben brachten und nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder:
»Weh! Weh! Windchen,
nimm Kürdchen sein Hütchen,
und lass’n sich mit jagen,
bis ich mich geflochten und geschnatzt
und wieder aufgesatzt.«
Da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürdchens Hut weg, dass es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und fragte, warum sie das alles so täte.
»Das darf ich Euch und keinem Menschen sagen, denn so hab ich unter freiem Himmel geschworen, weil ich sonst um mein Leben wäre gekommen.«
Er aber drang in sie und ließ ihr keinen Frieden. »Willst du mir’s nicht erzählen«, sagte der alte König endlich, »So darfst du’s doch dem Kachelofen erzählen.«
»Ja; das will ich wohl«, antwortete sie. Damit musste sie in den Ofen kriechen und schüttete ihr ganz Herz aus, wie es ihr bis dahin ergangen und wie sie von der bösen Kammerjungfer betrogen worden war. Aber der Ofen hatte oben ein Loch, da lauerte ihr der alte König zu und vernahm ihr Schicksal von Wort zu Wort.
Da war’s gut, und Königskleider wurden ihr alsbald angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war; der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte, die wäre bloß ein Kammermädchen, die wahre aber stände hier als die gewesene Gänsemagd. Der junge König aber war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden, obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur andern, aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck.
Als sie nun gegessen und getrunken hatten und guten Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf: Was eine solche wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte, erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte: »Welchen Urteils ist diese würdig?«
Da sprach die falsche Braut: »Die ist nichts Besseres wert, als splitternackt ausgezogen in ein Fass, inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen, geworfen zu werden, und zwei weiße Pferde davor gespannt müssen sie Gasse auf, Gasse ab zu Tode schleifen!«
»Das bist du«, sprach der alte König, »und dein eigen Urteil hast du gefunden, und danach soll dir widerfahren«, welches auch vollzogen wurde.
Der junge König vermählte sich aber mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.
Das Grimm’sche Märchen1Die Gänsemagd2 ist eines von denen, die einen richtig aufregen können. »Wie konnte diese Königstochter nur so blöd sein, sich alles wegnehmen zu lassen!«, empört sich eine Zuhörerin, als ich in einem Seminar dieses Märchen vorgelesen hatte. Ein anderer meinte: »Mir gefällt diese Kammerjungfer in ihrer Aufmüpfigkeit. Man ist ja auch nicht dazu geboren, andere zu bedienen!« Versuchen wir also, das Märchen in seiner Aussage zu verstehen, indem wir die von ihm aufgerollte Lebenssituation von Anfang an bedenken.
Die Königstochter, die Heldin dieses Märchens, hat eine liebevolle Mutter und keinen Vater. Jedenfalls ist er nicht genannt, er fehlt: Das ist untypisch für Königsmärchen. Wenn er fehlt, wird er meist als gestorben betrachtet. So kommt diese Königstochter ganz von der Mutter her. Sie hat eine stark gefühlsbetonte Beziehung zur Mutter Psychologisch könnte man von einem Mutterkomplex sprechen, der positiv getönt ist. Es gilt als typisch für Menschen, die aus einer warmen Mutterbeziehung kommen, dass sie eher wenig Phantasie für das Böse haben, für möglichen Neid. Sie fühlen sich zunächst fraglos geborgen unter Menschen, gerne gemocht und geschützt. Gerade aus einer positiven Mutterbeziehung heraus entsteht oft das Gefühl einer Geborgenheit, enthält sie doch auch eine gewisse Verwöhnung. Noch dazu ist diese Tochter hochgeboren, aus königlichem Geschlecht. Das bedeutet im günstigen Fall auch, dass sie von hohen Werten getragen ist. Königin zu werden heißt ja auch, souverän werden zu wollen.
Um diese Königstochter wurde geworben. Sie soll Königin werden, also souverän werden, sich mit einem Mann, also auch mit dem männlichen Prinzip verbinden, das ihr noch relativ fremd ist. Ihr fehlt ja der Vater, ihr fehlen auch die Brüder. Sie wird gut ausgerüstet mit einem Brautschatz, einem besonderen Pferd, sowie einer, wie die Mutter meint, vertrauenswürdigen Begleiterin. Doch fehlen männliche Begleiter auffällig bei dieser Brautreise. Über männliche Kräfte – äußere und vielleicht auch innere – verfügt diese Mutter nicht und kann sie deshalb ihrer Tochter auch nicht mitgeben. Sie verfügt nicht mehr darüber, denn sie ist offensichtlich Witwe, hat keine große Macht mehr nach außen, wohl aber nach innen über ihre Liebe zu der einzigen Tochter. Diese Tochter ist bei einer trauernden Mutter herangewachsen – hat deshalb vielleicht auch gelernt, die Mutter zu trösten und nicht zu belasten, also sich selbst und ihre Bedürfnisse zurückzustellen.
Auf die Reise zu ihrem Bräutigam wird der Königstochter eine Begleiterin mitgegeben, eine Kammerjungfer, nicht einfach eine Magd. Die Kammerjungfer ist meist eine enge Vertraute der Königin, soll ja bei der Anreise der verlängerte Arm der Mutter sein: beschützend und geleitend. So ist sie im Allgemeinen eine hochgestellte Persönlichkeit am königlichen Hof und selbst von hohem Adel. Aber ihr ist in diesem Fall die dienende, die bedienende Rolle zugedacht. Sie ist zumindest nur die Zweite am Hof. Von hier aus baut sich die Neid-Dynamik in diesem Märchen in aller Schärfe auf.
Noch etwas sehr Wichtiges, ein magischer Schutz gleichsam, wird der Tochter von ihrer Mutter mitgegeben: Falada, das Pferd, das sprechen kann. Ein merkwürdiger Name! In einer anderen Version dieses Märchentypus heißt es Folle. Der Name geht auf alte Wurzeln zurück.3Folle oder Fohle ist noch heute ein alter süddeutscher Name für Stute. Fähl nennt man im bäuerlichen Allgäu das Mädchen. Das Fohlen also ist das Junge der Fohle. Falada ist also eine Stute. Stute und Mädchen, Pferd und Reiterin gehören eng zusammen. Zudem ist das Pferd das Symbol frühgeschichtlicher Erd- und Mutter-Göttinnen, die zuerst selbst in Gestalt der Stute dargestellt wurden, später als Reiterin oder begleitet von Pferden. So ist das Pferd ein Begleittier weiblicher Gottheiten. Am bekanntesten dafür ist Epona, die keltische Mutter-Gottheit, die mythologisch selbst als Pferd dargestellt wurde. Auch die griechische Göttin Demeter wurde zuerst als Leukippe, als Weißstute verehrt, später als Pferdeköpfige, schließlich von Pferden begleitet. Auch in der klassischen hellenischen Mythologie blieb ihr die Fähigkeit, sich in ein Pferd zu verwandeln.
Das Pferd zeichnet sich aus durch Feinfühligkeit, Beziehungsfähigkeit, Tragfähigkeit. In sich selbst ist es von vitaler Kraft, von Feuer, Schnelligkeit, auch Instinktsicherheit im Vergleich zum Menschen. Es verkörpert oft eben die Körperseite, das Körperliche überhaupt, so wie für junge Mädchen oft die Pferde einen ersten Kontakt auch zu ihrer eigenen Körperlichkeit bedeuten. Pferden sind auch wilde Instinkte und Emotionalität eigen. Dies zeigt sich sprichwörtlich in der Redewendung: »Es sind einem die Pferde durchgegangen.« Dies steht für wilde Emotionen, die sich der Domestizierung entziehen. Falada bedeutet also für die Reiterin, einen Bezug zur Körperseite zu haben, einen Rückbezug zur Mutter und schließlich zur weiblichen Gottheit, zu ihrer persönlichen Weiblichkeit, von der sie sich getragen fühlen soll. Dieses Pferd kann sprechen, sich ausdrücken, also zu ihr Kontakt aufnehmen und ihr die Wahrheit sagen.