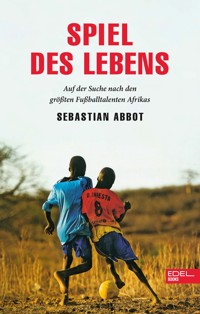
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Football Dreams" hieß das größte Scoutingprojekt der Geschichte, initiert vom Scheichtum Katar. Jahrelang wurden in Afrika Millionen jugendlicher Fußballer getestet, mit dem Ziel, die größten Talente nach Europa zu bringen und dort zu Profis zu formen. Sebastian Abbot hat dieses System kritisch unter die Lupe genommen und drei afrikanische Jungs auf ihrem Weg vom heimischen Sportplatz über eine Akademie in Katar bis nach Europa begleitet. Ein erhellendes Schlaglicht auf die zwielichtige Welt des internationalen Talentscoutings im Milliardengeschäft Fußball.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Prolog
TEIL 1 DIE JUNGS
KAPITEL 1Der Tornado
KAPITEL 2 Der Kapitän
KAPITEL 3 Der Torjäger
TEIL 2 DIE AKADEMIE
KAPITEL 4 Aspire
KAPITEL 5 Endrunde
KAPITEL 6 Nach Hause geschickt
KAPITEL 7 Brüder
KAPITEL 8 Ruhm und Schmach
KAPITEL 9 Der Milk Cup
TEIL 3 DIE PROFIS
KAPITEL 10 Die Schlacht von Belgien
KAPITEL 11 Miracle Land
KAPITEL 12 Erst der Anfang
Epilog
Dank
Anmerkungen zu den benutzten Quellen
Bildnachweis
PROLOG
Im Fußball kennt sich Josep Colomer aus. Schon als Teenager gründete er in Spanien sein erstes Trainingszentrum. 2002 war er im brasilianischen Trainerstab und half, den WM-Titel zu holen. Später wurde er Jugendleiter beim Fußballgiganten FC Barcelona und wirkte am Karrierestart eines ganz Großen mit. Die Rede ist von Lionel Messi.
Mit nigerianischen Aktivisten kannte sich Colomer deutlich weniger aus. (Es fängt schon damit an, dass sie es nicht mochten, wenn man sie „Aktivisten“ nannte. Sie bevorzugten den Begriff „Freiheitskämpfer“.) Bei seiner Arbeit als Scout und Trainer in den höheren Gefilden des internationalen Fußballs war er, nachvollziehbarerweise, noch keinem über den Weg gelaufen. Jetzt stand er an einem halbverfallenen Anleger im unruhigen Nigerdelta. Ganz in der Nähe trieb auf einem Teppich aus grünen Wasserhyazinthen ein kleines graues Yamaha-Motorboot. Einer der Insassen war Clemente Konboye, ein gestandener Kämpfer mit Schmerbauch, Zahnlücke und aggressiver Ausstrahlung. Seine Augen fixierten Colomer.
Konboye war nicht der Einzige, der den Fremden ins Visier nahm. Einheimische lugten aus Blechverschlägen und verbeulten Motorbooten und musterten den gedrungenen, kahlköpfigen Mann. Wie immer sah der Enddreißiger aus, als wäre er auf dem Weg ins Fitnessstudio. Colomer schien nie etwas anderes zu tragen als T-Shirt, Fußballshorts und Laufschuhe. Auch hier in Warri – einer der größten Städte im Delta State – machte er keine Ausnahme. Er versuchte gar nicht erst, sich kleidungsmäßig an die Umgebung anzupassen.
Der Sommer 2007 war nicht der beste Zeitpunkt, um als Weißer an einem Anleger im Nigerdelta zu stehen. Der Kampf für eine faire Beteiligung der Bevölkerung am enormen Ölreichtum der verarmten Region war in vollem Gange. Die Aktivisten rasten, mit Kalaschnikows und Panzerbüchsen bewaffnet, in kleinen Motorbooten durch die Gegend, griffen Regierungstruppen an und kidnappten ausländische Ölarbeiter. Wenn sie verfolgt wurden, brachten sie sich in dem Labyrinth aus Wasserläufen und Mangrovenwäldern in Sicherheit, die das Bild in dieser Gegend bestimmten. Konboye gehörte wie viele andere zu den Gefolgsleuten des schillernden Kommandanten Tompolo, der die „Bewegung für die Emanzipation des Nigerdeltas“ mitgegründet hatte. Seine Getreuen hatten 2006 unweit der kleinen Fischerstadt Ogulagha, in der Tompolos Mutter lebte, neun ausländische Ölarbeiter von einem Schiff entführt und für ihre Freilassung Lösegeld verlangt. Der Zufall wollte es, dass Colomer an diesem bewölkten Augustnachmittag ebenfalls nach Ogulagha unterwegs war. Konboye hatte sich am Anleger eingefunden, weil er und seine Mitstreiter entsprechend instruiert worden waren. Er war allerdings nicht hergekommen, um Colomer zu entführen. Er war hier, um ihn zu schützen.
Colomer interessierte sich nicht für das Öl im Nigerdelta. Er war auch nicht auf Diamanten und Gold aus, die seit jeher die Ausländer an die Küsten und ins Hinterland des Kontinents locken. Was in Afrikas Erdreich verborgen lag, war für ihn uninteressant. Er hoffte auf einen oberirdischen Schatz. Dieser Schatz war vielleicht abseits einer Ausfallstraße in Nigerias vor Menschen wimmelnder Hauptstadt Lagos zu finden, vielleicht auf einer spärlich besiedelten Insel im Nigerdelta. Er konnte überall sein. Der unbekannte Aufenthaltsort war aber nur eine von vielen Schwierigkeiten, die er zu bewältigen hatte.
Die erste lag darin, genau zu wissen, wonach er eigentlich suchte. Ob man Gold oder Diamanten gefunden hat, lässt sich leicht feststellen, aber in Colomers Metier waren die Analyseergebnisse weit weniger eindeutig. Lange Zeit verließen sich die Experten auf diesem Gebiet vor allem auf Erfahrung und Intuition statt auf harte Fakten, auch wenn sich das allmählich ändert. So oder so konnte die Suche Jahre dauern. Aber wenn sie erfolgreich wäre, war ihm weltweite Anerkennung sicher. Öl und Diamanten? Geschenkt. Colomer jagte etwas anderem hinterher: Er war auf der Suche nach dem nächsten Messi.
Die Fahrt nach Ogulagha war eine von vielen hundert Reisen, die Colomer und sein Scouting-Team 2007 kreuz und quer durch Afrika unternahmen. Sie waren dabei, die größte Talentsuche in der Sportgeschichte auf die Beine zu stellen. Allein 2007 sichtete Colomers Team 400.000 Jungs in sieben afrikanischen Ländern, und das war erst der Anfang. Später wurde die Nachwuchssuche, die den Namen „Football Dreams“ trug, auf mehr als zwei Dutzend Länder in Afrika, Lateinamerika und Südostasien und auf über 5 Millionen Kids ausgeweitet. Jedes Jahr wählte Football Dreams eine Handvoll aus, um sie an einer speziellen Fußballakademie auszubilden, mit der Absicht, Profis aus ihnen zu machen. Diese Auserwählten einfach nur als handverlesen zu bezeichnen, wäre untertrieben: Die Chance, aufgenommen zu werden, war eintausendmal geringer als die Chance, in Harvard studieren zu dürfen.
Als Zielgruppe wählten die Scouts 13-jährige Jungs. Die Trainer an der Akademie sollten genug Zeit haben, sie zu Fußballern auszubilden, die dann im Alter von 18 Jahren an der Weltspitze mitspielen konnten. Um eine Vorstellung von der Größenordnung zu geben: Die Scouts von Football Dreams sichteten jedes Jahr im Schnitt rund 500.000 Jungs. Das waren mehr als der Bevölkerungsanteil an 13-jährigen Jungs in jedem der 20 Länder, die ganz oben auf der FIFA-Weltrangliste stehen. In manchen dieser Länder lebten nicht einmal ein Zehntel so viele 13-Jährige. Wie viele angehende Messis, Pelés, Beckenbauers oder Zidanes würde man wohl ausfindig machen, wenn man in Argentinien, Deutschland oder Frankreich jedes Jahr alle 13-jährigen Jungs von Scouts sichten lassen würde? Colomer suchte aber nicht in Europa oder Südamerika, jedenfalls vorerst nicht. Er weitete seine Suche zwar auf einige wenige lateinamerikanische und asiatische Länder aus, aber sein Schwerpunkt war Afrika.
Der spanische Schriftsteller Manuel Vázquez Montalban bezeichnete den Fußballsport einmal als „Religion auf der Suche nach einem Gott“. Nirgends trifft diese Beschreibung mehr zu als in Afrika. Einige ostafrikanische Länder sind zwar eher für ihre Weltklasse-Läufer bekannt, aber fast überall sonst sind vor allem die Kinder unbändige Fußballverehrer. Die meisten von ihnen leben in bescheidenen Verhältnissen, und auch die Orte, an denen sie ihre Verehrung ausleben, sind bescheiden, trotzdem träumen sie davon, Götter zu werden – Fußballgötter.
Wenn man in der senegalesischen Hauptstadt Dakar am späten Nachmittag an der Corniche entlangspaziert und von den Felsklippen in die Tiefe schaut, sieht man auf einem schmalen Strandstreifen Dutzende barfüßige Männer und Jungs mit vollem Einsatz spielen, als stünden sie im Finale der Champions League. Sie tragen nachgemachte Trikots ihrer europäischen Lieblingsmannschaften und feuern den Ball auf ein paar alte Autoreifen, die sie halb in den Boden eingegraben haben und die das Tor darstellen sollen. Sie spielen gegen die Zeit, denn irgendwann wird die einsetzende Flut ihr Spielfeld davonspülen, wobei auch das Wasser sie nicht am Weiterspielen hindert. Sie rennen in den Ozean und schlenzen den Ball höchst gekonnt aus dem knöcheltiefen Wasser, während ihre Körper vor der untergehenden Sonne allmählich zu Silhouetten werden.
Szenen wie diese spielen sich überall in Afrika ab. In den zunehmend übervölkerten Städten des Kontinents nehmen die Kinder jede noch so kleine Freifläche in Beschlag und spielen dort Fußball. Sie stellen unter einer Autobahnbrücke in Lagos Bambustore auf. Auf einem mit Schotter bedeckten Friedhof in Accra wieseln sie zwischen den scharfkantigen Grabsteinen hindurch. Wenn sie auf einem quirligen Markt in Abidjan aus Versehen Teller mit kleinen roten Tomaten und Bratfisch von den Tischen kicken, entschuldigen sie sich brav. In den ländlichen Gebieten haben die Kids es etwas leichter, jedenfalls wenn es darum geht, einen Sandplatz zum Fußballspielen zu finden. Dann gibt es aber immer noch ein Problem: Wie kommt man an einen Ball? In diesem Punkt sind afrikanische Kids erfinderisch: Mal behelfen sie sich mit einer leeren Wasserflasche, mal mit Plastiktüten oder Kleidungsstücken, die sie mit einer Schnur zum Knäuel zusammenbinden.
Trotz der primitiven Rahmenbedingungen entwickeln junge afrikanische Spieler in vieltausendstündiger Fußballpraxis oft ein Ballgefühl, einen Instinkt und ein athletisches Können, die ihresgleichen suchen. Forscher sind sogar der Meinung, dass genau diese Erfahrung ein Grund ist, warum zum Beispiel brasilianische Fußballer so gut sind. Beim Straßenfußball trainieren sie ihren Körper und – noch wichtiger – schulen ihr Gehirn. Es gilt als erwiesen, dass die Spielpraxis, die sie beim Kicken auf der Straße oder auf Sand sammeln, ein entscheidender Faktor sein kann, wenn es darum geht, es bis zum Profi zu bringen.
Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass Afrika in den vergangenen Jahren einige der größten Fußballstars hervorgebracht hat, darunter Samuel Eto’o aus Kamerun, Didier Drogba und Yaya Touré aus der Elfenbeinküste. Europäische Vereine setzten schon zu Kolonialzeiten auf afrikanische Spieler, aber in den letzten 20 Jahren – seit Unsummen in den Profifußball fließen und die Globalisierung dieser Sportart immer weiter voranschreitet – ist die Zahl der Fußballer aus Afrika, die nach Europa und anderswo auswandern, explosionsartig angestiegen. Inzwischen sind fast zehn Prozent aller Spieler in der englischen Premier League Afrikaner. Auch aus anderen wichtigen Fußballligen der Welt, sogar aus der US-amerikanischen Major League Soccer sind die Afrikaner nicht wegzudenken. Die Clubs haben bereits dreistellige Millionenbeträge für afrikanische Spieler ausgegeben, und die Preise steigen rasant. 2016 kaufte Liverpool dem Konkurrenten Southampton den senegalesischen Stürmer Sadio Mané für die Rekordsumme von 34 Millionen Pfund ab.
Colomer war überzeugt, dass die afrikanischen Spieler, die Schlagzeilen machten, nur die Spitze eines Talent-Eisbergs auf einem Erdteil waren, der größtenteils noch ungesichtet war. Wenn er nur ein ausreichend großes Netz auswarf, würde er Nachwuchsspieler entdecken, die vielleicht das Zeug zum Superstar der Zukunft hatten. Das war der Grund, warum er im August 2007 an dem Anleger im Nigerdelta stand.
Es lief jedoch nicht alles nach Plan, als Colomer mit den beiden Polizisten, die zu seinem Schutz abgestellt und mit Kalaschnikows bewaffnet waren, am Anleger eintraf und sie aus ihrem Toyota-SUV stiegen. Den Polizeischutz hatte Colonel Sam Ahmedu organisiert, ein pensionierter Armeeoffizier, der jetzt Country Director für Football Dreams in Nigeria war. Colomer und die anderen europäischen Scouts, die an dem Programm beteiligt waren, ließen sich in Nigeria auf Schritt und Tritt von der Polizei begleiten. Doch Austin Bekewei, ihr Kontaktmann in Warri, wusste, dass das in Ogulagha keine Option war. Die Aktivisten hätten niemals Mitglieder der Regierungstruppen auf ihrem Territorium geduldet. Bekewei kam aus Ogulagha und kannte viele Aktivisten persönlich, auch Konboye, der jetzt neben ihm stand.
Bekewei, gut zehn Jahre jünger als Colomer, hatte die undankbare Aufgabe, diesem beizubringen, dass er bei seiner Fahrt in einen der gefährlichsten Bereiche des Deltas auf keinen Fall seine Aufpasser mitnehmen konnte. Außerdem musste er Colomer überzeugen, dass stattdessen Konboye ihn beschützen und wohlbehalten nach Warri zurückbringen würde. Er hatte zuvor mit Konboye und seinen Mitstreitern gesprochen. Sie hatten ihm versichert, dass sie nichts gegen Colomers Besuch einzuwenden hatten. Die Bewohner von Ogulagha wollten, dass er in ihre Stadt kam, denn sie sahen darin eine einmalige Chance für ihre Jungs, zu zeigen, was sie konnten. Nach Ogulagha hatte sich noch nie ein nigerianischer Scout verirrt und erst recht kein Europäer, der in der Fußballwelt an höchster Stelle gearbeitet und an der Karriere eines der besten Spieler aller Zeiten mitgewirkt hatte.
Colomer hatte Messi nicht entdeckt. Der zukünftige Star kam im September 2000 als schüchternes, schmales 13-jähriges Bürschchen zum FC Barcelona, mehr als zwei Jahre bevor Colomer dort Jugendleiter wurde. Doch sein kometenhafter Aufstieg war insofern zum Teil Colomer zu verdanken, als der den jungen Spieler unter seiner Fittiche nahm. Schon bald nach seinem Einstieg beförderte Colomer den Argentinier um vier Stufen auf einmal in die Ersatzmannschaft des FC Barcelona. Das hatte es bei Barça noch nie gegeben. Wenige Monate später, im November 2003, konnte Colomer dem 16-jährigen Zottelkopf verkünden, dass er erstmals in der Erwachsenenmannschaft spielen sollte. „Er riet mir, ich sollte einfach hingehen und das Spiel und das Erlebnis genießen“, erzählte Messi dem clubeigenen Fernsehsender, als sich sein Debüt zum zehnten Mal jährte.
Für beide war es eine unvergessliche Erfahrung, und sie blieben auch nach Colomers Weggang aus Barcelona in engem Kontakt. Messi vergaß nie, wie wichtig Colomers Unterstützung an einem so entscheidenden Punkt seiner Karriere gewesen war, und Colomer war stolz, einen der größten Fußballspieler der Welt herangezogen zu haben. Vielleicht würde er diese Erfahrung bei Football Dreams wiederholen können, aber jetzt musste er sich erst einmal darüber klar werden, ob er zu einem nigerianischen Aktivisten ins Boot steigen sollte.
Bekewei, Colomer und seine Beschützer steckten auf dem Anleger die Köpfe zusammen und berieten über die Lage. Bekewei versicherte, dass niemand Colomer etwas zuleide tun würde. In Wahrheit war ihm durchaus ein wenig mulmig zumute, aber er ließ sich nichts anmerken. Ihm war klar, dass er nicht in der Hand hatte, was auf der einstündigen Bootsüberfahrt von Warri nach Ogulagha passierte. Die Aktivisten in seiner Heimatstadt hatten ihr Wort gegeben, aber wie stand es mit den anderen Gruppen, die zwischen Warri und Ogulagha das Sagen hatten? Da es auf dem Wasser so gut wie keinen Mobiltelefonempfang gab, waren sie auf sich gestellt, falls ihnen etwas zustoßen sollte. Dieses Risiko ging Bekewei ein. Er war selbst angehender Fußballagent und wusste, dass Colomers Besuch für die Spieler eine einmalige Chance war, sich zu präsentieren, und seinem eigenen Ansehen in Ogulagha mächtig Auftrieb geben würde.
Die Polizisten protestierten. Die Lage sei einfach zu gefährlich. Sie drängten Colomer erfolgreich, Ahmedu anzurufen und ihn zu fragen, ob er das Boot besteigen sollte oder nicht. Der Colonel versicherte Colomer, er werde auf der Insel der sicherste Mensch überhaupt sein, weil die Einheimischen unbedingt wollten, dass er die Sichtung durchführte. Ahmedu sagte sogar, mit den Aktivisten an seiner Seite sei er sicherer als mit der Polizei: „Du hast zwei Polizisten dabei, die bewaffnet sind und vielleicht 40 Schuss Munition haben. Was können sie im Ernstfall ausrichten? Wenn die Aktivisten ihre Kooperation anbieten und sagen, dass sie dich schützen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.“
Was der Colonel weder dem spanischen Scout noch irgendjemandem sonst verriet: Er hatte längst einen Plan B vorbereitet. In der Regel arbeitete er mit dem nigerianischen Inlandsnachrichtendienst zusammen und ließ alle Spielstätten, wo Sichtungen stattfinden sollten, einen Tag vor Anreise der Scouts von Geheimdienstmitarbeitern in Augenschein nehmen. Manchmal verkleideten sich die Geheimdienstler als Fußballer, um das Gelände nach Hinweisen auf geplante Überfälle abzusuchen. In Ogulagha war eine solche Voraberkundung nicht möglich. Die Gefahr, enttarnt zu werden, war zu groß. Stattdessen hatte Ahmedu seine Ansprechpartner beim Militär eingeschaltet, die für den Notfall eine schnelle Eingreiftruppe bereithielten. Die Soldaten konnten jederzeit in ein Schnellboot springen, das mit einer gewaltigen Maschinenpistole bestückt war, und Colomer zu Hilfe eilen. Er hatte auch überlegt, ob er Satellitentelefone besorgen sollte, damit er während der Bootsfahrt mit Colomer kommunizieren konnte, aber davon hatte Bekewei abgeraten. „Die Jungs sind nicht auf den Kopf gefallen. Wenn sie sehen, dass du Hightech-Geräte dabeihast, halten sie dich womöglich für einen Spion“, berichtete Ahmedu später.
Die meisten Menschen hätten sich an Colomers Stelle wohl bedankt, wären wieder in ihr Toyota-SUV gestiegen und hätten das Weite gesucht. Doch schon als Teenager in der kleinen mittelalterlichen Stadt Vic nördlich von Barcelona war er von der Idee besessen gewesen, unentdeckte Talente aufzuspüren. Schon damals verbrachte er seine Wochenenden damit, nach fähigen Nachwuchsspielern für seine frisch gegründete Fußballschule Ausschau zu halten, dieweil seine Freunde Partys feierten und Mädchen nachstellten. Wenn es auf dieser Welt jemanden gibt, der zu einem nigerianischen Aktivisten ins Boot steigt, weil es ja sein kann, dass in einem kleinen Fischerstädtchen im Nigerdelta der nächste Fußball-Weltstar wohnt, dann Colomer. Und genau so kam es. Er überwand seine Angst, folgte Bekewei und Konboye zum Ende des Anlegers und stieg in das kleine graue Yamaha-Motorboot, das dort auf sie wartete. Während der Mann am Steuer ablegte und darauf achtete, dass die Schiffsschraube sich nicht in den Wasserhyazinthen verfing, schaute Colomer auf den Forcados River hinaus, über den er nach Ogulagha gelangen würde. Er war gespannt, was ihn dort erwartete.
Das Boot nahm rasch Fahrt auf. Schon bald fuhren sie so schnell, dass das schlammige Wasser links und rechts nur so vorbeiflog. Colomer saß auf einem kleinen weißen Kissen neben dem Außenbordmotor und hatte den rechten Arm auf dem Bootsrand abgelegt. Seine Miene war angespannt. Zu beiden Seiten des Flusses, der an manchen Stellen nicht breiter als 30 Meter war, erstreckten sich undurchdringliche, grüne Mangroven- und Palmenwälder. Hier und da zweigten schmale Nebenflüsse ab. Fluchtmöglichkeiten für den Fall, dass sie in Schwierigkeiten geraten sollten, gab es fast nirgendwo. Der Motor dröhnte so laut, dass man sich so gut wie gar nicht verständigen konnte.
Als sie sich Ogulagha näherten, wurde der Fluss deutlich breiter und führte an dem riesigen Ölterminal Forcados vorbei. In der Ferne sah man riesige weiße Öltanks. Sie waren nur ein kleiner Teil eines ausgedehnten, von Shell betriebenen Komplexes, an dem jeden Tag 400.000 Barrel Rohöl für den Export umgeschlagen wurden. Dieser Komplex war ein beliebtes Ziel für Aktivisten. Auch bei dem militärisch durchgeplanten Überfall, bei dem 2006 die ausländischen Ölarbeiter vor dem Morgengrauen entführt worden waren, hatten die Aktivisten die Ladeplattform des Terminals angegriffen.
Kaum hatten sie das Terminal hinter sich gelassen, steuerte das Boot auf Ogulagha zu. Die kleine Stadt war ein Durcheinander von zumeist verfallenen Holz- und Metallverschlägen, die sich am sandigen Flussufer aneinanderreihten. Die Armut bildete einen krassen Kontrast zu dem Reichtum, für den das benachbarte Shell-Terminal stand. Als das Boot sich dem Ufer näherte, lief ihnen durch das seichte Wasser eine Gruppe Teenager entgegen. Einer von ihnen trug ein rot-weiß gestreiftes Fußballtrikot.
„Guten Tag“, sagte Colomer gelassen. „Seid ihr Fußballer? Seid ihr bereit für ein Spiel?“
„Ja“, sagten sie. „Wir sind bereit.“
Die Kids stiefelten aber nicht auf das Boot zu, weil sie sich für Fußball interessierten. Sie wollten etwas anderes von Colomer: ein Trinkgeld. Sie boten Fahrgästen an, sie auf dem Rücken an Land zu tragen, damit ihre Schuhe nicht nass wurden. Als Lohn erhofften sie sich ein paar nigerianische Naira. Colomer waren nasse Füße egal. „Er sprang mit seinen Tennisschuhen einfach ins Wasser“, erzählt Bekewei. „Das ist wahrer Einsatz. Er war bereit.“
Bekewei und Konboye geleiteten Colomer vom Flussufer über ungepflasterte Wege, die sich durch die Stadt schlängelten, ins Herz von Ogulagha. Ein kleiner Kindertross zog hinter ihnen her. Die Kids waren neugierig auf den weißen Mann, der da zu Besuch kam. Die meisten Gebäude rechts und links des Weges waren rostige Wellblechbuden, die sich während der heißen Monate aufheizten wie Backöfen. Auf improvisierten Holzbrücken überquerten sie kleine, mit Müll verstopfte Kanäle. In der Luft lag der stechende Geruch von gebratenem Fisch, dem Hauptnahrungsmittel in Ogulagha.
Sie waren spät dran. Die Jungs, die Colomer begutachten wollte, standen schon seit Stunden auf dem kommunalen Fußballplatz mitten in der Stadt und warteten. Sie waren nicht alleine gekommen. Als Colomer auf dem Gelände eintraf, erblickte er rund um den Platz Zuschauer aller Altersstufen, ein Meer von Grün und dahinter die Wellblechhütten mit zum Trocknen aufgehängter Wäsche. Die Organisatoren hatten sogar ein Zelt aufgebaut, damit die Älteren im Schatten sitzen konnten.
Normalerweise traten bei den Tryouts, die Colomer in dem Jahr in ganz Afrika durchführte, jeweils 176 Spieler an. Das reichte für 16 Mannschaften à elf Spieler, die in insgesamt acht Partien à 25 Minuten gegeneinander antraten. Aus diesem Pool suchten Colomer und die anderen Scouts in jedem Land die besten 50 Spieler aus und luden sie zu einem viertägigen Tryout in die jeweilige Hauptstadt ein. Anschließend wurden die drei besten Feldspieler aus jedem Land und mehrere Torhüter aus ganz Afrika zu einem alles entscheidenden Tryout eingeladen, das nicht in Afrika stattfand und mehrere Wochen dauerte. Die besten Spieler im Finale wurden in die Akademie aufgenommen und zu Profis ausgebildet.
Um diese Tryouts auf die Beine zu stellen, brauchte es fast 6000 einheimische Freiwillige. Das sind ungefähr so viele Leute, wie man benötigt, um eine Fluggesellschaft am Laufen zu halten. Viele waren einheimische Trainer, die die Tausenden von kleinen, privaten Fußballschulen betrieben, die überall in Afrika in den Wohnvierteln zu finden sind. Um sich ihre Unterstützung zu sichern, verteilten Colomer und sein Team auf jedem Fußballplatz, auf dem sie ein Tryout durchführten, Nike-Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Dollar. Außerdem erhielten die Freiwilligen eine Auslandsreise gratis, wenn einer ihrer Jungs für das finale Tryout ausgewählt wurde. Das war eine attraktive Dreingabe, denn die meisten hatten ihre Heimat noch nie verlassen.
So etwas wie Football Dreams hatte die Fußballwelt noch nie gesehen, und zwar nicht nur wegen der Größenordnung des Programms, Fußball wird seit jeher als die Weltsportart schlechthin bezeichnet. Aber das Programm trieb die Globalisierung auf beinahe absurde Weise auf die Spitze. Football Dreams ist mehr als nur die Geschichte von ein paar europäischen Scouts auf der Suche nach zukünftigen Stars in Afrika. Es ist auch die Geschichte von reichen arabischen Scheichs, die in den Parks ihrer Paläste Fußball spielen, von südamerikanischen Wunderkindern, die zu Legenden werden, und von Fußballfans in einer Kleinstadt in Europa, die Angst haben, dass ihr Lokalverein gekapert wird. Die Zusammenführung dieser vollkommen unterschiedlichen Welten macht Football Dreams zu einem der ungewöhnlichsten Experimente in der Sportgeschichte. Wenn Colomers Mission gelang, würde er ebenso berühmt wie die Jungs, die er entdeckte.
In Ogulagha hatte Bekewei keine 176 Spieler für das Tryout auftreiben können, obwohl er mehrere Dutzend Kids aus den Nachbarorten dafür bezahlte, sich per Boot nach Ogulagha zu bemühen. Die zur Sichtung angetretenen Spieler waren ein bunter Haufen. Manche trugen richtige Fußballkleidung samt Fußballschuhen. Andere kamen barfuß oder wollten auf Socken spielen. Das Spielfeld ließ alle Unterschiede vergessen. Von Weitem sah der Rasen ganz annehmbar aus, bei näherem Hinsehen entpuppte er sich als Morast. In Nigeria war gerade Regenzeit. Das Spielfeld stand unter Wasser. Im Torraum hatten sich kleine Teiche gebildet, in denen Enten badeten, wenn gerade nicht gespielt wurde.
Die jungen Fußballer, die aufs Spielfeld liefen, trugen Nike-Trainingsleibchen, die vielen von ihnen mehrere Nummern zu groß waren. Sie kämpften gegeneinander und gegen die Platzverhältnisse und wollten Colomer beeindrucken. Das war nicht einfach. Vielversprechende Dribblings versackten in einer Pfütze, Spieler gerieten aus dem Gleichgewicht und fielen in den Matsch. Die wichtigste Fähigkeit bestand darin, den Ball aus dem stehenden Wasser herauszuschlenzen und das Spiel wieder in Gang zu bringen – eine Fähigkeit, die beim FC Barcelona nicht trainiert wird. Die Rahmenbedingungen gaben Colomer einen Vorgeschmack, wie schwer es für ihn und sein Scouting-Team auf dem einen oder anderen Bolzplatz in Afrika werden könnte, herauszufinden, was der einzelne Spieler draufhatte. Doch Colomer war fest entschlossen, ein möglichst großes Netz auszuwerfen. Niemand kann sagen, wo sich der nächste Messi verbirgt.
TEIL 1
DIE JUNGS
KAPITEL 1
DER TORNADO
Bernard Appiah ahnte nicht, dass er schon bald ein Wunder gegen ein anderes Wunder eintauschen würde. Der Mittelfeld-Dreikäsehoch fegte gerade den Boden in einem bescheidenen Kirchengebäude, dem aus Holz gezimmerten Miracle Temple in Ghanas übervölkerter Hauptstadt Accra. Sein Trainer kam zur Tür herein und verkündete, dass sich in ihrem Viertel ein Talentscout aus dem Ausland angesagt und für heute Vormittag ein Tryout – ein Probetraining – angesetzt habe. Das fügte sich gut, denn es gab auf der Welt nur eine Sache, die mit Bernards Glauben an Gott mithalten konnte: seine Fußballleidenschaft. Die Kirche – ein gedrungener Bau mit sanft abfallendem Giebeldach und einem hellblauen Anstrich, der allmählich verblasste – war mehr als bloß eine Kirche. Im Grunde war sie Bernards Zuhause und sein Fußballcoach Justice Oteng, der in der Gemeinde für den Bibelunterricht zuständig war, wie ein zweiter Vater. Heute war Oteng in den Miracle Temple gekommen, um Bernard zu ermuntern, an dem Probetraining teilzunehmen, das auf einem öffentlichen Bolzplatz in seinem Heimatviertel Teshie stattfinden sollte. Folgsam schnappte sich Bernard seine schwarz-weißen Nike-Stollenschuhe und flitzte zur Tür hinaus.
Die ersten erstaunten Trainerblicke hatte Bernard als kleiner Junge auf dem staubigen Pausenhof seiner Schule in Teshie auf sich gezogen. Der weite, offene Platz war für Kids, die sich dem chaotischen Menschengewimmel und der lärmenden Geschäftigkeit in den Straßen entziehen wollen, eine echte Oase. In der Gegend, in der Bernard aufwuchs, bestimmten unzählige klapprige Wohnhäuser und Läden aus Holz, Beton und Metall das Bild. Sie säumten ein Labyrinth von ungeteerten Straßen, auf denen sich Autos, Fahrräder, Holzkarren, Fußgänger, Händler, Hühner und Ziegen gegenseitig in die Quere kamen. Durch einige ungepflasterte Gassen der Stadt rann giftgrünes Abwasser. Das Einzige, was die Zumutung für die Sinne ein bisschen abmilderte, waren die Palmen, die hier und dort herumstanden. Der Ozean und seine kühle Brise waren nicht weit weg, aber das vergaß man leicht in dem wilden Gedränge.
Schon als kleiner Junge Jahren verbrachte Bernard jede freie Minute Fußball spielend auf dem Schulhof, meist mit seinem kleineren Bruder Eric. Zuerst hatten die beiden auf dem winzigen Stück Brachland vor ihrem beengten Zwei-Zimmer-Haus gekickt, aber der Vermieter scheuchte sie mit rüden Worten davon. Sie nahmen den kleinen Plastikball, den die Eltern ihnen gekauft hatten, in die Hand und rannten zum Schulgebäude. Bernard verlor seinen Ball häufig und wurde von den Eltern dafür ausgeschimpft. Für solche Dummheiten hatten sie kein Geld.
Wie Millionen andere Afrikaner waren Noah Appiah und Elizabeth Ansare auf der Suche nach einem besseren Leben vom Land in die Stadt gezogen. Sie stammen aus Ghanas sogenannter Zentralregion, wo ihre Eltern, die keine Ausbildung hatten, als Kakaobauern lebten. Das Leben in Teshie, einem Vorort von Accra, gestaltete sich beschwerlicher als gedacht. Immerhin fand Bernards Vater, der es als Stotterer nicht einfach hatte, an dem neuen Wohnort neue Arbeitsmöglichkeiten, auch wenn es nicht einfach war, an einen Job zu kommen. Seine Frau und er hatten mehr Bildung genossen als ihre Eltern, aber einen Sekundarschulabschluss hatten auch sie nicht. Als Bernard ein Kleinkind war, arbeitete Noah in einer Textilfabrik und lud für einen Monatslohn, der bei heutigen Preisen bei 40 US-Dollar liegen würde, Kisten auf Lkws. Mit diesem Geld waren keine großen Sprünge möglich, aber immerhin konnte Noah ab und zu Kleidung für Bernard, Eric und ihre kleine Schwester Josephine mitbringen.
Irgendwann setzte die Textilfirma Bernards Vater vor die Tür. Er war monatelang arbeitslos, bis er einen schlechter bezahlten Posten als Wachmann in einer Pension annahm. Für die Familie waren es entbehrungsreiche Zeiten. Einen beträchtlichen Teil des Lohns verschlang die Miete für das Häuschen, in dem sie alle zusammen im einzigen Schlafzimmer schliefen. In dem Haus gab es auch ein kleines Wohnzimmer mit einem Jesusbild an der Wand und einer schmalen Veranda. Dort bereitete Bernards Mutter auf einem Kohleherd das Essen für die Familie zu. Bernards Leibgericht war Banku, ein Gericht aus fermentiertem Mais, Maniokbrei und gedünsteten Okraschoten. Er packte im Haushalt mit an und holte in großen Kunststoffkanistern Wasser herbei, denn eine Wasserleitung gab es in dem Haus nicht. Wenn seine Mutter nicht gerade mit Kochen oder Putzen beschäftigt war, verkaufte sie auf dem Markt Secondhandkleidung, damit sie sich an den Schulgebühren für die Kinder und gelegentlich an der Anschaffung neuer Plastikbälle beteiligen konnte.
Bernard fand den schuleigenen Bolzplatz erheblich interessanter als sein Klassenzimmer. „In der Schule stellte ich mich nicht besonders helle an“, bekennt Bernard. Aber auf dem Platz zeigte er, was für ein intelligenter Bursche er war. Kaum war der Unterricht zu Ende, verließ er fluchtartig seinen hölzernen Schultisch, um zu kicken. Für die kleineren Kinder, zu denen Bernhard gehörte, gab es einen kleinen Fußballplatz mit verwitterten Holztorpfosten, die krumm und schief waren. Die älteren Kinder hatten einen richtigen großen Platz mit rostigen Toren aus Metall, von denen die weiße Farbe sich weitgehend abgelöst hatte. Nachmittags und am Wochenende tummelten sich auf beiden Plätzen scharenweise Kinder. Daneben stellten Frauen Holztische auf und verkauften Getränke und gegrillten Mais. Die Kinder, die nicht mitspielten, standen in ihrer braun-gelben Schuluniform am Rand und schauten zu.
Sie waren nicht die einzigen Zuschauer. Trainer aus der Gegend schlichen um die Bolzplätze herum und hielten Ausschau nach Nachwuchstalenten. Als Seth Ali zum ersten Mal auf Bernard aufmerksam wurde, war der ungefähr acht Jahre alt und kickte in alten Tennisschuhen. Doch schon damals fiel er auf, weil er schnell war, auf engem Raum den Ball gut kontrollieren und es mit seinem starken linken Fuß mit anderen Spielern aufnehmen konnte. Ali sprach mit Bernard und seinen Eltern und holte ihn in seine Mannschaft, die Top Stars. Schon bald waren seine neuen Mannschaftskameraden von ihrem neuen Mittelfeldkollegen beeindruckt. Weil er im Training immer so aufdrehte, nannten sie ihn Tornado. Diesen Spitznamen hatte er mit einem der berühmtesten Fußballer Ghanas gemeinsam – Stephen Appiah, der als Mittelfeldmann für Juventus spielte und die ghanaische Nationalmannschaft als Kapitän zur WM 2006 führte. Eines Tages für die Nationalmannschaft aufzulaufen, war auch Bernards Traum. Auf seinem Schulhof, wo die Top Stars trainierten, wehte die rot-gelb-grüne Flagge Ghanas mit dem markanten schwarzen Stern in der Mitte.
Ali war mit Enthusiasmus reicher gesegnet als mit Ressourcen – ein Dauerproblem für Fußballtrainer in Afrika. Für die 50 Kinder, die er trainierte, hatte er gerade mal zwei Bälle. Deshalb rannten die Kinder oft einfach nur auf dem staubigen Bolzplatz herum. Doch wer sein bester Spieler war, wusste Ali genau. „Bernard war bei den Leuten andauernd Gesprächsthema“, erzählt Ali. „In jedem Spiel war er der beste Mann auf dem Platz. Das war immer so.“ Auch seinen Teamkameraden war das klar. „Er war aus dem Nichts gekommen und schon auf dem Weg, ein Star zu werden“, berichtet sein Teamkollege und enger Freund Joshua Lartey. „Seine Freistöße, Elfmeter und Pässe waren unglaublich.“ Doch Ali hatte ein Problem: Er brauchte Geld für Trikots und Ausrüstung. So kam Justice Oteng ins Spiel – der Trainer, der Bernard vom Football-Dreams-Probetraining erzählte.
Bernard (zweiter von rechts) mit seinen Teamkollegen vom Unique FC, der in der Colts League spielte.
Oteng war gerade dabei, ein neues Team zusammenzustellen, das „Unique FC“ heißen und in Ghanas Jugendliga, der Colts League, spielen sollte. Oteng brauchte Spieler. Er entdeckte Bernard beim Bolzen auf dem Schulhof und sprach Ali an. Er sagte ihm, er wolle Bernard und mehr als ein halbes Dutzend weiterer Spieler aus dem Kader der Top Starsfür seine Mannschaft kaufen. Ein typisches Beispiel für das florierende Geschäft mit ganz jungen Fußballtalenten in Afrika: Lokaltrainer, die meist keine professionelle Ausbildung haben, versuchen, ein Kind zu finden, das so gut ist, dass es bei einem Spitzenclub in Europa spielen kann, weil sie hoffen, damit reich zu werden. Für manch einen sind diese Trainer böse Gesellen, die nur darauf aus sind, die jungen Spieler auszubeuten. Andere finden sie unverzichtbar, weil sie mithelfen, Fußball als Breitensport in Afrika aufzubauen. An beiden Positionen ist etwas dran, aber das Missbrauchspotenzial ist nicht von der Hand zu weisen.
Oteng holte Bernard nicht nur in seine Mannschaft, sondern ließ ihn auch bei sich zu Hause einziehen. So machen es viele Jugendtrainer in Ghana mit ihren besten Spielern. Die Bindung wird dadurch in beiden Richtungen gefestigt. Der Coach stellt seine Loyalität zu dem Spieler und dessen Familie unter Beweis, indem er in gewissem Umfang finanziell mithilft, ihn großzuziehen. Außerdem ist es für die Trainerkonkurrenz schwieriger, ihm den Spieler wegzuschnappen. Oteng wollte Bernard auf keinen Fall verlieren. „Er war sehr klein, aber er hatte das nötige Talent“, erzählt Oteng. „Er war der beste Stürmer und offensive Mittelfeldspieler, den wir hatten.“ Das war auch Bernard bewusst. Außerhalb des Spielfelds hatte er ein freundliches Gemüt und war nie um einen Scherz verlegen. Auf dem Platz war er das Selbstvertrauen und die Entschlossenheit in Person. „Gott hat mir diese Begabung geschenkt“, sagt Bernard. „Ich bin ein guter Dribbler. Meine Pässe kommen an. Ich habe eine Menge drauf.“
Bernards Familie förderte seine Fußballerkarriere nach Kräften, auch wenn das bedeutete, dass er nicht daheim wohnen konnte. Sein Vater war Fußballfan mit Leidenschaft und davon überzeugt, dass sein Sohn es weit bringen würde. „Immer wenn ich ihn spielen sah, hatte ich das Gefühl, dass mein Junge eines Tages groß rauskommt“, erinnert sich Noah Appiah. „Ich glaubte an ihn, weil ich sah, wie und mit welcher Leidenschaft er spielte.“ Bernard vergaß seine Familie ebenfalls nicht. Wenn er bei einem spontanen Spiel eine Packung FanIce (die landestypische Eiskrem) oder eine Tüte Boflots (die ghanaische Variante des Donuts) gewann, teilte er die Beute mit seinen Eltern und Geschwistern.
Bernard schlief zusammen mit zwei weiteren Spielen auf dem Fußboden in Otengs Einzimmerwohnung. Oteng sorgte für sie, als wären sie seine leiblichen Kinder. Er kaufte ihnen Stollenschuhe und Trikots, bekochte sie und zahlte sogar einen Teil des Schulgelds. Wenn sie gerade nicht in der Schule waren oder Fußball spielten, gingen sie Oteng in seinem Schweißbetrieb zur Hand. Die Schweißwerkstatt war ein ramponierter Bretterverschlag, auf den Oteng mit weißer Farbe in Krakelschrift seine Handynummer gemalt hatte. Mit den Einnahmen aus dem Betrieb finanzierte er seine Teams für die Colts League. Neben Trikots und Ausrüstung musste er auch die Fahrten zu den Spielen und, wenn sich ein Spieler verletzte, die Krankenhausrechnungen bezahlen.
Etwas Unterstützung bekam Oteng von seiner Kirchengemeinde, deren Gotteshaus Bernard gerade putzte, als Colomer in der Stadt auftauchte. Die Nächte vor den Spielen verbrachten seine Teams oft in der Kirche auf Schaumstoffmatratzen unter einem großen Moskitonetz, wo sie gleich für den Sieg beteten. Einer der Pfarrer, Reverend James Mensah, spielte früher selbst als Verteidiger in der Colts League. „Mit 17 kam ich dann zu den Born-Again Christians und hörte irgendwann mit dem Fußballspielen auf“, sagt er. 2007 zog Bernard zu Reverend Mensah und seiner Frau, weil Oteng einen Schweißauftrag in Kumasi im Landesinneren erhielt und nicht länger für ihn sorgen konnte. Das war der Grund, warum Oteng am Tag des Football-Dreams-Probetrainings in der Kirche nach ihm suchte, um ihm zu sagen, er solle sich seine Fußballschuhe schnappen und zum Star Park eilen. Von der Gruppe, die das Tryout veranstaltete, hatte hier noch nie jemand gehört, aber das spielte keine Rolle. Es war auf jeden Fall eine Chance.
Scouting im Fußball ist eine entbehrungsreiche Angelegenheit – auch in den höheren Preisklassen dieser Disziplin. In England verbringen Scouts viele Stunden hinter dem Lenkrad auf dem Weg in Kuhdörfer wie Yeovil und Hartlepool, um sich ein Spiel nach dem anderen anzusehen. Sie ernähren sich von Schinkensandwiches mit Senf oder Reis, Curry und Pommes und essen meistens zwischen Tür und Angel. Sie müssen permanent um ihren Arbeitsplatz bangen, vor allem angesichts der prophezeiten Datenrevolution, die sich wie ein Unwetter über der Welt des Fußballs zusammenbraut. Für ihre Mühsal bekommen sie vielfach nur mickrige 40 Pence pro Meile, wie Michael Calvin in seinem Buch The Nowhere Men berichtet, in dem er den abseits des Rampenlichts agierenden Clan der Fußballscouts anrührend porträtiert. „Scouts mögen beruflich eine Randgruppe sein, aber sie besitzen die Macht der Träume“, schreibt Calvin.
Bei den Spitzenclubs dieser Welt verdient man mitunter deutlich besser, aber das gilt nicht unbedingt für Scouts, die junge Spieler aufspüren. (Allerdings kommt man beim Jugendscouting normalerweise auch ohne paramilitärischen Polizeischutz und unauffällige Geheimdienstmitarbeiter aus und muss sich keine Gedanken darüber machen, wie man an ein Satellitentelefon kommt, um auf einer Bootsfahrt an der Seite eines nigerianischen Kämpfers mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben.) Das war der Grund, warum Colomer nicht quer durch Afrika reiste, um Nachwuchs für Barcelona, Chelsea oder einen anderen großen Verein zu suchen. Im Vergleich zu Colomers Geldgeber nahmen sich diese Clubs wie arme Schlucker aus. Er war nicht im Auftrag eines der reichsten Clubs der Welt unterwegs, sondern im Auftrag eines der reichsten Länder – des winzigen Wüstenstaats Katar. Ein Land, von dem die meisten Menschen in Afrika vermutlich noch nie gehört haben. Viele Leute im Rest der Welt auch nicht.
Das änderte sich auf einen Schlag, als Katar den Zuschlag als Gastgeber für die WM 2022 bekam und damit die Weltöffentlichkeit in Erstaunen versetzte. Mit den Eignungskriterien des Landes war es nicht weit her. Katar ist kleiner als der US-Staat Connecticut und hat so wenige Einwohner, dass die genaue Zahl wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird. Seine Nationalmannschaft belegte damals den 113. Platz der Weltrangliste und hatte sich noch nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Sommer, der üblichen Austragungszeit der Weltmeisterschaft, klettern die Temperaturen regelmäßig weit über 40 Grad. Doch Katar hat einen mächtigen Pfeil im Köcher: sein Geld. Unter dem Wüstensand und unter dem Meeresboden im Persischen Golf schlummern billionenschwere Öl- und Gasvorkommen. Wenn ein Land dermaßen gut betucht ist, aber nur zwei Millionen Einwohner hat, von denen obendrein nicht mehr als 300.000 eigene Staatsbürger sind, bleibt unter dem Strich jede Menge überschüssige Liquidität.
Die Scheichs, die in Katar die Macht haben, waren fest entschlossen, sich mit diesem Reichtum einen Platz auf der Weltbühne zu erobern, und sie wussten genau, dass kaum etwas mehr Aufsehen erregt als Erfolg im internationalen Fußballgeschäft und speziell bei der Weltmeisterschaft. Doch das Turnier mutierte für Katar rasch zum PR-Desaster. Schon bald musste das Land sich des Vorwurfs erwehren, es habe Funktionäre bestochen, um den Zuschlag zu erhalten. Es wurden ernsthafte Bedenken laut, ob das Fußballspielen in der brütenden Sommerhitze am Golf nicht sogar gesundheitsschädlich sei. Diese Bedenken bewogen die FIFA schließlich zu der Entscheidung, das Turnier in den Winter zu verlegen. Außerdem sah das Land sich vernichtender Kritik an seinem Umgang mit Wanderarbeitern ausgesetzt, die einen großen Teil seiner Bevölkerung ausmachen und die vielen Stadien für die WM bauen. Die Empörung war so heftig, dass viele an die FIFA appellierten, über die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 neu zu entscheiden.
Trotz der gestiegenen Aufmerksamkeit für das Land ist Katars Suche nach der nächsten Fußballstar-Generation bis heute geheimnisumwoben. Das Einzige, was noch unerhörter ist als die Dimension von Football Dreams, ist die Tatsache, wie wenige von diesem Programm wissen. Die meisten Menschen haben nicht die geringste Ahnung, dass Katar schon Jahre vor der Kür zum WM-Gastgeber beschlossen hatte, Colomer mit dem Auftrag nach Afrika zu schicken, mit den besten Nachwuchsspielern zurückzukommen, die er auftreiben konnte. Initiiert wurde das Programm von der Aspire Academy, einer staatseigenen Mammutinstitution, die Katar sich 1,5 Milliarden US-Dollar kosten ließ.
Selbst diejenigen, denen Football Dreams ein Begriff ist, können nur schwer nachvollziehen, welche Ziele Katar verfolgt und warum das Emirat so viel Geld in das Programm gesteckt hat – dem Vernehmen nach deutlich mehr als 100 Millionen Dollar. Versucht das Land, eine schlagkräftige Mannschaft afrikanischer Fußballer auf die Beine zu stellen, die bei künftigen Weltmeisterschaften mithalten kann? Wittert Katar die Chance, seinen Reichtum noch stärker zu vermehren, indem es die besten Spieler des Kontinents einsammelt und meistbietend verkauft? Aspire stellt Football Dreams als humanitäres Projekt dar, mit dem man jungen Afrikanern helfen will, ans Ziel ihrer Wünsche zu gelangen und bei einem Spitzenclub des Weltfußballs unterzukommen, doch der in den Medien und anderswo geäußerte Verdacht, Football Dreams sei bloß ein weiteres Kapitel in der andauernden Ausbeutungsgeschichte, in der reiche Länder Afrika seiner wertvollsten Ressourcen berauben, ließ sich nicht zerstreuen. „Ist das eine Akademie der Träume oder eine Akademie der Ausbeutung?“, lautete eine Schlagzeile.
Das ist eine wichtige Frage, die allerdings nur Teil einer größeren Geschichte ist – einer Geschichte, deren Hauptpersonen die Jungs sind, die Colomer von den staubigen Bolzplätzen ganz Afrikas pflückte und mit nach Katar nahm. Ihre Reise lüftet nicht nur den Schleier des Geheimnisvollen, das Football Dreams umgibt, sie vermittelt auch erhellende Einblicke in die weltumspannende Suche nach jungen Fußballtalenten und zeigt eine Seite des Spiels, die meist im Verborgenen bleibt. Für Millionen Kinder auf der ganzen Welt ist das Ziel, Fußball zum Beruf zu machen, der ultimative Traum. In die Schlagzeilen schaffen es nur die wenigen Spieler, die dieses Ziel erreichen, nicht die Millionen Gescheiterten. Die Zuschauer machen sich selten bewusst, wie verschwindend klein die Chancen für einen Jungen sind, ein ganz Großer zu werden, selbst wenn er, wie Bernard, alle Anlagen hat, oder wie schwer es für einen Scout ist, die richtigen Kids auszusuchen, selbst wenn er, wie Colomer, genau weiß, wonach er sucht. Wissenschaft und Technologie können dabei eine Hilfe sein, aber auch nur begrenzt. Nigerianische Kämpfer sind in der Regel keine.
Bernard zog sich noch schnell seine besten Fußballklamotten über. Er war Nike-Fan und überzeugt, Nike würde sein Sponsor werden, wenn er eines Tages groß herauskäme. Als er aus der Tür trat, sah er aus wie in der Nike-Werbung – allerdings wäre das Unternehmen darüber nicht begeistert gewesen, denn es handelte sich durchweg um billige Schwarzmarktimitate. Etwas anderes konnte sich Bernard nicht leisten. Er hüllte seine biegsame 1,50-Meter-Gestalt in so viel Nike wie irgend möglich. An jenem Tag trug er ein weißes Nike-T-Shirt, schwarze Shorts, weiße Socken und seine schwarz-weißen Nike-Stollenschuhe. Er machte sich auf den Weg in Richtung Star Park. Dort sollte auf dem öffentlichen Fußballplatz das Tryout für Football Dreams stattfinden.
Der Park lag am Ende einer roten Schotterpiste, die von einer der Hauptverkehrsadern von Teshie abzweigte. Auf der Straße herrschte reges Treiben. Händler saßen vor kleinen Holzbuden und boten alles Mögliche feil: Dörrfisch in rauen Mengen, riesige braune Yamswurzeln, Berge von grünen Mangos. Frauen balancierten Plastikwäschekörbe voller Erdnüsse und getrockneter Kochbananenchips auf ihren Köpfen. Als Bernard von der Hauptstraße abbog und sich dem Park näherte, ebbte der Trubel ab. Er betete und bat Gott um seinen Beistand bei dem Probetraining, das im ghanaischen Jargon „Justify“ heißt. Der Ausdruck liefert die Erklärung für einen von Bernards Lieblingsbibelversen, in dem das Wort „justified“ eine Rolle spielt. Römer 10,10: „For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.“ (Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.)
An religiösen Inspirationsquellen mangelte es Bernard auf seinem Weg zum Star Park nicht. In der kurzen Straße kam er nacheinander an God’s Time Beauty Salon, am God Is Good Beauty Salon und am God Is Grace Beauty Salon vorbei. Die meisten Geschäfte in Ghana führen einen christlichen Bezug im Namen – ein Zeichen für den hohen Stellenwert der Religion im Land. In derselben Straße gibt es auch eine Lokalität namens Girls Girls Pub. Auf dem Schild sind eine Frau in hautengen Jeans und High Heels und daneben eine Reihe Schnapsflaschen zu sehen. Was wäre alle Tugend ohne ein Quentchen Laster?
Von den Scouts war weit und breit nichts zu sehen, als Bernard am Star Park ankam. Der Name „Star Park“ war glanzvoller als die Wirklichkeit. Der „Park“ war einfach nur eine leere Schotterfläche mit jeweils einem Tor an jeder Schmalseite. An den Pfosten kam unter dem fast überall abgeblätterten weißen Lack das nackte Metall zum Vorschein. Für die Spielfeldmarkierungen auf den Boden behalfen sich die Spieler mit zerstoßener Kohle, wie sie zum Befeuern der Kochherde verwendet wurde. Die schwarzen Linien verliefen nicht besonders gerade, sondern schlängelten sich um und über den Platz.
Ein erstes Football-Dreams-Probetraining hatte Bernard schon absolviert. Colomer ließ in ganz Afrika von Einheimischen eine erste Runde durchführen, um die Spieler so weit auszusieben, dass an jedem Spielort jeweils 176 übrig blieben. Er selbst tauchte zusammen mit anderen Scouts aus Europa erst ein paar Tage später zur zweiten Runde auf. Vor der ersten Tryout-Runde war Bernard so aufgeregt gewesen, dass er schon vor dem Morgengrauen vor Ort war – Stunden bevor es losging. Wie viele andere Spieler war er sich allerdings nicht sicher, ob Football Dreams wirklich eine seriöse Chance war. Im afrikanischen Fußball wimmelt es von Leuten jeder Couleur, die das Blaue vom Himmel versprechen und gar nicht daran denken, ihre Versprechungen einzulösen. Entsprechend machte sich in Bernards Gemüt zunehmend Enttäuschung breit, als er dasaß und auf die Scouts wartete, die zu diesem zweiten Probetraining offenbar zu spät kamen. Irgendwann hatte er die Nase voll, verbuchte das Ganze als Schwindel und beschloss, nach Hause zu gehen.
Auf dem Heimweg traf er Oteng. Der forderte Bernard eindringlich auf, kehrtzumachen und wieder zum Star Park zu flitzen. Widerwillig drehte Bernard um und lenkte seine Schritte am lärmenden Händlergewusel vorbei und die rote Schotterpiste entlang in Richtung Park. Kaum angekommen, sah er einen Lastwagen mit der Aufschrift „Aspire Africa Football Dreams“ auf der Seite, dazu das Bild eines kleinen afrikanischen Jungen beim Kopfball und der Slogan „Your Dreams Come True“. Vielleicht war das Ganze ja doch eine lohnenswerte Angelegenheit.
Colomer stieg aus dem Lastwagen in die grelle Sonne Ghanas, und kurz darauf wurde das erste Testspiel angepfiffen. Die Organisatoren hatten im Schatten ein Zelt aufgebaut und Plastikstühle aufgestellt, damit die Zuschauer die Spiele bequem verfolgen konnten. Colomer wollte aber nicht sitzen. Er lief kreuz und quer über das Spielfeld, stellte sich manchmal genau in die Mitte und bewegte sich in langsamen Kreisen über das Feld, während um ihn herum die Partie ihren Lauf nahm. Der Schotterplatz war uneben und mit Steinen übersät, die den Ball unberechenbar ablenkten, aber die besten Spieler schafften es, ihn trotzdem unter Kontrolle zu bekommen, als hinge er an einer Angelschnur. Die Stollenschuhe hoben sich wie bunte Farbkleckse vom eintönigen Boden ab. Von den Zuschauerplätzen drangen Jubel und Entsetzensschreie hinüber – je nachdem, ob jemand einen eleganten Übersteiger hinlegte oder einen Schuss verzog. Bei jeder Aktion stiegen kleine rote Staubwölkchen auf – kurzlebige Spuren des Spielgeschehens, die der Wind im nächsten Moment verwehte.
Im Fußball gibt es zunehmend die Tendenz, sämtliche Aktionen auf dem Spielfeld per Videoanalyse zu erfassen und auszuwerten. Bei den Spielen, die Colomer in Afrika zu sehen bekam, war das ganz anders. Hier waren seine Augen die Aufzeichnungsgeräte und sein Gehirn der Prozessor. Bei einem so komplexen Spiel wie Fußball und einer so schwierigen Aufgabe wie der Suche nach dem nächsten Messi ist das eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, an der der Fortschritt in Wissenschaft und Technologie nicht spurlos vorübergeht. Beim Talentscouting werden längst nicht mehr nur Vorlagen, Torschüsse und Tore gezählt. Die neuesten Analysewerkzeuge liefern Informationen dazu, wie ein Spieler denkt. Das ist ein Quantensprung im Vergleich zum Stand der Technik noch vor wenigen Jahren. Aber als Colomer 2007 an der Seitenlinie im Star Park von Teshie stand, spielte die hochentwickelte Technik von heute für ihn keine Rolle.
Auch viele von Bernards Mannschaftskameraden vom Unique FC hatten sich zum Testspiel eingefunden. Mit ihnen zusammen lief er jetzt auf. Er war kleiner als viele seiner Mitspieler, konnte also kaum mit physischer Präsenz punkten. Mit rund 1,50 Meter war er ungefähr so groß wie Messi, als der im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal bei Barcelona auftauchte. Und wie Messi wirkte Bernard in seinem schwarz-weißen Nike-Outfit vermutlich regelrecht zart, aber er strotzte vor Selbstvertrauen. Er wusste, dass er talentiert genug war, um Colomer zu beeindrucken und es in die Finalrunde der Tryouts in Ghana zu schaffen. Außerdem war er sich sicher, dass er auf den Beistand eines mächtigen Freundes zählen konnte. „Ich wusste, dass ich es bei der Ausscheidung mindestens unter die letzten 50 schaffen würde, weil ich Gott immer bat, mir zu helfen“, bekennt Bernard.
Vielleicht hatte Gott sich an dem Tag freigenommen. Jedenfalls wählte Colomer Bernard nicht aus. Er wählte überhaupt niemanden aus. Nach dem 20-Minuten-Spiel schlichen alle deprimiert vom Feld. „Der Scout teilte uns mit, dass ihm niemand besonders aufgefallen sei“, sagt einer von Bernards Teamkollegen, Shadrack Ankamah. Enttäuscht und verwirrt verabschiedete Bernard sich von seinen Freunden und machte sich auf den Weg nach Hause. Shadrack und die anderen versuchten, ihn zum Bleiben zu bewegen – ohne Erfolg. Bernard zog seine Stollenschuhe und seine Nike-Klamotten aus und begab sich Richtung Ausgang. Zum zweiten Mal an diesem Tag verließ er den Star Park, ohne dass Colomer ihn auch nur eines Blickes würdigte.
In diesem Moment rief jemand seinen Namen. Er drehte sich um und sah, dass es Eugene Komey war, der einheimische Coach, der das Testspiel für Aspire in Teshie auf die Beine gestellt hatte. „Ich rief ihn zurück, weil ich wollte, dass er noch einmal spielt“, erzählt Komey. Er wusste, wie gut Bernard war, und fand, dass seine Talente im ersten Spiel nicht deutlich geworden waren. Vielleicht hatte er zu wenig Ballkontakt gehabt. Vielleicht hatten seine Mannschaftskameraden ihn nicht angespielt. Vielleicht hatte er einfach Pech gehabt. Manchmal braucht man beim Fußball neben dem Können eben auch Glück. Komey ließ Bernard für einen zweiten Anlauf in seinem Team, dem Dragon FC, mitspielen.
Der Zufall wollte es, dass der Dragon FC gegen Bernards angestammte Mannschaft Unique antrat. Auch Bernards Mannschaftskameraden hatten die Organisatoren erfolgreich um eine zweite Chance gebeten, aber Komey war sich sicher, dass der beste Spieler jetzt in seinem Team war. Die Spieler des Dragon FC sahen das genauso. „Sie wussten genau, dass er ein hervorragender Spieler war. Deshalb spielten sie ihn ständig an“, erzählt Shadrack. „Zugleich kannte er alle unsere Schwächen.“ Bernard spielte seine vertrauten Teamkollegen schwindelig. Die Art, wie er den Ball auf seinem linken Fuß balancierte oder die Gegner umtanzte, sah der Spielkunst eines kleinen Argentiniers, der zum Fußballgiganten wurde, verblüffend ähnlich.
Messi war damals noch nicht so berühmt wie heute. 2007 belegte er beim Ballon d’Or Platz 3 und bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres Platz 2. Er war erst 20 Jahre alt, und seine Zeit als prägende Figur im Fußballsport lag noch vor ihm. Als er berühmter wurde, fingen viele an, Ähnlichkeiten zwischen Bernard und Messi zu sehen. Doch im Star Park befand sich jemand, der mit Messis Können und seiner Spielweise bestens vertraut war. Dieser Jemand stand mitten auf dem Spielfeld mit einem Notizbuch in der Hand.
Komey ist überzeugt, dass er genau bemerkte, in welchem Moment Colomer Bernards besondere Begabung erkannte. Der flinke Mittelfeldmann bekam den Ball auf der rechten Seite ungefähr auf Höhe der Mittellinie. Dann sprintete er mit dem Ball am linken Fuß nach innen, wie Messi es schon so oft getan hatte. Ein Verteidiger wollte sich ihm entgegenstellen, als er sich der Spielfeldmitte näherte. Bernard täuschte ihn mit einem blitzschnellen Übersteiger und rief einen Mannschaftskameraden auf dem linken Flügel an, der sofort die Aufmerksamkeit des Verteidigers auf sich zog. Der Verteidiger ließ sich aus dem Konzept bringen und konnte nicht verhindern, dass Bernard mit einem Blindpass einen Mitspieler auf dem rechten Flügel anspielte. Colomer kritzelte etwas in sein Notizbuch und besprach sich an der Seitenlinie mit einem seiner Assistenten.
Komey erzählte den Leuten in seinem Umfeld, er sei sich sicher, dass Bernard es unter die 50 besten Spieler in Ghana geschafft habe, die bei der nächsten Tryout-Runde in Accra dabei sein würden. Die Menschen glaubten ihm nicht. Das könne er nicht wissen, sagten sie. Außerdem war Bernard wirklich klein. Aber wer nur physische Merkmale wie Körpergröße oder Schnelligkeit im Blick hat, macht einen Fehler. Einen verzeihlichen Fehler allerdings. Einen Fehler, den Scouts auf der ganzen Welt permanent machen und durch den sie den Messi der Zukunft möglicherweise übersehen.
Jugendscouting war lange eine ziemlich subjektive Angelegenheit. Wenn es darum ging, herauszufinden, welche Kids das größte Potenzial haben, vertrauten Trainer und Talentsucher vor allem auf ihren Instinkt. In den letzten Jahren wird immer intensiver geforscht, ob es nicht eine bessere Alternative gibt. Wissenschaftler versuchen dahinterzukommen, welche Merkmale aussagekräftig sind, wenn es zu entscheiden gilt, ob ein junger Spieler das mitbringt, was man als Top-Fußballer braucht. Wie viel sollten Scouts auf Größe und Körperkraft geben? Wie wichtig sind Schnelligkeit und Beweglichkeit? Welchen Stellenwert haben Technik und Spielintelligenz? Hinter der Erforschung dieser Fragen steht der Wunsch, aus dem Jugendscouting, das bisher mehr eine Kunst ist, eine Wissenschaft zu machen.
In manchen Sportarten müssen Scouts nur wenige körperliche Parameter begutachten, um zu ermitteln, ob ein Athlet oder eine Athletin das Zeug hat, Weltklasse zu werden. Von diesen Sportdisziplinen heißt es oft, die Begabung sei eher angeboren als erworben, weil die Genetik überproportional großen Einfluss darauf hat, wer erfolgreich sein kann. Ein Beispiel ist der Rudersport. 2007 startete Großbritannien das Programm Sporting Giants, um groß gewachsene Männer und Frauen zu finden, die es im Rudern, Volleyball und Handball – alles Sportarten, in denen die Körpergröße erfolgsentscheidend ist – auf olympisches Niveau schaffen könnten. Die Männer mussten mindestens 1,90 Meter und die Frauen mindestens 1,80 Meter groß sein. Zudem mussten die Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 16 und 25 Jahren alt sein und eine gewisse Sporterfahrung mitbringen, allerdings nicht unbedingt in den gesuchten Sportarten. Eine Frau, die 2008 unter über 4000 Bewerberinnen das Rennen machte, war die 22-jährige Sportlehrerin Helen Glover, die noch nie in ihrem Leben gerudert war. Sie war ein bisschen kleiner als verlangt, stellte sich aber beim Messen auf die Zehenspitzen, um weiterzukommen. Vier Jahre später gewann sie bei den Olympischen Spielen 2012 eine Goldmedaille und wiederholte dieses Meisterstück 2016. Darüber hinaus gewann sie eine ganze Reihe anderer internationaler Wettkämpfe und stieg zur Weltranglistenersten auf.
Einen ähnlichen Coup landete Australien in der Wintersportart Skeleton, die nichts für zarte Gemüter ist. Ein Skeleton-Lauf beginnt damit, dass der Athlet mit einer Hand oder beiden Händen am Rennschlitten übers Eis rennt. Dann wirft er sich bäuchlings auf den Schlitten und rast mit dem Kopf voran mit mehr als 110 km/h durch den Eiskanal. Als den Funktionären des Australian Institute of Sport zu Ohren kam, dass der Anlaufsprint für rund 50 Prozent der Schwankungen bei der Gesamtzeit verantwortlich ist, starteten sie 2004 eine landesweite Suche nach neuen Athletinnen. Die wichtigste Prüfungskomponente war ein 30-Meter-Testsprint, wie David Epstein in seinem Buch The Sports Gene berichtet. Die teilnehmenden Frauen hatten die Sportart nie ausprobiert, legten aber schon nach drei Testfahrten die schnellsten Anläufe in der australischen Skeleton-Geschichte hin. Eine Frau ließ nur zehn Wochen nachdem sie zum ersten Mal einen Fuß aufs Eis gesetzt hatte, bei der U23-Skeleton-WM das halbe Teilnehmerinnenfeld hinter sich. Im nächsten Anlauf holte sie den Titel. Eine andere Sportlerin qualifizierte sich sogar für die Olympischen Winterspiele 2006.





























