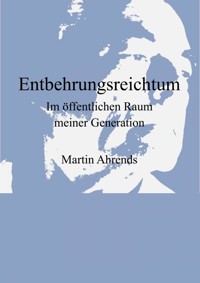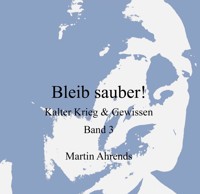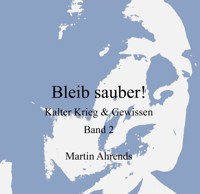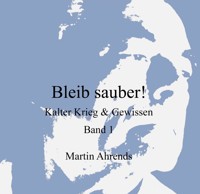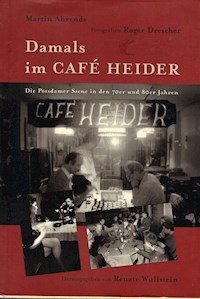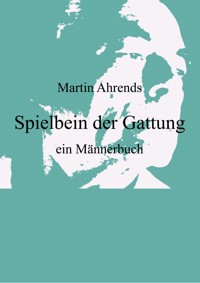
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Mann zu sein, ist nicht erst mit der Frauenbewegung fragwürdig geworden: Würdig, befragt zu werden. Wir Männer hatten in meiner Generation besonders viel zu lernen Auf allen Gebieten des Lebens haben sich unsere sozialen Rollen gewandelt und unser Innenleben mit ihnen - hinein ins Unerprobte. Ins Komische, manchmal Lächerliche. Innerfamiliäres Neuland wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger bewusst betreten, bestolpert, fluchtartig verlassen. Eine stille Revolution findet statt, unzählige Versuche, in den eigenen vier Wänden alles anders zu machen als die Vorfahren. Das Familienleben neu zu erfinden. Krampfhaft oder spielerisch. Als Spielbein der Gattung Mensch sehe ich Männer, die sich aufs Spiel setzen in ihren Erprobungen, Eroberungen, Kriegen, in ihren Abenteuern und Experimenten, in ihrem Selbstopfer für eine Religion, für König und Vaterland, für eine Familie, in ihrer ganzen riskanten Existenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 996
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Ahrends
Spielbein der Gattung
ein Männerbuch
Ich danke dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg für die freundliche Unterstützung.
Vorwort
Kürzlich saß ich vor einem ruhigen Café, hatte einen Wein und ein Buch vor mir, fünf Männer näherten sich, wetteifernd um die Wortführerschaft, blieben dicht neben mir stehen und debattierten laut über irgendwas. In mir wuchs helle Wut über die Rücksichtlosigkeit einer Gruppe, deren Einzelne nicht so aussahen, als würden sie sich so auffällig verhalten ohne die Gruppe. Wenn Männer im Kollektiv so unter ihr Niveau gehen, will ich sie an sich selbst erinnern als für sich verantwortliche Individuen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Jedenfalls hab ich mein Glas etwas lauter aufgesetzt, hab mich energisch erhoben und in die plötzliche Stille hinein gesagt: „Merkwürdig, wie das Verhalten in der Öffentlichkeit sich wandelt, wenn man in einer Gruppe ist.“ Sie haben mich sofort richtig verstanden und haben sich, etwas Abfälliges murmelnd, entfernt. So eine Art von Wut steigt gelegentlich in mir auf, kann dann nicht anders, als stammelnd herauszuplatzen. Hernach bin ich mir peinlich. Und bin mit meiner Herausplatzerei allein geblieben.
Viele Männer hab ich als einem Verbund Angehörige und Stellvertreter ihrer selbst kennengelernt. In Uniformen, in Vereinen, Versammlungen. Stellvertreter, denen ich nicht persönlich begegnen konnte, obschon ich ihnen gegenübersaß, weil sie nicht für sich mit mir sprachen, sondern als Repräsentanten oder Diener ihrer Institution, ihrer Partei, ihres Glaubens. Diese Sorte von Männern ist mir immer fremd geblieben, ich konnte mich kaum ansatzweise in sie hineinversetzen. Aber sie sind wohl die deutliche Mehrheit. Tretballtrainer sind medial allgegenwärtig und reden immer so ein Zeugs. Ich bin heilfroh, dass wir Autoren nicht im Fernsehen fußballern müssen.
Ein Mann zu sein ist nicht erst mit der Frauenbewegung fragwürdig geworden: Würdig, befragt zu werden. Ich bin in Berlin geboren, hab in Potsdam mein Abitur abgelegt, aufgewachsen bin ich in den Nachhall eines preußischen Militarismus, der sich schon nach dem Ersten, erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg zur Fratze seiner selbst entstellt hatte, von etwas vermeintlich Ehrenhaftem in etwas Verbrecherisches verwandelt. Aufgewachsen mit Männerbildern, die von Verneinung eher als von Bejahung, also eher von dem geprägt waren, was wir künftighin nicht mehr sein durften als von etwas überliefert Positivem, das sich von selbst verstand. Geblieben waren in meinem bürgerlichen Elternhaus Relikte von Anstand und Höflichkeit, Ritterlichkeit den Frauen gegenüber, die mein Vater mit einem ironischen Augenzwinkern zelebrierte, denn eigentlich hatte er keinen Respekt vor Frauen. Geblieben war auch die Rolle des Hauspaschas, die er mir mit leicht ironischer Selbstverständlichkeit vorlebte. Bis ins hohe Alter hatte mein Vater zu lernen, dass sich auch in dieser Beziehung nichts mehr von selbst versteht, was einmal als typisch männlich galt.
In den Familien meiner Eltern gab es keine Militärs, doch auch ihre zivile Bürgerlichkeit blieb nicht unberührt von den deutschen Zusammenbrüchen in und nach zwei Weltkriegen, die ausschließlich von Männern ins Werk gesetzt worden waren. Über meine Vorfahren, Berliner Ärzte und westfälische Fabrikanten, erfuhr ich wenig und nichts, was so etwas wie Stolz hätte evozieren können, es war, als gäbe es da einen Zeitenbruch, und was dahinter lag, taugte nicht, um daran anzuknüpfen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Latte dieser Vorbilder läge zu hoch für ein Nachkriegskind wie mich. „Das waren doch ganz andere Zeiten“, sagten meine Eltern und sahen mich mitleidig an, ein Kind, das nach dem großen Verlorenhaben und Schuldigwerden ihres, meines Volkes geboren war.
Auch in den Geschlechterrollen gab es wenig Sicheres an mich zu überliefern, keine zweifelsfreien Gewissheiten, unumstößlichen Prinzipien, schon gar keinen Stolz, alles war im stillen Übergang in etwas, das niemand von uns kennen konnte.
Im östlichen wie westlichen Nachkriegsdeutschland gab es durchaus Angebote, dem Mangel an Gewissheiten, auch an Stolz abzuhelfen, da gab es ein politisches und ein wirtschaftliches Wunderland, und wer daran glauben konnte, dem war wohl geholfen. Was meine Eltern waren und wollten, bezogen sie aus den Künsten, die galten ihnen unbeschädigt, die konnten sie immer noch ernst nehmen, hier waren die Quellen ihrer Selbstvergewisserung. Und sowohl in unserem Bücherregal als auch im Plattenschrank gaben Männer den Ton an. Von Mendelssohn bis Schostakowitsch, von Charles Dickens bis Arnold Zweig. Ich kann mich an keine Künstlerin erinnern, die in meinem Elternhaus eine Rolle gespielt hätte. Dieses Haus stand in Kleinmachnow, Christa Wolf und Maxi Wander wohnten nicht weit von uns, als Heranwachsender hab ich nie von ihnen gehört.
Männer, die die Mauer zu bewachen hatten, zogen an unserem Haus vorüber. In Uniform, im Gleichschritt, aber sie wirkten nicht mehr so schicksalsschwer, so bitterernst wie ihre Väter und Großväter in der Wehrmacht. „Hätte nie gedacht, dass ich über eine Marschkolonne auch lächeln kann“, sagte meine Mutter. „Das sind doch Schlappschwänze“, sagte mein Vater. Ich verstand so ungefähr, was sie meinten, und fragte mich: Was für eine Art von Mann soll aus mir werden?
Als ich auf den umwaldeten Nebenstraßen unserer Vorstadtsiedlung beobachtend, teilnehmend zu den Gleichaltrigen dazugehören durfte, ohne ganz dazuzugehören, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich als Erwachsener einmal in die Nöte, Zwänge und Abhängigkeiten gerate, die wohl nicht nur zufällig zu meinem Mannsein gehören.
Wir Männer hatten in meiner Generation besonders viel zu lernen. Auf allen Gebieten des Lebens haben sich unsere sozialen Rollen gewandelt und unser Innenleben mit ihnen – hinein ins Unerprobte. Ins Komische, manchmal Lächerliche. Innerfamiliäres Neuland wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger bewusst betreten, bestolpert, fluchtartig verlassen. Eine stille Revolution findet statt, unzählige Versuche, in den eigenen vier Wänden „alles anders“ zu machen als die Vorfahren. Das Familienleben neu zu erfinden. Krampfhaft oder spielerisch.
Als Spielbein der Gattung Mensch sehe ich Männer, die sich aufs Spiel setzen in ihren Erprobungen, Eroberungen, Kriegen, in ihren Abenteuern und Experimenten, in ihrem Selbstopfer für eine Religion, für König und Vaterland, für eine Familie, in ihrer ganzen riskanten Existenz. Als den Versuch der Gattung, Neues zu wagen, Scheitern ist da ganz natürlich eingeschlossen. Männer dürfen scheitern. In den Dreck fallen. Sie dürfen nur nicht liegenbleiben. Sie sind der Wurf ins Unvorhersehbare, sind das Wagnis, das in Unbekanntes ausragende Tentakel ihrer Gattung. Sie sind das mutierende, Frauen das selektierende Element der Entwicklung. Werden Männer nicht erwählt, hat sich ihr ganzes Dasein nicht gelohnt. Wenn sie Glück haben, finden sie dann Ersatz in hohen Damen wie der Philosophie, Kunst, Wissenschaft und Religion. Wenn sie Pech haben, sind ihnen die Haubitze, die Handgranate, die Muskete und die Bombe als Dirnen zu Diensten.
An unserem Punkt der Entwicklung gefährden wir Männer, wenn wir nicht auf uns aufpassen, die Menschheit eher, als dass wir ihr dienlich sind, denn wir setzen nicht nur uns als Exemplar und experimentellen Wurf aufs Spiel, die Gattung setzt sich in uns aufs Spiel.
In diesem Buch versuche ich, nicht nur mein eigenes Mannsein in den Blick zu bekommen durch verschiedene Okulare, als da sind: Der Mann als Aufmucker, Autofahrer, Bruder, Bürger, Co-alkoholiker, Draufgeher, Dulder, Ernährer, Faustus, Hagestolz, Hahnrei, Handwerker, Hausmann, Held, Küchenbulle, Mann in Not, Muttersohn, Ostmann, Pantoffelheld, Quartiermeister, Rekrut der Gattung, Rivale, Scheiterer, Unhold & König, Vater, Wallach, Wassermann… Es ist ein Buch, darin ein Mann über sich lacht. Und versucht, sich lachend ernst zu nehmen. Um rückblickend so etwas wie Respekt zu gewinnen vorm eigenen Lebensweg.
Werder im Februar 2025
Der Mann als Muttersohn
Über meine Mutter gibt es viel zu sagen, aber wenig, was ich über sie sagen kann. Hab ihre Beerdigung organisiert, die Totenrede gehalten ohne zu weinen. Ein Text für die Anderen, die sie kannten, mir sollte er nicht zu nahe gehen, er ist hier entbehrlich. Mit dem Lied „Zieh aus, mein Herz und suche Freud“ sind wir bei strahlendem Sonnenschein aus der Kleinmachnower Kapelle zum anonymen Aschefeld gezogen. Ich war froh, dass sie es hinter sich hatte. Zuletzt hat sie doch gelitten am kranken Herzen, wenn sie draußen unterwegs war. Hab sie ein paar Tage zuvor noch an eine ihrer „Stellen“ gefahren, wo sie auf kargen, trockenen Böden nach den Steinen und der Primärvegetation sah, nun nicht mehr, um derlei zu sammeln oder zu fotografieren, eher, um sich zu vergewissern, dass sie alle noch da sind, ihre Kameraden, ihre Augenfreuden. Als sie dann eines Tages nicht öffnete, bin ich um das Haus gegangen, hab in ihr Parterre-Fenster gesehen, da saß sie an ihrem Schreibtisch, die Augen geschlossen, leicht zur Seite geneigt. Sie war nicht mehr da, das sah ich gleich. Ich konnte nicht traurig sein über so einen guten Tod.
War ich ein Muttersöhnchen? Ihre Nöte mit meinem Vater waren unübersehbar, er wollte ihren Erstgeborenen nicht im Haus haben, nicht nur darunter hat sie gelitten. Als Kind hab ich mich um sie gesorgt, hab ihren Klagen zugehört, wollte ihr beistehen. Als ich 15 war, hat sie sich scheiden lassen, ist mit dem Malermeister, mit dem sie sich nur im Scheidungsjahr traf, zu einer anderen Frau geworden, ich war aus meiner Rolle (welcher Rolle?) entlassen.
Die Vorleserin geht über Bord
Meine Mutter hat mir viel vorgelesen. Immer bat ich: Lies weiter, Mutter, und sie las, bis ihr die Augen zufielen, spannende Gruselgeschichten von Poe, E.T.A. Hoffmann, Storm, aber es war nicht der Grusel, es war das Heiligtum Literatur, das uns hielt, das wir nicht verlassen wollten. Wenn meine Mutter so vorlas, waren wir nicht mehr zu zweit, es war eine größere Gemeinschaft, an der wir teilhatten. Es gab seltene Tage, an denen sie abgelenkt war, beim Lesen an etwas anderes dachte, las, um meiner Bildung nichts schuldig zu bleiben. Da hörte ich aus Höflichkeit zu und gab mich zufrieden, wenn sie das Buch zuschlug. Da lag es dann auf dem Tisch und hatte nichts vermocht, dasselbe Buch, das uns in dieses Heiligtum versetzen konnte, wenn meine Mutter sich mir ganz und gar mitteilte beim Vorlesen.
Beim Vorlesen kann man mitteilen, was ohne fremden Text kaum sagbar wäre. Meine Mutter hat mir beim Vorlesen viel von sich erzählt, auch, wie lieb sie mich hat. An Umarmungen kann ich mich nicht erinnern, damit hatte sie es schwer. Wenn sie mir vorlas, konnte sie sich zeigen: Kind geblieben, mit einem Zug ins Dämonische. Sie ließ sich gern von den Sprachwellen tragen, spielte damit und konnte ganz unvermittelt über Bord gehen, jäh abtauchen in das Halblicht darunter. Mit einem kleinen Wechsel der Tonlage ins irisierende Lichtspiel dunkler Ahnungen. Diese Doppelbödigkeit hatte jeder vorgelesene Satz. So indirekt konnte sie auch von sich erzählen, von ihren Kriegs- und Nachkriegserlebnissen. Ich hörte ihr zu und bekam nie genug, hab sie als Magierin vergöttert.Einmal saßen wir im Garten und sie hat mir mit ihren Fragen den Schulaufsatz beflügelt; näher bin ich nie einem Menschen gewesen.
Der Mann als Vatersohn
In den beiden kleinen Romanen „Der märkische Radfahrer“ / “Mann mit Grübchen“, (hier zitiert in der neueren Fassung „Halbschlaf“) und in der Erzählung „Draußen“ ist viel über den Vatersohn gesagt, was hier nur in Auszügen aufgenommen ist. Auch „Trost“ im Kapitel „Held“ und das Kapitel „Bürger“ erzählen vom Vatersohn.
Die gesprungene Kapsel
Wir waren uns nur noch selten begegnet und hatten uns wohl beide mit der Fremdheit abgefunden, die zwischen uns gekommen war. Bis ich von seinem Unfall hörte. Auch zu meiner ersten Visite ging ich nicht aus Neigung, sondern aus Pflichtgefühl. Man hatte mich gewarnt, ich würde ihn ganz verändert finden. Ich hatte mich gewappnet mit einer spöttischen Distanz, als ich ihn nach seinem Sturz zum ersten Mal besuchte an diesem Ende der Welt. Im ehemaligen Jagdschloss des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke. Irgendwie passte das für mich zusammen: Vaters Karriere als Genosse Künstler, wie er sich von der Staatspartei fördern und gängeln ließ – und dieses patjomkinsche Dorf Wolletz in der Uckermark, das auch die Bewohner dereinst nur mit einer Sondergenehmigung betreten durften. Da ist er ja am rechten Ort, dachte ich höhnisch, bei seinen alten Genossen zu Gast, nur leider sind sie inzwischen in die ewigen Jagdgründe eingegangen und können ihm nicht mehr helfen. Das Dorf liegt am Rande eines jener tiefklaren Eiszeitseen, die diese waldreiche Gegend prägen, die Landschaft ist märchenhaft schön. Auf meinem Fußweg am See entlang und hinauf zur neuen Reha-Klinik, die man an die einstige Jagdresidenz angeschlossen hat, empfinde ich wieder den alten Neid: Wie gut es ihm immer ging, wie gut es ihm auch heute noch geht, weil er bis zuletzt zur Fahne gehalten hat und erst aus der Partei ausgetreten ist, als ihm das keine Vorteile mehr brachte... Ich versuche mich zu fassen, mich auf etwas vorzubereiten, das ich noch nicht erlebt habe: Darauf, meinen Vater zu finden als einen Fremden, ihn also nicht mehr zu finden. Sondern nur noch einen Teil von ihm oder jemand anderen, ein Zerrbild, ich weiß es nicht.
Ich finde ihn beim Mittagessen. Da sitzt er in seinem vornehmen schwarzen Mantel, abgemagert und schärfer gezeichnet das alte Gesicht, er erkennt mich, nennt mich beim Vornamen meines Bruders, ich setze mich, versuche zu lächeln, er versucht es auch, und von nun an lassen wir das Grimassenschneiden. Er versucht die Gesten, die immer zu unseren Begegnungen gehörten, diese großen fahrlässig unbestimmten Gesten bürgerlicher Weltläufigkeit, mit der Rechten den Speiseraum ermessend, als wäre es der Weltenraum und gehörte ihm allein. Auf eine solche Geste folgte immer eine sehr subjektive Schilderung der allgemeinen und besonderen Lage. Aber er sagt nichts. Nur die Gesten folgen, eine nach der anderen: der erhobene Zeigefinger, hinter den er sich duckte, um eine absolut unwiderlegliche Erkenntnis zu verkünden, dann der Ring aus Daumen und Zeigefinger, den er in den Raum stößt. – Das Kennzeichen besonderer Leistung oder Qualität, eine Anerkennung, die er in erhabener Haltung vergibt. Aber an wen? Er sagt kein Wort, von den Interjektionen abgesehen, die ihm offenbar Mühe genug bereiten, dem Ach und Och, die er sich abpresst, als wären sie der Eingang zu langer, erlösender Rede. Die Gesten sind noch die alten, auch wenn sie etwas grob und fahrig geworden sind, doch sie bleiben leer, sie meinen nur noch sich selbst. Ich sehe ihn interessiert an, ich nicke, als verstünde ich, was er meint. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm damit helfe, ob ich ihn auch nur erreiche. Nach wenigen Minuten sinke ich schweißnass auf meinen Sitz zurück: Unternehmen Kommunikation misslungen. Wir sehen uns an. Ich sehe seine Augen, die mal höhnisch, mal traurig waren, mal kindlich vergnügt. Jetzt sind sie leer. Wo ist mein Vater geblieben, frage ich mich. Und wer sitzt mir da gegenüber? Ich bin dankbar, als das Essen aufgetragen wird. Nun hat er zu tun. Wie ein ausgehungertes Kind, stößt er gleich mit der Gabel auf die Kartoffeln, den Blumenkohl, das Fleisch ein, führt riesige Bissen zum Mund, die da nicht unterzubringen sind. Ehe ich zugreifen kann, ist der Mantel bekleckert, was den alten Mann mir gegenüber nicht hindert, weiter gierig und unter Zuhilfenahme der Hände sich einzuverleiben, was der Teller bietet. Ich sitze beschämt und verwirrt vor dem geblümten Wachstuch des Speisesaales einer neurologischen Rehabilitationsklinik, um mich herum die anderen Verwirrten und ihre beschämten Angehörigen, mir gegenüber mein alter Vater, der sich offenbar nicht im Griff hat. Was soll ich tun, was soll ich sagen, wie viel versteht er? „Vater“, sage ich und sehe ihn fragend an. Auch er sieht mich fragend an. Sieht er mich an? Oder durch mich hindurch?
Nun versucht er, mit dem Löffel das Fleisch kleinzukriegen. Gibt es auf mit einem Ausdruck tiefsten Bedauerns. Jetzt sucht er vergeblich, mit der Gabel den Blumenkohlstrunk zu zerlegen, spießt ihn zuletzt auf und will ihn abknabbern. Ich kann das nicht ansehen, bitte ihn, behilflich sein zu dürfen, er nickt, und ich schneide ihm mundgerechte Bissen. Worüber er keineswegs verstimmt ist. Es tut seiner Würde offenbar keinen Abbruch, wenn ich ihn so behandle, wie es mir mein plötzlich erwachter Vaterinstinkt eingibt: nämlich wie eines meiner Kinder. Eines der kleineren, die noch nicht richtig essen können. Ich frage die Schwester, ob ich ein Lätzchen haben könne, sie gibt es mir mit dem Bemerken, dass er in diesen Dingen sehr eigensinnig sei und macht ein heikles Gesicht. Ich trete hinter meinen Vater und lege ihm das Lätzchen um. Und staune noch, was ich da tue. Und welch seltsames Vergnügen es mir bereitet. Er beugt den Kopf vor wie ein braves Kind. Er sperrt sich nicht, offenbar vertraut er mir. Zum ersten Mal sehe ich diesen verletzlichen Nacken, den nur Liebende zu sehen bekommen. Oder Scharfrichter.
Ich bin sehr erleichtert, dass sich aus der anfänglichen Hilflosigkeit doch eine Möglichkeit eröffnet hat, miteinander umzugehen. Eine zwischen Vater und Sohn nicht ganz abwegige Möglichkeit des Umgangs. Nur die Rollen sind vertauscht. Als das Dessert überstanden, der Mantel, der Mund und die Hände gereinigt sind, lehne ich mich wieder zurück, wobei mein Jackenärmel die Armbanduhr freigibt. Er sieht sie, starrt lange darauf, ich sage ihm die Zeit an. Dann bewegt er die Lippen, formt einen Zischlaut, ein langes „Sch“, dem ein „ö“ folgt. Er zieht die Stirn hoch, gibt sich redlich Mühe: „Schöne Uhr“, bringt er schließlich hervor und nickt anerkennend. Oh Wunder: Er hat gesprochen und ich habe es verstanden! „Du kannst sie haben“, sage ich und nehme sie ab, „bitte, ich schenke sie dir.“ Er nimmt sie und freut sich wie ein Konfirmand. Streichelt seine Schädelnarbe, streichelt seine neue Uhr, mein armer Vater, nein, keine Karikatur. Ein trauriges Kind schon eher.
Nun machen wir einen Gang zum Kaffeeautomaten, es ist mühsam für uns beide, weil ich noch nicht gelernt habe, ihn zu führen, weil ich mich noch nicht getraue, ihn einfach fest bei der Hand zu nehmen. Soweit ich mich erinnere, haben wir das nie getan: Uns so bei der Hand nehmen. Das wäre viel zu viel Nähe gewesen, schrecklich peinliche Nähe. Doch irgendwann auf diesem langen Flur zwischen Physiotherapie und Cafeteria wird es mir zu bunt mit dem untergehakten Gewackel, ich nehme einfach seine Hand. Die Linke, die fürs Griffbrett, die er immer so gehütet hat. Darin steckten all die tausend Übestunden, seine verübte Kindheit. Nie hat er mir diese Hand gegeben. Aber jetzt kann ich sie einfach nehmen. Und siehe da, er gewinnt sofort Sicherheit, und mehr, er drückt meine Hand, als gefiele es ihm so viel besser, er wendet den Kopf, und jetzt lächelt er wirklich. Mit seinen geübten Fingern tastet er meine Hand ab, spielt seine Musik hinein in meine rechte Hand, nie vorher hat jemand so meine Hand gehalten.
Was ist das für ein Gefühl, das ich jetzt so genieße, wenn ich ihn in der Vorhalle behutsam in einen Ledersessel platziere, wenn ich ihm einen Kaffee und eine Zeitung besorge und am Tresen seine Post für ihn hole – was ist das für eine seltsame Mischung aus Hilfsbereitschaft und Machtgelüste. Ich gebe mir darüber keine Rechenschaft, aber ich wundere mich doch, wie gut es tut, meinen alten Herren wie ein kleines Kind zu behandeln. Ihm also nicht behilflich zu sein aus der gewohnten respektvollen Entfernung, sondern ihm wirklich zu nahe zu treten. Ihm seinen Kaffee umzurühren, ihm beim Aufnehmen und Abstellen des Bechers zu helfen, beim Zusammenlegen der Zeitung, beim Öffnen der Briefe, ihm vorzulesen, was seine Jugendliebe Rosemarie ihm aus dem fernen Amerika schreibt. Die beiden hatten sich über 50 Jahre aus den Augen verloren und erst kürzlich wiedergefunden. „Ich liebe dich und werde dich ewig lieben“, lese ich von der Karte ab. Nun verzieht er das Gesicht, wie ich es nie bei ihm gesehen hab, nun weint er wie nur ein Kind weinen kann, schluchzt hemmungslos in den Klangdunst der vornehmen Eingangshalle, lässt sich von mir, der ich vor ihm knie, umarmen und trösten. Dann erzählt er mir von Rosemarie, von der Jugendzeit und davon, wie schön es jetzt wäre, eine Zigarette zu rauchen. Erzählen ist zu viel gesagt, es sind flüchtige Bilder, die vorüberziehen, als ich ihm Rosemaries Liebeserklärung vorgelesen habe. Sein lädiertes Hirn produziert poetische Kurzschlüsse. Er reiht kaum verständliche Sprachbrocken und schwärmt mit großen Gesten von einer heute Siebzigjährigen, von ihrem unermesslichen Reichtum und ihrer Villa an der Küste, er ist ganz sicher, dass er sein viertes Leben mit ihr in Baltimore beginnen wird, sobald man ihn aus diesem Gefängnis entlässt. Nun will er wissen, wann es so weit ist, wann er endlich raus kann zu seinem Auto, das er irrtümlich vor der gesicherten Tür auf dem Parkplatz wähnt. Blickt auf, hebt die Hand und malt einen weichen Bogen in die Luft, das „C“ der „Chesterfield“, einer Nachkriegs-Zigarettenschachtel, die er nahe seiner Jugenderinnerung gefunden haben muss, etwas samtweich Wärmendes. Seine Hand hebt sich wie langsam aufsteigender Rauch. Seine eleganten, kräftigen Geigerhände dirigieren wage herum und beschwören andere Zeiten. Ich kenne diese Zeiten nur vom Hörensagen, eigentlich nur von diesen Gesten her, von seiner Großheit, mit der er faszinieren konnte und einschüchtern, und die nun komisch übersteht. Die waren aus anderem Holz, die Männer seiner Generation. Er war mir immer fremd.
Darf er denn rauchen? Warum nicht, entscheide ich für ihn und ziehe eine Schachtel aus dem Automaten. Als ich wiederkomme, hat er sich in den „Spiegel“ versenkt, als lese er. Aber er liest nicht, und als er mich bemerkt, zeigt er mir ein ganzseitiges in Öl gemaltes Portrait von Adolf Hitler auf dem Titelblatt, dann diverse Hitler-Fotos auf den Innenseiten, zeigt sie mir, als müsste ich verstehen, was sie ihm bedeuten. Er sieht mich an. Ich sehe ihn an. „Das war ein Kerl“, sagt er schließlich und setzt jedes Wort so behutsam, wie er seine Schritte setzt, „das war ein richtiger Kerl“. Mein alter Vater bläst die Backen auf, macht eine Faust und stößt sie in die Luft. Ich sehe mich erschrocken um: Wie gut, dass ihm nicht der Hitlergruß eingefallen ist.
Aus seinen Kindertagen hat sich offenbar etwas in ihm erhalten, das sich lang verbergen musste - und konnte. Nun kommt es herausgepoltert in seiner Einfalt. So ungebrochen, wie es sich in ihm verkapselt hat, als es plötzlich nicht mehr gedacht und gesagt werden durfte. Da war er 16 und Flakhelfer. Er hat mir kaum davon erzählt. Mit seinem Treppensturz auf einem Berliner S-Bahnhof ist die Verkapselung gesprungen. Inkontinent ist er in einem allgemeineren Sinne. Und ich frage mich, was wohl bei mir gegebenen Falls zum Vorschein käme. Könnte es sein, dass ich meinem Sohn jenes Pionierlied vorsänge, das ich als Zehnjähriger allein vorm Fahnenappell singen durfte? Meine DDR hat mir Zeit genug gegeben, mich relativ gefahrlos von ihr abzunabeln, mein Pionierlied von der Feld-Wald-und-Wiesen-Heimat wird immer ironisch in mir herumscheppern. Mein Vater hatte diese Zeit nicht. Ihm wurde der Boden, in den er eben eingewurzelt war, unter den Füßen weggezogen. Sein Hitler-Ölbild hat unbefleckt die Nachkriegsjahre überdauert. Nun steht es plötzlich wie ein Golem in ihm auf.
Er habe jetzt die intellektuellen Fähigkeiten eines Fünfjährigen, sagt mir der zuständige Neurologe ganz ungerührt. Und dass die Heilungschancen zweifelhaft seien. In zehn Tagen müssen sie ihn entlassen, das verlangt die Krankenkasse in diesem eher hoffnungslosen Fall, bis dahin muss eine Entscheidung über seinen Verbleib und die Vormundschaft getroffen werden. Ob ich denn bereit wäre, die Vormundschaft zu übernehmen. Ich verstehe nur Bahnhof. Wie bitte? Er wird nicht wieder gesund und heil, er bleibt ein Pflegefall, für den ein Angehöriger sich sehr viel Zeit nehmen oder einen Pflegeplatz finden muss? Und wenn die Dinge so stehen, warum erzählt er mir das? Offenbar hält er mich für zuständig. Und, oh Himmel, ich bin es wirklich. Ich bin jetzt zuständig für den Herren Professor, der seine Lage noch lange nicht eingesehen hat, der noch so gern unterrichten würde in seiner neu bezogenen Dresdener Dachwohnung und in seinem neuen Cabrio an die Ostsee fahren und mit seinem guten alten Kreuzer nach Bornholm segeln. Für meinen feschen Vater, der sein fesches Leben bis zu seinem Sturz ganz gut ohne mich leben konnte.
Ich verlasse die noble Klinik mit ganz unbekannten und sehr gemischten Gefühlen. Was da auf mich zukommt, ist eine riesige Verantwortung und wahrscheinlich eine Menge Arbeit, das jedenfalls hat mir die Sozialarbeiterin angekündigt. Ich fahre durch die herbstliche uckermärkische Seenlandschaft, doch statt sie zu genießen gehe ich mit mir zu Rate. Wie war denn das gelaufen in den letzten Jahren? War er nicht bis über beide Ohren verschuldet? Hatte er nicht zuletzt mit einer seiner Studentinnen zusammengelebt und ein Kind mit ihr, einen selbstgezeugten Enkel, sozusagen? Nicht nur sie, auch die Banker hatte er mit seinem Charme herumgekriegt. Hatte die Wohnung und den Saab auf Pump gekauft. Ich muss mich schleunigst darum kümmern. Aber wie? Bin ich dafür der Richtige? Doch wer sollte es sonst tun? Er hatte seine familiären Bindungen nie besonders gepflegt. – Als meine abfälligen Sätze enden, kommt darunter ein Jauchzen zum Vorschein, ein Stolz, eine unbändige Freude, dass er nun ganz mir gegeben sein wird und immer Zeit für mich haben. Ich brauche mich nur neben ihn zu setzen und meine Hand auf seinen Rücken zu legen. Mein Vater ist erreichbar jetzt.
Der Entlassungstermin ist nahe gerückt, ich muss handeln, sonst „verbringt“ man ihn in die Wohnung, wo er zuletzt allein lebte, und überlässt ihn dort - bis zur Feststellung einer Pflegestufe - so mehr oder weniger sich selbst. In den nächsten Tagen habe ich viel zu lernen. Zwischen meinen hastigen Visiten in Wolletz begebe ich mich zur Schuldnerberatung und lerne etwas über Erlassschreiben, Mindestrückbehalte und eidesstattliche Erklärungen... Und klappere die Seniorenresidenzen ab. Dabei habe ich immer ein schlechtes Gewissen, denn eigentlich dürfte ich ihn nicht abschieben, müsste ihn bei uns aufnehmen, müsste mich damit in der Familie durchsetzen und jedem einzelnen Familienmitglied ein Stück dieser Arbeit aufhalsen. Ich glaube sogar, dass es zuletzt uns allen gut tun würde, aber ich lasse mich von meinen Horror-Szenarien abschrecken: Von den Bildern eines inkontinenten, verwirrten Diabetikers, der im ganzen Haus seine Spuren hinterlässt, wenn er Tag und Nacht unterwegs ist auf der Suche nach Zuckerzeug oder einem Klo oder nach seiner Vergangenheit und seiner geliebten Geige. Und in Wahrheit gibt es nur den einen Grund: Ich hab ihn nicht lieb genug, meinen berühmten Vater.
Zeit genug kostet er mich ohnehin, das Amtsgericht hat mich zu seinem „Betreuer“ eingesetzt, früher sagte man „Vormund“. Ich darf ihn ungestraft bevormunden. Als ich darüber nachdenke, werden mir meine Gefühle bewusst, da ist eine Rechnung offen zwischen uns, die aus meinen Kindertagen stammt. Ich kann mich an keine Einzelheiten erinnern. Aber dass es etwas Ungeklärtes zwischen uns gibt, wird mir immer deutlicher daran, wie ich mit ihm umspringe, wie ich es genieße, mit ihm umzuspringen. Ich tu ihm kein Leid an, bin aber auch nicht eben zartfühlend. Und wenn ich ihn so ruckzuck mit dem Rollstuhl in die Cafeteria kutschiere und aus der Cafeteria über die hohe Schwelle in den Park und hopplihopp den steilen Parkweg hinab zum See, wird langsam aber sicher etwas heil zwischen uns. Wenn wir dann angekommen sind, unten auf dem Steg, tut er mir schon wieder leid. Als Kind, jetzt erinnere ich mich, hatte ich den Wunsch, ihn irgendwo hinunter zu stoßen. Ich stehe hinter ihm auf dem Steg, er vor mir im Rollstuhl. Nein, runter stoßen will ich ihn nicht mehr, damit bin ich durch, seit kurzem erst. Erst jetzt.
Vaters schöne Hände halten sich am Rollstuhl fest. Mit seinen Faustknöcheln hat er meinen Schädel malträtiert, bis ich schrie. Keine Strafe, nur ein Spiel. Jetzt weiß ich es wieder: Wir hatten unsere Jungsspiele miteinander – verstecken, fangen, kämpfen, unterkriegen. Er hat nie aufgehört, wenn er gewonnen hatte. Er hat mich in den Schwitzkasten genommen und so lange mit den Knöcheln seiner Faust bearbeitet, bis ich heulte. Dann hat er mich fallen lassen und verhöhnt. Seine Freude daran, mich zu peinigen und zu verhöhnen hatte ich vergessen, wenn er wieder Zeit für mich hatte. Doch von Mal zu Mal wuchs in mir der Vorsatz, ihn irgendwann zu töten. – Da sitzt er in seinem Rollstuhl auf dem Steg, das Kinn der schrägen Sonne zu gereckt, als habe er ihr zu gebieten. Der zarte Gewaltmensch. Auch in mir ist eine alte Kapsel aufgesprungen. Und ein verletztes Kind will Rache nehmen. Aber mit dem Gedanken ist es schon getan. Wir sind so reflektiert, wir Nachkriegskinder. Das Wenige, was ich aus seiner Kindheit weiß, macht seine Eigenart verständlich. Da gab es die Pferdepeitsche, die er seiner Mutter bringen musste, wenn er sein Quantum nicht geübt hatte. Damit hat sie ihn, wie er es beschrieb: inbrünstig verdroschen. Auf eine Art, die doppelt grausam wirkte, weil sie dabei Lust empfand. Erzählt hat er von seinem Besuch beim Psychiater. Da war er Musikstudent und wurde von dem brennenden Wunsch verfolgt, seine Mutter zu würgen. Der Arzt riet ihm, sich endlich eine Frau zu nehmen und ihm „Vollzug“ zu melden, was er auch tat. Ich erinnere mich an sein Frauenbild und an sein Musizieren, das nie heiter und frohgestimmt war; stets hat er gekämpft gegen sein Instrument oder sich darauf ausgeweint. Da sitzt er vor mir im späten Licht, das Kinn noch immer vorgereckt, die Anspruchs-, die Herrschergebärde. Ich könnte ihn jetzt noch eine Stunde herumkutschieren und ihm die frische Herbstluft gönnen. Gefärbtes Laub. Den See. Ich hätte Zeit. Doch ich schiebe ihn wieder bergauf in sein nobles Reha-Klinik-Zimmerchen, sage „Tschüss“, reiche die Hand. Bestürzt sieht er mich an: „Will mitkommen“, sagt er mühsam. „Geht nicht“, entgegne ich, wende mich ab und zieh die Tür ins Schloss. Danach geht es mir nicht besser, aber ich beschließe: Nun sind wir quitt. (Meine Lesung im Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop 2003 wurde unter dem Titel „Vaters Hände“ von MDR-Figaro und Kulturradio des RBB gesendet, nicht von mir gelesen auch im SWR2, kürzere Fassung unter dem Titel „Vatertag“ im Magazin der Berliner Zeitung vom 4. / 5. Mai 2002, unter dem Titel „Wie im Sohn der Vaterinstinkt erwacht“ in der Stuttgarter Zeitung vom 18. Mai 2002, 2012 unter dem Titel „Kapsel“ in der österreichischen Anthologie „Trau keinem über dreißig“, unter dem Titel „Chesterfield“ in der Anthologie „Wut“, Zürich 2022, unter dem Titel „Held“ in der Anthologie „Zerstören“, Herder Verlag 2023
Erdspalt
Auf heult der Wartburg vorm Haus wie ein Gequälter, die Tür knallt. Hans schaut aus dem Fenster: sandstaubige Bremswolke, der Vater steht wie ein Halbstarker vorm Haus und traut sich nicht hinein. „Sie ist gar nicht da“, sagt Hans zum geschlossenen Fenster hin. Der Vater kann ihn nicht hören, sieht auch nicht hoch, er versucht wohl, an den Küchenfenstern abzulesen, ob die Mutter im Haus ist, und Hans kann sich gut vorstellen, wie er jetzt zugleich darauf hofft und sich davor fürchtet. Der Vater betritt kaum hörbar das Haus, ruft sein heiseres „Hallo?“ in den unteren Flur, öffnet nacheinander alle Türen, ohne sie wieder zu schließen. Hans stellt sich vor, wie er nach etwas sucht, das noch ist wie es war oder doch wieder so werden kann. Wie er an der Garderobe nach ihren Sachen sucht: Nein, sie ist nicht da, aber die Garderobenhaken sind es ja noch, die Hutablage, das Garderobengestell mit dem Bastgeflecht, alles stabil verbunden. Hans stellt ihn sich vor, mit der Stirn am geflochtenen Bast, wo doch ihr Mantel und ihre Jacke immer hingen als sie noch zu ihm gehörte. Hans lernt seinen Vater neu kennen in seiner Schwäche, in seiner Verlorenheit ohne die Mutter. Erst jetzt weiß Hans, dass seine Mutter für seinen Vater viel wichtiger war als er für sie. Und dachte immer, es sei umgekehrt.
Der Vater steigt schwer und langsam die Treppe hinauf, öffnet die Bad-Tür, schließt sie wieder. Kommt näher, zögert. Öffnet seine Tür. „Gott sei Dank du bist da“, sagt er, „deine Mutter will sich scheiden lassen.“ Der Vater sieht ihn an, als müssten seine Tränen in Hans' Augen aufsteigen und er, Hans, müsste getröstet werden und tapfer sein. Er wolle etwas Wichtiges mit ihm besprechen, sagt der Vater, Hans folgt ihm ins Dachstübchen, der Vater schließt die Tür, obwohl außer ihnen niemand im Haus ist und überfällt ihn gleich: „Das ist alles so furchtbar, ich wünschte, ich müsste dir diese Entscheidung nicht zumuten, aber ich muss jetzt wissen, ob du bei ihr oder bei mir bleiben wirst.“ Der Vater sieht ihn an, wie er ihn nie angesehen hat. Hans wird es ganz mulmig. Zu lang zögern darf er nicht. „Wer hat eigentlich das Bild gemalt?“, fragt Hans. „Du musst dich ja nicht gleich entscheiden“, sagt der Vater. „Das Bild? Ist von deinem Urgroßvater mütterlicherseits. Das wird sie wohl mitnehmen. Aber das ist mir egal, nur dich soll sie mir nicht wegnehmen. Aber das ist natürlich deine Entscheidung, nein, lass dir Zeit damit. Es wär nur schön, wenn ich nicht so lang warten muss, das tut mir gar nicht gut im Moment, kannst du das verstehen? Du hast jetzt natürlich eine vorteilhafte Position, kannst deine Eltern gegeneinander ausspielen, wenn du willst. Aber das willst du nicht, ich weiß. Du bist so ein edler Charakter.“ Das klang ironisch. Hans erhebt sich. „Weißt du noch, wie wir elektrische Eisenbahn gespielt haben?“, fragt der Vater rasch. Hans nickt und lächelt höflich, ergreift die Klinke. „Es wäre auch für dich besser. Deine Mutter wird sich eine Arbeit und eine Wohnung suchen müssen, das wird schon schwer genug, sie hat ja nichts gelernt, und dann auch noch mit so einem pubertierenden Knaben – wie soll das gehen? Bei mir wirst du immer dein eigenes Zimmer haben, einen Garten, alles, was du brauchst für die Zeit bis zum Abitur, und dann sehen wir weiter.“ In Hans breitet sich Wut aus: Als ob er je den Garten gebraucht hätte. Der Vater hat keine Ahnung, was er braucht. Alles nur Getue, um ihn gegen die Mutter in der Hand zu haben. „Das mit dem Abitur hab ich auch geregelt, deine Noten sind momentan nicht so pikobello, aber das liegt an der häuslichen Situation, wo die Mutter auf Abwege geraten ist, so hab ich es der Kommission dargestellt, und das haben meine Genossen gelten lassen, du kommst also doch noch auf die EOS nach den Ferien, hab ich dir das gar nicht erzählt? Ich bin aber auch schusselig, naja, kein Wunder bei diesen emotionalen Wechselbädern. Ja, ich kann was für dich tun, Junge, aber du musst auch zu deinem Vater stehen, wenn es drauf ankommt, na, das weißt du ja...“ Hans ist die Wut in den Hals gekrochen, aber er sagt nichts, weil ihm die richtigen Worte fehlen, er nickt nur mit gesenktem Kopf und schließt die Tür. „In seinem Übezimmer fühlt er sich sicher“, sagt Hans halblaut, als er die Treppe hinunterstürmt, so weit weg wie möglich, ins Untergeschoss, in die Küche. Er nimmt einen Zug aus der Milchkanne, schnappt sich ein trockenes Brötchen und merkt, dass er noch nicht weit genug weg ist. Hans ist danach, in den Keller zu gehen, was er dort will, weiß er noch nicht so genau.
Hochkant steht da die Eisenbahnplatte. Wie lang das her ist. Lächerlich, sich jetzt darauf zu berufen. Wie sie die Umgebung nachgebaut haben aus Knüllpapier, Sackleinen, Tapetenleim. Es sollte ein Abbild der heimischen Stadtrand-Topografie werden mit dem Kanal, darüber aber nicht die Nachkriegs-Notbrücke, sondern jene Brücken, die der Vater aus seiner Kindheit kennt, und die in den letzten Kriegswochen gesprengt wurden. Die Stammbahn, die seit dem Kriegsende stillgelegt ist, wollte der Vater in der Modellbahnlandschaft wieder in Betrieb nehmen. Und mehr, er wollte den abgebrochenen Kreuzungsarm vor ihrer Haustür zu dem S-Bahnhof führen, den die Verkehrsplanungen von „Germania“ vorsahen. Es sollte alles so werden, wie es in Vaters Kindheit hatte werden sollen. Die Brücke der Friedhofsbahn gab es noch, da hatten sie den Kanal überquert, verbotenerweise. Ihr Männerabenteuer. Der Vater hatte daneben gestanden, als ihm so schwindlig geworden war, dass er sich hatte hinknien, dann hinlegen müssen vor dem Schritt über die fehlende Planke hin. „Steh auf, geh weiter, du Memme, die nächste Bahn kommt gleich!“ Der Vater hatte ihn verhöhnt, statt ihm die Hand zu reichen. Die ganze Vater-und-Sohn-Eisenbahn, alles Lüge von Beginn. Dieses Harmoniegebilde aus nachgemachter Landschaft. Doch er war dankbar gewesen, dass der Vater etwas mit ihm vorhatte. Ein richtiges Vorhaben. Hans zieht die Platte hervor, setzt sie auf zwei Böcke, versucht, sich dies Weihnachten in Erinnerung zu rufen, als alles so rund und stimmig war. Weihnachten 1961, das erste nach dem Mauerbau, das erste, zu dem die Eisenbahn nicht fertig wurde. Hans saß unter dem Flügel und versuchte vergeblich, an einer Murmelbahn Gefallen zu finden, die ihm Onkel Achim mitgebracht hatte, ein Tonmeister aus der Nachbarschaft. Als der Onkel ihn so missmutig spielen sah, kroch er unter den Blüthner, vielleicht war ihm gerade aufgefallen, dass Hans mit seinen zehn Jahren dem Murmelbahnalter entwachsen war. Er nahm eine Murmel, nannte sie einen Tonkopf und ließ sie in die weite Welt rollen. Die weite Welt war das Weihnachtszimmer. Und als er sie so übers Parkett rollen sah, kam ihm eine Idee. Er umwickelte die Kugel mit Silberpapier – wegen der elektromagnetischen Aufnahmequalität, wie er den Eltern erklärte – und ließ sie zuerst den Baum belauschen, der von Wind und Wetter zu erzählen hatte. Er imitierte den Regen, den Sturm, die Waldvögel: Das sei jetzt alles aufgenommen, behauptete er, nachdem er die Kugel zwischen zwei Fingern über die Äste hatte rollen lassen. An den Ästen hing der Familienerbbaumschmuck, Glocken und Wachsengel, die klangen und sangen nun mit der Stimme von Onkel Achim. „So“, sagte er, „das hätten wir. Die Atmo da draußen ist gerade dabei, sich gewaltig zu verändern, ins dumpf Hallige, wie in einem riesigen Innenraum. Weißt du, was eine Atmo ist? So etwas wie eine Stimmung, die in der Luft liegt, ohne dass man etwas davon hört. Aber man spürt es. Die Atmosphäre hier bei euch ist kostbar und leider vergänglich, also nehmen wir das alles auf.“ Er warf die Kugel immer wieder in die Zimmerluft und fing sie. „Deine Kugel bewahrt das alles, jedes Geräusch, jeden Ton.“ Schwungvoll nahm er die Noten vom Flügel, schlug sie auf und spielte der Kugel ein Brahms-Intermezzo. Kaum hatte er geendet, sprang er auf, wandte sich zum Bücherregal, lies die Kugel zwischen Buchseiten herabrollen und behauptete, sie könne sich jeden Satz merken. Er steigerte sich in dieses Spiel mit einer Ernsthaftigkeit hinein, die Hans damals unheimlich war. Aber der Onkel war auch sonderbar zärtlich, wie bei einem großen Abschied. Ein paar Wochen später war er spurlos verschwunden, abgehauen nach drüben. Hans steht im Keller vor der alten Eisenbahnplatte und wünscht sich, so spielen zu können wie Onkel Achim. Er trennt den Gleisstrang und stellt die beiden Schienen spitz gen Himmel ragend gegeneinander. Hier müsste die Grenze verlaufen, hier ungefähr. Die Geleise hat man wirklich getrennt, das weiß er aus dem Radio. Oder Prellböcke darauf gesetzt. Hans stellt sich vor, wie er nachts eine abgestellte S-Bahn besteigt, wie er alle Hebel ausprobiert, bis die Bahn anrollt, immer schneller auf die Grenze zu. Er würde sich rechtzeitig ducken und alle Hindernisse durchbrechen, auch den Schüssen entgehen. Dann käme es nur noch darauf an, die Bahn wieder anzuhalten. Wie mag es jetzt aussehen in diesem Zwischenreich? Hingehen wie damals, um sich zu vergewissern, das geht schon lang nicht mehr. Wahrscheinlich werden da jetzt überall Peitschenlampen stehen. Hans nimmt eine Handvoll Fahrradspeichen aus dem Werkzeugregal und steckt sie dort hin, wo er die Grenze vermutet. Es sieht außerirdisch aus, aber das scheint ihm stimmig. Jetzt die Schneise wie eine Narbe in der Landschaft. Ein Krankenkrad mit Beiwagen für die Verletzten. Für Klaus. Er wird das nachbauen, alles, was er von der Grenze ahnt und inzwischen erfahren hat: Das mit Klaus, das mit dem Bruder, dem Hund, Annas Haus, von hier aus wird er einen Tunnel graben und sie da alle hineinstopfen, sollen sie zusehen wie sie nach drüben kommen. Hans nimmt den großen Schraubenzieher und sticht in die wellige Landschaft aus Sackleinen, Zeitungspapier und Tapetenkleister, hackt Löcher in die Landschaftshaut, dicht an dicht, bis eine Furche daraus wird. Ein schwarzer Erdspalt. Irgendwo her kennt er den. Und weiß doch, dass es ihn nicht geben kann. Hier gibt es keinen Vulkanismus, keine Erdbeben, hier hält die Erde alles aus, lässt alles mit sich machen. Hans nimmt sich die Rolle Hasendraht und zieht ihn quer über die Eisenbahnlandschaft. Das Eisenbahnerhäuschen am Bahnübergang sieht aus wie das Postenhäuschen der Grenzer ausgesehen hat, da, stellt er sich vor, hocken sie immer noch drin. Eingeschlafen. Oder vermodert. Mit allen Sinnen ist Hans dabei, seiner Eisenbahnlandschaft diese Grenze zuzufügen, einen Erdspalt, wie er ihn im Traum sah. Er hat nicht bemerkt, wie der Schauspieler in den Kellerraum trat. Da sitzt er nun plötzlich, den Käscher in der Hand, im alten Sessel, in dem sonst der Vater saß, sieht ihn an, grinst: „Was wird das denn?“ Erst mit dieser Frage nimmt Hans ihn wahr, irgendwie hat er sich neben die Platte geschummelt, ein unmerklicher Auftritt, wie er ihn wohl am Theater gelernt haben muss. „Sieht man das nicht?“, fragt Hans zurück. Der Schauspieler lässt ein Lächeln flackern und schickt einen Blitz aus spitzen Augen. „Jetzt fragst du dich, ob du träumst oder wachst, gib es zu. Und woher kennst du den Grenzverlauf?“ – „Ich kenn ihn nicht, aber ich will ihn mir vorstellen können.“ – „Wozu?“ – „Ich träum davon. Ich träum von dieser Bahnstrecke und einer Draisine, ich träum von diesem Sand, auf dem die Kiefern stehen hier und dort. Dass sie sich berühren mit den Wurzeln. Und sich mit den Wipfeln winken. Ich stell mir vor, mich da durchzugraben. Ich träum von einer Riesentaube, die mich rüber trägt. Ich träum vom Hund der alten Frau, und dass er zerfetzt im Zaun hängt. Ich träum von Klaus, dass er dort im grünen Postenhäuschen sitzt und schläft, seit Wochen. Das Haus von diesem Krimiautor wandert jeden Tag ein paar Millimeter auf die Grenze zu, unmerklich. Irgendwann werden sie es abreißen müssen, oder es wird rübergewachsen sein. Und wenn ich das alles so anfassen und ansehen kann, vielleicht hört es dann auf in den Träumen.“ - „Sososo“, sagt der Schauspieler, „aber was soll daran so faszinierend sein. Kein schöner Anblick. Ich hab das jetzt direkt vorm Haus.“ - „Eine Auszeichnung ist das nicht.“ - „So wenig, wie es eine Auszeichnung ist, heutzutage ein Deutscher zu sein, ein deutscher Mann zumal. Du bist ja gerade dabei, einer zu werden. Stell ich mir nicht ganz leicht vor, in dieser Reihe von Verlierern und Verbrechern zu stehen. Die jetzt so rein gar nichts mehr dürfen. Nur noch brav sein dürfen sie. Keine wilden Bestien mehr, keine berauschten Krieger, trunkenen Helden. Einen Vorteil hat die Sache: Mit der Verantwortung sind wir auch unser Gewissen los. Wir leben hier in einem großen Ferienlager. Voilá, du kannst tun, was du willst, natürlich im Rahmen des FDJ-Statuts, aber da geht so manches. Ich war ja auch mal FDJ-Funktionär. Zu meiner Zeit waren die Camps sehr aufregend. Das ging hoch her, nachts, wenn die Kleinen schiefen.“ Der Schauspieler feixt und fuchtelt ungelenk wie ein Teenager. Hans will ihn rauswerfen, aber das ist ein Erwachsener. Obwohl er sich nicht so benimmt. Jetzt tritt er näher. „Warum tust du es nicht? Tu es. Werde ein Mann, sündige, werde schuldig, sonst hat das Leben keinen Reiz. Berausche dich an deiner Jugend, den großen Rausch, den unsere Väter hatten, den Volksrausch wirst du nicht mehr erleben, aber einen Vollrausch kannst du dir jederzeit leisten mit dem volkseigenen Vollbier…“ (Auszug aus: „Draußen – von Männern hinter der Mauer“, auch in der Anthologie „Hier soll Preußen schön sein“, Berlin 2019)
Blaue Scheine
Eines Abends kommt der Vater zu ihnen, er sei grad in der Nähe gewesen. Bleibt im Mantel, atmet rasch vom Treppensteigen. Hockt sich auf einen Küchenstuhl. Da sitzt er leibhaftig. Er hat sie nie besucht. Friedo strahlt. Als die Frau gegangen ist, um den Kindern vorzulesen, eröffnet der Vater ihm, er werde jetzt sein Erbteil ausgezahlt bekommen. „Mein was? Ich hab doch nichts zu erben.“ - „O doch. Da ist das Haus, das Boot, das Auto, die Geige.“ – „Aber warum denn jetzt schon“, fragt Friedo, „willst du sterben?“ – „Sozusagen.“ Der Vater lacht trocken. „Wenn ihr rübergeht, sehen wir uns nicht wieder. Du darfst nicht zurück, und ich bin gehalten, den Kontakt zu dir, sozusagen - abzubrechen. Die Alternative wäre, dass ich über meine Besuche bei dir berichte.“ Er zieht ein Papier aus der Innentasche, entfaltet es umständlich, reicht Friedo einen Füller. „Hier quittierst du den Empfang von zehntausend Mark und bestätigst, dass du keine weiteren Ansprüche stellen wirst.“ Friedo ist verdattert, will sich aber nichts anmerken lassen. „Zehntausend? Ist das nicht zu viel? Kannst du dir das leisten?“ Der Vater nickt. „Ein Vermögen“, sagt Friedo, „weißt du, was das für uns bedeutet? Damit sind wir zwei Jahre aus dem Schneider. Ich kann in Ruhe schreiben, muss nicht für hundert Mark die Woche jeden Tag Lehm schleppen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr uns das hilft!“ – „Schon gut“, sagt der Vater, holt einen Stapel blauer Scheine aus der Innentasche. „Zähl nach“, sagt er. – „Quatsch“, sagt Friedo, glotzt den Stapel an. „Mensch, Alter! Wie sollen wir dir danken? Du bist so gut zu uns.“ Da erhebt sich der Vater, kommt auf ihn zu und nimmt ihn hastig in den Arm. Er hat ihn nie umarmt. Sieht ihn beinahe grade an mit nassen Augen. „Machs gut, Junge.“ Lässt plötzlich los, wendet sich ab, sucht die Tür. „Hier lang“, sagt Friedo mit belegter Stimme. Im Treppenhaus dreht sich der Vater rasch noch einmal um, blinzelt ihm zu, nickt aufmunternd, versucht zu lächeln. Nie hat der ihn so angesehen. Der Vater schwebt im weiten Mantel treppab. Friedo steht verdattert in der Tür, und ihm dämmert, dass ihn soeben die inoffizielle Nachricht von ihrer Ausreisegenehmigung ereilt hat. “Warte mal“, ruft er noch, da ist der Vater schon drunten und aus dem Haus, Friedo hört, wie er seinen Volvo aus dem Regierungskontingent laut aufheulen lässt. (Aus „Halbschlaf“.)
Steak Letscho
Den Ofen ausschamottieren, der Luft einen Schlängelweg bauen, auf dem sie ihre Hitze an den hartgebrannten Ton abgeben wird. Großräumig die Brennkammer, wo es am heißesten ist und schnell gehen soll, nach oben hin enger, wo die Luft auf langen Wegen ihre letzte Wärme lassen kann. Breite und flache, lange und dicke Schamottziegel mit fettem Lehm verbinden, die Laibung mit dünnem Lehm ausschmieren. Mit flachen Händen, mit einem nassen Tuch streicht Friedo die Wände des Ofeninnern geschmeidig glatt, wie von Luft geglättet sehen sie aus. „Komm aus’m Knick“, sagt Robert, „mach das Werkzeug klar, wir hauen nach dem Essen ab.“ Friedo klaubt den Zollstock und die Haumesser zusammen, die Eisenklammern und die Zangen. Und ist in Gedanken ganz bei Luft und Erde, die durch ihre Handarbeit zu einer so nützlichen Allianz gezwungen werden. Und ist noch ganz beim Gespräch über Luft und Erde, das er gestern mit dem Vater hatte. - Dass die Musik kein Zuhause wäre, hatte Friedo da behauptet, weil sie in der Luft sei, Menschen aber nicht fliegen könnten. Dass sie bloß eine Luftspiegelung vergangener Zeiten sei, und dass man von ihr süchtig werden könne, weil sie nicht sättige. Aufgelöst hat sich die bürgerliche Welt, in der deine Musik ihre Gültigkeit hat, längst in Luft aufgelöst!’ Solche Sätze. Der Vater hatte nur geschmunzelt und schließlich die Bemerkung gemacht, dass Künstler schon immer das letzte Glied einer Familie gewesen seien, und dass die nächste Generation wieder von vorn, also ganz unten anfangen müsse, was einem vermutlich am schwersten falle: zu fallen, anstatt aufzusteigen. Dass es also in Friedos Lage tatsächlich ein Aufstieg sei zum Ofenbaugehilfen, weil eine tiefere genealogische Weisheit darin liege, er also weder mit seinem Schicksal noch der Musik oder seinen Vorfahren zu hadern brauche. Auch nicht mit der verschwundenen bürgerlichen Welt, um die es übrigens nicht schade sei.
Der Vater kann reden! Und ihm, Friedo, fallen die besten Sätze immer zu spät ein. Von einer Fata Morgana hätte er ihm reden sollen! Diesen Satz, und in aller Gelassenheit: ‚Wenn du deinen Beethoven und deinen Brahms und deinen Dvorak so spielst, als würde das noch gelten, als bräche sich das nicht den schönen Hals an den Lügen, die hier den öffentlichen Raum verstellen, wenn du es so spielst, als schepperte und echote das nicht von der Mauer zurück, dann ist es auch bloß gelogen.’ So hätte er reden wollen, so selbstgewiss. Aber die stolzen Worte kommen ihm erst jetzt, als er zusammengesackt auf dem Rand der Lehmkiste hockt und schweigt, wie er vor dem Vater geschwiegen hat, als er in der Mehrzweckgaststätte sein Steak-Letscho vertilgt und den Mund frei hatte. - Nein, frei wohl nicht, bloß leer.
‚Jedenfalls’, hatte der Vater gesagt und dem Kellner gewinkt, soll doch niemand behaupten, dass man im Sozialismus keine Bauchlandung machen kann.’ Joviales Lächeln. Die Musik sei daran nun aber wirklich unschuldig. Die sei nämlich absolut und von den Zeitläuften unberührbar, gottseidank. Sogar in der Nazizeit, sogar damals, als sie irgendein hohes Tier beerdigt haben, und die Siebte von Bruckner im Radio kam, sogar damals war die Musik absolut und unberührbar. Ich hab geheult vor dem Volksempfänger! Ja, stell dir vor! Und das hatte nichts mit diesem Nazi-Brimborium zu tun.’ Nun hätte der Streit erst recht losgehen können: um die Verfügbarkeit der Musik. Aber sie waren stumm in Vaters Volvo aus dem Sonderkontingent des Ministeriums für Kultur übers Kopfsteinpflaster geschunkert, hatten sich getrennt vor einer heruntergekommenen Potsdamer Villa, in der Friedo ein Zimmer bewohnt. Beim Aussteigen, endlich, hatten sie sich unverstellt angesehen. Die ganze Streiterei schien jetzt nur noch ein Vorwand, sich so nicht ansehen zu müssen, bevor man eine Autotür dazwischenschlagen und den Blick abbrechen kann. „Wenn der Meister nichts bringt, machen wir Feierabend“, sagt Robert unvermittelt, „hol mal den Rest Schamott hoch“. Mattweiße Abrisskacheln huckt Friedo sich auf, ihr Inneres hat die Hölle gesehen: Zähschwarze stinkende Flusen sind vom heißen Qualm geblieben, des Schlimmsten hat die Luft sich entledigt, wenn sie in den Schornstein geht. Den Abriss runtertragen, Vorfreude auf die Erleichterung, wenn er die Klappe aufstößt und Schutt unter sich lässt. (Aus „Halbschlaf“.)
Verdacht
Die Stasi-Unterlagen-Behörde informiert mich über einen nachträglichen Fund in meinen Akten, wir vereinbaren einen Termin zur Akteneinsicht, Joachim Gauck empfängt mich und versucht mich einzustimmen auf eine böse Entdeckung: Mein Vater habe nach unserer Ausreise über einen Besuch bei mir berichtet und habe versucht, hinter meinem Rücken auf meine journalistische Arbeit Einfluss zu nehmen. Er macht mich auf die Relativität der Eintragung aufmerksam, darauf, dass es für „Reisekader“ zur Routine gehörte, Berichte zu liefern, und zwar über jede Begegnung mit einem Bundesbürger. Und was man da berichtete, musste nicht der Wahrheit entsprechen, sondern hatte oft nur den Zweck, von künftigen Reisen nicht ausgeschlossen zu werden. Entscheidend sei, ob mein Vater mir wirklich geschadet habe. Ich begebe mich in den Lesesaal, finde ein vergleichsweise dünnes Dossier mit vielen Schwärzungen vor, schlage es auf und lese:
„28.März 1989, Zum Auftreten und der Haltung des NSA-Reisekaders (NSA= nichtsozialistisches Ausland, M.A.) Prof. (geschwärzt) und seinem Verhältnis zu seinem in die BRD übergesiedelten Sohn: Durch eine zuverlässige inoffizielle Quelle wurden zum Genossen Prof. (geschwärzt), geb. in: (geschwärzt), wohnhaft in (geschwärzt), Hochschullehrer, folgende Angaben erarbeitet: Prof. (geschwärzt) war vor einiger Zeit in der BRD und hat sich dort auch mit seinem Sohn, Martin Ahrends, geb. 20.3.51 in Berlin, Journalist, ‚Die Zeit‘, Hamburg, Abt. XII: erfasst für BV Potsdam, Abt: XVIII (ehem. Bürger der DDR) in einem Hotelzimmer getroffen und mit ihm eine ganze Nacht diskutiert. Neben unwesentlichen familiären Angelegenheiten versuchte Genosse (geschwärzt) auf seinen Sohn einzuwirken, insbesondere hinsichtlich seiner Artikel in der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘, die er dort veröffentlicht. Als Martin Ahrends am frühen Morgen das Hotel verließ, erklärte er, dass er jetzt endlich wieder wisse, ‚wie die Bonzen in der DDR diskutieren‘. Deutlich wurde erneut der militante Antikommunismus des Martin Ahrends und sein Hass auf die DDR. Dieser war nach Kenntnis der Quelle auch bereits Gegenstand eines Artikels vom Präsidenten des Schriftstellerverbandes der DDR, Hermann Kant, in einer Zeitung der DDR, in dem sich Kant scharf mit dem Martin Ahrends auseinandersetzte. Professor (geschwärzt), der langjährig gute persönliche Kontakte, einschließlich persönlicher Besuche, zum ehemaligen Bundeskanzler der BRD, Helmut Schmidt, unterhält, hatte seinen Angaben nach auch diesen als Herausgeber der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ gefragt, wie lange noch die antikommunistischen Ergüsse des Martin Ahrends abgedruckt werden. Schmidt hatte geantwortet, dass ‚Die Zeit‘ breiten Raum für verschiedene Meinungen hat und es ja auch viele andere Artikel gäbe. – Quellenschutz ist unbedingt erforderlich.“
Verwirrt will ich den Saal verlassen, werde leise zurückgerufen, unterschreibe die Akteneinsicht, bestelle eine Kopie, gehe durch die Gänge in den Tag. Was war das? Hat mein Vater mich verraten, hat er darauf hingewirkt, dass ich meinen Job bei der ZEIT verliere? Im Auftrag seiner Partei? Oder der Staatssicherheit? Inzwischen ist er ein Pflegefall, geistig verwirrt, entmündigt. Es ist endgültig zu spät, wir werden das nicht mehr klären können. Aber ich muss trotzdem damit klarkommen. Wie weit hat mein Vater sich eingelassen? Er war Parteimitglied, aber immer ein „unsicherer Kantonist“. Als ich ausgereist bin, haben ihm seine Genossen den Rektoren-Posten weggenommen. Und sie wollten eine schriftliche Distanzierung von seinem abtrünnigen Sohn, bevor er weiter unterrichten durfte. Erst die dritte Version haben sie ihm abgenommen, das ehrt ihn. Mein Vater hat als Künstler in der DDR sehr gut leben können, mit allen Vergünstigungen, die die DDR zu bieten hatte, einschließlich des so begehrten Reisepasses. Er hat dafür bezahlt, hat sich im November 1976 öffentlich gegen den ausgebürgerten Wolf Biermann erklärt, hat im ZK-Gebäude Erich Honecker ein Geburtstagsständchen gebracht, zusammen mit anderen „verdienten Künstlern des Volkes“ - gewiss ein sehr höfisches Zeremoniell. Aber er hat es auch geschafft, seine Studenten zu den großen internationalen Wettbewerben zu bringen, darum hat er gekämpft, dafür hat er sich bei seinen Genossen stark gemacht.
Kunst und Macht – ein weites Feld. Nachdem wir uns jahrelang um dieses Thema gestritten hatten, und ich endlich im Westen war, hab ich meinen Frieden mit ihm gemacht, hab mir ein Vaterbild gemalt, mit dem ich leben konnte: Für ihn war dies Nachkriegsdeutschland ein Provisorium, er hat das nicht ganz ernst genommen, dennoch versucht, das Beste daraus zu machen – für sich, seine Familie, seine Studenten. Die Konzessionen, die er machen musste, haben ihn, so schien es mir, kaum berührt, er wollte souverän bleiben in diesem insouveränen Land. Allerdings hatte ich immer den Verdacht, dass er ein Stück zu weit gegangen sein könnte, dass er seine Seele verkauft hat, und sie ihn wirklich beschädigen konnten. Gerade nach meiner Ausreise, in diesen späten Achtzigern, als der lichte Zukunftsstaat endgültig zu einem muffigen Kellerraum pervertierte.
Als wir uns im Winter 1988/89 bei einem Violinwettbewerb in Köln trafen (ich sollte für die ZEIT berichten, er hatte eine Schülerin im Rennen) und eine Nacht lang miteinander reden konnten, hatte ich am nächsten Morgen das Gefühl, nicht meinem Vater, sondern einem Apparatschik gegenüber gesessen zu haben. Er war bei den gestanzten Formulierengen aus den Parteilehrjahrs-Broschüren geblieben, nichts war da mehr von seiner mir so vertrauten Lust am Philosophieren, daran, die Fronten der Argumentation zu wechseln, nichts mehr von seinem ästhetischen Vergnügen an einem Wortgefecht. Ich hab eine ganze Nacht gebraucht, um zu erkennen, dass mein Vater gar nicht mehr mit mir reden wollte, sondern dass da jemand vor mir saß, der einen Auftrag hatte, den Auftrag mich zu agitieren und zu warnen. „Warum redest Du so mit mir?“, hab ich ihn irgendwann ungläubig gefragt, „sind hier Mikrofone eingebaut? Hört uns jemand zu?“ Auf solche Fragen bekam ich nie eine Antwort. Stattdessen hat er viel getrunken und viel geseufzt in dieser Nacht und mich am Morgen mit einem besorgten Lächeln verabschiedet. Irgendwas war zwischen uns gekommen, wovon er nicht sprechen durfte.
Auf meinem Weg von der Gauck-Behörde durch die Stadt steige ich zweimal in die falsche S-Bahn. Man hatte mir geraten, nicht mit dem Auto zu kommen, nun weiß ich, warum. Meine Gedanken stöbern in abgelegten inneren Bildern. Ist mein Vater, mein lebenslustiger Musikervater, mein immer etwas leichtsinniger, nie ganz erwachsener, allen Autoritäten spottender Vater zu einem verkappten Stasioberst mutiert? Einem OibE, einem Offizier im besonderen Einsatz? Undenkbar. Undenkbar? Was da wirklich gelaufen ist, werde ich wohl nie erfahren.
Meine bösen Ahnungen bekamen neue Nahrung, als mein Vater mich nach dem Mauerfall einlud, über sein eben gegründetes Reiseunternehmen zu schreiben. Aus meinem Künstlervater sollte über Nacht ein Taxi- und Reise-Unternehmer geworden sein? Was hatte das zu bedeuten? War das ein sogenanntes „U-Boot“, legalisierte und verwaltete er abgetauchtes Parteivermögen? Ich hab mich damals anonym in ein Taxi gesetzt, das Vaters neuer Firma gehörte und hab den Fahrer gefragt, was er vorher gemacht hätte. Statt einer Antwort grinst er mich spöttisch an. Diese Frage! Die verbotenste damals im Jahr nach der Wende, die den Frager brandmarkt als Fremdling. Kein Ostler hat einen Ostler in diesem Jahr gefragt, was er denn vorher gemacht habe. Wir plaudern also ein bisschen, ob es sich denn lohne, frage ich. Ach ja, sagt er, geht so, er habe ein auskömmliches Grundgehalt. - Fest eingestellt, mit allem drum und dran? Wo denn? - Bei einem Professor. - Ach so? Aber vorher war’s doch besser? - Na klar. Armee. Er hätte bleiben können, wollte aber nicht, wäre sich wie ein Verräter vorgekommen. - Wo denn Armee? - Na, da oben, Prenzlau, die Ecke. - Die anderen auch, die für den Professor fahren? - Weiß nicht, kann sein. - Und wie? Wie haben sie alle denn dieses Taxi-Unternehmen gefunden in einem kleinen Nest am Berliner Stadtrand? Per Annonce? - Jetzt sieht er mich doch etwas genauer an, grinst wieder. Das habe sich so rumgesprochen, sagt er. - Ach so, ja. - Das war schon meine ganze Recherche. Ich werde niemandem je erklären können, was ich dabei für ein Herzklopfen hatte in diesem Taxi. Wie sollte man das auch verstehen: Die Erregung, plötzlich auf seiner Spur zu sein, den Vorhang an einer Ecke zu lüften. Meinem Vater auf der Spur, dem Violinprofessor, von dem ich zu wenig weiß und nicht zu viel wissen will.
Und dann diese Pressevorführung seiner brandenburgischen Bildungsreise. Ob ich nicht etwas für ihn tun könne, für sein junges ostdeutsches Unternehmen, all die von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten. Ich war sehr neugierig. - Raues, regnerisches Wetter, als wir uns am Grünen Gitter von Sanssouci treffen; seine holländischen Gäste frieren, die Herren von der Dresdner Bank warten am falschen Treffpunkt. Die Journalisten-Kollegen, die er hatte einladen wollen, sind offenbar nicht erschienen. Oder er hatte so „unsichere Kantonisten“ gar nicht erst eingeladen. Endlich erscheint er, der große Organisator, mit einem Gesicht, das zwischen Elan und Bestürzung changiert. Dass schon am Anfang alles schief läuft! Seine schönen Geigerhände flattern überm Kopf und hängen an bleischweren Ellbogen. Flattern wie Ertrinkende, gezogen von Armen, die ab Schulterhöhe alle Haltung verlieren, die ihm einfach zu schwer geworden sind. Seine Hände! Sie brennen, sie häuten sich, rot aufgesprungen sind sie, zerschlissen, wund von der Zuckerkrankheit; immer fasert er daran herum, polgt und zupft und streichelt sie. Er brennt und ist am Ertrinken. Und ich? Ergetze mich daran.
Er sieht mich und macht eine Andeutung zur Umarmung. Ich weiche aus. Die alte Unordnung ist wieder da, das Knäuel von Ahnungen und Ängsten. Seine offenen Arme, meine Angst vor Vereinnahmung. Ach nein: Mein Ergetzen daran, wie seine offenen Arme einstürzen und er einen Übergang finden muss und weitermachen in seinem Stück vom großen Organisator. Rasch wendet er sich seinen Gästen zu und rasch der Parkführerin. Dann ist er wieder verschwunden. Er ist gar nicht da! - Ich meine: Was weiß ich von ihm? Was weiß er von mir? Diese Plätze haben für mich nichts Touristisches. Ich bin da gescheitert.
Durchs Grüne Gitter fuhr ich mit dem Rad zur Christuskirche. Der Kantor gab mir den Schlüssel, dass ich nach Feierabend orgeln konnte. Tagsüber hab ich die versotteten Potsdamer Kachelöfen abgerissen, für hundert Ost-Mark die Woche, in einem kleinen Handwerksbetrieb. Die Staatsbetriebe durften mich nicht einstellen. Als Ofenputzer und Orgelanfänger hab ich mich zum ersten Mal heimisch gefühlt in dieser Stadt. Weil ich endlich aus allen politischen Nötigungen gefallen war. Er war damals ein Genosse Professor und ein dem ZK unterstellter Nomenklaturkader. Er hat keine Ahnung, woran mich dieses Grüne Gitter erinnert. Und ich weiß nicht, was er da heraufbeschwören will mit seinen Reisen in Brandenburg-Preußens Historie. Mit seinem Rückgriff. Auch dem Rückgriff auf seine unternehmerische Begabung.