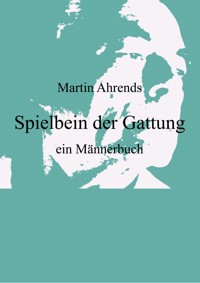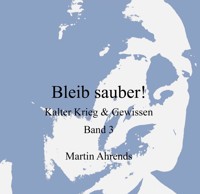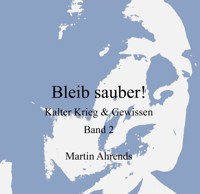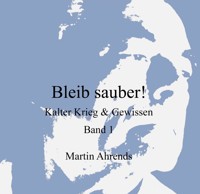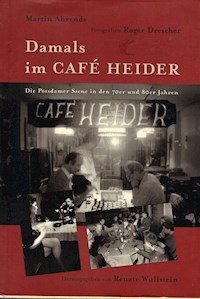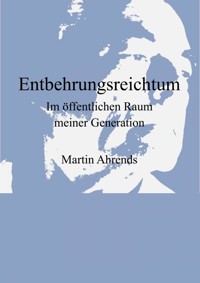
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies sind Beobachtungen, Begegnungen, Gespräche im öffentlichen Raum, wie ich sie in den letzten vierzig Jahren notiert und großenteils veröffentlicht habe. Sie erzählen von dem, was draußen unsichtbar in der Luft liegt und sich in Spuren zu erkennen gibt, wenn wir uns begegnen in der U-Bahn, im Café, im Park und auf dem Markt. Wenn wir einander mehr oder weniger flüchtig wahrnehmen auf dem Friedhof, im Supermarkt, im Wald oder im Museum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Ahrends
Entbehrungsreichtum
Im öffentlichen Raum meiner Generation
Für Susanne
Vorwort
Dies sind Beobachtungen, Begegnungen, Gespräche im öffentlichen Raum, die ich in den letzten 40 Jahren notiert und großenteils veröffentlicht habe. Sie erzählen vom Ansehen der Anderen. Aus der Herkunft ergeben sich unterschiedliche Lebenskonzepte, etwa hinsichtlich dessen, wie weit man sich in den öffentlichen Raum begibt, etwas daraus auf sich bezieht, in ihn hineinwirkt. Man kann auch zu allen Zeiten nur das eine Ziel haben im Leben: privat mit dem Arsch an die Wand zu kommen, wo und wann und wie auch immer. Aber man ist damit seine öffentliche Zuständigkeit nicht los, hat sie nur delegiert. Sie kommt einem also wieder über den Hals, wenn zum Beispiel ganz plötzlich und unerwartet so eine DDR zusammenbricht, in der man es sich gerade gemütlich gemacht hatte. Und die Wand hinterm Hintern plötzlich verschwunden ist. Meine Eltern hatten aus ihrer Kindheit und Jugend in der Nazizeit die Lehre gezogen, dass man nicht nur im Privaten leben darf, sondern auch öffentlich wach bleiben muss, um nicht schuldig zu werden. Meine Eltern hatten mir eingepflanzt, dass wir uns zu misstrauen haben, wir bürgerlichen Pflänzchen. Sie sprachen von Eliteversagen. Sie zweifelten an der Gültigkeit all der schönen Familien-Geschichten, auch der Noten, Bücher und Aquarelle, die auf sie überkommen waren. Alledies hatte scheinbar unbeschadet überstehen können. Was mein Vater spielte, was die Mutter mir vorlas, klang ja nun immer noch, wie es immer geklungen hatte. Und hätte so nicht mehr klingen dürfen. Es hatte niemanden schützen können, auch die Täter nicht vor sich selbst. Der Kunst-Glaube der Eltern war gebrochen, sie waren aber nicht entlassen aus der Zuständigkeit für das Gebrochene, auch wenn sie das vielleicht gern gewesen wären. Mein Beruf ist nichts, was ich mir ausgesucht habe. Wie sich der öffentliche und der private Raum durchdringen, das hat mich immer beschäftigt und war für meinen Beruf konstitutiv. Entbehrungsreichtum ist ein Reichtum, der sich durch Entbehrung auftut inmitten jenes Reichtums, der etwas Entbehrtes ersetzen soll.
Mir war, als hätte ich im großen Draußen meinen eigentlichen Arbeitsplatz, schon als Zehnjähriger vor dieser provisorischen Straßensperre in meinem Kindheitsort, aus der dann „die Mauer“ werden sollte. Und die in der Sonntagsstille summte von spannendem Nichtgeschehen. Als hätte ich meinen Arbeitsplatz zu finden im zerhackstückten Bahnhof Friedrichstraße, der ursprünglich Verbindung schaffen sollte. Dies mich schmerzende Paradoxon, das da jahrelang herumstand, stählern die greifbaren Nieten auf dem Weg ins Theater, über der Spree, und nicht einstürzen wollte von den Zerreißkräften. Mein Pfiff hinüber auf die verbotene andere Seite, meine Versuche, im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen, was dort fehlt. Das Schweigen zu brechen. Mein Arbeitsplatz auch die Hinterzimmer der Stellvertreter, die mich einvernehmen und zur Ordnung rufen sollten, obschon diese Zimmer nicht aussahen wie das, was man sich gemeinhin unter einem öffentlichen Raum vorstellt.
Die Titel der einzelnen Texte haben je Kapitel einen gemeinsamen Anfangsbuchstaben, womit ich zufällige Marker setze in die Flut, daran sie sich brechen mag. Fett gesetzt hab ich, was mir im Moment wichtig schien. So hab ich die Texte aufgepflügt, um sie zugänglich zu machen.
Dem Augenschein nach verkommt der öffentliche Raum, wenn man ihn sich selbst überlässt. Man soll ihn harken und wischen. Bebauen, pflegen und ehren, wofür das Verb „kultivieren“ steht. Denn in diesem Raum schauen wir uns an. Sofern es uns denn gibt in dem Anschauenden. Ja, der öffentliche Raum verkommt, wenn man ihn sich selbst überlässt. Aber auf tröstliche Weise: Er wächst zu. Und zwar in Zeitmaßen, die es uns erlauben, darauf zu reagieren, eingreifend, zuschauend, wegsehend.
Das große Draußen ist auch Raum der Paarung, wo stattfindet, was wir Bestäubung nennen mittels Insekten oder des Windes, wo dies Geheimnisvolle geschieht zwischen Balz und Befruchtung, das Gattenwahl genannt wird. Wo je nach Jahres- und Tageszeit, je nach kultureller und historischer Lage etwas in der Luft liegt, das Befruchtungen aller Art zu- oder abträglich ist, sie spezifisch modifiziert, und so auch die Paarung gestattet, verbietet, gebietet. Auch dieses Buch will sich als Same in den öffentlichen Raum ausstreuen, ausfliegen dahin, wo es erwartet wird. Etwas schwer geraten ist es wohl. Aber nicht flugunfähig, wie ich hoffe.
Werder, März 2025
Öffentliche Verkehrsmittel
Platzhalter
Ein Defekt an der Bremsleitung, erfahren wir, sei der Grund, den Zug auszutauschen, bei Minusgraden haben wir zu warten auf einem Bahnhof ohne Wartesaal, ich laufe also auf und ab auf diesem schmalen Bahnsteig, den ich so gut kenne und den ich nun, aus der Nähe betrachtet, kaum wiedererkennen kann. Hier kamen wir in den großen Ferien an aus der Großstadt, waren schon nahe dem Bootsplatz, wo nicht nur das Segelboot auf uns wartete, sondern auch ein keines Sommerquartier unter dem Dach des Bootshauses. Wenn wir hier dem Vorortzug entstiegen, dann waren wir in anderen Sphären und waren Andere, der Vater, die Mutter und ich. Ich suche nach der sommerlichen Verheißung in den gelben Ziegelbögen. Beklebt, beschmiert, zerbröselnd warten sie auf den Abriss. Vernagelt die hohen Fenster der Schalterhalle, der Bahnhofswirtschaft. Aufgegebene Willkommensarchitektur.Erst jetzt verstehe ich die Sprache dieser Bögen und Fenster eines Bahnhofs, der schon zu mir gesprochen hat, als ich Kind war, und noch immer zu mir sprechen will. Es sind noch dieselben willkommen heißenden Gesten mit seinen offenen Bögen wie ausgebreitete Arme, mit seinen großen Fenstern wie freundliche Augen. Seit Jahren geschlossen die Restauration, wo wir einen Imbiss bekamen und ein Getränk, wenn wir zu warten hatten. Und wo es eine saubere Toilette gab. Das war Normalität und wird mir erst jetzt so auffällig, weil es irgendwann aufgehört hat, normal zu sein. Wann war das? Ich war seit Jahrzehnten nicht hier. Die großen Gefühle der Ankunft in einer Fremde, der Abfahrt aus einer Heimat, des Losgerissen- und Unterwegsseins und banger, hoffnungsvoller Wiederkehr:Dieser Ort war einmal eine Architektur wert, die dem großen Gefühl eine öffentliche Form gab, darin man sich finden und fassen konnte, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Damit man sich nicht so verloren finde an diesem Zwischenort wie ich mich jetzt hier finde. Wie gern würde ich jetzt am alten Platz im Bahnhofsrestaurant mich an einem Kaffee festhalten und durchs hohe Fenster dem kalten Grau dabei zusehen, wie es alles erstarren lässt, statt selbst dem Erstarren ausgesetzt zu sein und genötigt mein albernes Auf und Ab zu exerzieren an einem Ort, der nur noch ein Bedarfshalt ist ohne Bedürfnisanstalt.
pfeifen
In meinem DDR-Leben gibt es ein paar rare Momente, in denen ich das Gefühl hatte, mich in den öffentlichen Raum ausbreiten zu können, als wäre ich dort zu Hause. Einmal stand ich als Philosophie-Student nachts auf diesem kompliziert in Ost und West zerhackten Grenzbahnhof Friedrichstraße: Hinter der hohen Stahlwand, die den einen S-Bahnhof von dem anderen trennte und die eine Hemisphäre des Kalten Krieges von der anderen, hinter dieser Stahlwand fuhr der schwach vernehmlichen Ansage nach eine Bahn in Richtung Wannsee ab, in eine Region meiner Stadt, die ich aller Voraussicht nach nie zu sehen bekommen würde. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen. Aber der Andere, der ich in dieser anderen Hemisphäre damals glaubte, werden zu können, der war auch durch diese Stahlwand von mir abgesperrt. Ich konnte diesseits nur in der Musik wahr sein, soviel hatte mein Studium mich schon gelehrt. In dieser Nacht auf dem S-Bahnhof pfiff ich Violinparts der großen Konzerte und Sonaten, die ich von meinem Vater kenne und die sich in meiner Kindheit mit elementaren Emotionen verbunden haben. In dieser Nacht war ich sicher, dass meine gepfiffenen Kantilenen drüben ankommen würden bei irgendwem, der sie kennt und der verstehen würde, wie sie gemeint sind: dass sie die getrennten öffentlichen Räume für einen Moment verbinden.
platznehmen
Bis zum Bahnhof stand ich unter Stress: Ist alles verabredet und abgesendet, abgestellt und abgeschlossen? Dann hab ich am Fenster Platz genommen, der Pfiff, die Türen, der Zug rollt an, ich kann nun nicht mehr zurück, so bald jedenfalls nicht, gefangen und geborgen bin ich nun in einem Dazwischen, zwischen den Orten, zwischen den Zeiten der Abfahrt und Ankunft. Auch größte Ungeduld würde nichts daran ändern. Ich lasse mich in den Sitz sinken, lasse die mitgebrachte Arbeit erst mal stecken. Hinterm Fenster flitzen Häuser und Felder vorüber, alles so wunderbar gleichgültig, weil unerreichbar und meinem Wollen und Müssen entzogen, ich darf es anschauen, als wäre ich ein Außerirdischer. Ich muss jetzt nichts mehr bedenken und regeln, der Zug ist erreicht, nun fährt er ohne mein Zutun, ich tauche in eine herrliche Passivität, lasse mich durch die Landschaft schieben, schneller und schneller…Nun betreten Gestalten die innere Bühne, die immer da sind, aber selten eine Chance bekommen. Scheue Gestalten, die sich nur hervorwagen, wenn diese Bühne nicht hell ausgeleuchtet ist, wenn sie nicht angestarrt und verstanden werden sollen. Dann tanzen sie ihren Reigen in mir, solang mein Hinschauen sie nicht vertreibt. Wenn ich so aus dem Fenster sehe, ohne etwas zu sehen, tanzen die Gestalten, die mir so vieles zu sagen haben, wovon ich nie erfahren würde, wenn ich nicht ab und an mit dem Zug führe aus allem raus, das mich fordert und bindet. Wie lang hat es gebraucht, dafür eine Form zu finden, die Zwischenzeit in den Alltag einzubauen, in die Woche, ins Jahr, so, dass es allen guttut. Gebetsstunden, Sonn- und Feiertage. Ich flitze an all den Kirchen vorüber, denen mit geradem, spitzem Turm, denen mit gedrungenem, gebauchtem. Kostbare Auszeit in einem meditativen Zwischenraum, während der Zugfahrt. Und was für eine dürftige Form doch im Vergleich zu dem, was die Ahnen schon gefunden haben über die Jahrhunderte hin.
plärren
Die Mutter mit den zwei Kleinen, die des Zugfahrens gründlich müde sind, aber noch nicht müde genug, um zu schlafen; ein kritischer Zeitpunkt, sie haben an nichts mehr Freude, sie greinen, sie sind sich selbst zur Last, so auch der Mutter, die es noch einmal mit den Apfelhälften versucht – nein? Und einem Tee aus der längst erkalteten Flasche – nein? Und mit dem Schnuller – der fällt auf den Boden des Abteils, wird aufgehoben, abgewischt und von der Mutter abgelutscht, noch einmal dargereicht. Aber das Kleinere will nicht den Schnuller, sondern auch so etwas Schönes, was das Größere jetzt in der Hand hält, eine Apfelhälfte. Die wäre ihm zu groß; die Mutter halbiert also eine andere Hälfte mit dem Taschenmesser und reicht sie freundlich dar. Zeter, Mordio und o weh geschrien: Dieses Stück ist so groß nicht wie das andere, das die Schwester hat. Dem Untröstlichen wird mütterlicher Trost zuteil, bis er sich beruhigt hat. Inzwischen ist das halbe Apfelstück der Größeren zu Boden gefallen, nicht ganz unbeabsichtigt, denn ihr mangelt es an Aufmerksamkeit. Da die Mutter noch immer mit dem Kleinen zu tun hat, greint nun auch die Große, spielt kleines Kind, ahmt den Kleinen nach, wälzt sich am Boden des Abteils. Und diese Frau, umzingelt von enervierender Unzufriedenheit und allerart Abfällen, obendrein von den enervierten, abfälligen Blicken der Mitreisenden, diese Mutter bleibt die ganze Zeit gelassen und freundlich. Sie lächelt, erfüllt Wünsche, trägt zwischendurch die volle Windel und den ganzen anderen Abfall zum Mülleimer. Hebt nun die beiden Kinder auf den Schoß, schlägt ein Buch auf, ignoriert den Unwillen der beiden, die nicht noch einmal dies und das und jenes wollen, das ihnen die lange Zugfahrzeit vertrieben hat, sondern endlich einmal ankommen. - Dann ist es so weit, der Zug bremst. Den Kleinen auf dem Arm, versucht die Mutter mit der anderen Hand die Große anzuziehen, die sich weigert, mitzutun, der Kinderwagen rollt, die Große fällt, da hat die Mutter auch den Kleinen noch nicht aufgehuckt, jetzt werde ich nervös, in ihrer Lage wäre ich längst ausgerastet. Sie aber spricht ruhig mit den Kindern, tut nacheinander dies und das, dann hat die Große Jacke an und Mütze auf, dann ist der Kinderwagen mit den Utensilien bestopft, man stapft zur Tür, betritt den Bahnsteig und ist angekommen. Allgemeine Erleichterung. Einige Reisende geben ihre Meinung kund, dass diese Frau ihre Kinder nicht im Griff habe. Ich aber rühme sie als einen Engel ob ihrer Engelsgeduld.
pennen
Auf den ersten Blick fand ich es amüsant: Ein Teenagermädchen ist in der U-Bahn eingeschlafen, nach vorn gesackt, mit dem Gesicht an einer Haltestange abgerutscht, die Nase aufgebogen, der Mund weit geöffnet: So sehen wir dieses Gesicht überlebensgroß auf einem Plakat der BVG, „Einfach mal den Tag zur Nacht machen…“ steht drunter geschrieben. Eine Entgleisung von Gesichtszügen, nicht der U-Bahn, die die Partygängerin sicher nachhause bringen wird. Sehr originell. Etwas hat mich gleich daran gestört. Nun, da dieses Plakat seit Wochen die Berliner U-Bahnhöfe dominiert, kommt es mir zum Bewusstsein. Es ist, als wäre sie dem Posting preisgegeben. Es ist ein Tabubruch. Und Tabus sind eben nicht nur dazu da, um gebrochen zu werden. Wenn die junge Frau so vor mir in der Bahn sitzen würde, empfände ich es für uns beide als entwürdigend, ihr entstelltes Gesicht anzusehen. Ich würde wegsehen von der unfreiwilligen Bloßstellung. Hinzusehen hieße, ihr zu nahe zu treten. Beim Plakat handelt es sich um eine freiwillige Bloßstellung, die aber eine unfreiwillige imitiert. Ein menschliches Antlitz ist in seiner Entstellung Hohn und Spott preisgegeben. Das ist nicht nur lustig. Es gibt einen Schutzraum um das Offene, das wir unser Antlitz nennen. Das Gesicht zu wahren oder zu verlieren hat nicht mit Kosmetik zu tun, ein „Schlag ins Gesicht“ ist die Verletzung nicht nur eines Körperteils. Das Gesicht ist ja nichts, worauf man stolz sein könnte, man hat es nicht durch Leistung erworben. Egal ob ebenmäßig oder nicht: Es ist das eigene, das man nackt durch die Welt trägt. Man kann nicht anders, als sich darin zu zeigen. Je nach Lebensprägung und Tageslaune ist man im Gesicht erkennbar. Nicht nur identifizierbar bei der Passabfertigung. Man erkennt und wird erkannt, man sendet und empfängt seelisch direkt, wie es nur von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Nur sehr Vertraute dürfen ein Gesicht berühren oder es im Schlaf betrachten, in der Entstellung oder im Tod. Solang man nicht sein Gesicht verliert, kann man in allen Lebenslagen seine Würde wahren. Auch schlafend in der ersten frühen U-Bahn. Das geht aber nur, wenn es diesen Schutzraum der Diskretion gibt. Wenn es mir peinlich ist, die Preisgegebene so anzustarren, wie es das Plakat nahelegt.
postieren
Was haben wir für prächtige Postämter und Bahnhöfe im Land, in den so genannten Gründerjahren wurden Symbole bürgerlicher Selbstachtung errichtet, die nun allenthalben leer stehen und es schwer haben, zu verkommen, weil sie so haltbar gebaut sind. Man sieht ihnen an, dass sie uns etwas vererben wollen und wir das Erbe ausschlagen. Bahnhof und Post sind Orte der Begegnung, Hochzeitsbesuche, Todesanzeigen, in Kuverts versenkte Sehnsucht, Abfahrts- und Ankunftsfreude, Verbundenheiten aller Art gehen von hier aus und werden hier gelebt. Man kann einander, wildfremd, wie man ist, auf einer Zugfahrt das Herz ausschütten. Und im Umarmen auf dem Bahnhof ist eine Haltung, die einem selbst Halt geben kann. Im Wartesaal wird nicht geklatscht und ausgebuht, dennoch nimmt man diskreten Anteil, unsichtbare Antennen nehmen Schmerz und Freude der Anderen nebenhin wahr. Was macht es, sich so zu zeigen vor den wildfremden Anderen? Sie hören auf, wildfremd zu sein. Was macht es mit mir, wenn ich so Anteil habe? Es gibt mir die Gewissheit, von Menschen umgeben zu sein, die ich nicht fürchten muss, weil sie berührbar sind wie ich. - Ich kenne die Verwahrlosung öffentlicher Bauten aus dem ehemals abgespaltenen Osten Deutschlands und weiß, wie sie auf Menschen wirkt: Man gibt es irgendwann auf, sich im öffentlichen Raum wohl fühlen zu wollen und zieht sich in die private Nische zurück. Was dort vor unseren Augen verkam, war angemaßtes Staatseigentum, was nun verkommt, ist Eigentum der teilprivatisierten Bahn und Post. Mit den prächtigen Bahnhöfen und Postämtern verlieren wir Räume der kollektiven Selbstachtung, die wir aus jenen Gründerjahren erben können, ohne in Selbstherrlichkeit zu fallen. Dass wir uns kaum mehr in der Pracht solcher Räume begegnen, darunter leidet unser Bild von jenen Anderen, mit denen wir die Gegenwart, aber auch Vergangenheit und Zukunft teilen. Post und Bahnhof wollten als weltliche Sakralbauten, dass wir etwas zu schaffen haben miteinander und unserem privaten Verbundensein eine öffentliche Fassung geben. Als Zeichen nationaler Vergewisserung werden sie nicht mehr gebraucht. Doch was bleibt nun ausgesperrt und vagabundiert verloren durch die Stadt? Ich suche es in den Gesichtern all dieser wildfremden, zugeknöpften Leute, mit denen ich mehr oder weniger zufällig das Land bewohne. Mit denen ich mich nirgends mehr erhoben fühle unter so einer hohen Überwölbung, sondern eingeflacht in standartisierte Raumhöhen.
Passagier
„Das reicht nicht“, höre ich im Vorübergehen. Ein Junge, acht, neun Jahre vielleicht, hält seine Hand auf, darin Kleingeld, das eine Bahnhofsbedienstete eben gezählt und mit dem Automatendisplay verglichen hat. Ich bitte, helfen zu dürfen, werfe Hartgeld ein, der Junge will mir sein Kleingeld geben, das werde er wohl für die Rückfahrt brauchen, sage ich und will weiter. Wie unlogisch, denke ich nun: Wie soll es für die Rückfahrt reichen, wenn es für die Hinfahrt nicht gereicht hat. Also drehe ich mich noch einmal zu ihm um und drücke ihm fünf Euro in die Hand: „Für die Wegzehrung, wo soll es denn hin gehen?“ – „Nach Berlin.“ Ich könnte jetzt unbekümmert weitergehen, aber es gibt so viele merkwürdige Zeichen: Er ist nicht gekämmt, trägt Hausschuhe und etwas Schlafanzugähnliches, sein Rad, das er mit in den Zug nehmen will, scheint mir nicht fahrtüchtig. Wo kommt der jetzt her, wo will er hin? Das geht dich nichts an, sage ich mir energisch und steige weit vorn in den Zug. Aber schon bald hat er sich zu mir durchgequetscht, mit dem Rad durch Passagiere und Waggonbrücken. Ich hab ihm weitergeholfen, nun sucht er Anschluss. Er erklärt mir die Defekte seines Rades als spräche er von den Eigenheiten eines nahen Angehörigen, die man akzeptieren muss. So spricht Colombo von seinem Auto, denke ich, vielleicht folgt auch dieses Bürschchen seiner Intuition, wie jener zerstreute Kommissar. „Zu wem fährst du denn?“, frage ich in der Hoffnung auf die Nachricht vom Frühstück bei der Großmama. Aber er zuckt die Schultern, „nach Berlin“, sagt er wieder, „will mir die Stadt ansehen“. Nach dem Ort und den Umständen seines Aufbruchs will ich gar nicht fragen, aber die Suggestionen sind unabweisbar: die betrunkene Mutter, das Chaos, dem er an diesem reinen, frischen Morgen entkommen ist in seinen Sonntagsausflug, der ihm wer weiß wie oft schon versprochen wurde. - Und der, wer weiß wie oft schon, vor dem Fahrkartenautomaten sein Ende gefunden hat. Weiter wäre er auch heute nicht gekommen, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ich hab sein Ticket bezahlt, bin ich nun zuständig für den Ausreißer? Was hab ich da angerichtet mit meiner dämlichen Hilfsbereitschaft? Und was soll ich jetzt tun? Mich wieder vor ihm verstecken? Ich seufze, hocke mich vor sein Rad: „Das kann man alles reparieren, aber jetzt frühstücken wir erst mal in der großen Stadt. Und dann bring ich dich nach Hause.“ Wer A sagt… Ein tröstlicher Satz für solche Fälle von Dämlichkeit: der Einmischung fremder Leute in fremder Leute Angelegenheiten.
passend
„Sie wollte da hin, ich eigentlich nicht“, sagt mein kranker Freund, „sie ist Schweizerin, vielleicht hat sie gar keine Angst davor. Ich war schon in Sachsenhausen, Ravensbrück, in Yad Vashem und in der Wannseevilla. Ich wollte mir das nicht noch einmal antun. Aber wie sagt man als Deutscher einer Schweizerin, dass man da nicht hin will, weil es einem nicht gut tut. - Also bin ich mitgefahren nach Auschwitz und hab mir eine Lungenentzündung geholt. Grelle Sonne, aber ein eisiger Ostwind. Offenes Gelände, zugige Ecken. Ich wollte mich schützen, gegen die Kälte und gegen diese – Kontamination. Hab den Kragen hochgeschlagen, hab mich innerlich zu gemacht. Ich hab mir gesagt: Recherchiere das Konzept, schau dir an, wie die Polen diesen Teil ihrer Geschichte sehen. Mir fielen auch gleich die dreisprachigen Schrifttafeln auf: polnisch, englisch, hebräisch. Deutsch kommt hier nur als Tätersprache vor. Auf solche museumspädagogischen Details wollte ich achten. Auf die anderen Besucher wollte ich achten, die hielten das ja auch aus. An die jungen Leute aus Schweden wollte ich mich halten, die gingen so unbeschwert unter diesem Schreckenstor durch. Aber dann kamen sie schweigend, mit ernsten Gesichtern aus der Tür, hinter der meine Schweizerin gerade verschwunden war. Nun musste ich da auch rein. Und nichts half mir gegen die Fingernagelspuren an den Wänden der Gaskammer. Ich konnte nicht mehr so zugeknöpft da durchgehen, hab meinen Selbstschutz aufgegeben und die ganze verfluchte Kontamination von Auschwitz-Birkenau an mich rangelassen. Nun lieg ich hier, selbstverschuldet, und weiß nicht, was ich davon halten soll.“ – „Diese Massen an Besuchen aus aller Welt, die da unbeschwert hinein und belastet wieder hinausgehen – vielleicht leisten sie so etwas wie eine allmähliche Dekontamination. Wie geht es denn deiner Schweizerin?“ – „Besser als mir jedenfalls. Sie hatte auf der Hinfahrt Blumen gekauft. Ich fand das ziemlich unpassend, irgendwie naiv. Sie hat sich, wie soll ich sagen, vernünftig verhalten, während ich da mit offenem Mantel und nassen Augen im Ostwind herumstand. Ich war dem ausgeliefert, sie wusste sich zu helfen, hat ihre Blumen auf dem Trittbrett eines dieser Viehwaggons der Deutschen Reichsbahn abgelegt. Wäre mir nie eingefallen.“ - „Sie hat es sich nicht zu schwer gemacht.“ – „Sie hat sich einen Andachtsort gefunden und eine Geste. Ja, vielleicht naiv oder unbeholfen. Aber sie hat nicht nur von dieser unvergänglichen Last etwas mitgenommen, sondern auch etwas Leichtes, Vergängliches dort gelassen.“
Prinzip
Die Tochter erregt sich über einen Berliner Omnibus, nicht, weil er zu spät kam, sondern weil er zur Beute wurde. „Zur Beute, zum Vehikel einer Marke, zum Werbeträger ganz und gar, ich hab ihn gar nicht erkannt, dachte da käme ein Reisebus, so bunt von Kopf bis Fuß. Früher gab es da einen Werbestreifen um den Bauch, heute ist der Doppelstockbus ganzflächig okkupiert, sogar die Fenster.“ – „Wie diese ehemals seriöse Zeitung, die sie mir trotz meiner Antiwerbeaufkleber in den Briefkasten stopfen, weil das Titelblatt noch immer seriös ist, allerdings schräg mit Werbung überdruckt. Da hat sich eine angesehene Tageszeitung ganz ungeniert prostituiert. Da sind alle Masken gefallen, die Marktschreier triumphieren.“ – „Und dieser NRW-Wahlgewinner verkündet im Fernsehen, nun würden endlich wieder die Kräfte des Marktes entfesselt…“ – „Hat er ‚entfesselt’ gesagt?“ – „Ja! Das ist doch von vorvorgestern, was die als Fortschritt ausgeben. Gibt es denn keine besseren menschlichen Kräfte als den Drang, die anderen übers Ohr zu hauen und möglichst viel Geld zu machen? Ich dachte, das ist eine christliche Partei…“ – „…die gelernt hat, dass wir ohne Teufels Hilfe nun mal nicht auskommen. Wie dieser Doktor Faustus: Erst hat er sich den Todestrunk gemixt, lässt sich aber von den Osterglocken zu Tränen rühren und zurück ins Leben rufen. Um sich alsbald von einem schwarzen Tier verführen zu lassen. Und seine Lüste und Begierden zu entfesseln. Ein Mann des Fortschritts, der über Leichen gehen darf, solang er sich an die Gesetze hält. Der Teufelspakt ist eine Tragödie, die in den Männerbrüsten heutiger Manager eher ein Gefühl von Größe und Relevanz evoziert als etwa den Wunsch nach Buße und Rückzug ins Kloster. Es gab sogar unter den IM der Stasi welche, die sich faustisch fühlten, die sich mit dem Teufelspakt im Dienst der guten Sache wähnten, wo sie doch nur im Dienst des schwarzen Tieres standen, ihrer niederen Instinkte…“ – „Wo sind wir hingeraten, Vater? Mal wieder zu deinem Lieblingsthema, der ollen DDR.“ – „Nur am Rande. Interessanter ist doch dies faustische Prinzip: Das Zufriedenheitsverbot. Ein Prinzip, das es wohl nur in der westlichen Kultur und in keiner der großen Religionen gibt. Und das nun wirklich des Teufels ist, fatal sowohl für unser Innenleben als auch für die Außen- oder Umwelt.“ – „Du meinst: ‚Verweile doch, du bist so schön…’“ – „‚Werd ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! du bist so schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde gehn!’ An dieser Hybris, an der Entfesselung dieser ewigen Unzufriedenheit können wir tatsächlich alle zugrunde gehen.“
peinlich
Was waren Flughäfen einmal für exklusive Räume. Angesichts der Profanität der heutigen Fliegerei frage ich mich nach den mehr oder weniger nichtigen Gründen, die man haben mag, mal eben einen Billigflieger zu nehmen als wäre es eine Straßenbahn. Der Hauptgrund ist wohl – wie auch für mich - die Tatsache, dass die Fahrt mit dem Zug das Vierfache gekostet hätte. Als ich gelandet bin, schäme ich mich und nehme mir fest vor, von nun an nur noch mit dem Zug zu reisen, weil das Preisverhältnis zwischen Flug und Zug die tatsächlichen Kosten auf den Kopf stellt. Auf dem Fußweg vom provisorischen Flughafen zum provisorischen Bahnhof kommt die Großbaustelle des BER in Sichtweite, hier soll auch der neue Bahnanschluss in Betrieb gehen. Irgendwann. Nun ist mir, als wäre diese spektakuläre Verzögerung nicht nur das Werk administrativer Unzulänglichkeit und einiger Unternehmen, die an der Verschleppung Unsummen verdienen. Mir scheint auch eine verborgene Weisheit darin zu liegen, dass diese Investition in die Vergangenheit als etwas an sich selbst Ermüdetes in die Zukunft ragt. Etwas, das sich als Verkehrskonzept längst erledigt hat, kann nur unter äußersten Mühen fertig gestellt werden. – In letzter Minute erreiche ich das Züglein, das alle Stunde in meine Richtung gondelt, teils eingeleisig und stark verzögert durch eine andere Großbaustelle: Die Ost-West-Autobahn wird hier von acht auf zwölf Spuren verbreitert, Brücken werden abgerissen und neu gebaut, ein unvorstellbarer Aufwand, damit auch künftig all die Container auf Trucks statt der Schiene von Tallin nach Bordeaux reisen können. In der Schweiz gibt es separate Güter- und Personenbahnnetze, in den drei Monaten, die ich dort zubrachte, hab ich nicht eine einzige Zugverspätung erlebt. Mein Züglein steht schon wieder, in Sichtweite verwittert die in den frühen Neunzigern begonnene ICE-Strecke nach Dresden und Prag, mannshohe Bäume wurzeln im Schotter des Trassenviadukts, das sich mit optimistischem Schwung aus dem Gleisgewirr hebt und allzu bald im Offenen endet. Wie ein großes Fragezeichen. Wer hat da für und gegen wen entschieden, frage ich mich. Hinter welchen Hintertüren ist da gegen mich entschieden worden, der ich mit gutem Gewissen bequem Bahn fahren will, statt mit schlechtem Gewissen die unbequeme Auto- oder Flugreise zu wählen? Jedermann weiß: Die Schadstoffbelastung pro Fluggast ist um ein Vielfaches höher als die des Bahnreisenden. Doch Kerosin wird hierzulande ebenso subventioniert wie Dieselkraftstoff. Ihr Regierenden: Ich fordere euch auf, Anwälte meines Gewissens zu sein.
Plunderläden
Der Potsdamer Hauptbahnhof hat drei Ausgänge: einen nach Süd, zu einer lauten Straße hin, einen nach West, zu einer anderen lauten Straße hin und einen nach Nord, da ist es nicht ganz so laut. Von hier aus käme man zu Fuß oder mit dem Rad direkt zur Innenstadt, wenn es denn einen gangbaren Weg gäbe. In dieser Richtung würde man durchaus reizvoll unter hohen Bäumen erst, dann zwischen den kunstvollen Rabatten des Potsdamer „Gartenphilosophen“ Karl Förster über zwei autofreie Havelbrücken in einer Viertelstunde Fußweg die historische Innenstadt erreichen. Da es diesen direkten Weg nicht gibt, müssen Fußgänger und Radfahrer zusehen, wie sie an einer der großen Autostraßen weiterkommen. Bahnhöfe sind Repräsentanten einer lokalen Willkommenskultur, sie tun gut daran, auf all das neugierig zu machen, was sich außerhalb ihrer Mauern an Sehenswertem eröffnet… Dieser Bahnhof aber tut so, als wäre er kein Durchgangsort, sondern das Ziel aller Wünsche: Hier, sagt der Bahnhof, gibt es einfach alles: einen Riesen-Supermarkt, ein Riesenkino, Fast-Food-Restaurants, allerlei Plunderläden, panisch werbend, weil von chronischem Leerstand bedroht. Hier wollen oder müssen Menschen aus- und umsteigen, doch statt ihnen diesen Durchgang angenehm zu machen, versucht man, ihre Anwesenheit schamlos auszunutzen. Sie haben eigentlich anderes vor, doch man versucht, sie umzustimmen, sie abzulenken und zum Bleiben zu verführen. Ein klebriger Ort ist dieser Bahnhof wenngleich die Flecken von Speiseeis und Currywurst immer wieder penibel entfernt werden. Hat man die grinsende Üppigkeit glücklich hinter sich gelassen, wird man ausgespuckt in ein autofreundliches Draußen, das stinkt und lärmt statt dem Gast die Arme zu öffnen. Es gab viel Protest, bevor der Bahnhofsneubau so beschlossen wurde. Statt der kommerziellen Wucherung hätte man sich auch für eine vergleichsweise marginale Investition in die angenehm fußläufige Verbindung zur Innenstadt entscheiden können. Die Würfel sind hinter verschlossenen Türen gefallen. Nun wirkt diese Dummheit Jahr um Jahr in die Zukunft hinein: das antiquierte Bild plärrender Überversorgung, ein öffentlicher Raum, der Passanten und Reisende zur Beute der Verkäufer machen will. Eine Art Wegelagerei. Dabei ist der öffentliche Raum so wertvoll für die kollektive Selbstvergewisserung. Es hat einen Wert, wenn Menschen sich öffentlich als solche wahrnehmen. Nicht als Verdauungsorgan des Wirtschaftskörpers. Sondern als ein Selbstzweck. Das könnten sie zum Beispiel auf dem Fußweg durch die Anlagen der Freundschaftsinsel, an Orten, die einzig und allein dafür geschaffen sind, um hier in eine Art Spiegel zu schauen. Kostenlos. Ohne kommerziellen Hintergedanken. Hier könnte man sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit ganz anders wahrnehmen als im Stress des Straßenverkehrs oder in der sinnen-saugenden Bahnstation. Auf der Freundschaftsinsel überdauern einige dieser relativ simplen, vielleicht naiven Bildwerke, die aus DDR-Zeiten stehen geblieben sind, weil noch niemand Anstoß an ihnen genommen hat. Zu meinen DDR-Prägungen gehört das gebrochene Wohlgefallen, das ich an ihnen hab. Gebrochen, weil sie ja auch eine Art Werbung waren für die einzig wahre Ideologie. Wohlgefallen, weil die spielenden Kinder und glücklichen Eltern aus Bronze doch immerhin einen Hinweis darauf geben, dass der öffentliche Raum kostbar ist und auch zu anderem taugt, als darin die nächste Würstchenbude aufzustellen.
partizipieren
Man fragt mich für eine Fernseh-Talkshow an, ich bitte mir einen Tag Bedenkzeit aus, den mir die Redakteurin widerwillig, mit einer Mischung aus Belustigung und Beleidigtsein gewährt. Dass das Fernsehen unser Leitmedium ist, weiß ich natürlich, wie sich diese Machtposition am Telefon anfühlt, hatte ich nicht gewusst. Sei’s drum, ich bedenke mich also, und die Entscheidung nimmt mich so sehr in Anspruch, dass es mich drängt, auf dem Heimweg mit der Bahn im Speisewagen davon anzufangen.
Was hatte ich schon für gute Gespräche in diesen Speisewagen! So unbelastet, heiter, so überraschend tiefgründig. Im Speisewagen erlebe ich Menschen, die sich vorher nie begegnet sind, sich wahrscheinlich nie wiedersehen werden, und sich dennoch für längere Zeit physisch nahe sind. Sie haben viel Zeit für ein Gespräch jenseits der sonst nötigen oder üblichen Rücksichtnahmen. Eine Gesprächsebene, auf der man belanglos plänkeln oder auf kurzem Weg in höhere Sphären gelangen kann. Man kann erstaunlich offen sein, denn man hat wenig zu verlieren in diesem halb öffentlichen, halb privaten Raum zwischen Abfahrt und Ankunft. In diesem Zwischenraum. Um meinen Landsleuten zu trauen, um sie zu mögen brauche ich diese spontanen Gespräche, die nicht organisiert, nicht institutionell verankert sind und frei von aller Nützlichkeit.
Mir gegenüber ist ein Herr meines Alters mit dem Handy befasst, was mich aber nicht hindern wird, ihn zu überfallen. Erst zögere ich noch, weil es nicht mehr so normal ist wie es früher war, mit diesen Wildfremden, mit denen man das Land bewohnt, aus heiterem Himmel ein Gespräch zu beginnen im Vertrauen, sie hätten ein ähnliches Interesse an dieser Art Austausch und würden den Gesprächsfaden ganz selbstverständlich aufnehmen, wo er gerade liegt: An einer Haltestelle, in einer Warteschlange oder hier, in diesem Zwischenraum. Sicher bin ich mir nicht, tu aber einfach so, als wäre nichts dabei und schieße gleich los: „Man hat mir angeboten in einer Talkshow mitzumachen, dabei hab ich diese Art, einander ins Wort zu fallen, nie gemocht, diese Kurzatmigkeit, Überspanntheit. Ich kann so kein Gespräch führen, so kann sich nichts neues entwickeln, so entsteht nichts, was die Beteiligten noch nie gedacht oder gesagt haben, die Statements wirken reproduziert und bleiben nebeneinander stehen. In einem richtigen Gespräch bleibt doch Raum fürs Bedenken, wonach man etwa einen Gedanken abschließen oder sich auf eine Metaebene schwingen kann. In diesen Talkshows ist alles so vorhersehbar, so vorselektiert. Und nie bekommt man die zu sehen, die abgesagt haben. Damit verglichen ist ein Speisewagen ein Dschungel an Unvorhersehbarem…“ Mein Gegenüber starrt mich verdattert an und versucht offenbar, meine Gesprächsattacke einzuordnen: Eine Anmache? Anwerbung? Ein psychisch Labiler? Offenbar war er auf so eine analoge Offerte nicht gefasst. Vielleicht hat er eine andere Vorstellung von einem Speisewagen: Man sitzt hier, um etwas zu sich zu nehmen, da Platzmangel herrscht leider nicht separat, sondern notgedrungen in allzu kurzer Distanz zu anderen Reisenden, eine Not, die man zu mindern sucht, indem man auf dem Handy wischt, aus dem Fenster blickt oder in eine Zeitung. Jetzt rafft er die Gesichtszüge, räuspert sich und spricht: „Ich bin nicht interessiert.“ Und da ich ihn nun auch verdattert ansehe, legt er nach: „Ich lehne Ihr Gesprächsangebot dankend ab.“ Für mich sind das Sätze aus einer anderen Welt, sie gehören nicht hierher. Auch ich fühle mich deplatziert und wechsle den Platz. Bei nächster Gelegenheit rufe ich die Fernsehredakteurin an und sage ab mit der Begründung, ich sei einfach zu altmodisch. Dass es doch aber gerade um meine Altersgruppe in der Talkshow gehen solle, beharrt sie. Dass meine Absage aber doch nicht mit meinem Alter zu tun habe, beharre ich, sondern mit meinem altmodischen Lebensstil. Eine Talkshow, sage ich, sei ein Ersatz für etwas Unersetzliches. Sie schweigt. Ich schweige. Dann legen wir auf.
paradox
Nach meinem Umzug will mich ein alter Freund besuchen und fragt am Telefon nach dem Weg. „Komm doch mit dem Zug, das geht schneller und macht weniger Stress“, schlage ich vor. „Mit dem Zug?“, fragt er, als wäre es eine Zumutung, „warst du mal auf unserem Bahnhof?“ Das muss ich verneinen, womit sich das Thema für ihn erledigt hat. Als er dann bei mir angekommen ist, hat er im Auto darüber nachgedacht, warum der Bahnhof an seinem Wohnort seit Jahren einen so schäbigen Eindruck macht, dass er sich da ungern hin begibt, weder, um jemanden abzuholen noch um dort auf einen Zug zu warten. Warum das Zugfahren für ihn und manchen, den er kennt, so ein negatives Image hat. Warum die ökologische Guttat, mit dem Zug zu fahren als sozial abwertend erlebt wird. Offenbar will er sich rechtfertigen. Er referiert, was er vom Hörensagen übers Zugfahren weiß: Da gibt es ständig Verspätungen oder die Züge fallen ganz aus. Die Heizung streikt oder die Kühlung. Oder die Lockführer streiken. Was man eben so liest und im Fernsehen sieht… Nein, da fährt er lieber mit seinem Auto, da ist er sicher, da fühlt er sich einfach besser. Ich verstehe nur Bahnhof, weil ich meinen Freund so ignorant nicht in Erinnerung hatte. Ich finde es paradox, dass sein Besserfühlen im SUV so gar nichts mit seinem Öko-Gewissen zu tun hat. Wozu man ein Gewissen habe, wenn man nicht danach handelt, frage ich ihn und wie der Bahnhof aussehen müsste, den er gern frequentieren würde. Das hätte ich nicht tun sollen, denn jetzt holt er ganz weit aus, erzählt mir von Moskauer U-Bahnhöfen, die er für Paläste hält und einer Schweizer Wartehalle, die auf ihn den Eindruck einer Galerie gemacht habe. Mein alter Freund versteigt sich zu der Behauptung, mit der Bahn zu fahren wäre ihm ein Fest, wenn nur ein Bruchteil jener schöpferischen Energien in unsere Bahnhöfe flössen, die seit Jahrzehnten in unsere Autos fließen, damit wir uns darin so ganz und gar wohl fühlen. Sicher und geborgen. Wie in einer zweiten Haut… Nun ja, ganz unrecht hat er nicht. Sein zu Recht schlechtes Gewissen beim Autofahren bildet sich natürlich nirgends ab im Design seines Wagens.Die Car-Designer haben es weit gebracht mit den Irrationalitäten bei der Wahl unserer Fortbewegungsmittel. Und zu diesen irrationalen Aspekten gehört natürlich auch das demütigende Gefühl, auf so einem heruntergekommenen Bahnhof zu stehen. Diese Demütigung muss im Interesse der Autoverkäufer liegen. Vielleicht steckt sogar ein geheimes Kalkül dahinter, vielleicht stecken die Manager des schlechten Bahn-Images mit der Auto-Lobby unter einer Decke. Wie viele Bahnchefs waren vorher in der Autobranche?
Ich hab mich ja längst an die abgeranzten Bahnhöfe gewöhnt, aber nun muss ich ihm doch recht geben: Auch ich fühle mich dort eher geduldet als willkommen und in meinen ökologisch korrekten Absichten verhöhnt. Ich sage das meinem Freund, und nun kommen wir auf die grüne Ästhetik einer möglichen Bahnhofskultur. Wir entwerfen Bahnhöfe, die das ökologisch Sinnvolle des Zug Fahrens widerspiegeln. Einen Provinzbahnhof, der mit demselben Aufwand an kreativer Energie gestaltet ist wie das Wohlfühl-Image seines Sport Utility Vehicle und mit einem ähnlichen Effekt der sozialen Aufwertung. Einen Bahnhof, der den Reisenden das Gefühl gibt, das Richtige zu tun und willkommen zu sein. Wir phantasieren über das Bahnhofdesign der Zukunft. Wir erfinden sogar einen Werbesloagan: „Schneller als auf Gummireifen / offroad durch die Pampa gleiten, / ohne Schadstoff zu verbreiten / ist ein Fahrspaß der Gescheiten.“ Dann ist es Zeit zum Aufbruch und mein Freund fährt wieder heim. Im Auto.
Pedale
Drei sehr junge Frauen in der S-Bahn, vielleicht Studentinnen, betuddeln und befachsimpeln ein Baby, eine von ihnen ist offenbar die stolze Mutter. Es wird gestillt, gewickelt, beklopft und bespaßt, jede Regung des Kindes wird ausführlich kommentiert, begackert. Babykult eben, so übertrieben, so laut, so albern und harmlos, wie er nun mal ist. Gegenüber auf der Bank eine sehr junge Frau weniger mütterlichen Typus, vor sich das Rennrad, auf den Knien das aufgeschlagene dickleibige Lehrbuch, sie fühlt sich gestört von dem Theater gegenüber, und nicht nur das, man sieht ihr deutlich an, wie sehr ihr das weibische Getue auf die Nerven geht. Immer wieder vertieft sie sich demonstrativ in die Lektüre, seufzt, hält nach einem anderen Platz Ausschau, aber den gibt es nicht. Sie versucht, den Dreien gegenüber ihr Recht zu behaupten. Und ich, der Zuschauer, gebe ihr Recht, der mit Rad und Bahn gut organisierten Studentin, die ihre Fahrzeit als Lernzeit eingeplant hat und ihr Pensum schaffen will. Gebe ihr Recht, bis ich Zeuge werde, wie sie aus der Bahn gerät, immer häufiger aufblickt zu den Dreien hin, der Vorwurf aus ihrem Aufblick schwindet, sie statt dessen zu starren beginnt, sich energisch zurückruft ins Buch, wieder abgleitet mit dem Blick, scheinbar der Lektüre nachsinnend, aber tatsächlich an diesem Kind haften bleibt, es anglotzt und sich dabei abhanden kommt. Schließlich mit offenem Mund, das Kinn auf dem Sattel, hingegeben da hinüberstiert, nicht mehr genervt, auch nicht eifersüchtig, sondern in beginnender Auflösung all dessen, was sie bisher war. Ihr entgleisen die strengen Gesichtszüge, in ihrem Gesicht flackert ein Kinderlächeln, das nie erwachsen wurde, sie rutscht mit dem Fuß von der Pedale, beinahe stürzt das Rad um, das Buch fällt auf den Boden, die Tasche hinterher, sie errötet, sammelt auf, der Zug bremst, da rollt ihr Studienzeug fort durch den Wagen, Stifte, Marker, Killer, nichts, das nicht auch zu einem Mann gehören könnte, mir scheint, genau das bemerkt sie jetzt auch.
Passanten
Am 24. 12. 2008 begebe ich mich, nachdem es dunkel geworden ist, zum Hauptbahnhof der Landeshauptstadt Potsdam, der Stadt, in der ich wohne. Dort angekommen, studiere ich zunächst den Fahrplan, um die großen Szenen bei der Abfahrt und Ankunft der Fernzüge nicht zu verpassen. Es gibt nur noch einen einzigen Fernzug, der in Potsdam hält, es ist der Intercity-Express nach Norddeich-Mole um 7.44 Uhr. Nach seiner langen Fahrt an den westlichen Rand und zurück, trifft er gegen 18 Uhr wieder in Potsdam ein: von Emden-Außenhafen, wo er gegen Mittag abfuhr. Ich frage mich, wo das wohl sein mag, und weshalb der wackere IC nach Norddeich-Mole hin und von Emden-Außenhafen zurück fährt, als die Bahnhofsuhr eben auf 18 Uhr vorrückt, und der besagte IC einrollt. Es ist einer dieser weiß angestrichenen, wie sie in den Neunzigern noch zwischen Hamburg und Berlin verkehrten, auch über Potsdam nach Hannover. Vielleicht, denke ich, ist das eine Art letztes Alibi für einen landeshauptstädtischen Zentralbahnhof, der zu nahe der Bundeshauptstadt gelegen ist. Ungefähr sechs Fernreisende entfallen den Waggons, einer von ihnen wird alsbald heftig umhalst und bekreischt. Ein kleines Empfangstheater, das mich von einer anderen, stillen Szene ablenkt. Als ich die beiden entdecke, stehen sie beinahe reglos ineinander versunken. Wie der Regen im See. Ach, Du einsamer alter IC, was Du alles kannst!
Vor der Ladenpassage wird der Eiserne Vorhang herabgelassen, die Erschöpfung ist der kitschigen Weihnachtsdeko anzusehen, die bis eben noch lamettalächeln musste, bis eben noch sind sie hier geflutet und gehetzt, um dem Ereignis irgendwie gerecht zu werden. Dieser allgemeinen Überforderung „Heiliger Abend“. – Jetzt hat er statt, der Abend. Nun sind sie beim Auspacken, und Staunen und Dankesagen. Nein, ich will nicht dabei sein, will es mir auch nicht vorstellen. Sehen will ich, was hier übrig bleibt, im öffentlichen Raum, wenn alle Messen gesungen sind. Wenn nur noch dieses amerikanische Gejammerschreie aus den unsichtbaren Boxen herabkleckert auf die noch nicht gewischten Fliesen.
Die Läden sind geschlossen. Was man sonst nie im Jahr verkaufen konnte, die Bindungspanik hat es unter die Leute gebracht. Ladenhüter ausverkauft. Alle Imbiß-, Bäcker- und Coffeestände sind geschlossen, einsam wacht nur dieser Indo-Cinese, wo man Entekross mit Massalacurry bekommen kann. Ich frage die schmaläugige Schöne, wie lang sie heute geöffnet habe, sie zuckt die Schultern. Mit einem grünen Tee setze ich mich und notiere, was mir unter die Augen kommt. Ein paar sehr Eilige sehe ich, fein gekleidet mit großen Tüten, Panik im Blick: Die Katastrophe, heute zu spät zu kommen. Und ein paar sehr Uneilige sehe ich etwas unentschlossen herumstehen, telefonieren, nach dem Parkplatz oder der Anzeigetafel Ausschau halten. Vielleicht tun sie, wie ich, nur so, als käme da noch wer.
Ein vielleicht sechsjähriges schmaläugiges Mädchen, steht im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Offenbar ist sie die Tochter der Asiatin, sitzt an einem der Tische und malt eine große Weltkarte aus. Die Mama gibt ihr Anweisungen in einem harschen Ton, der hierzulande aus der Mode gekommen ist. Das Kind steckt die mütterlichen Raunzer weg, sie weiß, wie es gemeint ist, malt sorgfältig, emsig, unbeirrt vom Kommen und Gehen um sie herum, das sie gleichwohl genau beobachtet. Als sich ein Betrunkener zu weit über ihren Tisch lehnt, ruft sie: „Ich sag’s der Mama!“ und stößt mit dem Pinsel nach ihm.
Jemand schiebt seltsam umständlich einen Rollstuhl zwischen die bestuhlten Tische, es scheint, als habe er sich angewöhnt, die Last zu demonstrieren, die ihm diese Rollstuhlschieberei macht. Jetzt erst bemerke ich, dass der Rollstuhl auch besetzt ist, eine Frau hängt da mehr, als dass sie aufrecht säße, ganz passiv, und so ausdruckslos, dass man ihre Gegenwart kaum bemerkt. Stöhnend begibt sich der Rollstuhlschieber zur Theke, bestellt etwas zum Mitnehmen, setzt sich mehrere Tische vom Rollstuhl entfernt und wartet. Er tut, als wolle er immerhin für diese Wartezeit mit dem Rollstuhl nichts zu tun haben.
Jetzt kommt ein vielleicht 16jähriger Junge im Anzug, hinterdrein watschelt seine merkwürdig alterslose, rundliche Mama in der Festtagsjacke. Er spricht besonders laut und deutlich zu ihr hin, sie antwortet leise, nuschelig in gebrochenem Deutsch, versucht es immer wieder russisch, worauf er sich aber nicht einlässt. Sie schämt sich in der Öffentlichkeit, er will sich ihrer in der Öffentlichkeit nicht schämen, was ihn offenbar einige Mühe kostet. Er will in dieser Öffentlichkeit bestehen, auch mit ihr. Er ist hier der Erwachsene, sie das Kind. Er holt ihnen ein feines Essen. Sie ist vielleicht nie in Deutschland angekommen und Jolka ist ja erst später im Jahr. Er aber feiert mit seiner Mama jetzt hier so etwas wie Weihnachten, mit einem feinen chino-indischen Nudelessen.
Immer wieder wird das malende Mädchen von jenem Gast gestört, der eben noch auf die Bahn geschimpft und so getan hat, als wolle er ganz schnell nach hause. Er geht mit der Flasche auf und ab und beugt sich über ihren Tisch, um ihre Arbeit zu loben oder ihr Fragen zu stellen. Jetzt setzt sie sich zu einer älteren Asiatin, die aus den hinteren Gelassen nach vorn gekommen ist. Der angeblich Eilige stutzt, schüttelt den Kopf und zieht ab. Enkelin und Muhme aber sind ein Paar und haben viel Freude aneinander. Die Großmama muss die Augen schließen, die Kleine führt ihren Zeigefinger hier- und dorthin auf dem großen ausgemalten Blatt: sie soll die Länder raten. Als sie Kind war, war die Welt hinter der großen Mauer nicht so wichtig, wie sie es heute ist. Großmama rät falsch, und die Kleine lacht und klatscht die Hände. Ach, Du lausiger Bahnhofsimbiss, was Du alles kannst!
Ein weißhaariger betritt die Bühne, nein, er schummelt sich in die Szene, tritt beiläufig ein ums andere Schrittelchen näher, bleibt auf der unsichtbaren Grenze zwischen Bahnhof und Imbiss stehen, schaut, erwägt, wartet. Er sieht aus, als habe er den Rollwagen mit seiner Habe in Sichtweite geparkt. Er sieht nicht aus, als wolle er Geld auch nur für ein Bier ausgeben. Vielleicht hofft er auf weihnachtliche Freigiebigkeit und hält nach jemandem Ausschau, der dafür in Frage kommen könnte. Er ist erstmal da. In der Runde und noch außerhalb. Man soll ihn nicht nach seinem Begehr fragen, aber schon als Teil des vielleicht doch irgendwie festtäglich versammelten Kreises verstehen. Er steht und schaut uns an, als wären wir seine Familie, uns, die wir doch gar kein WIR sind, sondern in der Mehrzahl wohl Menschen, denen ihre Anwesenheit hier am Heiligen Abend eher peinlich ist. Aber er hat schon recht: Es liegt eine verzweifelte Verbrüderung in der Luft. Und die wird früher oder später ihren Weg finden, wenn genug Bier geflossen ist. Die schöne Asiatin weiß das auch: Es gibt was zu verdienen, und es ist nicht ganz ungefährlich, denn heute sind die großen Gefühle im Spiel.
Der Rollstuhlschieber bekommt seine verpackte Portion, verpackt sie umständlich in seinem Rucksack, den er sich umständlich aufschnallt, bevor er laut aufseufzend mit dem Rollstuhl wieder von hinnen schiebt. Der Weißhaarige nutzt die Gelegenheit, um einen entscheidenden Schritt näher zu treten. Nun ist er drin, das Milieu kippt ins klebrig Private. Der Russenjunge räumt das Geschirr ab, hilft seiner Mama auf die runden Beine, verlässt, bewusst laut und deutlich akzentfrei mit ihr redend, den Imbiss, überwindet seine Scham, indem er besonders „öffentlich“ die Rolle eines erwachsenen Sohnes spielt. Offenbar hilft ihm das. WIR, die in diesem Bahnhof noch vorhandene Restöffentlichkeit, helfen ihm, seine Rolle zu spielen. Immerhin. Ich zahle und folge dem Sohn und der Mutter ein Stück. Er geht langsam voraus, sie wackelt lächelnd hinternach. Bestimmt ist er stolz auf seinen öffentlichen Auftritt, und sie ist stolz auf ihren feinen Herrn Sohn. Ach, Du dummer neuer Hauptbahnhof, was Du alles kannst!
paterjal
Mein Handy ist weg, einen Tag lang lasse ich es immer wieder klingeln dort, wo es inzwischen gelandet sein mag, unter einem S-Bahn-Sitz, in einem Müllcontainer, in der Spree vielleicht. Was für ein hilfloser Zustand: Mein Handy kann mir nicht sagen, wo es ist, und ich bin nicht erreichbar. Am Abend nimmt jemand ab, lallt: „Finderlohn? Wie viel? Zwanni ist okay.“ In einer Stunde sei er sowieso am Ostbahnhof, um Nachschub zu holen, da könnten wir uns treffen, ja wo nur, er sei schon leicht betrunken, kichert er, „am besten bei McDoof“. Der Ostbahnhof heißt auch Kotzbahnhof, weil ein paar große Nachtclubs in der Nähe sind. Tatsächlich riecht es so penetrant nach Erbrochenem, dass ich den Eingang von außerhalb des Bahnhofsgebäudes im Blick halte. Draußen lauer Südwest, eine großartige Mittsommernacht bricht an, der volle Mond erhebt sich links über die Dächer Ostberlins. Von rechts nähert sich zögernd eine Bettlerin mit feinem Gesicht, spricht mich gebrochen deutsch um etwas zu essen an. Da alles andere geschlossen ist, kaufe ich ihr bei McDoof ein Abendbrot; sie nimmt es sehr bewegt entgegen, ein Schluchzen will sich Bahn brechen. Jetzt ist mein Schulrussisch zu etwas nütze: Ich wünsche ihr alles Gute. Als ich wieder an der frischen Luft bin, kann sie mich nicht sehen, ich aber sehe sie in der Spiegelung der auffliegenden Glastür. Sie isst nicht. Unverwandt starrt sie zum Fenster hinaus. Vielleicht brauchte sie kein Essen, sondern Geld. Oder hab ich das Falsche gekauft, hab nicht bemerkt, dass sie keine Zähne mehr hat? Als sich zwei Stunden später der Vorplatz mit Discogängern füllt, die bis zum Hals und nicht nur unter Endorphinen stehen, beschließe ich, mein Handy aufzugeben. Den Finder konnte ich nicht finden. Die seltsam alterslose Frau hat immer noch nichts angerührt, aber inzwischen ihre Haltung wiedergefunden. „Dlja sawtra“, sage ich, „für morgen“ und lege einen Schein auf ihren Tisch. Erst will sie abwehren, dann strafft sie sich und nickt. Kunst des Nehmens: Sie macht es uns beiden leicht und lächelt beinahe aristokratisch. Und ich bin geneigt, dem allem einen höheren Sinn beizumessen: Dass mit dem Handy und seinen gespeicherten Kontaktleichen auch ein paar fernmündliche, kurzschriftliche Illusionen verschwunden sind, und dass ich dieser Frau begegnet bin, meiner unmittelbaren Erreichbarkeit.
Puppe
Berlin, Alexanderplatz: Der hohe Bahnhof hängt voller riesiger – ja, was? Plakate? Schautafeln? Stabil gegen Wind, unabhängig vom jeweiligen Tageslicht zeigen sie die immergleiche Frau mit winzigen Nuancen in Haltung und Gestus. Für solch eine außergewöhnliche Performance braucht es ein Kennerpublikum, Englisch verstehen muss man auch: „Experience our new store“. Wenn ich das nicht verstehe oder zu ignorieren trachte, bin ich ein Depp. Was so mega-mega und zugleich so exklusiv daherkommt, muss einfach mehr zu bedeuten haben als die gemeine Werbung. Also gut, nehmen wir das mal ernst: Ist es eine Huldigung an die Frau ganz allgemein? An diese Frau? Wird da ein besonderer Mensch gefeiert, eine Gestalt, ein Gesicht? – Nein, es handelt sich bei dieser Frau um ein namenloses Model mit der Ausstrahlung von einem Glas Buttermilch. Und das ist Absicht. Im Mittelpunkt steht ein Mensch, der nicht im Mittelpunkt stehen soll. Dass diese Frau Kleidung trägt, scheint ebenso nebensächlich wie ihre Person, ist aber die Hauptsache der Inszenierung. Die Hauptsache kommt auf leisen Sohlen, um das Bewusstsein nicht zu wecken und seine Abwehrbereitschaft. Eine nicht unschöne Frau präsentiert sich da in mehrfacher Überlebensgröße, darf aber ihre Kleidung nicht überstrahlen. Keine Puppe, ein lebender Mensch soll sie sein, aber weniger bedeuten als das fließende Beige, das sie umhüllt. - Gigantisch vergrößert, umstellt mich ein Gesicht, an das ich mich fünf Minuten später nicht mehr erinnern soll. Was für eine menschenverachtende Botschaft, die sich mir erst enthüllt, als ich zu lange hingesehen und darüber nachgedacht habe. Viel länger, als von den Inszenatoren kalkuliert. Das Gesicht dieser Frau ist vollkommen in seiner Ausdruckslosigkeit, ohne jede Spur einer eigenen Geschichte, geschweige denn eines Schicksals. Es liegt auf der Hand: Dieser Mensch braucht eine Designermarkenhülle, um ein Ich – nicht zu sein, aber doch zu scheinen.Ein Ich, das man sich jederzeit aus dem Kleiderschrank borgen kann, wenn man einmal genug dafür bezahlt hat. Kein Mensch aber ist auf der Welt, um einen Kleiderständer abzugeben.
Problemeuropa
Die Enkelin geht zum Schüleraustausch für ein halbes Jahr nach Spanien, wunderbares Europa, denke ich, wie gut, dass ihr nun möglich ist, wonach wir uns in ihrem Alter so gesehnt haben. Freilich, ein paar bürokratische Hürden seien da noch, erzählt sie mir. Das spanische Kultusministerium verlange die Zeugnisse der letzten beiden Jahre, beglaubigt. Also in ein tabellarisches Formular der Entsendeorganisation übertragen, auf einem Kopfbogen der Schule ausgedruckt gestempelt und vom Direktor unterschrieben. „Hui!“, entfährt es mir. Aber das war deutlich zu früh gewundert, denn die Enkelin fährt fort: Die Schriftstücke müssten nun von einer vereidigten Übersetzerin ins Spanische übertragen werden, zusammen mit der „Apostille“ (ich wusste vorher nicht, was das ist) müsse das Original mit der Übersetzung per Einschreiben zur Entsendeorganisation, die für die Weiterleitung nach Spanien sorgen würde. Das Problem sei die vereidigte Übersetzerin, ihr Befähigungsnachweis gelte in Deutschland, nicht in Spanien, das heißt: eventuell eben doch auch in Spanien, was aber erst in einem je zu übersetzenden Briefwechsel hin und her zu klären sei. „Nein!“, entfährt es mir jetzt. „Doch!“, sagt die Enkelin, „mein Klassenkamerad geht ein halbes Jahr nach Bolivien, das ging ganz einfach. Warum ist das so kompliziert in Europa?“ Die Verwirrung bleibt mir erhalten, ich dachte, der Austausch innerhalb Europas sei inzwischen viel unkomplizierter. Ich erinnere mich an meinen letzten Spanienbesuch: Auf dem Hügel der Stadt, den dereinst eine Kapelle krönte, thront jetzt das riesige, nachts angestrahlte Logo einer deutschen Supermarktkette, hier ist der Austausch offenbar gelungen, wenn auch etwas einseitig, die örtlichen Bauernmärkte, hörte ich, würden vom Sog der eingeführten Billigwaren ausgetrocknet, die örtliche Landwirtschaft zur billigen Massenproduktion genötigt… Als ich mich daran erinnere, will es mir scheinen, als gäbe es in diesem Europa an bestimmten Formen des Austausches deutlich mehr Interesse als an anderen, nein: Als gäbe es nur ein ökonomisches Interesse an diesem Europa und alles andere sei lästiges Beiwerk, mit bürokratischen Hürden bewehrt. Aber dann sitze ich bei fünf jungen Leuten, die der Zufall aus vier europäischen Ländern im Zugabteil versammelt hat und werde Zeuge eines fröhlichen Austauschs, der von niemandem behindert werden kann.
präpariert
Neujahrsnacht 15/16 in der S-Bahn, wie in jedem Jahr liegen große Sätze und Vorsätze in der Luft, in diesem Jahr auch ein großes Thema. „Alle sagen jetzt: Sie werden uns guttun“, ereifert sich mein Gegenüber, „warum eigentlich, was hat dieser Ansturm mit uns zu tun, mit unserer Geschichte, unseren Zukunftsplänen, mit dem, was wir sind und eigentlich vorhatten?“ - „Zukunftspläne?“ fragt sein Nachbar, „was hatten wir denn vor, wir Nachkriegsdeutschen? Außer unserem Wohlstand? Der steht seit 70 Jahren auf der Agenda. Was haben wir vor, nachdem jeder alles hat? Dass jeder alles zweimal hat, dreimal? Um die Wirtschaft anzukurbeln? Wir stecken seit 70 Jahren in den Vorbereitungen auf etwas, das wir nicht kennen.“ – „Der Ansturm ist doch reiner Zufall. Und das soll der ganze Sinn unserer Wirtschaftskraft sein? Dass wir Herberge sind? Was hat das mit uns zu tun? Aber alle tun so, als hätte es. Tun so, als wären wir gemeint mit dem Ansturm, dabei ist es nur die Hyperausstattung unserer Herberge.“ – „Wir wollen eben geliebt sein von der Welt, nachdem sie so viel Grund hatte, uns zu verachten und zu fürchten. Was für ein wunderbares Gefühl: Die halbe Welt steht vor unseren Toren, weil wir so ein liebenswertes Volk sind.“ – „Was für ein Trugschluss.“ – „Moment. Gerade wegen unserer Geschichte haben wir ein besonderes Verhältnis zu diesem Ansturm. Also sind eben doch wir gemeint: als diejenigen, die aus ihrer Geschichte gelernt haben. Unser besseres Wir ist gemeint mit dem Ansturm, er trifft unseren vielleicht naiven Wunsch, irgendwann wieder zu den Guten zu gehören.“ – „Genau: Unsere deutschen Selbstzweifel werden ausgenutzt, unsere deutsche Schuld, da sind wir verletzlich.“ – „Umgekehrt: Der Ansturm gibt unserer manischen Präparation endlich einen Sinn. Und: Wir haben zugesehen, wie sie unsere jüdischen Nachbarn abgeholt haben. Aber die Abholer und Abgeholten – das waren auch wir. Diese Fremden vor unseren Toren geben uns die Chance, vor uns und der Welt eines Tages anders dazustehen. Nicht mehr als die Gebrochenen, Zerrissenen, die nicht zu sich stehen können, sondern...“ – „Alles Schwachsinn: Dieses Wir gibt es gar nicht: Uns Deutsche. Wer soll das denn sein. Und willst du dazugehören? Was du meinst ist ein nicht vorhandenes geschichtliches Subjekt…“ - So geht es hin und her mir gegenüber in der S-Bahn, und ich staune, was dieser Ansturm für hohe Wellen schlägt.
pitschnasse Piste
Einen Rest von Luftschiffhafen hatte so ein Airport noch zu bieten, als ich das letzte Mal geflogen bin. Das ist ewig her, und ich staune über die Ernüchterung, die in das Geschäft eingezogen ist. Profan wie an der Straßenbahnhaltestelle. Im überfüllten Bus karrt man uns aufs Flugfeld, es gießt aus Eimern. Die pitschnassen Passangers drängen sich im engen Inneren der Maschine um Sitz- und Ablageplätze. Alles glitscht und dampft. Nachdem ich vergeblich versucht habe, den Anderen nicht im Weg zu sein, hocke ich mit eng geparkten Beinen auf meinem Mittelplatz und suche unterm Gesäß nach den Gurten. Seit wann bin ich so schwer? Ein kurzer Seitenblick. Da sitzt eine bildschöne Frau, schon angeschnallt, den Kopf in ihre Jacke neben dem Fenster geschmiegt, sie bemerkt meinen Blick, lächelt kurz. Was für ein Blick. Durch und durch, sagt man. Dass es sich genau so anfühlt, hatte ich vergessen. Aber das war ihrerseits gewiss nichts Persönliches. Natürlich nicht. Die Sonne blendet ja auch und meint es nicht so. Ein Bildschirm klappt auf, wir erfahren alles Nötige über die Notlandung. Meine Nachbarin lehnt sich wieder in ihre Jacke und schließt die Augen. Ich bemerke, dass der Gangplatz leer geblieben ist. Wenn wir in der Luft sind, werde ich dorthin wechseln.
Der Flieger nimmt seinen Anlauf, meine schöne Nachbarin ist schon eingeschlafen. Sie ist nicht dabei, als wir abheben. Sie scheint sehr erschöpft zu sein. Wir klettern durch die Wolken, ich sehe von meinem Mittelplatz aus dem Fenster ins weißer werdende Grau und nehme auch die unruhig schlafende Nachbarin wahr. Ich spüre ihren raschen Atem. Träumt sie? Jetzt sehe ich ihre flackernden Lider, ihre zuckenden Hände, sehe darin die Spuren großer Gesten, die wohl aus dem Traum ausragen. Ihre langen übereinander geschlagenen Beine zucken, als wäre sie auf der Flucht.
Wir stoßen ins Helle, in gleißendes Licht. Um mich von ihr abzulenken fixiere ich das Anschnallzeichen, das immer noch leuchtet. Da wirft sie sich zu mir hinüber, wie man es im Schlaf eben tut. Nichts Persönliches. Sie schmiegt sich in die Rückenlehne zu meiner Seite, ihr Kopf sackt, da wir nun kaum mehr steigen, nach vorn. Sie schreckt zurück, erwacht aber nicht. Der Kopf sinkt wieder vor, baumelt. Halbwach sucht sie in den Ecken der Kopfstütze Halt. Rutscht mehrmals ab und landet plötzlich an meiner Schulter, denn die ist da, wo ihre Kopfstütze endet. Hoppla, Pardon, will ich grade sagen und abrücken. Aber sie schläft weiter. Ruhiger als zuvor. Lächelt sie?
Wenn eine Frau ihren Kopf an die Schulter eines Mannes lehnt, so hat das etwas zu bedeuten. Und genau so fühlt es sich an: Ich traue Dir, beschütze mich, behüte meinen Schlaf. Es ist nicht so gemeint, aber es fühlt sich so an. Zwei Stimmen beginnen in mir zu streiten: Du deutest die Situation falsch, und du weißt es. Eigentlich ist das ein Übergriff, was du da tust. – Aber ich tu ja nichts. Ich sitz hier nur herum, wo sich zufällig ihr Kopf eingefunden hat. Wenn schon Übergriff, dann ihrerseits. Ich bin nur der Lehnpfosten. – Es bedeutet dir aber viel mehr. Wann hat sich das letzte Mal eine Frau so bei dir angelehnt? Du missverstehst willentlich. Es ist ein Deutungsübergriff. – Aber so fühlt es sich nicht an: übergriffig. Eher: väterlich. – Du lügst. – Lüge ich? Und jetzt? Soll ich abrücken? Sie schläft viel besser so. – Darum geht es nicht. – Doch, darum geht es. – Du samaritischer Heuchler! – Was tu ich denn? Gar nichts. Ich sehe sie nichtmal an. – Du siehst sie nicht direkt an. Aber aus den Augenwinkeln unternimmst du Spaziergänge von ihrem Kinn abwärts. Schämst du dich gar nicht? – Nein. Ein bisschen, ja. Aber es wär schade um ihren Schlaf, schau doch, wie schön sie schläft. – Du hast kein Recht, sie so anzusehen aus der Nähe. Hast du gar kein Gefühl dafür, dass du eine Grenze übertrittst? – Und wenn ich es nicht so empfinde? Als Übertretung? Dann ist es keine. – Aber du empfindest es genau so. Na, und so weiter.
Ich gebe der mahnenden Stimme Recht, rühre mich aber nicht vom Fleck. Soll sie doch erstmal in Ruhe ausschlafen. Ich sitze, freilich etwas verkrampft, doch beseligt durch ihr unbewusstes Zutrauen und sehe aus dem Fenster, sehe aber nichts, denn alle Sinnesfäden laufen in diese Schulter und von ihr zurück, so dass mich Wärme und Heiterkeit durchwallen. Ich bin der Hüter ihres Schlafes. Nichts besonderes, sage ich mir, alles ganz normal. Aber es fühlt sich anders an: beglückend, heroisch. Als wäre ich ihr Mann.
Hinter dem Fenster strahlender Azur, der Kapitän sagt seinen Spruch auf, mit einem kleinen Gong verlischt das Anschnallzeichen. Jetzt könnte ich zum Gang hin wechseln. Müsste ich eigentlich, um dieser fremden Frau nicht zu nahe zu treten. Aber ich bleibe noch. Einen Moment noch harre ich aus, erstarrt zum gepolsterten und beheizten Pfosten einer ansonsten dürftigen Bettstatt. Genießen dürfte ich es eigentlich nicht! Aber ich genieße es. Meine einzige Entschuldigung ist… Nein, es gibt keine.
Sie atmet tief und rasch. Die langen Beine zucken, wie man es so auch von träumenden Jagdhunden kennt. Nur ist es Eines, einem Hund beim Träumen zuzusehen. Und ein Anderes, wie diese Frau träumt. Dicht an meinem Ohr, wegen des Fluglärms von niemandem sonst hörbar gibt sie Laut. Aus ihrer Mitte steigt es auf, wellt sich durch ihren Körper und läuft in die Glieder aus. Und in die Kehle. Sie knurrt. Sie röchelt. Sie bleckt die Zähne um ein Winziges, die Nüstern flattern. Sie knirscht, sie schmatzt. Intimitäten, die nicht hier her gehören.