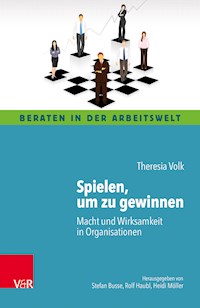
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Um im eigenen Arbeitsfeld wirksam zu werden, ist es unabdingbar, Macht zu analysieren und Machtkompetenz aufzubauen. Hierbei sind ein aufgeklärter sowie kompetenter Umgang mit Macht(-verhältnissen) und kluge Strategien inmitten konträrer Interessenslagen entscheidend. Dazu braucht es bei allen handelnden Akteuren ein kompaktes Wissen zu Macht und Mikropolitik. Theresia Volk zeigt in ihrem Beratungsansatz, wie eine reflektierte Haltung und eine technisch-praktische Kompetenz Lust machen, sich in machtpolitischen Feldern zu positionieren – und zu gewinnen. Gegen Klischeebilder und Lästerrhetorik setzt die Autorin Begriffe und Theorien, statt Abwehr und moralischer Ignoranz zu frönen, fordert sie Ethik und Entscheidungsfreude, statt Ärger und Empörung zu befeuern, verlangt sie Analysen und Strategien der Performanz. Auf der Basis einer differenziert beschriebenen Theorie stellt der Band praktische machtpolitische Analysekategorien zur Verfügung. Theresia Volk im Gespräch mit der Bertelsmann Stiftung zum Thema Macht: https://www.youtube.com/watch?v=gEpdqv9wgDE
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Theresia Volk
Spielen, um zu gewinnen
Macht und Wirksamkeit in Organisationen
Mit 9 Abbildungen und 2 Tabellen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Vectomart/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-99895-4
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Macht(Vor)worte
1Beziehung statt Sache: Ein Paradigmenwechsel
2Phänomen Macht: Theorie(n), Alltagspraxis, aktuelle Entwicklungen
2.1Wichtige Machttheorien und -definitionen
2.2Macht in Organisationen
2.3Mikropolitik: Die Alltagspraxis der Macht in Unternehmen
2.4Zeitgenössische Arbeitswelten und die Machtfrage
3Macht und Beratung – ein Plädoyer
4So ungefähr geht das praktisch – machtbewusste Beratung in vier Schritten
4.1Schritt 1: Ich will – das eigene Interesse präzise bestimmen
4.2Schritt 2: Die anderen brauchen – sie anerkennen und ihnen nützen
4.3Schritt 3: Die Spielregeln beherrschen – Unternehmenskulturen entziffern und nutzen
4.4Schritt 4: Die Strategien kennen – und seine eigenen weiterentwickeln
5Macht!
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe »Beraten in der Arbeitswelt« wendet sich an erfahrene Beratende und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforschende, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Macht(Vor)worte
–»Es geht immer nur um Macht. Mit meinen inhaltlichen Anliegen dringe ich gar nicht mehr durch.«
–»Diese Machtkämpfe verhindern jede Entwicklung, die setzen noch das Überleben der Einrichtung aufs Spiel.«
–»Es ist absurd, was da jetzt als Kompromiss ausgehandelt wurde, bar jeder Vernunft.«
–»Da müsste mal jemand ein Machtwort sprechen. So kann es nicht weitergehen.«
–»Ich weiß wirklich nicht, wie der es geschafft hat, an diese Position zu kommen – mit Sachkenntnis jedenfalls nicht.«
–»Ich sehe gar nicht ein, warum ich hier wieder den Kürzeren ziehen soll. Dieses Mal nicht!«
–»Ober sticht Unter.«
–»Wenn du dich immer brav an die Regeln hältst, kannst du vielleicht mitspielen, aber du wirst nie als Gewinnerin vom Feld gehen.«
–»›Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles‹, sagt schon Rilke.«
–»Eigentlich will ich gar nicht mitmachen bei diesen Machtspielchen.«
–»Als Beraterin bin ich da eh außen vor.«
–»Wenn du dich da mal nicht täuschst!«
1 Beziehung statt Sache: Ein Paradigmenwechsel
»Es setzt sich nur so viel Wahrheitdurch, wie wir durchsetzen.Der Sieg der Vernunft kann nurder Sieg der Vernünftigen sein.«(Bert Brecht: Das Leben des Galilei)
Die Regelwelt, an die wir im Kontext von Arbeitswelt, Beruf und Unternehmen denken, ist die der Sachlogik. Unternehmen – zumal im privatwirtschaftlichen Sektor – gelten nach wie vor als Hort der Rationalität, in denen zählt, was funktioniert, und in denen die Grundrechenarten die verlässliche Basis aller Entscheidungen sind. Menschliches, Emotionales und andere Irrationalitäten sind etwas fürs private Glück oder Leid. Im Büro hat die Objektivität Priorität.
Nach wie vor hält sich der Irrglaube, dass das sachlich bessere Argument auch das ausschlaggebende sein müsse. Und dass ein Fehler vorliege, wenn das bessere Argument nicht zieht. Was aber verhältnismäßig häufig vorkommt. So sind die Beschwerden laut, wenn ganz offensichtlich eine andere Ebene, eine nicht-sachliche, zum Vorschein kommt: die »Macht«.
Dieser Einsatz für seine persönlichen (unsachlichen) Interessen ist keineswegs eine Ausnahme, sondern die Regel. Das hat Gründe. Dass und wie diese Ebene konkret funktioniert, wird wenig thematisiert und beleuchtet. Der Ärger stößt immer wieder auf, aber die Reflexion darüber oder gar ein kundiger und selbstbewusster Umgang mit der Macht und den Macht-»Habern« ist selten. Meist wird auf den vorhandenen Instinkt verwiesen, den man und frau1 habe oder eben nicht. Oder es ist die Rede von fiesen Machenschaften am Rande der Legalität, die gestoppt werden müssten, und auf die sich niemand, der seriös arbeitet und auf ethische Integrität Wert legt, einlassen darf. Dass selten nüchtern (sachlich!) über Macht und ihre Hintergründe, ihre Funktionsweise gesprochen wird, ist selbst schon ein machtpolitisches Phänomen und hat vielerlei Gründe, wie sich zeigen wird.
Einer davon ist: Machtpolitik wird gelebt, aber nicht gelehrt; gelehrt wird ausschließlich Fachwissen. Jede Ausbildung, jedes Studium, jeder Berufseinstieg beginnt mit der Vermittlung der fachlichen, der professionellen Kenntnisse und Fertigkeiten. Wie versorge ich eine Wunde medizinisch korrekt? Wie programmiere ich eine fehlerfreie Software für einen Rasenmäher? Wie unterrichte ich didaktisch fundiert eine Fremdsprache? Wie fälle ich sicher einen Baum?
Das ist die erste Logik, auf die wir uns in der Arbeitswelt beziehen; und es scheint, sie bleibt lange prägend. Auf dieser ersten Ebene (siehe Abbildung 1) geht es darum, Sachen zu fertigen und Lösungen zu entwickeln. Hier zählen die beste Idee, die funktioniert, und das notwendige Know-how, sie zu entwerfen und zu bauen. Hierauf zielt die weitverbreitete Sehnsucht unter Beschäftigten, wenn sie einfach nur in Ruhe arbeiten wollen. Der Lohn der Mühe sind ein konkretes Ergebnis und die Erfahrung von Wirksamkeit.
Die zweite Lektion, die gelernt und gelehrt wird, führt weg von der einfachen Arbeitsebene – und sei diese noch so anspruchsvoll – hin zur Koordination derselben. Auf dieser Ebene wird Komplexität gemanagt, werden Prozesse gesteuert, synchronisiert, standardisiert oder überhaupt erst einmal definiert. (Multi-)Projekte werden aufgesetzt, Roadmaps angelegt und nachgehalten. Hier tauchen die ersten und bekannten Dilemmata auf, die nicht mit dem erworbenen Fachwissen der ersten Ebene gelöst werden können: zwischen Qualität und Kosten, zwischen Deadline und Änderungsanforderung, zwischen Erwartungs-, Informations- und Kontrollmanagement.
Abbildung 1: Die verschiedenen Anforderungsebenen
Interessen sind grundlegend
Der entscheidende Paradigmenwechsel führt nun aber zu einer weiteren, nämlich zur politischen, zur machtpolitischen Ebene: Es geht darum, Menschen zu überzeugen, Macht und Machtspiele zu gewinnen, sich und seine Ideen gegen Konkurrenz durchzusetzen.
Hier beginnt der Bereich der Interessen, der Bedürfnisse und Ängste von Menschen. Der wird nicht gelehrt (über das spezifische Verhältnis zwischen Lehre und Macht mehr in Kapitel 3), sondern erfahren. Oft als störend, als notwendiges Übel – als etwas Uneigentliches. Es ist erstaunlich, wie selbst erfahrene Führungskräfte diese machtpolitische Dimension im alltäglichen Business erstens immer wieder übersehen, zweitens lange versuchen, sie zu ignorieren oder drittens sie zu verharmlosen: als das störende »Zwischenmenschliche«, welches die Sache, das Eigentliche, immer mal wieder ins Stocken bringt. Auch die Rede von den Macht-Spielen, die da gespielt werden, verweist auf den Bereich des Unernstes, der unangemessen sei für seriöses Arbeiten.
Faktisch dürfen wir diese Ebene nicht nur nicht vergessen oder verniedlichen, sondern müssen die Pyramide umdrehen. Die Berufswelt steht mitnichten auf dem Sachfundament, sondern ihre Basis ist die soziale Ebene, auf der Menschen sich überzeugen, gewinnen, verführen und losschicken lassen, etwas zu tun oder zu erlauben. Dort, wo Macht über Menschen und der Einfluss auf sie die Motoren und Gestaltungsgrößen sind. Macht soll hier in einem ganz allgemeinen Sinn verstanden werden als »das Hervorbringen beabsichtigter Wirkungen«, wie Bertrand Russell treffend formulierte (»power may be defined as the production of intended effects«; Russell, 1938/1947, S. 32).
»Spielen, um zu gewinnen« handelt von der Macht über Menschen, wohlwissend, dass die Macht über die Materie durch die enormen Schritte in Wissenschaft und Technik die moderne Gesellschaft erst zu dem gemacht hat, was sie ist – und sie natürlich noch weiter prägen und verändern wird. Die Macht aber, derer es bedarf, um Menschen zu bewegen, zu inspirieren, zu begrenzen, ist von anderer Art; sie führt auf die Ebene der persönlichen Interessen. Und diese sind grundlegend. Sie legen den Grund für alles Weitere, was in der Arbeitswelt passiert. Schon am Beginn jedes beruflichen Engagements zeigt es sich: Der erste Grund, warum sich jemand in einem Betrieb anstellen lässt, ist keiner, der sich aus den Sachzielen dieser Unternehmung ableiten ließe, sondern ist immer ein ganz individuelles Interesse: Geld verdienen, etwas lernen, sich ausdrücken, gestalten, eine soziale Stellung haben, sich unabhängig machen oder … Und wer dann – in welcher Position auch immer – arbeitet, hat bei Vertragsunterschrift keineswegs sein bzw. ihr Bündel an Bedürfnissen und Interessen abgegeben, sondern arbeitet damit, z. B. mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder dem nach Einzig- und Großartigkeit oder nach Gestaltungsfreiheit oder nach Schutz. All diese persönlichen Interessen und Ziele liegen nicht auf der Sachebene der Profession, nicht in der Branchenlogik, nicht in der Mathematik, sondern auf der sozialen, auf der psychologischen, eben auf der machtpolitischen Ebene. Diese Interessen schließen Sachziele durchaus ein, sind aber wesentlich umfassender und vor allem stärker als diese.
Wie in einem Brennglas wird die relativ dazu geringere Bedeutung der Sachthemen deutlich beim Neuantritt in eine berufliche Position, z. B. bei einem Führungswechsel. Der größte Fehler, den eine neue Führungskraft machen kann (es gehört wirklich verboten und wird doch so häufig getan): sich als Erstes in und auf die Sachthemen zu stürzen und die Beziehungsebene zum neuen Team, zu den Stakeholdern, zur Hierarchie hintanzustellen. Natürlich wird dieser Fokus auf die Sachebene gefordert. Weil es ja um die Sache geht! Nein, die erste und wichtigste Angelegenheit ist es, belastbare Arbeitsbeziehungen aufzubauen: die Akteure im engeren und weiteren Umfeld kennenzulernen, sich über Erwartungen zu informieren und zu verständigen, Formen der Zusammenarbeit zu verhandeln, ihr Vertrauen zu erringen, kurz: Menschen zu gewinnen.
Die zweite Hürde beim Neuantritt ist es, die Komplexität zu händeln: Überblick zu gewinnen, Zusammenhänge schnell zu verstehen, um schlussendlich Prioritäten setzen zu können. Wie soll das gelingen, wenn die erste Ebene – die Unterstützung durch Kollegen, Vorgesetzte, Team – nicht funktioniert? Erst im dritten Schritt ist es dann möglich, für konkrete Probleme Lösungen zu entwickeln, Instrumente einzusetzen, gewinnbringende Ansätze zu verfolgen und Ergebnisse zu produzieren.
Diese Reihenfolge ist entscheidend. Die soziale und machtpolitische Ebene zu überspringen oder als selbstverständlich funktionierend voraus- und damit hintanzusetzen, ist hoch riskant.
Diese Reihenfolge – Beziehung vor Sache – entspricht im Übrigen auch der lebensweltlichen: Lange, bevor ein Kleinkind sich fachlich engagiert und Türme aus Lego baut oder Kunstwerke aus Strichweibchen fertigt, hat es erfolgreich Menschen dafür gewonnen, seine primären Bedürfnisse zu erfüllen: es zu nähren, zu trösten, zu schützen.
Dass jemand überhaupt eine bestimmte Stelle in einem Unternehmen bekommt, ist bereits und zuallererst eine machtpolitische Entscheidung, die natürlich sachlich begründet wird, aber die Begründung wird durch den oder die gegeben, die machtpolitisch in der Lage war, die Einstellungsentscheidung zu treffen. Die Macht, in diesem Sinn die Befugnis und das Interesse, jemanden einzustellen, ist wie auch die Machtkonstellation, die zu einer Versetzung führt, primär und Grundlage für alles Weitere. Dass das gerne – von allen Seiten – vergessen und hinter der Sachebene versteckt wird, ist bereits selbst eine machttaktische Entscheidung aus dem Bereich der Mikropolitik.
Machtlogik nutzt Sachlogik, funktioniert aber anders
Es kommt hinzu: Die Sachlogik und die Machtlogik funktionieren komplett unterschiedlich. Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem einen Bereich helfen im anderen nur sehr begrenzt weiter. Bisweilen machen sie blind füreinander. Machtkonstellationen mit Sachargumenten zu begegnen, stößt an Grenzen, denn die Währung, mit der auf der machtpolitischen Ebene gerechnet wird, ist nicht die Sache und ihre Gesetzmäßigkeiten, sondern das Interesse der Protagonisten. Dieses kann mit der Sache zu tun haben, muss es aber nicht.
Nach der Fusion zweier Firmen gilt es zu entscheiden, welcher der beiden etablierten Lieferprozesse innerhalb eines Beschaffungsgebiets künftig gelten soll. Dabei wird deutlich, dass sowohl Kosten wie Rahmenkonditionen des Prozesses A deutlich günstiger sind als die des Prozesses B. Wieso wird schlussendlich dennoch für Prozess B entschieden? – Nach absurd langen Verhandlungen, in deren Verlauf die erhobenen Daten wieder und wieder neu arrangiert wurden, ohne dass sie sich im Kern verändert hätten, in denen sich die beteiligten Projektleiter mehr und mehr bekriegten und währenddessen zwei ganze Abteilungen, die eigentlich ihre künftige Zusammenarbeit organisieren sollten, in der Luft hingen und nicht wussten, wann und wie endlich entschieden wird.
Das Resultat aus dem Beispiel lässt sich nur aus der Interessenlage der Akteure, die B bevorzugten, erklären, und aus ihrer wohl stärkeren Machtposition. Interessen – z. B. Statuserhalt, Funktionserhalt, Gesichtswahrung – lassen sich nicht über Sachargumente verändern.
In Anlehnung an den amerikanischen Philosophen und Zeitdiagnostiker Harry Frankfurt, der sagte: »Liebe braucht keine Gründe, sie schafft sie«, lässt sich hier sagen: Interessen brauchen keine Sachgründe, sie schaffen diese. Wer erlebt, wie nach einer Restrukturierung – die doch eigentlich eine Verschlankung der Strukturen bewirken sollte – die sogenannten Sachgründe für die Schaffung von zig Führungsstellen nur so sprudeln und am Schluss exakt so viele Stellen sachlich hergeleitet werden, wie es Führungskräfte gibt, die wieder in Position kommen wollen, kann diese kausale Umkehrung in Reinform studieren.
Selbstverständlich wird das Gespräch, der Streit immer mit Argumenten und Bauteilen aus dem Sachbereich geführt, aber die Auseinandersetzung wird nicht darüber gelöst. Nur wer etwas auf das Interessenkonto des Gegenübers einzahlen kann, kann auf einen Gegenwert hoffen.





























