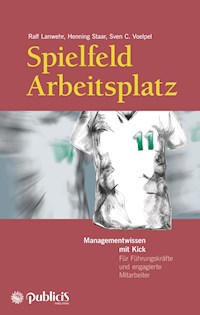
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sie möchten wissen, wie Sie, Ihre Chefs, Kollegen oder Mitarbeiter optimal für sich und Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation arbeiten können? Warum dafür zum Beispiel Persönlichkeit, Selbstreflexion, Selbstvertrauen und Work-Life-Balance so wichtig sind? Was Zusammenarbeit, Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen bedeuten? Und wie moderne Führung funktioniert - mit Zielen und Feedback, über Motivation, Charisma und Führungspsychologie, bis zu Mikropolitik und Machtfaktoren? Welche Führungsrollen es gibt, warum sie irgendwie alle wichtig und in welchen Situationen sie besonders relevant sind? Und wie Coopetition, Kreativität, Innovation, Balance und die gleichzeitige Konzentration auf die Gegenwart und die Zukunft zum Erfolg beitragen? Die meisten Bücher stellen das Thema zu einseitig dar, viele in der Praxis übliche Managementkonzepte und -methoden sind überholt. Wie alles wirklich funktioniert, beschreibt "Spielfeld Arbeitsplatz" - fundiert, auf dem neuesten Stand der Forschung, unterhaltsam, praxisorientiert. Dabei nutzen die Autoren - Experten für Wirtschaftspsychologie und Führung, die auch mit Bundesligavereinen zusammenarbeiten - Analogien aus dem Fußball, die wunderbar deutlich machen, worauf es tatsächlich ankommt. Ergänzt wird der Inhalt durch inspirierende Statements von Personen aus der Wirtschaft, Vereinen und verschiedenen Organisationen. Und die praxisbewährten Tests helfen bei der Selbsteinschätzung, der Einschätzung von Führungskräften und der Organisationskultur. Mit Geleitworten von Roland Berger (Unternehmensberater) und Wilfried Porth (Daimler AG, VfB Stuttgart) und themenbezogenen Statements u.a. von Jens Bormann (buw), Stephanie Busch (Facelift), Skateboard-?Urgestein? Titus Dittmann, Peter Görlich (TSG Hoffenheim), Alexander Insam (KPMG), Eric Kearney (Universität Potsdam), Frank Kohl-Boas (Google), Frank Kuhlmann (TUI Cruises), Henning Lühr (Staatsrat, Bremen), Jan Mayer (Sportpsychologe), Daniel Neubauer (Zurich Insurance) und Michael Welling (Rot-Weiß Essen).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Spielfeld Arbeitsplatz
Managementwissen mit KickFür Führungskräfte und engagierte Mitarbeiter
Von Ralf Lanwehr, Henning Staar und Sven Voelpel
2. Auflage, 2017
ISBN 978-3-89578-731-7 (EPUB)
Vollständige EPUB-Ausgabe von Ralf Lanwehr, Henning Staar und Sven Voelpel Spielfeld Arbeitsplatz
ISBN 978-3-89578-468-2 (Printausgabe)
Publicis Publishing, Erlangen, Germany
www.publicis-books.de
© 2017 Publicis Pixelpark Erlangen – eine Zweigniederlassung
der Publicis Pixelpark GmbH
Prof. Dr. Ralf Lanwehr ist Deutschlands drittmittelstärkster Professor für Wirtschaftspsychologie. Im Rahmen seiner Spezialisierung auf datengestütztes, evidenzbasiertes Management kooperiert er mit Firmen wie Google, SAP und BMW. Als Geschäftsführer des Netzwerks Fußballanalytik ist er zudem für verschiedene Vereine der ersten Bundesliga tätig. Die große Karriere als Profifußballer blieb trotz seiner Zeit als Stürmer von Balane Inhambane in der dritten mosambikanischen Liga vollkommen verdientermaßen aus.
Prof. Dr. Henning Staar ist Professor für Wirtschaftspsychologie, Mitbegründer der „doppel p Organisationsberatung“ und ausgebildeter Kommunikations- und Verhaltenstrainer. 2012 erhielt er den Preis für herausragende und innovative Lehre des Fachbereichs Psychologie der Universität Hamburg. Er berät und begleitet Unternehmen in ganz Deutschland zu Themen um Führung, Kooperation sowie Arbeit und Gesundheit. Als ehemaliger Leistungssportler war er selbst bei Werder Bremen aktiv – allerdings nicht im Fußball, sondern als Sprinter in der Leichtathletik.
Prof. Dr. Sven C. Voelpel ist Professor für Betriebswirtschaft an der Jacobs University in Bremen und Gründungsdirektor des WDN – WISE Demografie Netzwerks. Er berät Hidden Champions und Konzerne wie Allianz, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Otto und Volkswagen sowie mehrere Bundesligaclubs. Neben Demografiethemen beschäftigt er sich insbesondere mit dem neuen Thema „Digitalkompetenz und Arbeit 4.0“, effektiver Führung und lebenslanger Höchstleistung. Und spielt begeistert Fußball im Trampolin mit seinen beiden deutsch-brasilianischen Jungs.
Treffsicher, wenn es um Führung, Kommunikation und Strategie geht: Der Blick durch die Fußballbrille
Geleitwort von Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Gründer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Roland Berger Strategy Consultants
Wenn Sie in Ihrer heimischen Buchhandlung einmal einen Blick in das Regal für Managementliteratur werfen, könnte Ihnen leicht der Gedanke kommen, dass Sie sich in der Abteilung geirrt haben. Schließlich springen Ihnen an prominenter Stelle eine ganze Reihe von Titeln ins Auge, die in dieser Form nicht unbedingt zu erwarten wären und die sich ebenso in der Ecke für Zoologen finden könnten: die Strategien von Delphinen, Mäusen oder Bären werden dort ebenso präsentiert wie Prinzipien von Pinguinen oder Motivationsmodelle von Fischen. Gemein ist all diesen Ansätzen, dass Anthropomorphismen aus der Tierwelt mehr oder minder gewaltsam darauf getrimmt werden, dem modernen Manager bestimmte Verhaltensstrategien zu erläutern.
Nun sind Fabeln zwar schon seit den Sumerern eine beliebte literarische Technik, um anspruchsvolle Sachverhalte greifbar zu machen. Es drängt sich jedoch die Frage auf, ob mit solcherlei Stilmitteln auch die Anforderungen an das heutige Management erstens korrekt und zweitens in der erforderlichen Komplexität erfasst sowie im Anschluss adäquat in konkretes Verhalten umgesetzt werden können. Zumindest leise Zweifel sind diesbezüglich wohl angebracht. Es stellt sich jedoch zugleich die Frage, wie und weshalb die erwähnten Werke in der Managementliteratur so stark an Popularität gewinnen konnten. Dafür gibt es zwei Gründe.
Die erste Antwort darauf findet sich in der suggestiven Kraft, die Analogien bisweilen entfalten können. Es ist anhand von vertrauten Begrifflichkeiten leichter und anschaulicher, komplizierte Sachverhalte auf die eigene Situation zu übertragen. Folgt man diesem Gedankengang, ist es naheliegend, das Thema von Führungs- und Managementstrategien nach den vielfältigen Expeditionen ins Tierreich auch mit einer Fußballbrille zu betrachten. Schließlich ist Fußball der mit Abstand beliebteste Volkssport, und zu den bekanntermaßen 80 Millionen Bundestrainern unserer Nation gehört eben auch die Zielgruppe der Manager und Entscheidungsträger. Außerdem entstand im Zuge der WM 2006 immer wieder eine Diskussion über die Übertragbarkeit des als modern empfundenen Führungs- und Managementverständnisses von Jürgen Klinsmann auf die Wirtschaft. Durch den Gewinn des Weltmeistertitels durch die deutsche Mannschaft in Brasilien hat diese Betrachtung erneut an Popularität gewonnen. Insofern ist es nur folgerichtig, dass es dieses Managementbuch gibt, das auf der Welt des Fußballs begründet ist.
Die Autoren mögen mir dennoch verzeihen, wenn ich dem Ergebnis zunächst mit einer gewissen Skepsis gegenüberstand, schließlich hätte es sein können, dass sie den Delphin-Mäuse-Bären-Pinguin-Fisch-Management-Publikationen hier nur noch eine neue, menschliche Variante hinzufügen. Schließlich betrachten ähnlich ausgerichtete Werke aus der Vergangenheit die Welt des Managements doch sehr vereinfacht.
Zweitens klafft eine erhebliche Anspruchslücke zwischen den häufig beeindruckend langatmigen Lehrbüchern für Betriebswirtschaft und den oftmals unterhaltsameren, dafür aber auch weniger fundierten populärwissenschaftlichen Werken. Es drängt sich besonders in der deutschsprachigen Managementliteratur die Frage auf, ob die diskutierten Konzepte wegen irgendwelcher Zwänge entweder dröge oder fachlich wackelig kolportiert werden müssen.
Sie werden sich nun sicherlich fragen, weshalb ich angesichts all dieser Vorbehalte dennoch ein Geleitwort zum vorliegenden Buch beisteuere. Die einfache Antwort lautet, dass meine Skepsis nicht nur verflogen, sondern sogar einer gewissen Begeisterung für die dargestellten Inhalte gewichen ist.
Die Autoren beschränken sich nämlich keineswegs darauf, episodische, eher banale Parallelitäten zwischen Management- und Führungstechniken auf der einen und Fußballbeispielen auf der anderen Seite aufzuzeigen. Auch begnügen sie sich nicht mit einer launigen Zitatesammlung, welche dem Leser zwar einige vergnügliche Stunden beschert, aber später, nach der Lektüre, in der Bedeutungslosigkeit verhallt. Das Gegenteil ist der Fall.
Die große Stärke des Buches ist zuallererst das äußerst solide fachliche Fundament. Den Autoren gelingt es, aktuelle betriebswirtschaftliche Fragestellungen mit Prozessen aus dem Profifußball auf sehr anschauliche Weise in Verbindung zu bringen. Der Bezug zwischen Wirtschaft und Fußball ist dabei keinesfalls willkürlich, sondern folgt in allen Kapiteln konsequent dem als zentrale Parallele identifizierten Thema des Buches: dem Balance-Management. Die Autoren haben ihr Buch aus dem Jahr 2009, „Management für die Champions League“, völlig überarbeitet und für eine breitere Zielgruppe aufbereitet, denn der Inhalt funktioniert für alle Ebenen von Führung, Kommunikation und Strategie.
Auf der Basis einer intensiven, vergleichenden Literaturrecherche der Fachzeitschriften aus Sport und Wissenschaft und Dutzenden Interviews mit Fachleuten aus Profisport und Wirtschaft werden auf vergnügliche Art Parallelen aufgezeigt, Unterschiede diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Durch sein solides fachliches Fundament, seine ausgesprochen hohe Aktualität sowie seine breite empirische Basis hebt sich das Buch wohltuend von vergleichbaren Werken ab.
Das Ergebnis, das Sie nun in den Händen halten, entspricht in hohem Maß dem idealtypischen Anspruch der Autoren: einerseits fachlich ebenso fundiert wie relevant, andererseits aber zu jeder Zeit höchst vergnüglich und spannend. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Spaß!
Fußballvereine und Unternehmen: Nur erfolgreich mit Führung und Strategie!
Geleitwort von Wilfried Porth, Vorstand Personal und Arbeitsdirektor, IT & Mercedes-Benz Vans der Daimler AG und Aufsichtsratsmitglied beim VfB Stuttgart
Wenn man es objektiv betrachtet, könnte man meinen, dass Fußball unbedeutend ist. Für die Fans hat der Spielausgang keine persönlichen Konsequenzen. Denn durch den Spielausgang werden die Arbeit im Büro nicht weniger, der Kontostand nicht höher oder die pubertierenden Töchter und Söhne nicht erträglicher. Und trotzdem stimmen wohl viele der Nationalmannschaft von 1974 zu: „Fußball ist unser Leben!“
Er ist leidenschaftsgeladen, mitreißend und baut Schranken ab. Fans eines Fußball-Teams sitzen ja nicht nur für 90 Minuten in einem Boot. Ihr Leben lang leiden und freuen sie sich miteinander und bilden dadurch eine starke Gemeinschaft.
Vereine geben diesem Gemeinschaftsgefüge einen Rahmen. Sie sind in vielen Dingen ein Abbild von Unternehmen: auf ein Ziel ausgerichtet und im ständigen Wettbewerb mit anderen in der Branche. Die Anspruchsgruppen sowohl von Unternehmen als auch von Vereinen sind – eine gewisse Größe und Bekanntheit vorausgesetzt – zahlreich und divers: von Anteilseignern über Medien, von der Belegschaft bis hin zu Geschäftspartnern. So ist es nur konsequent, dass Managern in Unternehmen sowie Vereinen ähnliche Aufgaben zukommen. In Unternehmen und Vereinen kümmern sich die einen um die richtige Strategie oder Finanzierung, während andere für die Mannschaftsaufstellung zuständig sind oder sich mit dem Vertrieb der Produkte auseinandersetzen.
Trainer agieren in diesen Gemeinschaftsgefügen wiederum als Vorgesetzte. Wie gute Führungskräfte in Unternehmen wissen sie um ihre Rollen als Coach und Motivator. Die Führungsarbeit der Trainer lässt sich aufgrund des öffentlichen Erfolgs oder Misserfolgs zeitnah miterleben. Und zwar sowohl die Führung selbst als auch ihre Wirkung auf die einzelnen Spieler, das gesamte Team und den Verein. Sowohl Fußballtrainer als auch Führungskräfte werden nicht selten von der Fülle und Vielseitigkeit der Anforderungen, die Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzte an sie stellen, überrascht. Als eine der schwierigsten Aufgaben zeigt sich dabei oft die Mitarbeiterführung. Eine Aufgabe, durch die man permanent gefordert ist. Dass für den Erfolg personenbezogene Faktoren wie Selbstvertrauen, Erfahrung, die richtige Einstellung und das Wissen um die eigene Persönlichkeit vonnöten sind, steht außer Frage.
Bücher wie dieses beschreiben die Herausforderungen in Führungsfragen mit einem Quantum Humor und machen deshalb auch Spaß beim Lesen. Die Autoren geben dabei zahlreiche Tipps, wie man Mitarbeiter und Kunden in Fans verwandelt. Das Trio, ein Betriebswirt und zwei Wirtschaftspsychologen, schreibt fachlich fundiert sowie verständlich und hat Spaß bei der Sache. Dabei orientiert sich „Spielfeld Arbeitsplatz“ am neuesten Stand der Managementforschung.
Inhaltsverzeichnis
Geleitworte
Anstoß
Teil I
Spieler
1 Einstellung und Persönlichkeit
2 Selbstreflexion und Perspektivwechsel
3 Selbstvertrauen
4 Work-Life-Balance
Teil II
Mannschaft
5 Zusammenarbeit, Kommunikation und Vertrauen
6 Ansporn durch Ziele
7 Feedback geben und empfangen
8 Transaktionale Führung: Das Prinzip „Leistung und Belohnung“
9 Transformationale Führung: Der mitreißende Ansatz
10 Transformationale Führung: Die Strahlkraft von Motivation und Charisma
11 Transformationale Führung: Psychologie für Team und Individuum
12 Mikropolitik, Macht und Einfluss: Wer führt eigentlich wen?
Teil III
Trainer
13 Das „Competing Values Framework“
14 Kooperation: Facilitator & Mentor
15 Kontrolle: Monitor & Coordinator
16 Konkurrenz: Producer & Director
17 Kreativität: Innovator & Broker
Teil IV
Verein
18 11 Freunde sollt Ihr sein – Der Sinn von Kooperation
19 Kreativität und Innovation
20 Psychologische Diagnostik
21 Der Blick in die Zukunft: Balance als Herausforderung in einer komplexen Welt
22 Beidhändigkeit: Acht Regeln zum Erfolg
23 Kultur
Teil V
Selbsttests
24 Selbsttest 1: Transaktionale Führung und Laissez-faire
25 Selbsttest 2: Transformationale Führung
26 Selbsttest 3: Die acht Rollen eines Managers
27 Selbsttest 4: Organisationale Beidhändigkeit
28 Selbsttest 5: Die Offenheit und Geschlossenheit Ihres Unternehmens
Liste der Gastautoren und Spielfelder
Verwendete und weiterführende Literatur
Anstoß
Laut DFB gibt es in Deutschland 6,7 Millionen aktive Fußballerinnen und Fußballer. Dazu kommen bekanntlich 80 Millionen Bundestrainer, jeder mit seiner eigenen Meinung darüber, wie moderner Fußball auszusehen hat.
Fußball ist in Deutschland außerdem eine große Fundgrube für Analogien. Immer wieder hört man Menschen diesen oder jenen Sachverhalt anhand von Beispielen aus dem Fußball erklären – und es funktioniert! Dieses Potenzial möchten wir in diesem Buch ausschöpfen, um Ihnen auf entspannte Weise viele Aspekte der aktuellen Managementforschung zu vermitteln.
Wir knüpfen damit an unser 2009 erschienenes Buch „Management für die Champions League – Was Unternehmen vom Profifußball lernen können“ an. Im Rückblick war dieses Buch nach unserem Eindruck ein für Leser, Autoren und Verlag ausgesprochen erfolgreiches und erfreuliches Unterfangen – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch weil es Spaß gemacht hat, dieses Buch zu machen und weil es viel fachliche Anerkennung für die Inhalte gab.
Leider mussten wir etwas konsterniert feststellen, dass die Halbwertszeit von Beispielen aus dem Profifußball enorm kurzlebig ist. Selbst in den Fällen, in denen die Managementforschung keine erwähnenswerten Wandlungen vollzogen hat, wirken 5 Jahre alte Fußballbeispiele bestenfalls antiquiert.
Das haben wir dankbar zum Anlass genommen, um uns abermals ausführlichst mit der schönsten Nebensache der Welt zu beschäftigen. Um die Halbwertszeit zu verlängern, haben wir versucht, uns auf Beispiele mit längerer Lebensdauer zu konzentrieren und auf die zwar attraktiven, aber kurzlebigen Spieler- und Trainerfotos verzichtet.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Teil I
Spieler
Mit Fußballmannschaften verhält es sich nicht anders als mit Unternehmen: Abseits aller vorgegebenen Strategien und Strukturen sind es am Ende immer die handelnden Menschen mit ihren ganz individuellen Voraussetzungen, Bedürfnissen und Kompetenzen, die maßgeblich zum Erfolg oder Misserfolg beitragen. Diese Wichtigkeit des Faktors „Mensch“ brachte Real Madrids damaliger Trainer Carlo Ancelotti 2014 in einer Ansprache vor zukünftigen Managern auf den Punkt: „Als Manager muss man die Charakteristika der einzelnen Spieler kennen (...) Cristiano Ronaldo arbeitet anders als Angel Di Maria oder Luka Modric oder Sergio Ramos – alle sind unterschiedliche Charaktere.“ Der wichtigste Grundsatz erfolgreicher Trainerarbeit sei es, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zu verstehen – übrigens auch die eigene. Es geht also darum, genau jene individuellen Treiber und Hemmnisse zu identifizieren, die sich auf die Leistung des Einzelnen auswirken, um diese zielgerichtet zu beeinflussen. Daneben spielen aus der Perspektive des Einzelnen auch Aspekte wie Selbstvertrauen und die Balance zwischen Arbeit und Privatleben eine Rolle. Diese Themen sollen in den folgenden Kapiteln vertieft und mit Beispielen aus dem Profifußball unterfüttert werden.
1 Einstellung und Persönlichkeit
Dieses Kapitel sollten Sie unbedingt lesen, wenn Sie wissen wollen, …
… warum Ihnen Jahrhunderttalent Pablo Aimar zu 99% kein Begriff sein wird.
… warum Messi, Ronaldo und Ibrahimovic nicht nur Riesentalent haben, sondern auch noch die richtige Einstellung.
Hand aufs Herz, wollten Sie zu einem frühen Zeitpunkt in Ihrem Leben irgendwann einmal Fußballprofi werden? Wir wissen zwar nicht, wer dieses Buch gerade in der Hand hält, aber möglicherweise haben auch Sie wie viele andere von der großen Karriere als Stürmer oder als genialer Regisseur im Mittelfeld geträumt – oder tun es noch. Vielleicht haben Sie diesen Traum aber auch irgendwann begraben müssen. Wenn ja, woran lag es, dass Sie doch nicht auf der großen Champions-League-Bühne stehen durften?
Mit dieser Gretchenfrage sind wir schon mitten im Thema: Es geht um den Einfluss auf die individuelle Leistung und den Erfolg. Gewisse Menschen in bestimmten Leistungsbereichen, sei es nun im klassischen Management oder im Profifußball, sind langfristig erfolgreich und dadurch herausragend. Plastischer formuliert: Warum sind die Zlatans, Lionels und Cristianos im Profifußball genau da, wo sie stehen? Warum kann der Kollege so sensationell im Kundengespräch präsentieren? Und aus welchem Grund hat der Chef so ein herausragendes Händchen mit den Mitarbeitern?
Eins können wir festhalten: Das vielzitierte Talent – also die mitgegebenen Voraussetzungen des Einzelnen – hat zweifelsohne einen Einfluss auf die individuelle Leistung. Dies gilt nicht nur für den Leistungssport, sondern gleichermaßen für das Berufsleben. Daneben bestehen allerdings noch erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten für den Karriereerfolg. Wie sagte einst die ukrainische Trainerlegende Valery Lobanovsky so prägnant: „Bei hervorragenden Spielern gilt folgendes Prinzip: 1% Talent, 99% harte Arbeit.“
Dass Talent allein also offensichtlich nicht für Erfolg ausreicht, zeigen auch die vielen tragischen Fälle junger „Jahrhunderttalente“ im Fußball: Sagt Ihnen beispielsweise der Name Pablo Aimar noch etwas? Das argentinische Nachwuchstalent wurde 2001 nach seinem Wechsel zum FC Valencia bereits als kommender Megastar gehandelt (O-Ton Diego Maradona: „Der einzige Spieler, für den ich zahlen würde, um ihn spielen zu sehen.“). Nach diversen Stationen, unter anderem in Spanien (San Sebastián, Saragossa), Portugal (Benfica Lissabon) und Malaysia (Johor Darul Takzim) ließ Aimar seine Karriere schließlich in der Heimat bei River Plate ausklingen. Die großen Erwartungen, die in „El Mago“, den Zauberer, gesetzt wurden, konnte der Argentinier nie erfüllen. Wir können bezüglich der Gründe nur spekulieren, aber möglicherweise fehlte es hier trotz fantastischer „Grundausstattung“ an jenem unbedingten Willen und inneren Antrieb, der Weltklassespieler wie Cristiano Ronaldo oder Zlatan Ibrahimovic auszeichnet. Dass neben der Motivation aber auch beispielsweise der Umgang mit Stress und Druck einen wichtigen Einflussfaktor auf die individuelle Leistung darstellt, macht der fast schon „klassische“ Fall des Deutschen Sebastian Deisler deutlich: Anfang 2000 galt dieser als einer der talentiertesten Fußballer seiner Generation. Im Alter von 27 Jahren beendete er 2009 wegen schwerer Depressionen seine Karriere als Profifußballer. Es fehlte ihm an „emotionaler Stabilität“ und Strategien, mit dem Druck der Umwelt umgehen zu können. Der 17-jährige Martin Ødegaard steht hingegen noch ganz am Anfang seiner Karriere. Anfang 2015 wurde das norwegische Toptalent von Real Madrid für mehrere Millionen verpflichtet, andere Konkurrenten wie z. B. der FC Bayern München hatten das Nachsehen. Die Erwartungen waren wieder einmal riesig. Ein Jahr später, Anfang 2016, sind die Lobeshymnen weitestgehend verstummt. Ødegaard spielt in der B-Mannschaft, die sich in der dritten spanischen Liga tummelt. Journalist Fernando Banquero von der spanischen „Sport“ sprach sogar von einem Fiasko. Hat der Junge nun überhaupt noch eine Chance, die Erwartungen zu erfüllen? Eines steht fest: Eine Weltkarriere wird der junge Norweger nur dann noch machen können, wenn Trainer und vor allem der Spieler selbst kontinuierlich alle leistungsrelevanten Treiber und Hemmnisse im Blick haben.
Was kann der Einzelne also tun, um das Optimum aus sich herauszuholen und langfristig leistungsfähig und gesund zu bleiben? Hier spielen verschiedene psychologische Faktoren sowie deren individuelle Ausprägungen eine wichtige Rolle. Um die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten zu beantworten, müssen wir uns kurz auf ein paar theoretische Begriffe einlassen. Entscheidend sind hier vor allem die Eigenmotivation und Einstellung, kognitive Funktionen, die persönliche Grundstimmung, Selbstwirksamkeit und die individuellen emotional-mentalen Selbststeuerungsfähigkeiten.
Eigenmotivation und Einstellung
Vor dem Viertelfinale der WM 2014 antwortete Brasiliens Torjäger Neymar den Journalisten auf die Frage, welche Rolle seine Einstellung und sein Talent spielten, mit folgendem knackigen Satz: „Klar habe ich eine Gabe. Aber ich nehme das Training als Spiel. Und das Spiel gehe ich an, als ob Krieg ist.“ (Wie Spieler wie Neymar ihr Team mitreißen und welche Faszination sie auch auf Zuschauer ausüben, verdeutlicht das erste „Spielfeld“ im Buch, „Campeonato Brasileiro 2009: FC Santos – Náutico 3:1“.)
Das Zitat macht deutlich: Im Training wie im Spiel geht es darum, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden, an die Grenzen zu gehen. Mitarbeiter im Unternehmen entwickeln sich ebenfalls nur dann weiter, wenn sie ihre Komfortzone verlassen. In beiden Fällen ist dies vor allem eine Frage der (Eigen-)Motivation und der individuellen Einstellung. Die Motivation bestimmt, wie viel Energie ein Spieler für bestimmte Aufgaben generieren kann. Dabei spielen die unbewussten Motive eine viel stärkere Rolle, als bis vor einigen Jahren angenommen wurde. Es reicht deshalb einfach nicht aus, wie von Motivationsprofilen vorgesehen, die Motive einfach abzufragen. Oft gibt es Diskrepanzen zwischen dem, was bei einer Person wirkt, und dem, was diese Person annimmt, was wirkt, zwischen der bewussten Meinung über die eigenen Motivatoren und den tatsächlichen Anreizfaktoren. Kurzum: Wir wissen manchmal gar nicht so richtig, was wir eigentlich wollen. Ein starkes Auseinanderklaffen von bewussten und unbewussten Motiven verhindert nicht nur eine eindeutige Leistungsausrichtung, sondern verstärkt gleichzeitig auch die „gefühlte Belastung“ und kann sogar zu Burnout führen. Zum anderen stellen unbewusste Bedürfnisse ungenutzte Energiequellen dar, die mobilisierbar sind, wenn man sich diese bewusst macht. Zentrale Fragen zur Selbstreflexion sind beispielsweise:
Was treibt mich an?
Was will ich eigentlich (und was wollen andere)?
Was ist mir wichtig?
Welche (persönlichen) Ziele habe ich?
Campeonato Brasileiro 2009: FC Santos – Náutico 3:1
November 2009, Estádio Pacaembu. Das erste Spiel, in dem ich den damals noch sehr jungen Neymar live im Stadion sehen konnte. Nicht nur wegen seiner zwei Tore ist mir der Moment in Erinnerung geblieben, sondern vor allem wegen der Leidenschaft, der Unbekümmertheit und der Frische, mit der Neymar damals auftrat. Und wie diese Haltung und Freude am Spiel die ganze Mannschaft mitriss. Das Ganze obwohl – oder vielleicht gerade weil – Neymar seine erste Saison für Santos spielte.
Diese Energie, diese Leidenschaft und auch die Neugierde, die junge Leute ausstrahlen, ist auch für ein Team in einem Unternehmen von großer Bedeutung. Sie kann inspirieren, vorantreiben, aber auch erschrecken.
Wie identifiziere ich die Neymars meines Teams? Zunächst muss ich die Energie, die Neugierde, erkennen, etwa in Gesprächen – in formalem oder informalem Rahmen – und durch die Vergabe bestimmter Aufgaben. Diese Aufgaben sollten mit entsprechenden Prioritäten versehen sein, um in einem nächsten Schritt diese Energie zu kanalisieren und lenken. Gleichzeitig muss ich sensibel bleiben für die Reaktion anderer Teammitglieder. Der hohe Level an Energie kann andere überrollen, speziell wenn sie sich „abgehängt“ fühlen.
Wie gehe ich damit um? Ich bringe die Kollegen über eine gemeinsame Aufgabe zueinander. So können junge Leute mit ihrer Energie mitreißen. Gleichzeitig können ruhigere – meist auch erfahrenere – Kollegen dafür sorgen, dass junge Teammitglieder vor ihrer eigenen Energie geschützt werden. So ist der Aufprall auf der Wand der Corporate World nicht ganz so hart. Und in Krisensituationen kann die „junge“ Energie zur Lösung der Situation eingesetzt werden und verliert sich nicht im Schwarzen Loch der Unerfahrenheit.
Gibt es eine ideale Mischung? Schwierig, hierzu eine allgemeine Stellungnahme abzugeben. Ich bin mir jedoch sicher, dass eine Vielfalt förderlich ist, unabhängig vom Umfeld. Leidenschaftliche Neugier hilft, bestehende Prozesse zu hinterfragen, anzufassen und notfalls auch umzudrehen. Die Gelassenheit der Erfahrung erlaubt innezuhalten, einen Schritt zurückzugehen und die Änderung auf sich wirken zu lassen.
Letztendlich muss es in jedem Team, wie Neymar im Spiel Santos gegen Náutico, jemanden geben, der vorneweg läuft und sich unbekümmert und mit Leidenschaft der Herausforderung stellt. Erfolgreich können er und damit das Team jedoch nur sein, wenn es andere Mannschaftskollegen gibt, die nach hinten absichern.
Dr. Hannes Schollenberger, Leiter Group Accounting, Henkel
Alle hier genannten Topstars wissen ganz genau, was sie wollen und was sie antreibt. Die persönlichen Ziele werden klar formuliert und aktiv verfolgt. Allerdings: Das Wissen um die verschiedenen Faktoren der Eigenmotivation und der individuellen Einstellung allein bedeutet für einen Spieler noch nicht, dass er diese auch situativ effektiv einsetzt. Das setzt nämlich bestimmte kognitive Fähigkeiten voraus, zu denen wir nun kommen.
Kognitive Fähigkeiten
Möglicherweise sind Sie gerade irritiert: Kognitive Fähigkeiten? Wofür braucht man die beim Fußball? Wir können Ihnen sagen: für eine ganze Menge. Der ehemalige niederländische Nationalspieler und jetzige Assistenztrainer von Ajax Amsterdam Dennis Bergkamp formulierte einmal: „Hinter jedem Kick vom Ball muss ein Gedanke stehen.“ Und damit spricht er genau das an, worum es geht: in komplexen und dynamischen Situationen schnell die richtigen Entscheidungen treffen.
Die Ausprägung verschiedener Hirnleistungen bzw. kognitiver Grundfunktionen zeigt das grundsätzliche Potenzial eines Spielers für bestimmte psychische Anforderungen. Wesentlich ist allerdings nicht nur, wie gut die Fähigkeiten eines Spieler oder Mitarbeiters in diesen Funktionen ausgebildet sind, sondern vor allem, ob er diese situativ effektiv abrufen, also ob er im richtigen Moment in den richtigen Modus „umschalten“ kann – und das ist abhängig von der Selbststeuerungsfähigkeit. Folgende vier Grundfunktionen sind essenziell für das Potenzial eines Spielers: Ein Spieler muss
Spielzüge planen und
voraussehen können,
Situationen analysieren und ihnen
strategisch begegnen.
Ist die Planungsfunktion zu gering ausgeprägt, ist es schwieriger für den Spieler, eine abgestimmte Taktik konsequent umzusetzen.
In unüberschaubaren Situationen, in Chaos und Krisen aber kommt man mit dem „Verfolgen des Plans“ nicht weiter. Hier gilt es, neue Wege zu finden, Ideen zu haben und Situationen kreativ zu lösen. Dazu sind ein gewisser Überblick und das Erfahrungsgedächtnis erforderlich. Dieses System wird in der Differentiellen Psychologie auch als Fühlfunktion bezeichnet, weil im Erfahrungsgedächtnis „das Selbst“, die innere Motivation betreffenden Inhalte, repräsentiert sind. Dieses System ist aber nur unter einer relativ gelassenen Stimmung gut zugänglich.
Die diskrepanzsensitive Wahrnehmung als drittes System ermöglicht dem Spieler, detailliert Veränderungen wahrzunehmen, zu spüren, was sich beim Gegner oder in der Situation gerade ändert, Risiken eines Spielzuges abzuwägen und vor allem: aus den eigenen Fehlern zu lernen. Ist ein Spieler während des Spiels zu lange in diesem kognitiven System, verlangsamen sich die motorischen Abläufe und die „gefühlte“ Belastung steigt, während die Stimmung sinkt. Ist er generell wenig in diesem Modus, lernt er weniger aus seinen Fehlern.
Das vierte System findet im Fußball als wichtiger Stammhirnbereich viel Beachtung: die intuitive Verhaltenssteuerung. Gewünscht ist, dass einem Spieler alle durch Übung erworbenen Handlungsroutinen in der Hochleistungsphase zur Verfügung stehen, was heißt, dass er schnell reagiert und ohne zu zögern „instinktiv das Richtige tut“. Die im sportlichen oder Mentaltraining erworbenen „Routinen“ stehen in diesem Modus allerdings nur dann zur Verfügung, wenn die Stimmung des Spielers entsprechend ausgeprägt ist. In diesem Modus ist der Spieler bei guter Stimmung schneller, reaktiver und initiativer. In sogenannten „High-Risk-Unternehmen“ in der Wirtschaft (zum Beispiel im Bereich der Luftfahrt, in Kernkraftwerken oder bei medizinischen Notfallteams) bedient man sich übrigens genau dieses Prinzips: Hier werden Szenarien durchgespielt, deren Auftreten vielleicht eher unwahrscheinlich, aber mit großen Konsequenzen verbunden ist. In solchen erfolgskritischen Situationen sollten die handelnden Personen sofort richtig reagieren. Genau dieses Vorwegnehmen des „Was-wäre-wenn“-Szenarios sorgt dafür, dass Menschen stabil in ihren Zielen, aber flexibel in der Ausführung bleiben.
Man kann diese Funktionen inzwischen messen und damit über gezielte Trainings unterentwickelte kognitive Fähigkeiten der Spieler optimieren. Möchten Sie wissen, in welcher Hinsicht sich diese Anforderungen an Handlungsschnelligkeit auf die Touristikbranche übertragen lassen? Dann lesen Sie das Spielfeld des TUI Cruises-CFO Frank Kuhlmann:
Von dreieckigen Spielfeldern und vier Toren
Im Grunde müsste man unser Unternehmen entlang des Fußballvokabulars als klassischen Aufsteiger bezeichnen: Erst im Jahr 2008 gegründet, hat TUI Cruises mit einem Schiff seinerzeit sozusagen in der Kreisklasse angefangen. 2017 wird die Flotte aus insgesamt sechs Schiffen bestehen und rund 1 Milliarde Euro Umsatz machen. Damit haben wir alle ursprünglichen Businesspläne weit übertroffen, haben aber auf dem Weg in die Champions League weiterhin noch viele Herausforderungen vor uns.
Insbesondere für TUI Cruises als noch junges Unternehmen ist es bei einer solchen Geschwindigkeit in der Entwicklung wichtig, über den Tellerrand zu schauen und Erkenntnisse aus anderen Bereichen – auch aus der Sportwelt – zu adaptieren. In Bezug auf Themen um Führung, Management und Teamwork drängen sich Bezüge geradezu auf. Daneben erscheint aus meiner Sicht vor allem eine wesentliche Fähigkeit entscheidend, die sowohl den Erfolg im Profifußball wesentlich mitbestimmt, als auch für unser Unternehmen immer wichtiger wird: Handlungsschnelligkeit. Während körperliche Fitness und ausgereifte technische Fähigkeiten schon immer zentrale Bausteine für den Erfolg auf dem Platz waren, steht diese Kompetenz bei modernen Fussballtrainern seit einiger Zeit mehr und mehr im Fokus. Unter Handlungsschnelligkeit versteht man die Fähigkeit, schnell und flexibel auf komplexe, sich verändernde Spielsituationen reagieren zu können. Es geht also darum, eingefahrene Muster gar nicht erst aufkommen zu lassen und ständig neue Reize zu setzen. Trainer wie Pep Guardiola oder Thomas Tuchel widmen sich der Entwicklung dieser Fähigkeit, indem sie ungewöhnliche, von der Normalität abweichende Spielformen üben lassen. Beispielsweise wird im Training auf vier statt auf zwei Tore gespielt, ein dreieckiges Spielfeld statt einem rechteckigen wird für Trainingsspiele genutzt, mehrere Bälle sind gleichzeitig im Spiel, oder es wird nur eine Ballberührung erlaubt.
Wo liegt nun die Parallele zu den Anforderungen, die wir als Unternehmen erleben? In einer digitalisierten Welt bekommen wir als Anbieter von Kreuzfahrten sehr schnell und direkt Feedback von Kunden und Gästen. Eingefahrende Muster und ein „Schema F“ im Umgang mit individuellen
Rückmeldungen bringen uns hier wenig weiter. Schnell auf sich wechselnde Wettbewerbsbedingungen reagieren zu können, wird damit zu einem Wert an sich. Diese Fähigkeit ist mit der Handlungsgeschwindigkeit beim Fußball vergleichbar.
Leider gibt es in der Wirtschaft weniger Möglichkeiten, Handlungsschnelligkeit zu trainieren, als in der Sportwelt. Aber auch in einem Unternehmen kann man versuchen, die Mitarbeiter mit mehr Handlungsgeschwindigkeit auszustatten. Die dreieckigen Spielfelder bei TUI Cruises heißen allerdings Job Rotation, agile Projektarbeit oder dynamische Zielvereinbarungssysteme. Hilfreich ist eigentlich alles, was von der Routine abweicht und den Mitarbeiter besser mit einem gewissen Maß an Unsicherheit umgehen lässt.
Die große Herausforderung dabei ist, dass viele Mitarbeiter ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Dieses Bedürfnis auf der einen Seite und das Streben der Firma nach hoher Handlungsgeschwindigkeit auf der anderen Seite sind nicht immer einfach unter einen Hut zu bringen und erfordern ein sehr professionelles Changemanagement auf allen Ebenen. Ziel ist es, die Spielräume der Mitarbeiter hoch zu halten, Eigenverantwortlichkeit sowie Initiative und proaktives Handeln zu stärken und gleichzeitig das Gefühl von Unsicherheit in Bezug auf Ziele und Prozesse klein zu halten bzw. in einem gewissen Maße tolerieren zu können. Und mit Blick auf unsere Branche und die Menschen, die hier tätig sind, braucht es sicherlich auch einen gewissen Blickwinkel auf die Dinge: So sehe ich die ständigen Herausforderungen und das flexible Reagieren auf neue Situationen nicht als Gefahr, sondern vor allem als positive und spannende Herausforderung.
Frank Kuhlmann, CFO, TUI Cruises
Individuelle Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster
Die verschiedenen Persönlichkeitsstile der Spieler ergeben sich aus deren verfestigten Wahrnehmungs-, Einstellungs- und Verhaltensgewohnheiten. Sie zeigen sich an Eigenheiten im Teamverhalten und im wiederholten Umgang mit bestimmten Situationen. Ist ein Spieler vom Typ eher selbstsicher, loyal, eigenwillig, skeptisch, oder braucht er viel Bewunderung? Diese Stile sind über die Lebenszeit hinweg gewachsen sowie zum Teil auch genetisch determiniert und sorgen in ihren vielfältigen Kombinationen besonders in einem kulturell heterogenen Team oft für gegenseitiges Unverständnis. Kritisch wird es dann, wenn sich solche Unstimmigkeiten und Reibungspunkte zwischen einzelnen Spielern negativ auf die Leistung auswirken.
Ähnlich wie unterschiedliche Wahrnehmungs-, Einstellungs- und Verhaltensgewohnheiten unterscheiden sich Spieler auch in ihrer Grundstimmung. Diese ist teilweise in der Persönlichkeit verankert. Doch auch hier werden genetische Faktoren angenommen. Situativ kann ein Spieler aber über seine Selbststeuerung positive Gefühle herauf- und negative Gefühle herabregulieren. Die Trainer können meist genau sagen, welcher Spieler das Team eher „runterzieht“ oder welcher das Team positiv mitreißt. Bei manchem Spieler liegt also genau dort der Ansatzpunkt. Die Rolle von Stimmungen wurde lange unterschätzt. Inzwischen gibt es viele Belege dafür, dass Stimmungen Hirnregionen hemmen oder aktivieren können. Eine negative Stimmung beispielsweise sorgt für wertvolle Detailorientierung, blockiert aber auch die Fähigkeit zum Überblick und die Wahrnehmung von Chancen. Gute Stimmung hingegen aktiviert das motorische System und damit Schnelligkeit und Reaktivität der Spieler, mindert aber die Wahrnehmung von Risiken. Besonders für die Mannschaftsführung ergeben sich hier viele Ansatzpunkte.
Was lässt sich aus diesen Erkenntnissen ableiten? Spieler sollten kontinuierlich dazu angehalten werden, sich selbst in ihrem Verhalten und ihren Kognitionen und Emotionen zu reflektieren: Welche Grundstimmung nimmt der Spieler bei sich selbst wahr? Wie ist diese zu regulieren? Es sind genau diese „Aufschaukelungsprozesse“, die frühzeitig wahrgenommen werden müssen und auf die aktiv eingewirkt und gegengesteuert werden muss.
Sind Sie an einem kleinen Exkurs zum Thema „Wahrnehmung“ interessiert? Oder wollen Sie wissen, warum Bratwurst nicht immer gleich schmeckt? Dann lesen Sie das Spielfeld zur „Irradiation im Fußball“!
Irradiation im Fußball: Zwischen Bratwurst, Bier und Thunfisch-Carpaccio – wie der Spielausgang unsere Geschmacksnerven täuscht!
Die Professionalisierung des Fußballs schreitet seit Jahrzehnten voran: Statt uriger Linienoriginale sind heute Laptop-Trainer erfolgreich; nicht rauchende Feierabendfußballer, sondern funktionierende Nachwuchstalente setzen die wissenschaftlich fundierten Taktikanweisungen um, und an die Stelle zugiger Leichtathletikstadien sind moderne Arenen getreten. Eines ist dennoch geblieben und findet sich nicht nur in der Fußballbundesliga, sondern bis hinunter auf den kleinsten Amateurplatz: Bratwurst und Bier gehören in Deutschland zum festen Bestandteil des Kulturgutes Fußball. Auch in den VIP-Räumen der modernen Fußballtempel hat man dies erkannt. Den Business-Gästen werden Bratwurst und Bier genauso selbstverständlich angeboten wie das Thunfisch-Carpaccio und der halbtrockene Prosecco.
Diese Speisenvielfalt hat ihren Ursprung in der klassischen Marktsegmentierung, die auch beim Dienstleistungsprodukt „Fußballspiel“ angewendet wird. Fußballclubs schneidern ihre Angebote zielgenau auf die entsprechenden Fan- bzw. Gästesegmente zu und erbringen die unterschiedlichen Bestandteile des Dienstleistungsbündels entweder selbst oder beauftragen spezialisierte Dienstleister. Auch daher findet man in Fußballstadien nicht mehr nur die Bratwurst auf dem Holzkohlengrill, sondern spezielle Angebote von Sterneköchen wie Tim Mälzer in Hamburg oder Tim Raue in Berlin. Doch egal ob Hobbygriller in der Kreisklasse oder Sternekoch in der Bundesliga: Sie alle sehen sich einem besonderen psychologischen Phänomen ausgesetzt, das im Marketing basierend auf Bernt Spiegel als „Irradiation“ bezeichnet wird. Dies gehört wie selbstverständlich zum Lehrplan in den Business-Schools, überrascht Sportmanager im Praxiskontakt aber stets aufs Neue und wird auch Mälzer und Raue eher unvorbereitet getroffen haben. Als Irradiation begreift man „Verzerrungseffekte in der Wahrnehmung“, die bei der Beurteilung der Gesamtqualität von Produkten eine Rolle spielen. So strahlt die weiße Innenfarbe des Kühlschranks auf die vermutete Kühlleistung aus oder wird bei Putzmitteln mit erfrischendem Geruch eine bessere Putzleistung vermutet. Als „Attributdominanz“ gilt, wenn eine Produkteigenschaft alle anderen Merkmale dominiert und deren Ausprägung für die Gesamtbeurteilung ausschlaggebend ist.
Im modernen Sport nimmt man ein solches Phänomen an jedem Spieltag war, wenn Sieg oder Niederlage über Wohlbefinden entscheiden oder wenn die Qualität des Caterings insgesamt, die in der Eigenschaftsqualität konstanten Leistungen wie Bier und Bratwurst oder die Gerichte der Sterneköche nach einer Niederlage schlechter beurteilt werden als nach einem überzeugendem Sieg. Der Spielausgang stellt den entscheidenden irradiierenden Faktor für die Beurteilung der Dienstleistungsqualität des Fußballspiels dar, er prägt unseren Geschmackssinn mehr als die Qualität der Speisenzubereitung selbst. Oder, wie es schon der Dortmunder Fußballphilosoph Adi Preißler wusste und für den Fußball sehr universell ausdrückte, Irradiation bedeutet hier: „Entscheidend is’ auf’m Platz!“
Prof. Dr. Michael Welling, 1. Vorsitzender/Geschäftsführer, Rot-Weiß Essen
Umgang mit psychischen Belastungen und Selbstwirksamkeit
Im Bereich des Freizeit- und Gesundheitssports gilt es als wissenschaftlich recht gut gesicherte Erkenntnis, dass sportliche Aktivität als Schutzfaktor gegen äußere Stressoren und die Entwicklung psychischer Störungen wirkt. Im Profifußball liegen hingegen bislang vergleichsweise wenige Untersuchungen vor. Eine einfache Übertragung auf den Leistungssport ist nicht ohne weiteres machbar, da im Profifußball durch deutlich höhere Belastungsintensitäten und -umfänge als auch durch Erwartungen von Fans und Medien vollkommen andere Anforderungen für die Spieler bestehen. Die wenigen aktuellen Studien mit Spitzensportlern (unter anderem auch mit Fußballern) bestätigen diese Annahme: So zeigte jeder zehnte Athlet psychische Befindensbeeinträchtigungen, zum Beispiel Erholungs- und Schlafprobleme. Auf der Basis solcher Ergebnisse kann zumindest davon ausgegangen werden, dass diese Probleme keine Seltenheit sind. Zentrale Faktoren hierfür sind im Profifußball in erster Linie die individuelle Wahrnehmung von Erfolg und Misserfolg. Hier geht es nicht um notwendigerweise eingetretene Erfolge oder Misserfolge, zum Beispiel gewonnene oder verlorene Spiele. Bereits das bloße Antizipieren von Erfolg oder ein Scheitern und die hiermit verbundenen Ängste und Befürchtungen beeinflussen wesentlich das Befinden des Spielers. Entsprechend kann schon die Angst vor Misserfolg („Misserfolgsorientierung“) und damit verbunden die Angst, Fehler zu machen, noch bevor welche eingetreten sind, zu Stress führen. Geraten Spieler unter Stress, führt dies zu unangenehmen Gefühlszuständen wie Ärger oder Frustration, die leistungsmindernd wirken. Solche Stressreaktionen müssen von Spielern angemessen bewältigt werden, damit sich die negativen Gefühlszustände nicht verstetigen und so die psychische Gesundheit nachhaltig schädigen. Verschiedene Strategien zur Stressbewältigung können hier unterstützend wirken. Die Forscher Nicholas Holt und John Hogg untersuchten 2002 das Bewältigungsverhalten von Spielerinnen im Profifußball und konnten aufzeigen, dass eine ganze Bandbreite von Stressbewältigungstechniken verwendet wird:
Kognitive Strategien(z.B. die Neubewertung von Situationen)
Inanspruchnahme sozialer Unterstützung (z.B. die Familie als Ressource)
Strategien zur konkreten Änderung des eigenen Verhaltens (z.B. die Veränderung des Kommunikationsverhaltens mit den Mitspielern oder mit dem Trainer)
Ablenkung von oder Verdrängung der Stressoren
Je nachdem, wie funktional oder dysfunktional die Bewältigungsformen für die jeweilige Situation sind, wirken sich Stress und Druck unterschiedlich auf Wohlbefinden und Leistung aus. Ist die Bewältigung angemessen, kann dies die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Stressoren stärken. Damit verbunden kann sich die Selbstwirksamkeit des Spielers erhöhen und sich ein positiveres Selbstbild entwickeln, und zwar durch folgende individuell ausgerichtete Maßnahmen:
Selbstreflexion(Reflektieren eigener Bedürfnisse und Motive)
Wissensvermittlung(z.B. Kenntnisse über Stressprozesse)
Umgang mit Beanspruchung und Misserfolg
Soziale Kompetenzen(z.B. Kommunikation mit Mitspielern und Trainer; aktive Suche nach sozialer Unterstützung)
Selbststeuerung und die funktionale Sicht
Argentiniens ehemaliger Nationaltrainer Alejandro Sabella hat einmal über die Bedeutung mentaler Stärke in den K.o.-Spielen der Weltmeisterschaft 2014 folgenden Satz verloren: „Wenn das Gehirn ein Muskel wäre, wäre es der wichtigste von allen. Ein Gramm Neuronen ist wichtiger als ein Kilo Muskeln.“ Dem wollen und können wir nicht widersprechen. Denn: Die größte Bedeutung für die Leistung haben die Fähigkeiten zur Selbststeuerung, wie die differentielle Persönlichkeitsforschung zeigen konnte. Dazu gehören auch Willenskomponenten. In den bislang 40 messbaren Funktionen der Selbststeuerung sind manche Spieler sichtbar sehr gut, andere aber könnten viel von deren Training profitieren.
In der Selbststeuerungsforschung wird zwischen Selbstregulation und Selbstdisziplin unterschieden. Selbstregulation bezeichnet verschiedene Selbststeuerungsfähigkeiten, die den Zugang zu den eigenen Bedürfnissen auch unter Stress ermöglichen. Selbststeuerung ist allerdings nur möglich, wenn auch entsprechende Handlungs- und Entscheidungsspielräume durch den Trainer gewahrt werden. Selbstdisziplin hingegen bezeichnet Fähigkeiten, die das Ausblenden eigener Bedürfnisse zugunsten eines Ziels forcieren. Die richtige Balance zwischen beiden Fähigkeitskomplexen, so zeigt die sportpsychologische Forschung, bietet optimale Voraussetzungen für Hochleistung.
Auch wegen dieser Erkenntnisse erscheint die Maßnahme von Carlo Ancelotti, den Spielern bei der Auswahl ihrer Freizeitaktivitäten freie Hand zu lassen, in einem positiven Licht. Umgekehrt könnte eine extreme Betonung von Disziplin und Zielorientierung, wie sie beispielsweise von Louis van Gaal eingefordert wird, auf längere Sicht sogar das Gegenteil bewirken, nämlich die Spieler in Stresssituationen hemmen.
Der Osnabrücker Forscher Julius Kuhl hat sich intensiv den Fragen von Persönlichkeitsstilen und Selbststeuerung gewidmet. Von ihm stammt zunächst das Konzept der Handlungs- und Lageorientierung. Es wird bereits seit Jahren in verschiedenen Sportarten, beispielsweise im Handball und in der Leichtathletik, vereinzelt aber auch in der Wirtschaft zur Führungskräfteauswahl genutzt. Athleten mit einer hohen Handlungsorientierung sind in der Lage, alle mentalen Prozesse auf den Handlungsvollzug auszurichten und Misserfolge schnell auszublenden, während Athleten mit einer niedrigen Ausprägung der Handlungsorientierung sich beim Handlungsvollzug über zukünftige, gegenwärtige und vergangene Dinge Gedanken machen und nach Misserfolgen Leistungseinbußen zeigen.
Kuhl untersuchte unter Berücksichtigung psychologischer, physiologischer, medizinischer und neurobiologischer Aspekte die Wechselwirkungen verschiedener Persönlichkeitsebenen (zum Beispiel bewusste und unbewusste Motive, Temperament, Persönlichkeitsstile und Selbststeuerungsfunktionen) und übertrug seine Schlussfolgerungen auf den Sport und die Wirtschaft. Er unterscheidet dabei generell zwischen Erst-, Zweit-, und Drittreaktion beim Zustandekommen eines Verhaltens.
Die Erstreaktion bestimmt, mit welcher Grundstimmung ein Spieler generell in neue Situationen eintaucht: Geht er gefahrenorientiert oder chancenorientiert in ein Spiel hinein? Dazu kommen seine Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensgewohnheiten, die Persönlichkeitsstile. Sie legen eine Verhaltensrichtung fest, die der Spieler in einer bestimmten Situation am liebsten einschlagen würde.
Die Zweitreaktion ist die motivationale Ausrichtung in der Situation. Welche Ziele zur Befriedigung eines Bedürfnisses sind für den Spieler bedeutsam? Diese Ziele können bewusst, aber auch unbewusst sein. Gewinnt er Energie daraus, seine Ziele oder das, was der Trainer vorgegeben hat (Leistungsmotiv), umzusetzen? Oder ist es für ihn reizvoller, sich gegen den Gegner zu behaupten (Machtmotiv)? Vielleicht ist es ihm ein Bedürfnis, das Zusammenspiel oder das Team zusammenzuhalten (Beziehungsmotiv). Alle drei Motive können dabei zu einer Hochleistung führen.
Die dritte Reaktion schließlich ist entscheidend für die Art des Verhaltens: Wie setzt der Spieler seine Selbststeuerungsfähigkeiten ein? Kann er seinem durch Stimmung, Persönlichkeit und Motivation entstandenen „Impuls“ widerstehen und sich situationsadäquat „einstellen“? Ausraster auf dem Platz zeigen, dass Spielern dies nicht immer gelingt.
Apropros Ausraster: Vielleicht erinneren Sie sich noch an den Eklat während der WM 2014, als Uruguays Luis Suarez seinen Gegenspieler, den Italiener Giorgio Chiellini, in die Schulter biss? Aus dieser Attacke resultierte eine deftige Sperre für neun Pflichtländerspiele bzw. vier Monate. In der Anhörung versuchte Suarez seine Reaktion zu erklären: „Im Moment des Aufpralls habe ich die Kontrolle verloren, wurde instabil und bin auf meinen Gegner gefallen.“ Mit anderen Worten: Hinsichtlich der Impulskontrolle hat Suarez in diesem Moment versagt und seinem Team damit einen Bärendienst erwiesen.
Es zeigt sich, dass die Arbeit an den Selbststeuerungsfaktoren in relativ kurzer Zeit Veränderungen hervorbringt. Die „Grundausstattung der ersten und zweiten Reaktion“ benötigt hingegen langfristige Programme und Trainings, um Erfolge vorzuweisen.
Zum Ende dieses Kapitels halten wir fest: Jede Mannschaft besteht aus so vielen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen wie Spielern. Es gibt dabei eine ganze Reihe verschiedener Treiber und Hemmnisse, die die Leistung des Einzelnen entscheidend beeinflussen. Außerdem stehen verschiedene Methoden unterschiedlicher Qualität bereit, die dabei helfen sollen, Persönlichkeitsprofile und Motive der Spieler abzubilden.
Nun ist weder der Mitarbeiter im Unternehmen noch der Spieler eines Clubs eine Insel. Vielmehr geht es darum, zielgerichtet mit anderen zu interagieren und sich selbst in seiner Rolle zu hinterfragen. Denn das Tun des Einzelnen hat immer auch Auswirkungen auf das Kollektiv. Mehr zum Thema Selbstreflexion erfahren Sie im nächsten Kapitel.
Doch möchten wir Ihnen zum Abschluss dieses Kapitels noch ein Spielfeld mit auf den Weg geben, weil es so wunderbar zu den Themen Einstellung und Persönlichkeit passt:
Wie Unmögliches doch noch möglich wird: Hier kommt ein Weltmeister
Oft erscheinen uns Ziele in so weiter Ferne und so unerreichbar, dass wir eine lähmende Hoffnungslosigkeit spüren und uns erst gar nicht auf den Weg machen möchten. Im Prinzip ist es aber in erster Linie dieses Zaudern und Verzagen, das das Ziel unerreichbar werden lässt. Ein schönes Beispiel dafür ist Bastian Schweinsteiger, Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und Weltmeister 2014. Bastian musste in seiner Karriere beim FC Bayern oft sehen, wie Ziele, die zum Greifen nah schienen, plötzlich in ganz weite Ferne gerissen wurden. So zum Beispiel bei der WM in Deutschland im Jahr 2006, als eine Welle der Euphorie durch das Land ging, aber Deutschland im Halbfinale an Italien scheiterte und ein landesweiter Traum zerplatzte. Mit dem FC Bayern stand Bastian Schweinsteiger 2012 im „Finale dahoam“ im Endspiel der Champions League gegen den FC Chelsea, nachdem man 2010 im Finale an Inter Mailand gescheitert war und das Triple verpasst hatte. Im eigenen Stadion sollte der lang gehegte Traum nun endlich Wirklichkeit werden. Nachdem man das Spiel über weite Teile sicher im Griff hatte und die Engländer überlegen dominierte (bis zur 70. Spielminute hatte der FC Bayern bereits 26 Torschüsse absolviert, ein Rekord für Champions-League-Finale) schoss Ribéry endlich den Führungstreffer. In der 88. Minute glich Chelsea jedoch glücklich durch Drogba zum 1 : 1 aus. Der Rest ist Geschichte, Schweinsteiger verschießt den letzten Elfmeter der Bayern, Drogba überwindet Manuel Neuer und Chelsea gewinnt in München das Finale.
2 Jahre später, WM-Endspiel Deutschland – Argentinien in Rio. Nach vielen geplatzten Träumen und unzähligem Wiederaufrappeln hatte Bastian 2013 den Champions-League-Titel geholt, im Finale gegen den BVB in London. Sicher auch mit Wut im Bauch, mit unbedingtem Willen in der Brust, nachdem viele schmerzhafte Niederlagen das Ziel irgendwann unerreichbar wirken ließen. Schweinsteiger wuchs über sich hinaus. Er lief 15,3 km, mehr als alle anderen Spieler. Er gewann 20 von 29 Zweikämpfen, 87 von 95 Pässen kamen beim Mitspieler an – alles Rekordwerte. Christoph Kramer fiel nach einer halben Stunde verletzungsbedingt aus und Bastian entschloss sich, die Aufgaben im Mittelfeld nun allein zu übernehmen, mit Kampf, eisernem Siegeswillen und der absoluten Entschlossenheit, heute etwas Unmögliches zu erreichen. Sechs mal war er an dem Abend nur durch Fouls zu stoppen, ein weiterer Spitzenwert. Als in der 109. Spielminute der argentinische Stürmer Agüero ihm mit einem Ellenbogenschlag die Wange aufplatzen ließ, musste er sich vom Mannschaftsarzt die blutende Wunde tackern lassen. Statt sich aber für den bereitstehenden Kevin Großkreutz einwechseln zu lassen, kam Bastian noch entschlossener auf den Platz zurück. Er warf seinen Gegenspielern Agüero und Mascherano einen vernichtenden Blick zu und machte seiner Mannschaft wie dem Gegner deutlich: Heute werden wir das Unmögliche schaffen! Und „Die Mannschaft“ schaffte das Unmögliche, holte zum vierten Mal den Weltmeisterpokal. Bei der feierlichen Zeremonie im Anschluss an das Spiel schritt Schweinsteiger, der Kapitän, wie ein Feldherr vorweg. Er kämpfte sich durch die Menschenmassen auf den Weg zur Ehrentribühne, sichtlich abgekämpft und gezeichnet, ein Veilchen am rechten Auge, getrocknetes Blut im Gesicht. Körpersprache und Mimik aber verrieten: Hier kommt ein Weltmeister.
Im Arbeits- wie im Privatleben kennt jeder die kleinen und großen Rückschläge, die es wegzustecken gilt. Davon sollte man sich nicht abhalten lassen, sich hohe, unmöglich scheinende Ziele zu stecken. Erst dadurch entsteht die Möglichkeit, sie eines Tages auch zu erreichen.
Ralf Jodl, Geschäftsführer, SIP Scootershop
2 Selbstreflexion und Perspektivwechsel
Dieses Kapitel sollten Sie unbedingt lesen, wenn Sie wissen wollen, …
… warum Sie sich vorher überlegen sollten, ob Sie anderen den „Elfer klauen“.
… was der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Bewertung ist – und was Balotelli damit zu tun hat.
… warum der Fokus auf Gemeinsamkeiten statt auf Unterschiede für Ribéry und Robben äußerst fruchtbar war.
Im ersten Kapitel haben wir uns dem Thema Persönlichkeit und Individualität gewidmet und festgestellt, welche Hemnisse und Treiber hier eine Rolle spielen. Wie wirkt sich aber nun die Konfiguration unterschiedlicher Persönlichkeiten auf der Teamebene aus? Gilt hier das Prinzip „je bunter, desto besser“? Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf die aktuelle Forschungsliteratur sagen: Die Ausprägungen bestimmter Persönlichkeitseigenschaften der Teammitglieder scheinen für den Erfolg einer Mannschaft von deutlich größerer Wichtigkeit zu sein, als die Heterogenität der Persönlichkeitstypen in der Zusammenstellung des Kaders.
Die wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften sind hier vor allem die Verträglichkeit (der Grad an Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Verständnis für andere) und Gewissenhaftigkeit (der Grad an Selbstkontrolle, Genauigkeit und Zielstrebigkeit) eines Spielers. Ebenfalls relevant ist die emotionale Stabilität, also das Maß, in dem sich ein Mensch ruhig, zufrieden und sicher fühlt. Offenheit für Neues und Extraversion (d.h. der Grad an Geselligkeit und zwischenmenschlicher Aktivität) sind zwar weniger wichtig, aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Die Diversität von Persönlichkeitstypen – also die Vielfalt der Individuen innerhalb des Mannschaftsgefüges – ist kein Erfolgskriterium.
Mit Blick auf die aktuelle Forschungslage zum Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften auf den Berufserfolg ergibt sich ein ähnliches Bild: Vor allem die Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit hängt branchenübergreifend positiv mit Erfolgskriterien wie Gehalt, Hierarchie und Einschätzung durch Vorgesetzte und Kollegen zusammen. Eigenschaften wie Extraversion sind hingegen nur für bestimmte Berufe wichtig. Sie können sich vorstellen, dass ein Moderator oder Berater gemäß seiner Tätigkeitsanforderung ein höheres Maß an gesprächigem, aktivem und enthusiastischem Verhalten zeigen sollte als ein Statistiker oder Chemielaborant ohne Kollegen- oder Kundenkontakt. Übrigens sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass es sich bei Persönlichkeitseigenschaften zwar um zeitlich und situativ sehr stabile Konstrukte handelt, Eigenschaften aber im Wesentlichen auf Präferenzen abzielen. Extravertierte Menschen empfinden beispielsweise den Austausch und das Handeln innerhalb sozialer Gruppen als anregend und mögen dies gern. Das heißt allerdings nicht, dass nicht auch von Natur aus introvertiertere Menschen in diesem Bereich lernen und sich entwickeln können. Das Gegenteil ist der Fall und sollte im Sinne guter Personalentwicklung auch so gelebt werden.
Die oben gemachten Aussagen zur Vielfalt der Individuen innerhalb des Teamgefüges in Sport und Wirtschaft gelten übrigens auch für Vielfalt in heterogenen Gruppen hinsichtlich Geschlecht, Alter und Kultur. Aus dem Angelsächsischen hat sich für diese Art der Vielfalt mittlerweile auch der Begriff Diversity etabliert. Aktuelle Studien legen nahe, dass dadurch Synergieeffekte entstehen können, aber nicht müssen. Vielmehr muss erstens ein gegenseitiges Verständnis direkt zu Beginn der Zusammenarbeit geschaffen werden. Zweitens müssen die jeweiligen Kräfte entsprechend ihrer Kompetenzen eingesetzt werden.
Auf den Profifußball bezogen bedeutet dies, dass ein erfahrener Spieler auch im Spätherbst seiner Karriere sehr wohl ein Gewinn für das Team sein kann. Nur sollte ihm und seinen Mitspielern klar sein, was von ihm erwartet wird, und was nicht erwartet werden kann. So konnte ein Spieler wie beispielsweise Miroslav Klose bei Lazio Rom nicht mehr 90 Minuten das Spielfeld hoch- und runterrennen, aber als Knipser für die letzten zwanzig Minuten und als Mentor, zu dem junge Spieler aufschauen, taugte er allemal. Der erfolgreichste ausländische Knipser der Bundesligageschichte, Claudio Pizarro, ist mit seinen 37 Jahren ebenfalls in einem für den Profifußball fast biblischen Alter. Allerdings hatte der Fußball-Oldie mit seinen Toren, Assists und seiner Präsenz innerhalb des Teams erheblichen Anteil daran, dass Werder Bremen in der Saison 2016/17 die Klasse halten konnte.
Dies setzt allerdings voraus, dass alle Beteiligten in der Lage sind, sich in ihr Gegenüber und dessen Voraussetzungen hineinzuversetzen. In Bezug auf andere ist also auch die Frage zu stellen: Wie könnte das eigene Verhalten auf die Mitspieler wirken? Psychologen sprechen hier von einem Perspektivwechsel. Symptomatisch für solche kritischen Situationen im Profifußball ist beispielsweise der auf und neben dem Platz oft hitzig diskutierte „Elferklau“.
Ein Beispiel aus dem Jahr 2016, aus dem Europa-League-Spiel von Liverpool gegen Besiktas Istanbul: Beim Stand von 0:0 in der 85. Minute schnappte Mario Balotelli dem Kapitän Henderson, der eigentlich als Schütze bestimmt war, den Ball weg. Auch die Einwände der Mitspieler konnten den eigenwilligen Stürmer nicht von seinem Vorhaben abbringen. Balotelli traf zwar, der verletzte Stephen Gerrard wetterte anschließend dennoch öffentlich über diese „Respektlosigkeit“ Balotellis und brachte die Kernbotschaft des Perspektivwechsels auf den Punkt: „Was ist denn, wenn sechs, sieben Spieler schießen wollen und alle auf ihrer Forderung beharren?“
Im schlimmsten Falle isoliert solch ein sich wiederholendes egoistisches Verhaltensmuster einen Spieler vom Rest des Teams. Für eine maximale Leistungserbringung ist er aber auf seine Mitspieler und gegenseitige Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig braucht es natürlich Spieler mit unbedingtem Willen und individueller Klasse, die bereit sind, in den entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen. Empfehlenswert ist sicherlich eine gesunde Balance zwischen Individual- und dem kollektiven Teaminteresse. Individualismus und Kreativität dürfen also nicht auf der Strecke bleiben, große Egos müssen sich jedoch zurücknehmen. So pflegt und ermutigt der deutsche Weltmeistertrainer Jogi Löw Edeltechniker wie Mesut Özil oder Mario Götze behutsam, ohne Höhenflüge einzelner Stars zu dulden: „Der Teamgedanke schlägt im Zweifel den Individualismus. Das gilt für jeden.“
Der zweite Aspekt bei der Selbstreflexion bezieht sich auf die Trennung von Wahrnehmung und Bewertung. Viel zu oft vernachlässigen wir diese wichtige Unterscheidung im beruflichen Alltag, beispielsweise, wenn der Chef in der Kantine nicht grüßt. Vielleicht denken Sie reflexartig, er ignoriert Sie bewusst, fragen sich möglicherweise sogar, was Sie falsch gemacht haben könnten, dass Sie so stehen gelassen werden. Schließlich hat Ihr Vorgesetzter sich so noch nie verhalten. Hier sind Sie allerdings schon mitten in der Bewertung. Davor kommt aber das rein Sichtbare, die bloße Wahrnehmung. Was haben Sie also an konkretem Verhalten wahrgenommen? Richtig, nur, dass er nicht gegrüßt hat. Die dahinterliegenden Gründe sind genauso vielfältig wie möglicherweise harmlos. Er war in Gedanken, er war in ein Gespräch vertieft oder er hatte schlicht seine Brille vergessen. Überlegen Sie in uneindeutigen Situationen also noch einmal, ob Ihr erster Eindruck nicht auch täuschen könnte. Gleichzeitig sind Sie nicht nur Beobachter und Bewerter, sondern auch jemand, der kontinuierlich durch andere wahrgenommen und bewertet wird. Prüfen Sie folglich, ob Ihr Verhalten den Eindruck hinterlässt, den Sie im Sinn hatten.
Bleiben wir bei Mario Balotelli. Als er 2012 Deutschland im Halbfinale aus dem EM-Turnier schoss, waren weniger seine Tore im Blickpunkt des Interesses. Vielmehr war es seine Pose, die als Foto um die Welt ging (zur Erinnerung: Mit freiem Oberkörper ließ er die Muskeln spielen.). Von allen Seiten beleuchtet und besprochen, reichte die Palette der medialen Interpretationen „von der prolligen Geste eines Egomanen“ bis hin zum „hochreflektierten politischen Symbol“ („das Sprengen der Ketten der Sklaverei“). Sie sehen schon: Obwohl alle sich auf dasselbe Foto bezogen, gingen die Bewertungen von Balotellis Pose ziemlich auseinander. Der Grund ist einfach: Wir beurteilen die Welt immer vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen. Hier spielen verschiedene Strategien („Heuristiken“) zur Eindrucksbildung wie Bestätigungstendenzen („der Mario, das war ja klar!“) oder Selbstschemata (der deutsche Fan dürfte die Pose anders bewerten als ein Anhänger der Tifosi) eine nicht unerhebliche Rolle.
Solche Heuristiken sind im Alltag wichtig, sie reduzieren die Komplexität der Welt auf ein Maß, das uns handlungsfähig bleiben lässt. Wichtig ist nur, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir unsere Umwelt nicht vorurteilsfrei und objektiv wahrnehmen, sondern dass jede Wahrnehmung auch immer zu einer bestimmten – und von Person zu Person teilweise sehr unterschiedlichen – Wirkung führt. Diese Wirkungen finden übrigens immer auf drei Ebenen statt: auf der kognitiven (Was denke ich?), affektiven (Was fühle ich?) und verhaltensmäßigen Ebene (Wie reagiere ich äußerlich?).





























