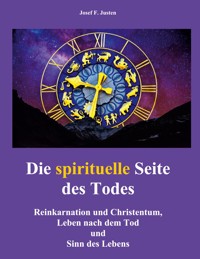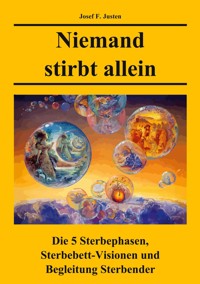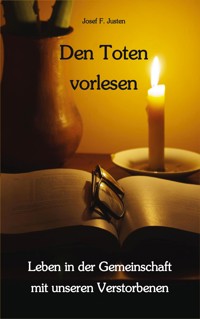Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Autorin, Julia Lucia Fink, hat über zwanzig Jahre im Rahmen ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche Hospizhelferin viele Menschen, die an der Schwelle des Todes standen, begleiten dürfen. Auch deren Angehörigen durfte sie zur Seite stehen. Es war ihr stets besonders wichtig, die spirituellen Aspekte des Sterbens, die in einer Sterbebegleitung eine große Rolle spielen, mit einzubeziehen. In all diesen Jahren kam es zu vielen sehr angenehmen und fruchtbaren, zu bewegenden und berührenden, aber auch zu einigen beklemmenden und bedrückenden Begegnungen mit Menschen, die sich in einer schicksalsträchtigen Phase ihres Lebens befanden. Alle Begleitungen, auch - oder vielleicht sogar gerade - die schwierigen, empfand sie als ein Geschenk und eine Bereicherung. Fast alle Sterbenden haben sie - meistens natürlich, ohne sich dessen bewusst zu sein - gelehrt, haben ihr wertvolle Anregungen und Impulse für ihr Leben gegeben. In diesem Buch schildert sie über ihre Erfahrungen aus einigen ihrer insgesamt mehr als sechzig Sterbebegleitungen, die sie - aus unterschiedlichen Gründen - besonders gefordert oder berührt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allen Menschen, die ich begleiten durfte, als sie an der Schwelle des Todes standen, gewidmet
Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Matthäus 25, 40
Inhaltsverzeichnis
Die Idee zu diesem Buch
Vorwort
Meine Motivation, mich mit dem Thema »Tod« auseinanderzusetzen
Mein Weg zu spirituellen Erkenntnissen
Mein Weg zur Hospizhelferin
Meine Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin
Aufgaben und Dienstleistungen des Hospizvereins
Spirituelle Aspekte in der Sterbebegleitung
Planung und Organisation einer Begleitung
Erfahrungsaustausch, Supervision und Weiterbildung
Schilderungen meiner Sterbebegleitungen
Zufrieden und dankbar
Gehen Sie mit Gott!
Chance am Lebensende
Wut auf das eigene Schicksal
Der Leichenschmaus
Die Geduld der Engel
Wo Rost und Motten ...
Der »Katzenfreund«
In guten wie in schlechten Tagen
Der »Feuerwehr-Einsatz«
Ein großes Missverständnis
Wenn man nur wüsste ...
Der »Doppelgänger«
Dem Tod kann man nicht davonlaufen
Das Gelübde
Hinter der Tür
Der Tod kennt kein Alter
Schlusswort
Hinweise und Erläuterungen zu den Fußnoten
Buchempfehlungen
Das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis des Todes sind verschlossen in zwei Schatullen, von denen jede den Schlüssel zum Öffnen der anderen enthält.
Mahatma Gandhi
Die Idee zu diesem Buch
In den drei Jahrsiebten von 1998 bis 2018 durfte ich als ehrenamtliche Sterbebegleiterin unseres überkonfessionellen Hospizvereins etlichen Menschen in ihrer letzten Lebensphase zur Seite stehen. Auch konnte ich viele, die einen lieben Angehörigen verloren hatten, bei der Verarbeitung ihrer Trauer unterstützen.
In dieser Zeit traf ich mich des Öfteren mit einem guten Freund, Herrn Josef Justen1, der sich in dem Hospizverein seiner Stadt ebenfalls der Sterbebegleitung gewidmet hatte. Gemeinsam tauschten wir unsere Erfahrungen aus, reflektierten diese und gaben uns gegenseitig Anregungen und Empfehlungen.
Während eines unserer vielen Gespräche wurde schließlich im November 2000 die Idee geboren, dieses Buch zu schreiben.
Als ich mich eines Abends unmittelbar nach einem besonders bewegenden Einsatz, an dessen Ende die Patientin starb, mit Herrn Justen traf, schilderte ich ihm, was ich soeben bei dem Besuch dieser Patientin erlebt hatte. Meine Erzählung schloss mit den Worten: »Eigentlich müsste man das alles aufschreiben!«
Darauf sagte er: »Mach es doch! Schreib ein Buch darüber!«
Im ersten Moment war ich von dieser Antwort, die er durchaus ernst meinte, etwas überrascht, obwohl ich ein paar Monate zuvor auch schon einmal diesen Gedanken hatte. Doch schien es mir damals unpassend, derart persönliche, ja intime Erfahrungen zu veröffentlichen. Ich glaubte, alles nur in meiner eigenen Seele bewahren zu dürfen. Außerdem war ich sehr ungeübt, was das Schreiben eines Buches angeht.
Aber nun schien mir der Gedanke, ein Buch über diese Erlebnisse zu verfassen, doch eine ganz gute Idee zu sein und er sollte mich nicht mehr loslassen, auch wenn die Realisierung noch sehr lange auf sich warten ließ, da ich erst noch möglichst viele weitere Erfahrungen sammeln wollte.
Vermutlich hätte ich mich nicht an diese Aufgabe herangewagt, wenn mein Freund sich nicht bereit erklärt hätte, mich bei der Gestaltung des Buches tatkräftig zu unterstützen. Ohne ihn wäre dieses Buch wohl niemals zustande gekommen.
Er war mein Inspirator, Kritiker und Lektor.
Dafür gebührt ihm mein großer Dank!
Vorwort
In all diesen Jahren kam es im Rahmen meiner Tätigkeit als Sterbebegleiterin zu vielen sehr angenehmen und fruchtbaren, zu bewegenden und berührenden, aber auch zu einigen beklemmenden und bedrückenden Begegnungen mit Menschen, die sich in einer schicksalsträchtigen Phase ihres Lebens befanden.
Alle Begleitungen, auch – oder vielleicht sogar gerade – die schwierigen, waren für mich ein Geschenk und eine Bereicherung.
Fast alle Sterbenden haben mich – meistens natürlich ohne sich dessen bewusst zu sein – gelehrt, haben mir wertvolle Anregungen und Impulse für mein Leben gegeben.
Hierbei denke ich ganz gewiss nicht an Plattitüden, die mir natürlich auch ein paar Mal mit auf den Weg gegeben wurden, wie etwa: »Genieße dein Leben, solange es noch möglich ist!«
Über meine Erfahrungen aus einigen meiner insgesamt mehr als sechzig Sterbebegleitungen, die mich – aus unterschiedlichen Gründen – besonders gefordert oder berührt haben, möchte ich in diesem Buch erzählen.
Der Zeitraum, über den sich eine Begleitung erstreckte, variierte sehr stark. Bei den kürzesten kam es nur zu einer einzigen Begegnung, was im Normalfall daran lag, dass der Patient bereits während meiner Anwesenheit oder kurz danach verstarb. Meine längste Begleitung dauerte ein Vierteljahr und umfasste etwas mehr als dreißig Besuche.
Von meiner ersten Begleitung an hatte ich mir nach jedem Patientenbesuch Notizen gemacht. Seit ich mich entschlossen hatte, irgendwann dieses Buch zu schreiben, wurden meine Aufzeichnungen besonders ausführlich und umfangreich.
Daher kann ich heute noch fast alle Begegnungen taggenau und authentisch schildern. Natürlich kann ich die meisten Gespräche, die ich geführt habe, nicht mehr wörtlich, sondern nur sinngemäß wiedergeben. Allerdings gibt es auch ein paar Aussagen, die sich so fest in mein Gedächtnis eingebrannt haben, dass ich sie absolut wortgetreu zitieren kann.
Dieses Buch erhebt gewiss nicht den Anspruch, als Lehrbuch für die Hospizarbeit zu dienen. Auch ist es nicht unbedingt als Leitfaden für Menschen, die in der Sterbe- oder Trauerbegleitung engagiert sind, gedacht.
Dennoch hoffe ich, dass meine Erfahrungen – so individuell diese auch gewesen sein mögen – dem einen oder anderen Menschen, der privat, ehrenamtlich oder professionell einen Schwerkranken oder Sterbenden begleiten möchte, viele Impulse und Anregungen zu geben vermögen. Auch habe ich die Hoffnung, dass dieses Buch Menschen, die selbst kurz vor dieser Schicksalsprüfung stehen, eine große Hilfe sein kann.
Insbesondere jemand, dem die spirituellen Aspekte in einer Begleitung am Herzen liegen, kann aus meinen Erfahrungen sicherlich wertvolle Denkanstöße für seine Aufgabe gewinnen.
Aber auch hier möchte ich betonen, dass alles, was und wie ich etwas in meinen Begegnungen mit den Patienten gemacht oder gesagt habe, nicht als Lehrbeispiele verstanden werden sollte.
Schließlich ist jeder zu begleitende Mensch ein Individuum. Jeder hat seine eigene Art, mit seinem Schicksal umzugehen. Jeder hat für seine finale Lebensphase seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen darüber, ob bzw. wie es mit ihm nach seinem Tod weitergeht. Jeder muss letztlich seinen eigenen Tod sterben.
Auch jeder Begleiter ist ein individueller Mensch. Jeder hat seine eigenen Ansichten und seine eigenen Stärken, die er in eine Begleitung fruchtbar einbringen kann.
Meine Schilderungen mögen zugleich auch ein Plädoyer für die so wichtige und wunderbare Aufgabe sein, Menschen in ihrer Sterbephase helfend und unterstützend beistehen zu dürfen.
Im Dezember 2019 Julia Lucia Fink
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Selbstverständlich habe ich aus Gründen des Datenschutzes und des Respekts der Privatsphäre sämtliche Namen, also die der Patienten, ihrer Angehörigen, der Hospizmitarbeiter, der Orte sowie aller Einrichtungen, und alle kalendarischen Daten geändert, so dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Personen gezogen werden können.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Meine Motivation, mich mit dem Thema »Tod« auseinanderzusetzen
Viele meiner Bekannten und Arbeitskollegen, die von meinem Engagement in der Hospizarbeit wissen, fragen mich, wie ich überhaupt um alles in der Welt auf die Idee gekommen sei, mich einer solchen Aufgabe zu widmen.
Diese Fragen haben häufig den Unterton: »Wie kann man sich nur freiwillig mit Tod und Sterben befassen, da wir doch alle so viel Angst davor haben und es am besten nie erleben möchten?«
Mir ist klar, dass es sich hierbei immer noch um ein Tabuthema handelt. Viele Zeitgenossen scheinen geradezu nach dem Motto zu verfahren, dass der Tod sie nicht ereilen könnte, wenn man ihm nur keinen gedanklichen Raum gebe.
Das war bei mir schon immer ganz anders. Bereits in meiner Kindheit hat mich das Thema »Tod« sehr beschäftigt.
Als meine Großmutter, die in der elterlichen Wohnung lebte und die ich sehr lieb hatte, starb, war ich gerade eingeschult worden. Es war das erste Mal in meinem noch jungen Leben, dass ich – zumindest bewusst – mit einem Sterbefall konfrontiert wurde.
Obwohl ich mit eigenen Augen gesehen hatte, dass ihr Leichnam in einen Sarg gelegt und dass der Sarg drei Tage später ins Grab versenkt wurde, konnte ich irgendwie nicht glauben, dass es wirklich meine Oma war, die in dem Sarg lag.
Ich dachte: »Das kann doch höchstens ein Teil von ihr sein, der da in dem Sarg liegt. Das kann doch nicht alles sein, was von ihr übrig geblieben ist.«
So fragte ich meine Eltern: »Wo ist denn die Oma jetzt? Und was macht sie da?«
Mein Vater antwortete: »Die Oma ist jetzt im Himmel beim lieben Gott und den Engelein. Dort geht es ihr sehr gut. Du musst dir keine Sorgen machen! Wenn du für sie betest, wird es ihr noch besser ergehen.«
Dann ergänzte meine Mutter noch etwas, was aus meiner heutigen Sicht durchaus richtig ist: »Auch wenn wir sie jetzt nicht mehr sehen können, so ist sie doch immer noch bei uns. Nachts, wenn du schläfst, ist sie dir besonders nah.«
Die Erklärungen meiner Eltern befriedigten mein kindliches Gemüt. Oft schaute ich gen Himmel und dachte: »Irgendwo da oben ist die Oma jetzt. Und der liebe Gott und die Engelein passen gut auf sie auf.«
In etwas späteren Jahren ging es dann auch im katholischen Religionsunterricht, den der Pfarrer unserer Gemeinde hielt, manchmal um die Frage, wie es mit dem Menschen nach dem Tod weitergeht.
Das, was der Pfarrer dazu lehrte, ging im Grunde nicht wesentlich über die Floskeln, die ich Jahre zuvor von meinem Vater schon gehört hatte, hinaus. Natürlich sprach er auch noch über den »Himmel«, die »Hölle«, das »Fegefeuer«, das »Jüngste Gericht« sowie die »Auferstehung am Jüngsten Tage«.
Als ich siebzehn Jahre alt war, starb meine beste Freundin. Sie hatte Magenkrebs.
In ihren letzten Lebensmonaten war sie ans Bett gefesselt. Sie hatte große Schmerzen, so dass ihr immer wieder Morphium verabreicht wurde. Eine Palliativmedizin gab es noch nicht. Wenn ich an ihr Sterbelager trat, dämmerte sie meistens vor sich hin, so dass sie nur selten ansprechbar war. Es war für alle Betroffenen – insbesondere natürlich für meine Freundin – sehr schlimm! Ihre Eltern waren völlig verzweifelt!
Nachdem sie dann gestorben war, machte ich mir erstmals ganz ernsthaft Gedanken darüber, was mit einem Menschen nach dem Tod geschieht.
Vermutlich war es meiner katholischen Erziehung zu danken, dass ich nie den geringsten Zweifel daran hatte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Aber dieser Glaube genügte mir nicht. Ich suchte Antworten auf viele Fragen, die mir keine Ruhe lassen wollten:
Warum muss ein so junges, anständiges Mädchen schon so früh sterben?
Was ist der Sinn, dass sie zum Schluss so stark leiden musste?
Kann Gott überhaupt gerecht sein?
Was geschieht eigentlich genau mit der Seele nach dem Tod?
Mir war längst klar geworden, dass die Kirchenvertreter mir keine befriedigenden Antworten geben konnten oder wollten.
Deshalb unternahm ich gar nicht erst den Versuch, unseren Pfarrer zu fragen. Auch mit meinen Eltern darüber zu reden, machte nach meiner Einschätzung keinen Sinn, da sie als Erzkatholiken auch nur das glaubten, was die Kirche lehrte.
Im Gegensatz zu mir schien ihnen das zu genügen.
Mein Weg zu spirituellen Erkenntnissen
Unter meinen Mitschülern und Jugendfreunden fand sich im Grunde leider auch niemand, der ein wirkliches Interesse an diesem Themenkomplex hatte.
Somit machte ich mich dann auf die Suche nach geeigneter Literatur, nach Büchern, in denen diese Thematik behandelt wird.
Das erste Buch, das mir in der Gemeindebücherei ins Auge fiel, trug den Titel »Bericht vom Leben nach dem Tod«.
Ich lieh es mir aus und las es noch am gleichen Tag. In diesem Buch wurden bestimmte Phasen des nachtodlichen Lebens recht plastisch geschildert. Alles, was dort zu lesen war, nahm ich mit Begeisterung, aber auch völlig unkritisch auf, was gewiss meinem jugendlichen Alter geschuldet war.
Immerhin befriedigte es meinen Wissensdurst vorerst.
In dem besagten Buch hörte ich auch erstmals die Begriffe »Reinkarnation« und »Karma«, die dort aber nur am Rande erwähnt wurden.
Jedenfalls war mein Interesse für diese Themen geweckt, so dass ich gezielt nach Büchern suchte, die diese zum Inhalt hatten.
Schon bald stieß ich auf eines, in dem die »Wiederverkörperung« bzw. »Reinkarnation« populär-wissenschaftlich behandelt wurde.
Obwohl mir der Gedanke, dass jeder Mensch schon viele Male auf der Erde verkörpert war und noch viele Male wieder dort erscheinen wird, völlig neu war, erschien er mir sehr stimmig und logisch zu sein.
In dem Buch waren auch die Zitate vieler großer Dichter und Denker zu finden, die eindeutig zeigten, dass auch sie an die wiederholten Erdenleben glaubten.
In den folgenden zwei, drei Jahren las ich mindestens zwei Dutzend weiterer Bücher, welche die Themen »Tod«, »Leben nach dem Tod« sowie »Reinkarnation und Karma« behandelten. Darunter waren auch einige, die über Nahtoderfahrungen schilderten.
Leider fand ich lange Zeit keinen Menschen, mit dem ich über das Gelesene sprechen konnte. Ich konnte alles nur in meiner Seele bewegen.
Erst viele Jahre später lernte ich durch eine sehr glückliche Fügung des Schicksals meinen bereits erwähnten Freund, Herrn Justen, und seine Frau kennen.
Schon bald stellte sich heraus, dass sie auch auf dem Weg waren, spirituelle Erkenntnisse zu gewinnen.
Die beiden beschäftigten sich schon seit Jahren mit der Anthroposophie2, der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, von der ich bis dahin noch nichts gehört hatte.
Schon nachdem ich dann das erste Buch von Dr. Rudolf Steiner3 gelesen hatte, gab es für mich keinen Zweifel mehr: Steiners Werke sind die beste Quelle, um in der heutigen Zeit stimmige spirituelle Erkenntnisse gewinnen zu können. Er fasste seine Darstellungen in einer Sprache ab, die mit den Verstandeskräften und dem Vorstellungsvermögen rechnet, die dem modernen Menschen eigen sind. Steiners Schilderungen sind frei von Schwärmerei, Gefühlsduselei, religiösem Fanatismus und jedweder Form von Dogmatismus.
Das, was dieser große Eingeweihte in seiner Geistesschau in den übersinnlichen Welten wahrnehmen und studieren konnte, übersteigt alles, was jemals von anderen Menschen erforscht wurde. Sein Werk, das er der Menschheit schenkte, ist so unfassbar umfangreich und vielschichtig, dass bei einem Durchschnittsmenschen – wie ich einer bin – ein Erdenleben kaum ausreichend sein kann, um es zu studieren oder gar in seiner Gänze zu verstehen und zu verinnerlichen.
Mir ging es ja in erster Linie ›nur‹ darum, Antworten auf meine im vorigen Kapitel formulierten Fragen zu finden. Nachdem ich so etwa zwanzig seiner Bücher durchgearbeitet und mich über das Gelesene des Öfteren mit meinem Freund und dessen Frau ausgetauscht hatte, habe ich viele Antworten gefunden!
Auch zahlreiche weitere wichtige Erkenntnisse konnte ich durch dieses Studium gewinnen.
So hörte ich etwa erstmals, dass jeder Mensch ein viergliedriges Wesen ist. Er besteht neben dem physischen Leib4 noch aus drei übersinnlichen Wesensgliedern, die sich nur einem hellsichtigen Menschen offenbaren: Ätherleib5, Astralleib6 und Ich(-leib)7.
Dann lernte ich die »neun Engelreiche«8 bzw. »Engelhierarchien« und deren große Bedeutung, welche diese Wesen für den Menschen – auch nach dessen Tod – haben, kennen.
Schließlich begann ich zum ersten Mal wirklich zu erahnen, welch unermesslich segensreiche Folgen die Mission Christi für die ganze Menschheit hat.
Ich bin meinen Schicksalsmächten zutiefst dankbar, dass sie mich zur Anthroposophie geführt haben.
Der Tod hat für mich jetzt nichts Schreckliches mehr. Er ist nicht etwas, wovor wir uns fürchten müssten. Man kann ihn sogar als Freund erfahren.
Übrigens, anthroposophische Grundkenntnisse sind für das Verständnis dieses Buches zwar hilfreich, aber keineswegs erforderlich. Einem Leser, der solche Kenntnisse wünscht, kann das Buch meines Freundes »Die spirituelle Seite des Todes« empfohlen werden, in dem insbesondere alles, was die Themen »Reinkarnation und Karma« sowie »Leben nach dem Tod« anbelangt, in kompakter und gut verständlicher Form dargestellt wird.
Mein Weg zur Hospizhelferin
Schon Anfang der 1990er Jahre hatte ich von der »Hospiz-Bewegung« gehört, die es in vielen Teilen der Welt gibt.
Mir war bekannt, dass sich in diesem Zuge Menschen in regionalen – vorwiegend überkonfessionellen – »Hospizvereinen« zusammenschließen und sich dann – zumeist ehrenamtlich – in vorbildlicher Weise um die Begleitung Sterbender und deren Angehörigen kümmern.
Ich hielt das für eine sehr gute Sache. Manchmal dachte ich: »Wenn mich mein Job zurzeit nicht so sehr fordern würde, könnte ich mir vorstellen, mich bei einem Hospizverein für diese Tätigkeit zu melden.« Hinzu kam, dass ich schon lange den Wunsch, ja das Bedürfnis verspürte, etwas ›Sinnvolles‹ für andere Menschen zu leisten.
Über die Voraussetzungen sowie die Rand- und Rahmenbedingungen machte ich mir aber keine Gedanken.
Allerdings trug ich dieses Vorhaben jahrelang in meiner Seele mit mir herum.
Im Frühling des Jahres 1997 machte ich mal wieder mit meinem Mann einen Bummel durch eine nahe gelegene Kleinstadt.
Dabei fiel mein Blick auf ein schönes altes Haus, neben dessen Eingangstür ein Schild mit der Aufschrift »Hospizverein« angebracht war. Ich weiß nicht, wie oft ich schon an diesem beeindruckenden Gebäude vorbeigekommen war, jedenfalls habe ich das Schild nie bemerkt.
War es selektive Wahrnehmung oder ein Wink des Schicksals, dass es mir nun geradezu ins Auge stach?
An der großen Holztür hing ein Plakat mit einer Einladung zu einer Informationsveranstaltung für an der aktiven Hospizarbeit Interessierte.
Für mich stand sofort fest: »Jetzt oder nie! An dieser Veranstaltung werde ich teilnehmen.«
Am angegebenen Abend war ich pünktlich zur Stelle. Im Vorfeld dachte ich noch: »Ich würde mich nicht wundern, wenn außer mir keiner käme! Schließlich ist alles, was mit Sterben und Tod zusammenhängt, ja immer noch ein Tabuthema.«
Umso überraschter war ich dann, als ich einen fast vollen Raum vorfand. Etwa zwanzig Interessenten waren erschienen, vorwiegend Damen. Ich war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Die meisten der Anwesenden waren älter als ich, einige deutlich älter.
Die Veranstaltung, die fast drei Stunden dauerte, wurde von zwei Damen vom Hospizverein geleitet.
Die eine Dame war so Ende sechzig und stellte sich als Dagmar Oberberger, die andere, die deutlich jünger war, als Barbara Mischke vor. Diese Damen waren für die Ausbildung der neuen Hospizhelfer zuständig.
Die beiden wechselten sich dabei ab, über den Verein, seine Aufgaben usw. zu schildern. Auch erzählten sie, aus welchen Motiven sie sich vor Jahren für die Mitarbeit im Hospizverein entschieden hatten.
Besonders berührt hatte mich der Beweggrund, der Frau Oberberger zu ihrem Engagement in der Hospizarbeit führte: »Ich habe in meinem bisherigen Leben bereits so unglaublich viel Schönes und Angenehmes erleben dürfen! Mein Schicksal hat es immer gut mit mir gemeint! Daher hielt ich es für meine Pflicht, davon etwas an andere Menschen zurückzugeben!«
Das machte sie mir gleich sehr sympathisch.
Frau Oberberger berichtete noch sehr ausführlich, dass für alle an der Sterbebegleitung interessierten Menschen eine spezielle Ausbildung nötig sei, über deren Inhalte sie einiges schilderte.
Dann wurden die Termine für den Grundkurs genannt. Mein Entschluss, diese Ausbildung zu absolvieren, stand fest.
Frau Mischke zitierte zum Abschluss noch einen Spruch von Rainer Maria Rilke:
O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not.
Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht.
Meine Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin
Die Ausbildung möchte ich hier nur in groben Zügen skizzieren.
Es begann mit dem Grundkurs. Dieser erstreckte sich über sechs Samstage und fand im zweiwöchigen Turnus statt.
Am ersten Schulungstag, der wie die übrigen auch fast den ganzen Tag dauerte, ging es ums gegenseitige Kennenlernen und um eine Einführung in die Hospizarbeit. Es waren mit mir immerhin acht Personen, die auch schon der Informationsveranstaltung beiwohnten, erschienen: ein Herr und sieben Damen. Drei waren etwas jünger als ich, vier älter. Eine Dame war schon über siebzig.
Zunächst stellten sich die beiden Ausbilderinnen, Frau Oberberger und Frau Mischke, nochmals ausführlich vor. Dann bekamen wir Teilnehmer die Gelegenheit, uns zu präsentieren. Frau Oberberger bat uns, die Motive zu nennen, die uns zur Absolvierung dieser Ausbildung führten.
Einige gaben an, dass sie in ihrem Beruf als Krankenschwester bzw. Altenpflegerin sehr häufig mit dem Tod ihrer Patienten konfrontiert würden und nun lernen wollten, wie sie damit besser umgehen könnten. Andere sagten, dass sie vor einiger Zeit im Familien- oder Freundeskreis einen liebgewonnenen Menschen durch Tod verloren und sich durch dieses Schicksal erstmals mit diesem Thema befasst hätten. Diese Erfahrungen wollten sie jetzt zum Wohle anderer Menschen einbringen. Eine Dame sagte: »Ich habe mich nie mit dem Tod auseinandergesetzt. Nun hat mich der Tod meines Sohnes vor zwei Jahren regelrecht aufgeweckt!«
Dann hielt uns Frau Mischke einen Vortrag über die Geschichte der Hospizbewegung, über die Organisation unseres Hospizvereins sowie über dessen Leistungsangebote.
Die Schwerpunktthemen an den folgenden fünf Tagen waren: »Bedürfnisse Sterbender«, »Prognosen verschiedener Krankheiten«, »Die 5 Phasen des Sterbens«, »Formen und Regularien einer Bestattung«, »Eigene Endlichkeit« und »Umgang mit Trauer«.
Zu einigen dieser Themen waren Spezialisten geladen: Ärzte, eine Pfarrerin und ein Bestattungsunternehmer.
An allen Ausbildungstagen herrschte eine sehr angenehme und harmonische Atmosphäre. Wann immer es angebracht war, wurde der Unterricht durch Rollenspiele und dergleichen aufgelockert.
Nach dem Grundkurs konnte jeder entscheiden, ob er die Ausbildung fortsetzen möchte. Zwei Damen stiegen aus, weil sie den Eindruck gewonnen hatten, dass das bisher Gelernte für ihre Zwecke hinreichend war.
Die übrigen, die weitermachen wollten, mussten nun zunächst ein sogenanntes »Besuchspraktikum« in einem Alten- oder Pflegeheim absolvieren.
Ich wurde einer 85-jährigen Dame zugeteilt, die in der Nähe meines Wohnortes in einem Altenheim lebte.
Es ging für uns darum, die Gepflogenheiten eines solchen Heimes ein wenig kennenzulernen und insbesondere das Gespräch mit fremden hilfsbedürftigen Menschen einzuüben. Zehn Besuche, die jeweils etwa eine Stunde dauern sollten, waren vorgeschrieben.
Die alte Dame, die ich besuchte, war zwar gemessen an ihrem Alter körperlich noch sehr fit, aber extrem verwirrt. Sie war in hohem Grade dement.
Sie freute sich immer sehr, wenn ich zu ihr kam. Ohne Punkt und Komma erzählte sie mir Geschichten aus ihrem Leben. Spätestens bei meinem zweiten Besuch wurde mir klar, dass es keine wirklichen Erlebnisse gewesen sein können, sondern Phantasiegeschichten. Vieles, was sie schilderte, war einfach zu unwahrscheinlich und absurd, so dass es wohl kaum ein Mensch wirklich erlebt haben könnte.
Es strapazierte schon ein wenig meine Geduld, mir immer wieder diese Fabelgeschichten anhören zu müssen, obwohl einige durchaus spaßig waren. Trotzdem fiel mir der Abschied nach diesen zehn Besuchen nicht ganz leicht.
Aber auch dieses Abschiednehmen gehörte zu den gewollten Lerneffekten des Besuchspraktikums. Bei meinen späteren Sterbebegleitungen war es manchmal auch nicht ganz einfach, sich von einem Menschen, den man über Wochen besucht und liebgewonnen hatte, für immer verabschieden zu müssen.
Dann folgte der Aufbaukurs, der sich auch über sechs Samstage erstreckte.
Schwerpunktthemen waren: »Häusliche Pflege«, »Kommunikationstraining«, »Schmerz- und Symptomtherapie«, »Patientenverfügung«, »Trauerbegleitung«, »Aufgaben und Dienstleistungen des Hospizvereins« und »Planung und Organisation einer Begleitung«.
Die Ausbildungstage waren ebenso intensiv wie informativ.
Nun durfte ich mich als »Ehrenamtliche Hospizhelferin für die Sterbe- und Trauerbegleitung« bezeichnen.
Aufgaben und Dienstleistungen des Hospizvereins
Insbesondere im Aufbaukurs wurde ausführlich dargelegt, worin die wesentlichen Aufgaben unseres Hospizvereins bestehen und welche Dienstleistungen, die alle kostenfrei sind, angeboten werden. Auch ging es darum, wie ein Einsatz geplant und organisiert wird.
Da diese Themen für das Verständnis meiner an späterer Stelle folgenden Erfahrungsberichte hilfreich sind, möchte ich diese hier in einiger Ausführlichkeit schildern.
Also, das Leistungsspektrum in unserem Hospizverein lässt sich in zwei Hauptbereiche aufgliedern: die professionelle palliativmedizinische Betreuung und die ehrenamtliche Begleitung.
Die Palliativmedizin hat zum Ziel, die Lebensqualität des Patienten durch Symptomkontrolle und insbesondere durch Schmerztherapie zu verbessern, wodurch in vielen Fällen erreicht werden kann, dass er nicht aus seinem vertrauten Lebensumfeld herausgerissen werden muss.
In unserem Verein wird diese professionelle Aufgabe von zwei Ärzten, Herrn Dr. Koch und Herrn Dr. Broy, sowie drei Krankenschwestern mit palliativer Zusatzausbildung wahrgenommen. Wir bezeichnen diese fünf Persönlichkeiten meistens kurz als »Palliativkräfte«.
Sie sehen ihre Aufgabe nicht darin, die Lebenszeit des Patienten um jeden Preis zu verlängern. Vielmehr geht es ihnen darum, dessen Lebensqualität zu verbessern, indem sie durch gezielte Medikation versuchen, seine Schmerzen in erträglichem Rahmen zu halten.
In manchen Fällen ist es erforderlich, dass unsere Palliativkräfte ihren Patienten täglich – bisweilen sogar mehrmals am Tag – aufsuchen müssen, um zu sehen, wie die Medikation angeschlagen hat und um gegebenenfalls die Dosis zu verändern.
Einer erfahrenen und einfühlsamen Palliativkraft kann es durchaus gelingen, die Dosierung der Schmerzmittel so einzustellen, dass der Patient keine unerträglichen Schmerzen mehr verspürt, ohne dass er es mit einer starken Beeinträchtigung seines Bewusstseins bezahlen müsste.
Allerdings möchte ich schon an dieser Stelle auf das Risiko einer Überdosierung hinweisen. Diese kommt meistens dadurch zustande, dass die Angehörigen bitten, die Dosis zu erhöhen, weil sie es nicht ertragen können, ihren lieben Sterbenden stöhnend und mit schmerzverzerrter Miene zu sehen. Die Folge ist dann häufig, dass das Bewusstsein des Patienten so stark herabgedämpft wird, dass er nahezu nichts mehr mitbekommt, was aus spiritueller Sicht sehr kritisch zu bewerten ist.
Nun möchte ich noch kurz über die Aufgaben der ehrenamtlichen Begleiter, zu denen ich mich nun auch zählen durfte, berichten.
Für diese Tätigkeit gibt es viele Begriffe, die meistens synonym verwandt werden, wie etwa: »Sterbe- und Trauerbegleiter«, »Hospizbegleiter«, »Hospizhelfer«.
Diese versuchen in erster Linie, einfach für den Sterbenden da zu sein und ein offenes Ohr für ihn zu haben. Insbesondere Patienten, welche die finale Phase ihres Lebens in einem Altenheim, Pflegeheim oder Krankenhaus verbringen müssen, sind meistens sehr froh, wenn jemand bei ihnen ist, sich um sie sorgt und kümmert und ihnen die Hand hält. Vielen ist es ein Bedürfnis, aus ihrem Leben zu erzählen. Sie freuen sich, wenn ihnen jemand aufmerksam zuhört.
Einigen Menschen ist es auch wichtig, mit einem neutralen Begleiter über tiefsinnige Themen, etwa über den Sinn des Lebens und Sterbens zu sprechen. Manchmal fragen sie den Begleiter sogar, ob er an ein Leben nach dem Tod glaube und wie er sich das vorstelle. Dabei geht es gewiss nicht darum, ihm fertige Antworten zu geben, sondern in allererster Linie ums Zuhören.
Ein wichtiges Motto in der Hospizbewegung lautet: »Man muss den Sterbenden da abholen, wo er gerade steht.« Das heißt, man muss seine Wünsche und Einstellungen respektieren. Es wäre also kontraproduktiv, ihn mit irgendwelchen Erkenntnissen, die seinem Weltbild völlig widersprechen, zu konfrontieren.
Ja, das war für mich in meiner Begleitungspraxis manchmal eine Gratwanderung.
Erfreulicherweise gibt es immer mehr Sterbende, die bis zuletzt in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können, was ganz wesentlich den Möglichkeiten, welche die Palliativmedizin bietet, zu verdanken ist.
In einem solchen Fall geht es auch darum, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Angehörigen zu haben und diese zu entlasten. Viele Angehörige können so die Anwesenheit eines Sterbebegleiters nutzen, um unbesorgt Erledigungen zu machen.
Bisweilen quälen die Familienmitglieder größere Ängste als den Sterbenden, so dass auch sie mit in die Begleitung einbezogen werden müssen.
In der absolut finalen Lebensphase des Patienten werden häufig Nachtwachen organisiert, so dass permanent jemand bei dem Sterbenden sein kann. Hierbei wechseln sich im Normalfall mehrere Begleiter ab. Dadurch wird den Angehörigen ermöglicht, mal wieder ein paar Nächte durchschlafen und neue Kräfte sammeln zu können.
Die Pflege des Patienten gehört übrigens nicht zu den Aufgaben eines Hospizhelfers. Dafür gibt es ambulante Pflegedienste.
Die Hospiztätigkeit endet nicht mit dem Tod des Menschen. Ein weiteres wichtiges Angebot besteht darin, die Hinterbliebenen bei der Verarbeitung ihrer Trauer zu unterstützen.
Es gibt zwei Varianten der Trauerbegleitung.
Die eine besteht darin, dass der Angehörige oder die Angehörigen von einem Begleiter mehrmals aufgesucht werden. Mit diesem können sie dann über alles reden, was sie belastet.
Die andere Möglichkeit bilden die sogenannten »Trauergruppen«, die von unserem Hospizverein im zweiwöchigen Turnus angeboten werden. Diese Gruppen werden von zwei Hospizhelferinnen geleitet. Die wesentliche Idee dieser Maßnahme ist, dass hier mehrere Menschen zusammenkommen, die kürzlich einen lieben Angehörigen verloren haben. Hier können sie dann etwa erleben, wie die anderen mit dieser Situation umgehen, was ihnen hilft, usw.
Über die Erfahrungen, die ich in meinen Trauerbegleitungen sammeln konnte, möchte ich in meinem nächsten Buch »Spirituelle Begleitung hinter der Schwelle des Todes« schildern.
Spirituelle Aspekte in der Sterbebegleitung
Wie bereits erwähnt habe ich meine Ausbildung zur Hospizhelferin als sehr angenehm, interessant und informativ empfunden.
Was mir allerdings gefehlt hat, waren die spirituellen Aspekte, die nach meiner Überzeugung auch oder sogar gerade in der Sterbebegleitung eine große Rolle spielen sollten. Zwar gab es mal ein Thema, das eigentlich ein sehr spirituelles war und über das eine evangelische Pfarrerin referierte, aber das, was sie schilderte, hatte nach meiner Einschätzung nichts mit Spiritualität zu tun. Im Grunde kamen nur ein paar Allgemeinplätze, Worthülsen und Floskeln über ihre Lippen.
Nicht zuletzt dadurch wurde mir wieder einmal deutlich vor Augen geführt, dass das Adjektiv »spirituell« von vielen Zeitgenossen völlig falsch verstanden wird. Das ist aber im Grunde nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass heute – insbesondere in der amerikanisch-europäischen Welt – die Ideologie des »Materialismus« weit verbreitet, ja sogar absolut vorherrschend ist.
Ein Vertreter dieser Weltanschauung, also ein »Materialist«, betrachtet nur dasjenige als existent, was er vermöge seiner fünf Sinne wahrnehmen, beobachten und studieren kann. Somit hält ein solcher zwangsläufig göttlich-geistige Welten und Wesen sowie ein Leben nach dem Tod für ein Hirngespinst.
Ein Materialist ist daher im Grunde auch immer Atheist, es sei denn, er vertritt die absurde Meinung, Gott sei ein physisches Wesen, das sich irgendwo in den Weiten des Weltalls aufhalte.
Aber selbst ein ›frommer‹ Christ, Muslim oder Jude kann durchaus auch einige Züge eines Materialisten zeigen, obwohl er zumindest immerhin an ein geistig-göttliches Wesen glaubt!
Viele Menschen setzen das Wort »spirituell« mit »religiös« oder »seelisch« oder gar mit »mental«, »intellektuell« oder »psychologisch« gleich, was ein grobes Missverständnis ist.
»Spirituell« bedeutet »geistig«, es ist also das Gegenteil von »materiell« bzw. »physisch« und auch das von »sinnlich«. Der Begriff »spirituelle Weltanschauung« ist das Gegenteil von »materialistische Weltanschauung«.
Ein spirituell gesinnter Mensch wird die Existenz übersinnlicher, also geistiger Welten und Wesen genauso wenig verleugnen, wie ein Blindgeborener Licht und Farben verleugnet. Es ist gewiss zwar wünschenswert, aber keineswegs notwendig, dass ein solcher tiefschürfende spirituelle Erkenntnisse, wie sie insbesondere aus der Anthroposophie geschöpft werden können, sein Eigen nennt.
Er lässt sich dadurch charakterisieren, dass er wenigstens die beiden folgenden Fakten anerkennt:
Jeder Mensch ist in seinem tiefsten, inneren Wesenskern ein »göttlich-geistiges Wesen«. Solange er auf der Erde lebt, hüllt er seinen Wesenskern in ein ›körperliches Gewand‹, den physischen Leib, den er erst bei Eintritt des Todes wieder als Leichnam ablegt.
Es gibt (mindestens) eine »geistige Welt«, die sich nur der Wahrnehmung eines hellsichtigen Menschen offenbart. In dieser Welt weben und wesen insbesondere die Engel und die Seelen der Verstorbenen.
Es ist offensichtlich, dass jemand, der davon überzeugt ist, dass der Verstorbene nach dem Tod weiter lebt und dass auch seine letzten Wochen vor seinem Tod eine gewisse Auswirkung auf sein nachtodliches Leben haben, mit einer ganz anderen Einstellung an eine Begleitung herantritt als jemand, der glaubt, dass es kein Leben nach dem Tode gäbe.
Natürlich gibt es etliche Materialisten, die bis zu einem gewissen Punkt einen Sterbenden angemessen und würdevoll begleiten können; sie können ihn aber niemals spirituell begleiten, was ich persönlich für eine Notwendigkeit in unserer geistlosen Zeit halte.
Ein Begleiter, der davon überzeugt ist, dass ein Sterbender nach seinem Tod nicht mehr existent ist, kann eigentlich nur nach folgender Maxime verfahren: »Ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, um dem Patienten seine letzte Lebensphase – was ja bis zu einem gewissen Grad auch durchaus wünschenswert ist – so schmerzfrei und angenehm wie möglich zu gestalten – nach seinem Tod die Sintflut!«
Man muss sich in jeder Begleitung der großen Verantwortung, die auf einem lastet, bewusst sein. Das gilt insbesondere für eine spirituelle Begleitung. Es kann ganz gewiss nicht darum gehen, dem Patienten irgendwelche Erkenntnisse überzustülpen.
Es würde keinen Sinn machen, wenn man ihn da mit den eigenen spirituellen Erkenntnissen konfrontieren wollte. Ihm etwas von geistigen Tatsachen aufdrängen zu wollen, würde bedeuten, dass man seine Freiheit nicht respektiert. Auch jedwede Form von Missionierung würde einen unzulässigen Eingriff in dessen Freiheit bedeuten, was ein schweres Sakrileg wäre.
In jedem individuellen Fall muss man auf sein Gefühl bzw. auf seine »innere Führung« hören und nur dasjenige tun bzw. sagen, was der Betreffende wünscht oder vertragen kann.
Sofern man einen Menschen begleiten darf, der noch bei Bewusstsein ist, der noch ansprechbar ist und der selbst noch reden kann und will, wird man, ohne ihn irgendwie drängen zu müssen, schon recht bald heraushören, ob dieser eine Affinität zu spirituellen Themen hat. Auch seine religiöse Orientierung und Gesinnung wird man schnell erfahren.
Die spirituelle Reife des Sterbenden und somit natürlich auch seine Einstellung zu spirituellen und religiösen Fragen entspricht seinem geistig-seelischen Entwicklungsstand, den er sich in seinen vielen Erdenleben sowie während seiner Aufenthalte in der geistigen Welt zwischen zwei Inkarnationen errungen hat. Damit soll überhaupt keine Wertung verbunden sein!
Wenn es um die spirituellen Aspekte in einer Begleitung geht, gilt das Hospiz-Motto »Man muss den Sterbenden da abholen, wo er gerade steht« in ganz besonderem Maße!
Es gibt aber etwas, was man immer tun kann und sollte, unabhängig davon, ob der Betreffende spirituelle oder religiöse Neigungen zeigt.
Man kann den eigenen Schutzengel8, 9 bitten, dass er einem die richtigen Impulse gibt, um sich in der jeweiligen Situation angemessen verhalten zu können.
Engel erwarten für ihre Dienste keinen Dank, sie wollen nur wahrgenommen werden.
Andreas Tenzer
Planung und Organisation einer Begleitung
Jeder Begleitung geht eine Anfrage, eine Bitte um diese Begleitung voraus. Auch wenn der Patient meistens nicht mehr in der Lage ist, selbst um eine Begleitung zu bitten, so ist sein Einverständnis erforderlich, sofern er noch seinen Willen äußern kann.
Bei Patienten, die nicht mehr in den eigenen vier Wänden wohnen, wird diese Anfrage in der Regel von einem Arzt, einer Krankenschwester oder von der Stationsleitung eines Heimes an den Hospizverein gerichtet. Oftmals ist es aber auch so, dass der Sterbende schon palliativ betreut wird und dass die Palliativkraft eine Begleitung für sinnvoll erachtet.
Wenn der Patient noch zu Hause wohnt, so sind es meistens die Angehörigen oder auch ein Arzt, der in unserem Hospizbüro anruft und um eine Begleitung bittet.
Sobald eine Anfrage eingegangen ist, nimmt sich eine unserer beiden Einsatzleiterinnen, Frau Balhuber bzw. Frau Mischke, der Aufgabe an.
Im Normalfall suchen sie den Patienten auf, um sich ein Bild von seiner Situation, seinen speziellen Bedürfnissen und Wünschen sowie seiner Persönlichkeit zu verschaffen. Dann reden sie mit dem behandelnden Arzt bzw. Hausarzt sowie mit unserer Palliativkraft, sofern schon eine palliative Versorgung angelaufen ist, und legen eine Patientenakte an.
Schließlich prüfen sie, welcher Hospizhelfer, der gerade verfügbar ist, von seiner Art her gut zu dem Patienten passen könnte. Insbesondere Frau Balhuber hatte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen und ihrer ausgezeichneten Menschenkenntnis immer ein gutes Gespür für diese Wahl.
Nun informiert sie den auserkorenen Hospizhelfer, holt sich seine Zustimmung ein und versorgt ihn mit den nötigen Informationen.
Dann kann der Helfer entscheiden, wann er seinen ersten Besuch macht. Bei neuen Helfern sowie in aus unterschiedlichen Gründen besonders schwierigen Fällen begleitet die Einsatzleiterin ihn beim ersten Besuch.
Es obliegt nun der Einschätzung des Begleiters, wann und wie oft er den Patienten aufsucht. Die Tage und Uhrzeiten müssen bisweilen mit ihm oder seinen Angehörigen abgestimmt werden.
In weniger kritischen Fällen kann es hinreichend sein, den Sterbenden vielleicht nur einmal pro Woche für ein bis zwei Stunden zu besuchen. Wenn der Patient schon sehr nahe an der Schwelle des Todes steht, sind natürlich häufigere – bisweilen sogar tägliche – Besuche wünschenswert.
Nach meinen Erfahrungen ist es übrigens bei Patienten, die daheim sterben wollen und dürfen, oftmals leider so, dass die Angehörigen erst sehr spät um eine Begleitung ersuchen, so dass man als Begleiter kaum noch die Möglichkeit hat, eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung zu dem Sterbenden aufzubauen.
Bei vielen Angehörigen hatte ich den Eindruck, dass es ihnen peinlich war, mit der Situation nicht allein zurechtzukommen. Einigen war es möglicherweise unangenehm, dass die Nachbarn mitbekommen könnten, dass sie der Unterstützung eines fremden Menschen bedürfen.
Auf der anderen Seite gab es aber auch einige Zeitgenossen, die glaubten, man könne sich auf diese Weise eine kostenlose Pflegekraft oder Putzhilfe ins Haus holen. Dies ist jedoch ganz gewiss nicht die Aufgabe eines Hospizhelfers! Das schließt jedoch nicht aus, dass man in einer konkreten Situation schon einmal solche Dienste – bis zu einem bestimmten Grad – übernehmen kann.
Erfahrungsaustausch, Supervision und Weiterbildung
Zu den Angeboten, die unser Hospizverein seinen ehrenamtlichen Helfern macht, gehört zunächst einmal ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch, der durchschnittlich zweimal pro Monat stattfindet.
An diesem Abend kommen alle Begleiter, die es zeitlich einrichten können, und manchmal auch einige unserer Palliativkräfte zusammen.
Bei Kaffee und Kuchen kann man sich dann austauschen. Im Grunde geht es hierbei in erster Linie darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. So kann man etwa auch erfahren, welcher Kollege gerade im Einsatz ist und was ihn da besonders bewegt.
Auch werden bei diesen Zusammenkünften hin und wieder Ideen geboren, was man organisatorisch verbessern könnte.
Sofern die Palliativkraft, die meinen aktuellen Patienten betreute, anwesend war, habe ich meistens die Gelegenheit genutzt, mich mit ihr ausführlich über unseren gemeinsamen Patienten zu unterhalten.
Dann steht etwa einmal im Monat eine Supervision auf dem Programm. Natürlich kann man einen Ehrenamtlichen nicht zu einer Teilnahme zwingen, aber es wird schon sehr gern gesehen, wenn man regelmäßig teilnimmt.
An diesen Abenden hat jeder Hospizhelfer die Möglichkeit, über Probleme in seiner aktuellen Begleitung zu berichten, die ihn besonders belasten. Der Supervisor und auch die übrigen Teilnehmer versuchen dann, ihn mit Empfehlungen und Ratschlägen zu unterstützen.
Aufgrund der großen Anzahl unserer Helfer waren schon in meiner Anfangszeit zwei Supervisions-Gruppen erforderlich.
Ich hatte mit meinem damaligen Supervisor, Herrn Cords, großes Glück. Er war hauptamtlich als Sozialpädagoge und Krankenhausseelsorger tätig.
Was mir an ihm besonders gut gefiel, war die Tatsache, dass er ein sehr spirituell orientierter Mensch ist. Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung waren, schätzten und mochten wir uns sehr.
Ein sehr schönes Ritual, das er einführte, war ein Gedenken an die von uns begleiteten Menschen, die seit dem letzten Supervisionstermin verstorben waren.
Jeder Helfer zündete für ›seinen‹ Verstorbenen eine Kerze oder ein Teelicht an. Dann schilderte er in aller Kürze ein wenig über diese Persönlichkeit und über besondere Erinnerungen an die Begleitung. Abschließend wurde meistens noch ein Spruch oder Gebet gesprochen.
Ich verwandte meistens einen der vielen Sprüche, die Rudolf Steiner3 für solche Zwecke gegeben hatte.
Schließlich werden mehrmals im Jahr Weiterbildungsmaßnahmen angeboten, die an einem Wochenende irgendwo in Deutschland stattfinden.
Hierbei geht es vorwiegend um sehr spezielle Themen. Da diese mich meistens weder unmittelbar betrafen noch sonderlich interessierten, habe ich in meiner aktiven Zeit auch nur einige Male an einer solchen Weiterbildung teilgenommen.
Schilderungen meiner Sterbebegleitungen
Wenn du als Begleiter vor einem Sterbenden stehst, hält der Verstand an.
Du wirst vollkommen gegenwärtig im Jetzt, und eine unendlich viel größere Kraft übernimmt die Führung.
Deshalb gibt es so viele Berichte von ganz normalen Menschen, die in einer solchen Situation plötzlich ganz richtig und unglaublich mutig handeln konnten.
frei nach Eckhart Tolle
Zufrieden und dankbar
Drei Wochen nachdem ich meine Ausbildung zur Hospizhelferin abgeschlossen hatte, nahm ich am ersten Donnerstag im Mai 1998 erstmals an einem Erfahrungsaustausch im Hospizkreis teil.
Diese Veranstaltung wurde schon im Vorfeld groß angekündigt. Die neuen Hospizhelfer sollten offiziell den Helfern und Helferinnen, die diese Tätigkeit schon länger ausübten, vorgestellt werden.
Der Raum war brechend voll. Fast alle der gut dreißig Ehrenamtlichen sowie drei unserer fünf Palliativkräfte waren zugegen. Auch der komplette siebenköpfige Vorstand, der sich bezeichnenderweise mit Ausnahme einer Beisitzerin nur aus Männern rekrutierte, ließ es sich nicht nehmen, die Neuen zu begrüßen und ein wenig kennenzulernen.
Nach der Begrüßungszeremonie stellten sich alle Anwesenden kurz vor. Natürlich konnte ich mir die meisten Namen noch nicht merken. Dann wurde den Neulingen die Möglichkeit gegeben, Fragen, die eine Begleitung betreffen, an die Erfahrenen aus dem Kreis zu richten. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht.
Ich stellte keine Fragen, da ich der Meinung war, Fragen oder Probleme würden wohl erst im Zusammenhang mit den Erfahrungen aus einer eigenen Begleitung auftauchen.