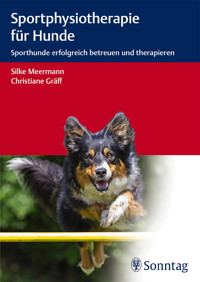
99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sonntag, J
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hundesport – immer beliebter, immer leistungsorientierter. Die neuen Herausforderungen für den Tierarzt oder Tierphysiotherapeuten: Andere Verletzungen und besonders aufmerksame Besitzer.
Dieses Buch hilft, den Sporthund optimal zu betreuen und zu therapieren. Es gibt handfeste Trainingshinweise zu Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und zur Verbesserung der Sprungtechnik. Besonderer Augenmerk richtet sich auf die Erstellung zielgerichteter Trainingspläne.
Die Autorinnen erläutern die gängigen Sportarten mit Regelwerk, sportartspezifischen Belastungen sowie daraus resultierenden häufig vorkommenden Verletzungen und Überbelastungsfolgen. Für jedes Krankheitsbild gibt es Angaben zu Ätiologie, Diagnostik und therapeutischen Möglichkeiten. Spezifische Aufbauübungen werden veranschaulicht sowie eine bestmögliche Prävention thematisiert.
Ein idealer Leitfaden zur Prophylaxe und diagnostischen Aufarbeitung zahlreicher Indikationen sowie zur kompetenten Beratung der Hundebesitzer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sportphysiotherapie für Hunde
Sporthunde erfolgreich betreuen und therapieren
Silke Meermann, Christiane Gräff
280 Abbildungen
Vorwort
Obwohl mittlerweile immer mehr Hunde in den verschiedenen Sportarten spezifisch und auf technisch hohem Niveau ausgebildet und auf Wettkämpfen geführt werden, spielt der gezielte sportphysiotherapeutische Trainingsaufbau dabei oft nur eine untergeordnete Rolle. Dies spiegelt sich leider auch im häufigen Auftreten akuter Sportverletzungen sowie in überlastungsbedingten degenerativen Erkrankungen wie Spondylosen und Arthrosen bei Sporthunden wider.
„Vor einigen Jahren kam eine Besitzerin mit ihrem 9-jährigen Deutschen Schäferhund in die Praxis zur physiotherapeutischen Behandlung aufgrund von fortgeschrittener Hüftgelenksarthrose und hochgradigen Spondylosen. Während der zweiten Therapiesitzung bemerkte die Besitzerin zerknirscht: „Mhm – ich glaube, ich habe ihn durch den Sport ziemlich ruiniert.“ Ich erkundigte mich, welche Sportart sie mit ihrem Hund betrieben hatte, und war ehrlich bestürzt, als ich erfuhr, dass sie – wie ich selber auch – Turnierhundsportlerin war. Ihr Hund war bereits früh sehr erfolgreich im Vierkampf und er errang mit ihr schon im Alter von drei Jahren den Landesmeister-Titel. Allerdings musste der Hund bereits ein Jahr später aus dem Sport genommen werden, da die Verschleißerscheinungen an den Hüften und im Rücken bereits so weit fortgeschritten waren, dass an Turnierhundsport nicht mehr zu denken war.
Ich selber war ein halbes Jahr zuvor mit meiner damals bereits zehneinhalbjährigen Border-Collie-Hündin „Lynn“ noch Vizelandesmeisterin – ebenfalls im Vierkampf – geworden und für mich war es daher eigentlich fast nicht vorstellbar, dass auch diese Sportart einem Hund derartig schaden kann.
In unserer Turnierhundsportmannschaft hatte ich das Glück, dass von Anfang an auch Trainingsgrundsätze für die körperliche Ausbildung der Hunde berücksichtigt wurden und das Auf- und Abwärmen (für Mensch und Hund) selbstverständlicher Bestandteil jeder Trainingseinheit ist. Außerdem werden alle neuen Teilnehmer durch die Trainerinnen ermutigt, sich selbst und ihre Hunde vor Beginn der Ausbildung medizinisch durchchecken zu lassen, und wann immer Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten der Hunde auftreten, werden sie aus dem Training genommen, bis die Ursache abgeklärt und behoben ist. Dabei fand und findet ein laufender Austausch zwischen unseren Trainerinnen einerseits und mir als Tierärztin mit physiotherapeutischer Zusatzausbildung andererseits statt. All dies sind sicherlich Gründe dafür, dass die meisten (zwei- und) vierbeinigen Sportler unserer Mannschaft erst in fortgeschrittenem Alter „in Rente gehen“.
Wie Ausbildung und Training jenes Schäferhundes im Einzelnen ausgesehen haben, weiß ich nicht, und es ist sicherlich denkbar, dass bei ihm auch noch andere ungünstige Faktoren wie beispielsweise die genetische Veranlagung für das frühe Auftreten extremer Verschleißerscheinungen verantwortlich waren – dennoch hat mich diese Begebenheit sehr nachdenklich gemacht und dadurch mit zur Entstehung dieses Buches beigetragen und dazu geführt, dass ich mittlerweile regelmäßig Praxis-Workshops für Hundesportler, aber auch Theorie-Seminare für Trainer im Deutschen Verband für Gebrauchshundsport gebe.“
(Silke Meermann)
„Für mich gehört Sport schon immer zum Leben, sportliche Betätigung bedeutet für mich Lebensqualität. Ich habe lange Jahre Fußball gespielt und im Seniorenbereich Mittel- und Langstreckenläufe absolviert. Noch heute jogge ich regelmäßig mit meinen Hunden. Ein Warm-up und Cool-down ist für mich genauso selbstverständlich wie eine gezielte Trainingssteuerung und ein entsprechendes Ausgleichstraining.
Meine ersten Erfahrungen mit Hundesport sammelte ich bei einem zehnwöchigen Einsteigerkurs für Agility: Ich staunte nicht schlecht, als die Hunde ohne Aufwärmtraining die verschiedenen Geräte absolvieren sollten. In den Pausen zwischen den einzelnen Übungen wurden die Hunde einfach abgelegt, auch wenn das Gras nass war. Nach Beendigung des Trainings kamen die Hunde ohne ein gezieltes Abwärmen sofort ins Auto. Schon in der vierten Trainingsstunde wurden die Hürden auf eine Höhe von 60 cm eingestellt.
Niemand machte sich darüber Gedanken, dass körperliche Strukturen entsprechend Zeit brauchen, um sich an Belastungen zu adaptieren. Für mich war das der Zeitpunkt, den Kurs abzubrechen. Ich hatte einfach Sorge, dass ich meinen damals einjährigen Hund überfordern würde.
Aufgrund dieser Erfahrung wuchs in mir der Wunsch, diese Missstände anzugehen. Gleichzeitig wurden in unserer tierphysiotherapeutischen Praxis auch immer mehr Sporthunde vorgestellt. Mir fiel auf, dass die Muskulatur vieler Sporthunde schmerzhaft verspannt und verkürzt war; es zeigten sich Fehlhaltungsmuster mit Muskeldysbalancen und Überlastungsschäden – alles Hinweise auf ein falsches bzw. einseitiges körperliches Training.
Seit dieser Zeit führe ich regelmäßig Workshops in Hundesportvereinen zu den Themen Auf- und Abwärmen sowie Trainingslehre durch. Die große Nachfrage zeigt, dass sich Hundesportler und Hundetrainer zunehmend Gedanken über Trainingslehre und Trainingssteuerung machen.
In meiner sportphysiotherapeutischen Ausbildung im Humanbereich wurden u.a. die Themen Trainingssteuerung, Training am Gerät, Leistungsdiagnostik, Biomechanik, Neurophysiologie und Ernährung gelehrt – von einer solch umfassenden Ausbildung sind wir in der Hundesportphysiotherapie immer noch meilenweit entfernt. Ähnlich sieht es leider auch im Bereich der Grundlagenforschung zum Thema Trainingssteuerung und Trainingseffekte beim Hund aus – während es hier im Humanbereich umfangreiches Studienmaterial gibt, fehlen solche Untersuchungen beim Hund bisher.“
(Christiane Gräff)
Wenn man als Mensch eine Sportart betreibt – sei es Fußball oder Volleyball, Judo oder Ballet, Leichtathletik oder Turnen –, so ist es völlig selbstverständlich, dass jede Trainingseinheit mit einem entsprechenden Aufwärmen beginnt. Auch ein Turnierreiter würde nicht in den Parcours einreiten, ohne vorher sein Pferd „abgeritten“, also aufgewärmt zu haben. So wie das Aufwärmen mittlerweile integraler Bestandteil des Trainings auch im Breitensportbereich ist, finden sich vor allem im Leistungssportbereich Physiotherapeuten, von denen die Mannschaft oder die Einzelathleten professionell sportphysiotherapeutisch betreut werden.
Auch im Hundesport lässt sich beobachten, dass hier in den letzten Jahren ein Umdenkprozess begonnen hat. Einerseits bieten viele Hundesportverbände und Vereine mittlerweile Seminare und Lehrgänge für Trainer und Sportler zum Thema „Warm-up und Cool-down“ beim Hund an. Andererseits suchen auch mehr und mehr Sportler von sich aus den Weg zum Tierphysiotherapeuten, Osteopathen oder Chiropraktiker, wenn ihr Tier eine Sportverletzung erlitten hat oder operiert wurde; aber auch dann, wenn sie körperliche Probleme bei ihrem Tier als Ursache für unbefriedigende Trainings- oder Turnierergebnisse vermuten. Wie wichtig dieser Prozess ist, wird auch daran deutlich, dass im vergangenen Jahr (2016) die deutsche Agility-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft erstmalig von einer Human- und Tierphysiotherapeutin begleitet wurde und so erfolgreich abschnitt wie nie zuvor!
Leider ist es dennoch weiterhin keine Seltenheit, dass die vierbeinigen Sportler auf Hundesportturnieren überhaupt nicht oder mit nur ungeeigneten Methoden auf ihren Prüfungslauf vorbereitet und vor allem nach einem Lauf auch meist direkt wieder ins Auto oder in ihre Box „weggepackt“ werden. Nicht viel besser sieht die Situation auf vielen Hundeplätzen im Training aus: Selbst dort, wo vielleicht noch ein kurzes Warm-up durchgeführt wird, liegen die Hunde zwischen den einzelnen Übungseinheiten meist einfach angebunden am Zaun oder in ihren Kennels.
Eine weitere Schwierigkeit entsteht bisweilen dort, wo Hundesportler einerseits und Tierärzte sowie Tierphysiotherapeuten andererseits nicht dieselbe Sprache sprechen. Dabei kann sich jedoch die Suche nach einem geeigneten Therapeuten unter Umständen schwierig gestalten, da für den Bereich der Sportphysiotherapie beim Hund bislang kaum qualifizierte Fort- und Weiterbildungsangebote existieren.
Überlegt man als Therapeut, sein Angebot im Bereich der Sportphysiotherapie für Hunde zu erweitern und hat bisher noch keine Erfahrungen im Hundesport gesammelt, so sollte man sich zumindest mit der Grundhaltung identifizieren, die für Sportphysiotherapeuten im Humanbereich wie folgt beschrieben wird:
„Der moderne Sportphysiotherapeut benötigt in der Betreuung von Sportlern Verständnis für den Sport, den Sportler und dessen sportliche Ziele. Bei einer Verletzung des Sportlers steht allerdings die Fürsorgepflicht gegenüber dem Athleten an erster Stelle. Der Sportphysiotherapeut muss unabhängig von den äußeren Erwartungen und Einflüssen die Sportfähigkeit eines Sportlers bzw. die Belastbarkeit von verletzten Strukturen beurteilen.“
Teilt man diese grundsätzliche Ansicht nicht, sondern ist eher der Meinung, dass Sport für Hunde (und Menschen?!) eher schädlich sei, wird man wahrscheinlich niemals ein wirklich guter Sportphysiotherapeut werden.
Die Sportphysiotherapie zielt also nicht nur darauf ab, den Partner Hund zu sportlichen Höchstleistungen zu bringen oder nach Operationen und Verletzungen möglichst schnell eine Rückkehr in den Sport zu ermöglichen – zentraler Gedanke ist vielmehr auch die Prävention von Sportverletzungen durch die Berücksichtigung allgemeiner Trainingsgrundsätze sowie individueller Besonderheiten.
Mit dem vorliegenden Buch möchten wir dazu beitragen, dass die Sportphysiotherapie im Hundesport genauso ein selbstverständlicher Bestandteil wird, wie dies im Humanbereich mittlerweile schon der Fall ist.
Wir möchten uns an Tierärzte und Tierphysiotherapeuten wenden, da diese meist die direkten Ansprechpartner der einzelnen Besitzer sind, wenn sie Fragen zum Bewegungsapparat ihres Tieres haben. Hier ergibt sich in der Praxis bisweilen die Schwierigkeit, dass sie oft erst dann zu Rate gezogen werden, wenn der Hund bereits verletzt und eine Therapie erforderlich ist.
Daher richtet sich das Buch auch an Hundetrainer, da sie die Möglichkeit haben, durch eine sinnvolle körperliche Ausbildung der Hunde einen effektiven Beitrag zur Verletzungsprophylaxe zu leisten. Sie sind außerdem wichtige Multiplikatoren, da sie viele Besitzer und dadurch viele Sportteams gleichzeitig erreichen.
Viele Hundesporttrainer sind selbst auch erfolgreiche Hundesportler – sie und ihre Hunde profitieren besonders von einer individuellen sportphysiotherapeutischen Beratung bzw. Anleitung. Gleichzeitig haben sie aber auch in ihrer jeweiligen Sportszene eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion: Ihr Umgang mit den eigenen Hunden wird viel beachtet und von Nacheiferern kopiert.
Nicht zuletzt möchten wir auch Leistungsrichter und Prüfer ansprechen und ermutigen, sich kritisch mit den Belastungen und Anforderungen der eigenen Sportart auseinanderzusetzen und auch die jeweiligen Prüfungsordnungen auf ihre Bedeutung für die gesundheitlichen Belastungen der Hunde hin zu überprüfen. Wir möchten sie darüber hinaus ermutigen, entschlossen aufzutreten, wenn ihnen auf Turnieren oder Prüfungen Hunde vorgestellt werden, die aufgrund von körperlichen Problemen eigentlich nicht in der Lage sind zu starten. Ein Prüfungsausschluss führt zwar sicherlich zu einer kurzfristigen Enttäuschung beim Hundesportler – kann aber dem Hund auf lange Sicht Probleme ersparen!
Wir möchten mit diesem Buch dazu beitragen, dass mehr Hunde ihren Sport mit Spaß und ohne Schmerzen bis ins hohe Alter ausüben können – und weniger Besitzer mit gemischten Gefühlen auf die sportliche Karriere ihrer Hunde zurückblicken müssen. Unsere Hunde möglichst lange körperlich gesund, geistig fit und sportlich aktiv zu halten, sollte gemeinsames Ziel von Besitzern, Trainern, Leistungsrichtern und Funktionären sowie natürlich auch von Tierärzten und Tierphysiotherapeuten sein!
Wir möchten alle Beteiligten dazu ermutigen, ihr Training zu überdenken und gegebenenfalls umzustellen – eine solche Umstellung unter sportphysiotherapeutischen Gesichtspunkten erfordert meist keine teuren Anschaffungen, wohl aber ein Umdenken im Kopf!
Ascheberg und Karlsdorf-Neuthard im Januar 2017
Silke Meermann und Christiane Gräff
Danksagung
Unser Dank gilt unseren Familien, Kolleginnen und Freunden, die uns die Zeit gegeben und uns den Rücken freigehalten haben, sodass wir uns diesem Buchprojekt widmen konnten. Insbesondere möchten wir Jonna, Mads und Volker Brümmer, Bettina Walker und Britta Westermann danken.
Auch bei unseren Hunden Andi, Ebby, Maira, Shari und Taff möchten wir uns für die Geduld als Fotomodelle sowie für die langen Stunden zu unseren Füßen unter dem Schreibtisch bedanken. Auch Lynn und Xantha haben uns in Gedanken das ein oder andere Mal über die Schulter geschaut und wussten es – wie immer – besser.
Ein besonderer Dank gilt außerdem allen Hundesportlern und Besitzern, die sich und ihre Hunde für die zahlreichen Fotos zur Verfügung gestellt oder uns ihre eigenen Fotos als Bildmaterial überlassen haben: Heike Appelbaum; Kunibert Barth; Louise, Simon und Dr. Ulrike Beckschulte; Mark Berkenbusch; Margot Beuth mit Ferdi; Julian Blum; Alexander Bölling; Petra Brinkmann; Dr. Nina Büchel; Petra Deggendorfer; Anne Eisemann; Didi Gäng; Carina und Mathias Godbarsen; Carmen Irmen; Benjamin Klöck; Frank Kunzmann; Sandra Malice; Andrea Manthey; Susanne Meermann; Marie France Mühlschlegel; Lisa Müller; Anja Mucha; Christine Nölke; Beate Oertel; Martina Panter; Ingrid Raufhake; Pia Reiterer; Dr. Christine Sachse; Martin Schlockermann; Miriam Schmidt; Birgit Schüssler; Markus Seeberger; Stefanie Schaub; Erika Slaby; Franziska Stau; Christina Thiel; Frank van Loh; Susanne Voss; Saskia Zirkel; Andrea Zumdick sowie allen Sportlern und Mitgliedern des HSV Münster e.V. Ein besonderer Dank gilt außerdem Martin Preissner für seine Großzügigkeit, der uns als professioneller Fotograf seine Bilder gegen eine Spende an einen Tierschutzverein zur Verfügung gestellt hat.
Schließlich möchten wir all unseren Hundsportlern, die wir in unseren Praxen betreuen durften, danken: Euch ist dieses Buch gewidmet! Bedanken möchten wir uns vor allem für euer Vertrauen, das ihr uns tagtäglich entgegenbringt und für die geduldige Beantwortung unserer unzähligen Fragen!
Danke auch an das Team vom Sonntag Verlag für das uns entgegengebrachte Vertrauen und den Mut, neue Themen anzugehen.
Geleitwort
Hundesportler setzen sich sehr intensiv und umfangreich mit der Gesundheit ihrer Hunde einerseits und deren Gesunderhaltung im Sport andererseits auseinander. Um dies fachlich unterstützt tun zu können, bedürfen sie der veterinärmedizinischen Beratung, die aber nicht nur nach der Schulmedizin, sondern auch an ganzheitlichen Methoden wie der Homöopathie, Osteopathie und Physiotherapie ausgerichtet ist und deren Therapiemethoden je nach Bedarf zur Anwendung bringt. Zu diesen Themen in Kombination mit dem Hundesport gibt es bisher keine Literatur in Deutschland, die beide Zielgruppen, die medizinischen Fachkräfte und die Hundesportler, gleichermaßen anspricht und diese dadurch in ihren gegenseitigen Bemühungen unterstützt.
In diesem Buch konzentriert sich der medizinische Part auf die Physiotherapie oder besser gesagt auf „Sportphysiotherapie für Tiere“ – sicherlich das schwierigere Kapitel. Da diese Thematik in Deutschland in den Lehrplänen der Hochschulen gar nicht vorkommt, gibt es natürlich auch keine staatlich anerkannten Fortbildungen etwa für Veterinärmediziner oder auch Physiotherapeuten (Humanbereich) mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung, die gerne einfach mehr Wissen erwerben möchten, z.B. über die Belastungen von Hunden im Sport. Insoweit erachte ich diesen Teil als immens wichtig. Es kann Veterinärmedizinern, die sicherlich immer häufiger mit Sportverletzungen ihrer Patienten konfrontiert werden, dabei helfen – wie es bereits auch viele Hundesportler tun –, schon präventiv im Training zu unterstützen und den Hund richtig vorzubereiten, damit es gar nicht erst zu dauerhaften Schäden kommt. Auch kann dieser Teil das „Wie“ einer sinnvollen Nach- oder Mitbehandlung von Sportverletzungen aufzeigen.
Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den 15 verschiedenen Sportarten, die aktiv mit dem Hund – mit den vom Körperbau sehr unterschiedlichen Hunden – innerhalb des Verbandes für das Deutsche Hundewesen nach den in der jeweiligen Sparte einheitlichen Regeln betrieben werden. Die Regeln werden immer dem Jetzt und Heute angepasst, und dabei sind Geschichte und Herkunft der Sportart, die nicht nur die Basis dieses Sports ausmachen, sondern auch bei der weiteren Entwicklung immer wieder reflektiert werden sollten bzw. in den Fokus zu stellen sind, nur allzu schnell vergessen.
Die Entscheidung, ein wissenschaftliches Buch auch lesenswert für den Hundesportler zu gestalten, ist meines Erachtens nur deshalb so hervorragend gelungen, weil die Autoren in beiden Bereichen dieses Buches Fachkompetenz besitzen: als Veterinärmedizinerinnen wie auch als aktive Hundesportlerinnen in Training und Wettkampf. Dieses Zusammenspiel macht den Inhalt des Buches einzigartig.
Entsprechend weit gefächert sehe ich den Leserkreis dieses wertvollen Beitrags zur Kynologie. Ich bin überzeugt davon, dass sowohl Veterinärmediziner, Physiotherapeuten, Ausbilder und Hundesportler beim Lesen dieses Buches auf ihre Kosten kommen. Ich empfehle es auch jedem gewissenhaften Hundefreund als Lektüre. Denn wer dieses Buch liest oder besser gesagt studiert, kann auf sehr angenehme Art und Weise sehr viel für sich und seinen Hund lernen.
Christa Bremer
Vizepräsidentin des Verbandes für das Deutsche Hundewesen
Abkürzungsverzeichnis
A1–3
Leistungsklassen im Agility
AAS
Allgemeines Anpassungssyndrom nach Selye
ADP
Adenosindiphosphat
AMP
Adenosinmonophosphat
APr 1–3
Arbeitsprüfung 1–3 für Gebrauchshunde (Schwierigkeitsstufen 1–3)
AST
Aspartat-Aminotransferase (Enzym)
ATP
Adenosintriphosphat; Energieträgermolekül
BH
Begleithundprüfung
BMI
Body-Mass-Index
BSP
Bundessiegerprüfung
BWS
Brustwirbelsäule
C
Cholesterin (Cholesterol)
CACL
Certificat d’Aptitude au Championat des Courses de Lévriers
CEKS
Cauda-equina-Kompressions-Syndrom
CK
Kreatinkinase (Muskelenzym)
CP
Kreatinphosphat
CSC
Combination Speed Cup (Teildisziplin des THS; Staffel-Hindernislauf)
COX-1-, COX-2-Hemmer
Cyclo-Oxygenase-1- und -2-Hemmer; Klassifizierung nicht-steroidaler Antiphlogistika
CT
Computertomografie
DJD
Degenerative Joint Disease; englische Bezeichnung für degenerative Gelenkerkrankungen; Arthrose
DLSS
degenerative lumbosakrale Stenose
DM
Deutsche Meisterschaft (z.B. dhv-DM, VDH-DM)
DSH
Deutscher Schäferhund
ED
Ellbogendysplasie
EKG
Elektrokardiografie
EMG
Elektromyografie
ESR
Extensions-Seitneigungs-Rotations-Fehlstellung (osteopathischer Begriff; Benennung einer osteopathischen Dysfunktion, die mit einer Fehlstellung des betroffenen Wirbelsäulensegments in Extension, Seitneigung und Rotation einhergeht)
Ex.Im
extensive Intervallmethode (Abkürzung im Trainingsplan)
EZM
extrazelluläre Matrix
FG-Fasern
fast glycolytic fibres
FOG-Fasern
fast oxidative glycolytic fibres
FH1, FH2 und IPO FH
Fährtenprüfung; Schwierigkeitsstufen 1, 2 und Internationale Prüfungsordnung
FPr1–3
Fährtenprüfung ohne Ausbildungskennzeichen
FT-Fasern
Fast-Twitch-Fasern
GAG
Glykosaminoglykane
HD
Hüftdysplasie, Hüftgelenksdysplasie
HGLM
Hintergliedmaße
HWS
Halswirbelsäule
HZP
Herbstzuchtprüfung (für Jagdhunde)
IPO
Internationale Prüfungsordnung
LDH
Laktatdehydrogenase (Muskelenzym)
LSSS
lumbosakrales Stenose-Syndrom
LSÜ
lumbosakraler Übergang
LWS
Lendenwirbelsäule
Lz
Langzeitintervall (Angabe im Trainingsplan)
MCH
mittlerer korpuskulärer Hämoglobingehalt; Hämoglobinkoeffizient
MCV
mittleres korpuskuläres Volumen
MRT
Magnetresonanztomografie (Kernspintomografie)
Mz
Mittelzeitintervall (Angabe im Trainingsplan)
NMES
neuromuskuläre Elektrostimulation (Form der Elektrotherapie)
NSA; NSAID
nicht-steroidale Antiphlogistika; Englisch: non-steroidal anti-inflammative drugs; Substanzklasse schmerz- und entzündungshemmender Medikamente
O1–3
Prüfungsklassen im Obedience; Schwierigkeitsstufen 1–3
OA
Osteoarthritis; im englischen Sprachgebrauch für degenerative Gelenkerkrankungen, Arthrosen
OCD
Osteochondrosis dissecans
P
Pause; Angabe im Trainingsplan
P
i
anorganisches Phosphat
PROM
passive range of motion; passiver Bewegungsumfang
QSC
Qualification Speed Cup (Disziplin im Turnierhundsport, bei der 2 Teams im K.-o.-System gegeneinander laufen)
REKOM/REKOM-Training
Regenerations- bzw. Kompensationstraining; ruhige Ausdauereinheit
RGT-Regel
Reaktions-Geschwindigkeits-Temperatur-Regel
RH
Rettungshund
ROM
range of motion; Bewegungsspielraum; jeweils als aktiver und passiver Bewegungsspielraum (AROM und PROM)
SBS
sphenobasiläre Synchondrose; Begriff aus der kraniosakralen Osteopathie
SchH
Schutzhundprüfung
SIG
Sakroiliakalgelenk
SO-Fasern
slow oxidative fibres
SP
Serienpause; Angabe im Trainingsplan
SPr1–3
Schutzdienstprüfung, Schwierigkeitsstufen 1–3
ST-Fasern
Slow-Twitch-Fasern
TCM
Traditionelle Chinesische Medizin
TENS
transkutane elektrische Nerven- bzw. Neuro-Stimulation (Form der Elektrotherapie)
TLÜ
thorakolumbaler Übergang
UMN
unteres Motorneuron
UPr1–3
Unterordnungsprüfung 1–3
VGLM
Vordergliedmaße
VGP
Verband-Gebrauchsprüfung (Jagdhundwesen)
VJP
Jugendsuche (Jagdhundwesen)
VK1–3
Vierkampf, Schwierigkeitsstufen 1–3; Teildisziplin im THS
VPG
Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde
WP
Wiederholungspause; Begriff im Trainingsplan
WS
Wirbelsäule
ZNS
Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark)
ZOS
Ziel-Objekt-Suche
ZTÜ
zervikothorakaler Übergang
Verbände und Institutionen
ABCD
Arbeitsgemeinschaft Border Collie Deutschland
ASB
Arbeiter-Samariter-Bund
ATF
Akademie für Tierärztliche Fortbildung der Bundestierärztekammer
BLV
Bayerischer Landesverband für Hundesport
BRH
Bundesverband Rettungshunde
BZRH
Bundesverband zertifizierter Rettungshundestaffeln
dhv
Deutscher Hundesportverband (übergeordneter Verband; swhv, HSVRM, BLV, SGSV, DSV und BRH sind dessen Mitgliedsverbände)
DLRG
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DRK
Deutsches Rotes Kreuz
DRV
Deutscher Rettungshundeverein
DSV
Deutscher Sporthundverband e.V.
DVG
Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine
DWZRV
Deutscher Windhundzucht- und Rennverband
ECF
European Cani-Cross Federation
FCI
Federation Cynologique Internationale
HSVRM
Hundesportverband Rhein Main e.V.
IFSS
International Federation of Sleddog Sport
IRO
Internationale Rettungshunde Organisation
ISDVMA
International Sled Dog Veterinary Medical Association (internationale tiermedizinische Vereinigung für Schlittenhunde)
JGHV
Jagdgebrauchshundverband
SGSV
Schutz- und Gebrauchshundesportverband
SV
Verein für Deutsche Schäferhunde
swhv
Südwestdeutscher Hundesportverband
THW
Technisches Hilfswerk
VDH
Verband für das Deutsche Hundewesen
VDSV
Verband Deutscher Schlittenhundesport Vereine
WSA
World Sleddog Association
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Danksagung
Geleitwort
Abkürzungsverzeichnis
Teil I Theorie
1 Hundesport braucht professionelle Physiotherapie
1.1 Aufgaben der Sportphysiotherapie
1.2 Physiotherapie versus Sportphysiotherapie
1.2.1 Was ist Physiotherapie?
1.2.2 Sportphysiotherapie beim Hund
1.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
1.3.1 Praxisbeispiel
2 Die gebräuchlichsten Hundesportarten von A–Z im Überblick
2.1 Einfluss der Motivation auf die Belastung
2.2 Agility
2.2.1 Geschichte und Herkunft
2.2.2 Die Sportart
2.2.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.2.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.3 Dog Dancing
2.3.1 Geschichte und Herkunft
2.3.2 Die Sportart
2.3.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.3.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.4 Fährtenarbeit
2.4.1 Geschichte und Herkunft
2.4.2 Die Sportart
2.4.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.4.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.5 Flyball
2.5.1 Geschichte und Herkunft
2.5.2 Die Sportart
2.5.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.5.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.6 Frisbee
2.6.1 Geschichte und Herkunft
2.6.2 Die Sportart
2.6.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.6.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.7 Gebrauchshundsport
2.7.1 Geschichte und Herkunft
2.7.2 Die Sportart
2.7.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.7.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.8 Hütearbeit
2.8.1 Geschichte und Herkunft
2.8.2 Leistungshüten und Hütewettbewerbe
2.8.3 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.9 Jagdliches Arbeiten
2.9.1 Bedeutung der Jagd
2.9.2 Geschichte der Jagd
2.9.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.9.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.10 Mantrailing
2.10.1 Geschichte und Herkunft
2.10.2 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.11 Obedience
2.11.1 Geschichte und Herkunft
2.11.2 Die Sportart
2.11.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.11.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.12 Rally Obedience
2.12.1 Geschichte und Herkunft
2.12.2 Die Sportart
2.12.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.12.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.13 Rettungshundearbeit
2.13.1 Geschichte und Herkunft
2.13.2 Bedeutung und Formen der Rettungshundearbeit
2.13.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.13.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.14 Schlittenhunderennen
2.14.1 Geschichte und Herkunft
2.14.2 Die Sportart
2.14.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.14.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.15 Turnierhundsport
2.15.1 Geschichte und Herkunft
2.15.2 Die Sportart
2.15.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.15.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.16 Windhundrennen
2.16.1 Geschichte und Herkunft
2.16.2 Die Sportart
2.16.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
2.16.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
2.17 Zughundsport
2.17.1 Sportart, Geschichte und Herkunft
2.17.2 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
3 Basics der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
3.1 Update Anatomie und Physiologie des Skelettsystems
3.1.1 Allgemeine Osteologie
3.1.2 Spezielle Osteologie: das Skelettsystem des Hundes
3.2 Update Anatomie und Physiologie des Muskelsystems
3.2.1 Allgemeine Myologie
3.2.2 Spezielle Myologie: die Muskulatur des Hundes
3.3 Update Anatomie und Physiologie des Bindegewebes
3.3.1 Allgemeiner Aufbau der Körperfaszie
3.3.2 Die Faszien – wichtiges Organ für die Körperwahrnehmung
3.3.3 Physiologie des Bindegewebes
3.3.4 Physiologie des Gelenkknorpels
3.3.5 Pathophysiologie des Gelenkknorpels
3.3.6 Der Wundheilungsprozess
3.3.7 Die myofaszialen Wirkungsketten
4 Körperbau und Fortbewegung des Hundes
4.1 Modell von Struktur und Funktion
4.2 Embryologische Homologien und funktionelle Entsprechungen
4.3 Gliedmaßen
4.4 Rumpf
4.5 Bewegungszyklen im Gang
4.6 Gangarten
4.7 Kinetik der Fortbewegung
4.8 Die Jenaer Bewegungsstudie
4.9 Energieausnutzung und -rückgewinnung während der Fortbewegung
4.10 Anatomische Besonderheiten
4.10.1 Körperbauliche Voraussetzungen und Bewegungstypen
4.10.2 Rassetypische Besonderheiten
5 Allgemeine Grundlagen für ein erfolgreiches Training
5.1 Prinzipien der Trainingslehre
5.2 Superkompensation
5.3 Die motorischen Hauptbeanspruchungsformen
5.3.1 Ausdauer
5.3.2 Kraft
5.3.3 Schnelligkeit
5.3.4 Koordination
5.3.5 Beweglichkeit
5.4 Periodisierung
5.5 Aufwärmen und Abwärmen
5.5.1 Bedeutung und physiologische Effekte des Aufwärmens
5.5.2 Bedeutung und physiologische Effekte des Abwärmens
6 Die sportartspezifischen Belastungen im Hundesport
6.1 Einordnung häufiger Symptome und Probleme im Hundesport
6.2 Belastungsanforderungen der Sportart Agility
6.2.1 Die drei Bewegungsphasen des Sprungs
6.2.2 Weitere Belastungen
6.2.3 Typische Überlastungssyndrome durch Agility
6.3 Belastungsanforderungen der Sportart Dog Frisbee
6.3.1 Typische Überlastungssyndrome durch Dog Frisbee
6.4 Belastungsanforderungen der Sportart Flyball
6.4.1 Typische Überlastungssyndrome durch Flyball
6.5 Belastungsanforderungen des Gebrauchshundsports
6.5.1 Typische Überlastungssyndrome durch Gebrauchshundsport
6.6 Belastungsanforderungen der Fährtenarbeit
6.6.1 Typische Überlastungssyndrome durch Fährtenarbeit
6.7 Belastungsanforderungen der Sportart Obedience
6.7.1 Typische Überlastungssyndrome durch Obedience
6.8 Belastungsanforderungen des Turnierhundsports
6.8.1 Typische Überlastungssyndrome durch Turnierhundsport
6.9 Belastungsanforderungen der Sportart Windhundrennen
6.9.1 Typische Überlastungssyndrome durch Windhundrennen
6.10 Belastungsanforderungen des Zughundsports
6.10.1 Typische Überlastungssyndrome durch Zugarbeit
6.11 Konsequenzen für die Trainingspraxis
6.12 Das Hundegeschirr
7 Stress im Hundesport
7.1 Physiologische Grundlagen
7.2 Stress aus sportphysiotherapeutischer Sicht
7.3 Stress beim Sporthund
8 Doping im Hundesport
8.1 Problemkomplex Doping
8.2 Doping und Medikamentenmissbrauch
8.3 Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSA)
8.4 Rechtliche Grundlagen
Teil II Trainingspraxis
9 Training der motorischen Hauptbeanspruchungsformen
9.1 Der Trainingsprozess – konkrete Trainingsgestaltung im Hundesport
9.2 Durchführung von Auf- und Abwärmen
9.2.1 Ablauf des Aufwärmens
9.2.2 Ablauf des Abwärmens
9.3 Ausdauer
9.3.1 Training der Grundlagenausdauer I
9.3.2 Training der Grundlagenausdauer II im Hochleistungssport (extensive Intervallmethode)
9.3.3 Training der speziellen Ausdauer im Hochleistungssport (intensive Intervallmethode)
9.4 Kraft
9.4.1 Training der funktionellen Kraft
9.4.2 Training der Kraftausdauer
9.4.3 Training der Sprungkraft
9.5 Schnelligkeit
9.5.1 Training der Schnelligkeitsausdauer
9.6 Koordination
9.6.1 Koordinative Fähigkeiten
9.6.2 Training der Koordination
9.7 Beweglichkeit
9.7.1 Störungen innerhalb der myofaszialen Wirkungsketten
9.7.2 Sportphysiotherapeutische Bewegungstestreihe
9.7.3 Training der Beweglichkeit (Dehnen)
9.8 Beispiele für Trainingspläne
9.8.1 Beispiel 1: Agility-Hund
9.8.2 Beispiel 2: Hund, Geländelauf auf THS-BSP/VDH-DM THS
9.9 Exkurs Training der Sprungtechnik
10 Basics der physiotherapeutischen Techniken
10.1 Manuelle Lymphdrainage
10.1.1 Das Lymphgefäßsystem
10.1.2 Die Bildung der Lymphe
10.1.3 Das Lymphödem
10.1.4 Grundlagen der Lymphdrainagegriffe
10.1.5 Behandlungsaufbau am Beispiel einer Kontusion des M. quadriceps
10.2 Funktionsmassage
10.3 Dehnungsübungen
10.4 Myofasziale Release-Techniken
10.4.1 Die Grundtechniken der myofaszialen Behandlung
10.4.2 Beispielhafte Darstellung der Grundtechniken
10.5 Kompressionsbehandlung synovialer Gelenke
10.6 Elektrotherapie und Ultraschalltherapie
10.6.1 Elektrotherapie
10.6.2 Ultraschalltherapie
10.7 Hydrotherapie
10.7.1 Unterschiede Unterwasserlaufband und Schwimmtherapie
11 Akute hundesporttypische (orthopädische) Verletzungen
11.1 Sportverletzung versus Sportschäden
11.2 Fraktur
11.3 Muskelkontusion
11.4 Krallenabriss
11.5 Bissverletzungen
12 Überbelastungs- und Fehlbelastungsfolgen im Hundesport
12.1 Wirbelsäulendysfunktion und Dysfunktionen der Sakroiliakalgelenke
12.1.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.1.2 Relevante Anatomie
12.1.3 Ätiologie/Pathogenese
12.1.4 Diagnostik
12.1.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.2 Spondylose
12.2.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.2.2 Relevante Anatomie
12.2.3 Ätiologie/Pathogenese
12.2.4 Diagnostik
12.2.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.2.6 Prävention
12.3 Lumbosakrale Instabilität
12.3.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.3.2 Relevante Anatomie
12.3.3 Ätiologie/Pathogenese
12.3.4 Diagnostik
12.3.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.4 Subkutane Pannikulose
12.4.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.4.2 Relevante Anatomie
12.4.3 Ätiologie/Pathogenese
12.4.4 Diagnostik
12.4.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.5 Limber-Tail-Syndrom
12.5.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.5.2 Relevante Anatomie
12.5.3 Ätiologie/Pathogenese
12.5.4 Diagnostik
12.5.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.6 Instabilität Schultergelenk
12.6.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.6.2 Relevante Anatomie
12.6.3 Ätiologie/Pathogenese
12.6.4 Diagnostik
12.6.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.7 Tendopathie der Bizepssehne
12.7.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.7.2 Relevante Anatomie
12.7.3 Ätiologie/Pathogenese
12.7.4 Diagnostik
12.7.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.8 Insertionstendopathie des M. gastrocnemius
12.8.1 Häufige Sportarten und Hinweise aus der Anamnese
12.8.2 Relevante Anatomie
12.8.3 Ätiologie/Pathogenese
12.8.4 Diagnostik
12.8.5 Therapeutische Möglichkeiten
12.9 Gelenkarthrose
12.9.1 Ätiologie/Pathogenese
12.9.2 Klinik und Symptome
12.9.3 Diagnostik
12.9.4 Therapeutische Möglichkeiten
12.10 Fallbeispiele
12.10.1 Fallbeispiel 1: Rüde Tom, 7-jähriger Border Collie
12.10.2 Fallbeispiel 2: Rüde Tim, 6-jähriger Airdale Terrier
13 Sport für Hunde mit Handicap
14 Ausblick
14.1 Untersuchungen und Konsequenzen für das Agility
14.2 Untersuchungen und Regeländerungen in anderen Sportarten
14.3 Hundesportverbände – Tierärzte – Tierphysiotherapeuten
15 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Theorie
1 Hundesport braucht professionelle Physiotherapie
2 Die gebräuchlichsten Hundesportarten von A–Z im Überblick
3 Basics der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
4 Körperbau und Fortbewegung des Hundes
5 Allgemeine Grundlagen für ein erfolgreiches Training
6 Die sportartspezifischen Belastungen im Hundesport
7 Stress im Hundesport
8 Doping im Hundesport
1 Hundesport braucht professionelle Physiotherapie
1.1 Aufgaben der Sportphysiotherapie
Die angestrebte Professionalisierung des Hundesports erfordert unseres Erachtens eine Spezialisierung im Bereich der Tiermedizin und der Tierphysiotherapie. Dies soll ein kleines Beispiel aus der Praxis verdeutlichen: Eine Lahmheitsuntersuchung beinhaltet normalerweise nur das Vorführen des Hundes im Schritt und im Trab. Oftmals haben Sportler bei ihren Tieren jedoch nur leichte Bewegungsabweichungen im Galopp, im Sprung oder in bestimmten Wendungen oder Hinderniskombinationen bemerkt – Veränderungen, die von einer normalen Lahmheitsuntersuchung nicht erfasst werden können. Der Therapeut wird bei seiner Befundung wahrscheinlich ein „Gangbild ohne besondere Befunde“ notieren. Damit sich der Tierarzt oder Therapeut von den Beobachtungen des Hundeführers ein Bild machen kann, ist oft ein Handyvideo sehr nützlich. Wird dies im Vorbericht jedoch nicht gesondert erfragt oder aber unaufgefordert vom aufmerksamen Besitzer mitgebracht, wird der Besuch beim Therapeuten nicht sehr erfolgreich sein. Die Hundeführer fühlen sich dann häufig unverstanden und ein Wechsel von Therapeut zu Therapeut ist die Folge. Bisweilen finden sich aber auch aufseiten der Tierärzte und Therapeuten Unverständnis bzw. Vorbehalte in Bezug auf den sportlichen Einsatz von Hunden, da vielleicht die eigene Idee von einem „glücklichen Hundeleben“ eben nicht zwangsläufig auch eine sportliche Ausbildung und Turnierlaufbahn beinhaltet. Hier sollte man sich als Tierarzt und Therapeut dann vielleicht fragen, ob man Patienten mit sportlichen Ambitionen und sportphysiotherapeutischen Fragestellungen nicht lieber in eine andere Praxis überweist – und als Hundesportler oder -trainer ist man wahrscheinlich umgekehrt auch bei einem Tierarzt oder Therapeuten mit Erfahrungen im Hundesport und entsprechenden Fortbildungen im Bereich der Sportphysiotherapie besser aufgehoben. Die Sportphysiotherapie innerhalb des Hundesports erfüllt gleich mehrere Aufgaben: Bei Sportverletzungen und Überlastungsschäden ist eine gute sportphysiotherapeutische Nachbehandlung entscheidend für die erfolgreiche Rückkehr in den Sport. Durch präventive sportphysiotherapeutische Maßnahmen wie z.B. ein funktionelles Warm-up können Verletzungen vermieden werden. Eine sportphysiotherapeutische Betreuung des Sporthundes führt außerdem zu einer Leistungsoptimierung. Hierzu ist jedoch sicherlich zu sagen, dass auch im Bereich des sportphysiotherapeutischen Arbeitens niemals die sportlichen Ambitionen der Besitzer über das gesundheitliche Wohl des Hundes gestellt werden dürfen. Bisweilen bedarf es hier tatsächlich einer couragierten Aufklärung der Hundehalter durch den Tierarzt oder Therapeuten, dass unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei Vorliegen einer Hüftgelenksdysplasie; nach einem operierten Kreuzbandriss) eine weitere sportliche Karriere auf Wettkampfniveau nicht realistisch bzw. nicht im Sinne des Tierschutzes ist. Denn hier besteht ein deutlicher Unterschied zwischen zwei- und vierbeinigen Sportlern: Der Mensch als Sportler ist für seinen Körper selbst verantwortlich, er kann für sich entscheiden, was er seinem Körper zumuten kann oder will. Im Hundesport übernimmt der Mensch jedoch Verantwortung für ein anderes Lebewesen, welches sich oft nicht so eindeutig äußern kann. Vor allem Hunde, die bereits viele positive emotionale Erfahrungen im Hundesport gesammelt haben, „hoch im Trieb stehen“, d.h. also eine hohe Motivationslage mitbringen, oder aber ihrem Besitzer einfach alles recht machen möchten, signalisieren im Sportumfeld meist nicht, dass sie Schmerzen haben. Hier sind eine gute Tierbeobachtung und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein – optimalerweise bei Sportler, Trainer und Therapeut – gefragt!
1.2 Physiotherapie versus Sportphysiotherapie
Der Begriff Physiotherapie hat griechische Wurzeln und bedeutet übersetzt so viel wie „Naturheilbehandlung“ (von physis: „Natur“ und therapeia: „Dienstleistung“, „Behandlung“). Er beschreibt die Behandlung gestörter Körperfunktionen mit natürlichen Therapiemethoden und wird außerdem definiert als die äußerliche Anwendung von Heilmitteln vor allem im Bereich des Bewegungsapparats. Der Erhalt und die Verbesserung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Körpers stehen dabei als Therapieziele im Vordergrund. Der Beruf des Physiotherapeuten im Humanbereich zählt zu den therapeutisch-rehabilitativen Heilberufen im Gesundheitswesen. Die Ausbildung zum Physiotherapeuten ist eine bundesweit einheitlich geregelte schulische Ausbildung an einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für Physiotherapie. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Modernisierung des Bildungswesens und neue Herausforderungen im Gesundheitswesen führten in den letzten Jahren zu einer Weiterentwicklung der Heilberufe. Im Vordergrund steht hier die Professionalisierung der Physiotherapie. So haben sich bereits seit 1999 unterschiedliche physiotherapeutische Hochschulstudiengänge in Deutschland etabliert.
1.2.1 Was ist Physiotherapie?
Orientiert man sich an der vom Weltverband für Physiotherapie herausgegebenen Definition, so kann Physiotherapie als ein Beruf begriffen werden, der sich mit der Wiederherstellung und der Erhaltung der Gesundheit und dem Wohlbefinden bzw. Wohlfühlen sowie der Behandlung von Beeinträchtigungen und Dysfunktionen der menschlichen Bewegung befasst. Diese Beeinträchtigungen können aus angeborenen Fehlhaltungen oder Deformitäten resultieren, auf Traumata und Fehlbelastungen zurückgehen, aber ebenso aus psychischen und emotionalen Dysfunktionen entstehen. Da die Bewegungseinschränkungen meistens mit Schwierigkeiten in der Ausführung funktioneller Aktivitäten einhergehen, ist das primäre Ziel, die Klienten bei der Erlangung des größtmöglichen Bewegungspotenzials oder der möglichst normalen Funktion zu begleiten und damit deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern und zu unterstützen. Um diese Ziele zu erreichen, sind Physiotherapeuten in der Lage, Schmerzen zu lindern, das Gelenkspiel zu erweitern, die Atemfunktion zu schulen, die Balance und die motorische Kontrolle sowie die Muskelkraft zu vergrößern. Damit beinhaltet die Rolle des Physiotherapeuten aber auch, Klienten und ggf. ihre Familien anzulernen und über die Bedingungen und das Management aufzuklären, wie die maximale Lebensqualität wiederzuerlangen ist.
Aus der Definition wird ersichtlich, dass die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden von Einzelpersonen und der Gesellschaft im Allgemeinen im Vordergrund der physiotherapeutischen Arbeit stehen. Im deutschen Sprachgebrauch wird teilweise der Begriff Physikalische Therapie synonym zur Physiotherapie verwendet. Dabei bezeichnet die physikalische Therapie streng genommen nur diejenigen Therapieformen, bei denen physikalische Reize zur Anwendung kommen (also z.B. Wärmeanwendung, Magnetfeldtherapie, Elektrotherapie etc.) und bezieht sich somit nur auf einen Teilbereich der Physiotherapie. Auch im Hinblick auf den Begriff Physikalische Medizin gibt es inhaltlich weite Überschneidungsfelder mit der Physiotherapie bzw. der Physikalischen Therapie. Dabei bezieht sich die korrekte Verwendung des Begriffes „Physikalische und Rehabilitative Medizin“ jedoch ausschließlich auf eine ärztliche Tätigkeit: Fachärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin haben im Anschluss an ihr allgemeines Studium eine fünfjährige Weiterbildung mit anschließender Facharztprüfung absolviert. Ausbildung und Prüfung umfassen u.a. die Bereiche Erkennung von Krankheiten und fachbezogene Diagnostik, Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Erkrankungen und Schädigungen mit Methoden der Physikalischen Therapie, der Manuellen Therapie und der Naturheilverfahren sowie die Erstellung von Rehabilitationsplänen.
Im Bereich der Tierphysiotherapie lassen sich die einzelnen Begriffe oft noch schwieriger definieren und schlechter voneinander abgrenzen. Dies liegt in erster Linie daran, dass es hier bislang keinerlei staatliche Regelungen in Bezug auf die Ausbildung, Prüfung und Berufsausübung des Tierphysiotherapeuten gibt. Im Bereich der Tiermedizin existieren für Tierärzte Möglichkeiten zur Weiterbildung und Erlangung einer Zusatzbezeichnung ähnlich der Weiterbildung zum Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin im Humanbereich – allerdings finden sich auch hier keine deutschlandweit einheitlichen Bezeichnungen, was der Tatsache geschuldet ist, dass die Weiterbildungsordnungen für Tierärzte durch die Tierärztekammern der einzelnen Bundesländer zum Teil sehr unterschiedlich geregelt werden.
Die Ursprünge der Sportphysiotherapie beim Menschen lassen sich – ähnlich wie auch die Wurzeln anderer physiotherapeutischer Maßnahmen wie beispielsweise die der Massage – bis in die Antike zurückverfolgen. So finden sich bereits bei Hippokrates, Galen und Epiktet Beschreibungen verschiedener Behandlungen bei Athleten der antiken olympischen Spiele, insbesondere bei Läufern und bei Sportlern, die in Kampfsportarten gegeneinander antraten. In der Neuzeit trugen ebenfalls olympische Spiele dazu bei, dass die Sportphysiotherapie weiter an Bedeutung gewann: So wurde ihre Rolle durch die offizielle Ablehnung jeglicher pharmakologischer Manipulationen im Zusammenhang mit den olympischen Spielen 1976 in Montreal seitdem noch deutlich gestärkt.
Definition
Die Sportphysiotherapie versteht sich als Teilgebiet der Physiotherapie, deren Ziel es ist, die Gesundheit des Menschen zu fördern und zur Gesunderhaltung der Bevölkerung durch sportliche Aktivität beizutragen.
Die Sportphysiotherapie umfasst dadurch sowohl die Beratung im Hinblick auf die Förderung eines aktiven Lebensstils sowie in Bezug auf alle sportlichen Aktivitäten als auch therapeutische Interventionen, sofern diese notwendig werden. Insgesamt lässt sich die Sportphysiotherapie so in vier Teilbereiche untergliedern:
Verletzungsprävention: Dies geschieht immer unter Berücksichtigung der individuellen sportlichen Aktivität des Athleten einerseits und unter Einbeziehung sportartenspezifischer Aspekte andererseits.
Verringerung der Verletzungshäufigkeit durch Identifizierung von Verletzungsrisiken
Information und Training von Sportler und Trainer zur Minimierung von Verletzungsrisiken
Akute Intervention: Nach akuten Verletzungen im Zusammenhang mit sportlichem Training oder Wettkampf muss auf diese Sportverletzungen in Absprache mit anderen medizinischen Betreuern reagiert werden.
Rehabilitation: Die Rehabilitation hat das Ziel, dass der Sportler nach einer Verletzung oder einem Eingriff sicher zu seinem optimalen Leistungslevel zurückkehren kann. Hierbei steht insbesondere die Entwicklung von Therapie- und Trainingsplänen auf der Basis evidenzbasierter Erkenntnisse im Vordergrund.
Leistungssteigerung: Um die Leistung eines Sportlers zu optimieren, muss zunächst die sportliche Ist-Leistung ermittelt und bewertet werden. Auf dieser Basis können dann leistungsbezogene Trainingspläne erstellt und Ratschläge zur Optimierung der Bedingungen für das Erreichen der Maximalleistung erarbeitet werden. In der Praxis besteht meist ein deutlicher Unterschied zwischen dem Breiten- und Leistungssportbereich: Sind Sportphysiotherapeuten im Breitensport in erster Linie an der Therapie von Sportverletzungen beteiligt, so liegt im Leistungssport ein stärkeres Augenmerk auf der Prophylaxe von Verletzungen einerseits und der Leistungsoptimierung andererseits. Im Humanbereich obliegt die Ausübung der Sportphysiotherapie in Deutschland momentan den Physiotherapeuten. Für sie besteht die Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung. Durch Absolvierung der vom Deutschen Olympischen Sportbund zertifizierten Weiterbildung mit 280 Unterrichtseinheiten kann die Zusatzqualifikation „DOSB-Sportphysiotherapie“ erlangt werden. Dabei wird momentan jedoch diskutiert, ob diese Form der Weiterbildung noch zeitgemäß ist. Es gibt sowohl Vorschläge, hier noch eine weitergehende Spezialisierung im Sinne eines eigenen Ausbildungs- bzw. Studienganges mit eigener beruflicher Qualifikation und staatlicher Anerkennung anzustreben, als auch Überlegungen, die Ausbildung im Bereich der Sportphysiotherapie nur noch in Form eines akademischen Studienganges im Sinne eines Bachelor- oder Masterstudiums anzubieten.
In Bezug auf ihr Selbstverständnis formulieren Sportphysiotherapeuten zum Teil sehr hohe ethische und fachliche Anforderungen: So sehen sie sich zum einen als Spezialisten, die ihre Tätigkeit unter Einhaltung professioneller Standards in den Dienst von Athleten aller Alters- und Leistungsgruppen stellen und deren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Sie bringen Verständnis für die Sportler selbst, aber auch für deren Verletzungen und für den auf ihnen lastenden Umgebungsdruck auf. Zum anderen begreifen sie sich als Pioniere auf ihrem Gebiet, die sich durch evidenzbasierte Forschung an der Entwicklung neuen Wissens beteiligen und dieses auch in die Praxis einbringen. Dabei bringen sie eine aufgeschlossene, aber zugleich kritisch hinterfragende Grundhaltung mit.
1.2.2 Sportphysiotherapie beim Hund
Die Entwicklung der Sportphysiotherapie beim Hund steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen. Dies wird auch daran deutlich, dass bisher kaum wissenschaftliche Publikationen oder Fachbücher zu dieser Thematik existieren.
Dennoch finden in den letzten Jahren immer häufiger Hundebesitzer aufgrund von sportphysiotherapeutischen Fragestellungen den Weg in eine Tierarzt- oder Tierphysiotherapie-Praxis. Dabei stehen insgesamt sehr ähnliche Themen im Blickpunkt, wie dies auch im Humanbereich der Fall ist:
Wie kann ich meinen Hund körperlich so aufbauen und trainieren, dass er die Turniersaison möglichst ohne Verletzungen übersteht?
Kann ich das Training meines Hundes aus körperlicher bzw. (sport-)physiotherapeutischer Sicht optimieren, um im Wettkampf noch bessere Ergebnisse zu erzielen?
Was kann ich nach einer Trainingspause, einer Erkrankung oder Verletzung tun, damit mein Hund möglichst schnell und gut wieder ins Training einsteigen kann?
Ist es nach einer Verletzung überhaupt realistisch, dass der Hund wieder sein ursprüngliches Leistungsniveau erreicht und im Wettkampf starten kann?
Die Sportphysiotherapie beim Hund verfolgt dadurch sicherlich primär individuelle Ziele, die durch die einzelnen Mensch-Hund-Teams vorgegeben werden. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass Hunde „Privatpatienten“ sind und Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge nicht gefördert werden. Eine sportphysiotherapeutische Beratung und Behandlung wird daher meist nur von entsprechend interessierten bzw. ambitionierten Besitzern in Anspruch genommen. Der Grundgedanke, die Gesundheit aller Hunde durch einen aktiveren Lebensstil und sportliche Betätigung zu fördern, tritt dadurch in der Praxis in den Hintergrund, obwohl der Anteil der Hunde in Deutschland, die davon profitieren könnten, sicherlich ähnlich hoch ist wie beim Menschen ( ▶ Abb. 1.1).
Abb. 1.1 Ausreichend Bewegung zählt zu den wichtigsten Grundbedürfnissen unserer Hunde. Ein aktiver Lebensstil, ausgewogene Ernährung und ausreichend Ruhezeiten begünstigen ein gesundes und langes Hundeleben.
(Foto: Marie France Mühlschlegel, Karlsruhe)
So ist die Mehrzahl der heute in unseren Wohnungen und Häusern gehaltenen Hunde „arbeitslos“ und bewegt sich dadurch auch wesentlich weniger als ihre Vorfahren. Darüber hinaus gibt es mittlerweile einige Hunderassen und -typen, für die allein durch ihre körperlichen Voraussetzungen ein sportlich-aktives Leben kaum mehr möglich ist. Hier sind sicherlich an erster Stelle die brachyzephalen Rassen (z.B. Mops, Shi-Tsu, Bulldogge) zu nennen, bei denen die Einengung der oberen Luftwege nicht selten zu Atemnot oder sogar Bewusstseinsausfällen (Synkopen) führen kann. Aber auch viele Zwerghunde werden bisweilen kaum als Lebewesen mit einem ausgeprägten Bewegungsdrang wahrgenommen, sondern eher wie Accessoires auf dem Arm ihrer Besitzer durch die Gegend getragen. Wenn so auch die Verletzungsprophylaxe und Gesundheitsförderung stärker auf den einzelnen Hund ausgerichtet sind, ergibt sich dennoch bezüglich der Teilbereiche der Sportphysiotherapie eine dem Humanbereich analoge Gliederung. Die Sportphysiotherapie für Hunde umfasst entsprechend folgende Bereiche ( ▶ Abb. 1.2):
Prophylaxe von Verletzungen und Überlastungsschäden im Sport
Therapie und Rehabilitation von Sportverletzungen
Trainingslehre und Leistungsoptimierung
Abb. 1.2 Aufgabenfelder der Hundesportphysiotherapie.
Die Sportphysiotherapie nutzt dabei in Prävention und Therapie im Wesentlichen alle Therapieformen, die auch sonst im Bereich der Physiotherapie beim Hund zur Anwendung kommen. Diese umfassen passive Maßnahmen, vor allem aber auch aktive Maßnahmen im Sinne der aktiven Bewegungstherapie mit und ohne (Sport-)Geräte sowie physikalische Therapieformen ( ▶ Abb. 1.3).
Abb. 1.3 Die verschiedenen Therapieformen in der Hundesportphysiotherapie.
Da im Bereich der Tierphysiotherapie nicht einmal eine einheitliche Grundausbildung existiert, sind die Möglichkeiten zur Fortbildung auf dem Gebiet der Sportphysiotherapie für Hunde noch uneinheitlicher. Eine Weiterbildung für Tierärzte zum Hundesportmediziner gibt es derzeit in Deutschland noch nicht. Lediglich an der Tiermedizinischen Fakultät in Maisons-Alfort (Frankreich) und den beiden amerikanischen Universitäten Auburn und Florida existiert solch ein sportmedizinscher Zweig. Die International Sled Dog Veterinary Medical Association (ISDVMA, internationale tiermedizinische Vereinigung für Schlittenhunde) ist ein 400 Mitglieder starker Fachverband für Tierärzte, der sich seit der Gründung 1991 um das Wohlergehen und die Gesunderhaltung von Schlittenhunden bemüht. Die ISDVMA vergibt jährlich Stipendien an zahlreiche Tiermedizinstudenten, die sich für diesen Bereich der Tiermedizin interessieren. Da jedoch auch Sporthunde mit ihren spezifischen Anforderungen und therapeutischen Fragestellungen eine kompetente Betreuung benötigen, ist es notwendig, dass sich die Sportphysiotherapie bzw. die Sportmedizin als Spezialgebiete innerhalb der Veterinärmedizin in Deutschland weiterentwickeln.
1.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Der Hundesportphysiotherapeut begegnet in seiner Arbeit verschiedenen Zielgruppen. Zu diesen Zielgruppen gehören nicht nur die Breiten- und Leistungssportler, sondern auch die dienstlich und jagdlich geführten Hunde. Die Herausforderungen in der Hundesportphysiotherapie stellen also zum einen die sehr unterschiedlichen Zielgruppen und dadurch auch unterschiedlichen Fragestellungen dar, zum anderen muss hier in besonderem Maße auch immer der Besitzer und zum Teil auch der Trainer in die Therapie- und Trainingsgestaltung mit einbezogen werden. Dies erfordert nicht nur eine entsprechende fachliche Qualifikation im Umgang mit dem Sporthund, darüber hinaus sollte der Hundesportphysiotherapeut als direkter Ansprechpartner für den Hundeführer auch über ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft verfügen. Das sportlerzentrierte Arbeiten ist sehr vielschichtig und bedarf einer intensiven Zusammenarbeit von Hundesportphysiotherapeuten, Trainern und den behandelnden Tierärzten ( ▶ Abb. 1.4).
Abb. 1.4 Das multidisziplinäre Team – das Mensch-Hund-Team steht im Mittelpunkt. Die verschiedenen Disziplinen tauschen Informationen aus und stimmen verschiedene Maßnahmen ab.
Entscheidend für die Zusammenarbeit ist das Entwickeln eines Therapie- und Trainingsziels, an dem gemeinsam auf den unterschiedlichen Ebenen gearbeitet wird. Das Ziel sollte immer aus einer Perspektive entwickelt werden, die sich am Mensch-Hund-Team orientiert. Bei der Zusammenarbeit geht es hauptsächlich um das Austauschen von Informationen und das Abstimmen verschiedener Maßnahmen, um den gesamten Behandlungsprozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Dies kann beispielsweise bedeuten, dass der Hundesportphysiotherapeut auf der ersten Ebene direkt vor Ort in der Praxis den Hund manuell oder mithilfe physikalischer Methoden behandelt. Auf der zweiten Ebene gibt er Anleitungen an den Besitzer weiter, wie dieser durch bestimmte Übungen, die er täglich zu Hause mit dem Hund durchführt, den Therapiefortschritt unterstützen kann. Die dritte Ebene bezieht das Training im Verein oder in der Hundeschule mit ein. Auch hier können Modifikationen notwendig werden, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, z.B., indem auf ein gezieltes Warm-up und Cool-down geachtet wird oder aber der zu therapierende Hund (vorübergehend) von bestimmten Übungen ausgenommen wird. Die Möglichkeiten einer effektiven interdisziplinären Zusammenarbeit sollen an einem Beispiel verdeutlicht werden.
1.3.1 Praxisbeispiel
Sina, eine zweijährige deutsche Schäferhündin, wird im Gebrauchshundsport in der Klasse 2 geführt. Wegen einer Pyometra (eitrige Gebärmutterentzündung) musste eine Kastration durchgeführt werden. Für die Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken wurde bei Sina der Bauch durch einen hinter dem Nabel beginnenden Schnitt eröffnet. Dieser Schnitt wird mittig durch die sog. Rektusscheide gesetzt. Die Rektusscheide ist eine Sehnenplatte, die genau in der Körpermitte liegt und von den Bauchmuskeln gebildet wird. Durch diese Sehnenplatte werden alle Bauchmuskeln zu einer funktionellen Einheit zusammengeschlossen. Die Bauchmuskeln sind wichtige Beuger und Stabilisatoren für die Wirbelsäule, sie tragen die Eingeweide und unterstützen die Atmung. Gerade beim Sprung oder beim Galopp werden die Bauchmuskeln maximal beansprucht. Die Heilungszeit der Sehnenplatte nach der Operation beträgt ungefähr drei Monate. Zwar werden schon nach 14 Tagen die Fäden gezogen, dann ist aber nur die Wunde geschlossen und das Gewebe ist noch nicht belastungsstabil. Das bedeutet, dass eine Hündin nach einer solchen Operation, aber auch nach einer normalen Kastration erst nach drei Monaten wieder voll belastet werden kann. Es ist daher enorm wichtig, dass der behandelnde Tierarzt und auch der Hundesportphysiotherapeut den Besitzer und den Trainer über Heilungsverlauf und Heilungszeit des Gewebes aufklären. Ziel der Zusammenarbeit ist es in diesem Fall, Sina schnellstmöglich wieder an ihr vorheriges Leistungsmaximum heranzubringen. Hierzu gehören eine zielgerichtete Therapie sowie eine sinnvolle Trainingsplanung und -gestaltung. Wir erleben es oftmals in der Praxis, dass Sporthunde schon kurz nach dem Ziehen der Hautfäden wieder voll belastet werden. Das kann einerseits zu Verwachsungen und Verklebungen und andererseits zu erheblichen Einschränkungen der Narbenbeweglichkeit führen. Auch sehen wir häufig, dass der Sporthund eine Fehlhaltung bzw. Schonhaltung entwickelt, indem er sich z.B. beim Sprung nicht maximal streckt und die Sprünge taxiert. Verwachsungen, Einschränkungen der Narbenbeweglichkeit und Fehlhaltungen können dann im Laufe der Zeit zu Wirbelsäulenproblemen führen. Die physiotherapeutische Behandlung beginnt am zweiten Tag nach der Operation. Im Vordergrund der Therapie steht die Narbenbehandlung. Ziel der manuellen Narbenbehandlung ist die Verbesserung der Dehnfähigkeit und der Widerstandsfähigkeit des Gewebes sowie eine Verminderung der überschießenden Gewebesensibilität. Der Physiotherapeut kann den Heilungsverlauf kontrollieren und bei eventuellen Wundheilungsstörungen den behandelnden Tierarzt sofort informieren. Im weiteren Verlauf der Therapie kann ab dem fünften Tag mit koordinativen Übungen begonnen werden. Das Koordinationsprogramm kann vom Hundeführer als Heimübungsprogramm durchgeführt werden. Ab der vierten Woche sollte ein Training zur Verbesserung der aeroben Leistungsfähigkeit erfolgen. Der Hundeführer kann hierbei von seinem Trainer unterstützt werden, deshalb ist der Austausch zwischen Hundesportphysiotherapeut und Hundetrainer im Hinblick auf die optimale Rehabilitation sehr wichtig. Fährtenarbeit und Übungen aus der Unterordnung sind ab der sechsten Woche wieder möglich. Schutzarbeit, Schrägwand und Meterhürde können ab der zwölften Woche nach Operation wieder trainiert werden. Am Ende der Rehabilitation sollte der Hundesportphysiotherapeut den behandelnden Tierarzt über den Verlauf und das Ergebnis der Rehabilitation informieren.
Sinas Fallbeispiel verdeutlicht, wie wichtig der Austausch von Informationen und das Abstimmen der Behandlungsmaßnahmen der am Rehabilitationsprozess beteiligten Akteure ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
2 Die gebräuchlichsten Hundesportarten von A–Z im Überblick
2.1 Einfluss der Motivation auf die Belastung
Definition
Im offiziellen Sprachgebrauch des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) bezeichnet der Begriff Hundeführer diejenige Person, die den Hund im Training sowie auf Prüfungen und Wettkämpfen führt. Der Hundeführer muss dabei nicht mit dem Halter oder Eigentümer des Hundes identisch sein. In der Beschreibung derjenigen Sportarten, die traditionell unter dem Dach des VDH ausgeübt werden, haben wir diesen Begriff entsprechend übernommen. In vielen jüngeren Sportarten hat sich dieser Begriff jedoch nicht durchgesetzt; dort wird in der Regel die Bezeichnung Hundesportler/in verwendet. Diese erscheint auch uns zeitgemäß und wird daher bei der Beschreibung der neueren Sportarten sowie im allgemeinen Teil des Buches von uns benutzt.
Im Folgenden werden die derzeit in Deutschland am häufigsten ausgeübten Hundesportarten zunächst beschrieben und mit ihrer Entstehungsgeschichte sowie dem jeweiligen Regelwerk kurz umrissen. Dabei erhebt die Auswahl der hier behandelten Sportarten keinen Anspruch auf Vollständigkeit – Hundesport ist ein vergleichsweise junger Sport, der auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Sportarten und Disziplinen hervorgebracht hat. Die hier dargestellten Verhältnisse in Bezug auf Regelwerke und Prüfungsordnung entsprechen – sofern vorhanden – den momentan (2016) geltenden Vorschriften des VDH bzw. der FCI (Federation Cynologique Internationale). Einige Sportarten unterliegen teilweise in anderen Ländern anderen Regelwerken. Auch geben sich nicht dem VDH angeschlossene Vereine z.T. andere Reglements. Die in Deutschland jeweils aktuell gültigen Reglements für die verschiedenen Hundesportarten sind über die Homepage des VDH unter www.vdh.de jeweils als PDF-Dateien erhältlich. In vielen Sportarten gibt es zusätzlich zu den sog. Prüfungsordnungen, die jeweils das eigentliche Reglement enthalten, Richtlinien und Leitfäden, die darüber hinausgehende Informationen geben.
Vor allem im Agility finden sich auch zahlreiche Hundeschulen, die ein „Just-for-Fun-Training“ anbieten und dafür meist auch die standardisierten Geräte nutzen, oftmals aber ganz andere Lernziele verfolgen, als dies in einem wettkampforientierten Training der Fall ist. Der Ansatz, durch eine solche Trainingsgestaltung den menschlichen Ehrgeiz und dadurch den Leistungsdruck aus dem Training herauszunehmen und so den Mensch-Hund-Teams einfach ein positives, gemeinsames Bewegungserlebnis zu bieten, ist sicherlich gut und kommt vielen Freizeitsportlern entgegen. Allerdings sollte man trotzdem kritisch hinterfragen, ob durch ein solches „Just-for-Fun-Training“ tatsächlich auch die körperlichen Risiken für den Hund minimiert – oder vielleicht auch schlichtweg nur unterschätzt – werden!
Dagegen spricht vor allem, dass die Motivationslage des Hundes im Sport eine völlig andere sein kann als die seines Besitzers. Läuft der Besitzer vielleicht ein wenig schneller, weil er sich dadurch ein Qualifikationsergebnis, eine gute Platzierung oder einen Pokal erhofft, beeinflussen solche abstrakten Belohnungen den körperlichen Einsatz des Hundes gar nicht oder nur indirekt. Wirft der Hundeführer dagegen zur Belohnung nach dem Zieleinlauf den Ball für seinen Hund, so wird dieser mit voller Geschwindigkeit und vollem körperlichen Einsatz hinterherjagen – egal, ob er zuvor nur drei Hürden in einem Trainingsparcours absolviert oder die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Für die meisten Hunde gibt es keinen Unterschied zwischen einer „Just-for-Fun-Aufgabe“ und einer „ernsten Anforderung“: Hoch motivierte Hunde geben meist bei jeder ihnen gestellten Aufgabe hundertprozentigen Einsatz, um ihrem Besitzer zu gefallen und ihre Sache möglichst gut (und schnell) zu machen. Und andersherum ist glücklicherweise auch die Mehrzahl der erfolgreichen Turnierhunde mittlerweile so positiv aufgebaut und trainiert, dass sie auch in einer Prüfungssituation freudig und motiviert arbeiten und „Spaß“ zu haben scheinen.
Oftmals unterschätzen aber auch Trainer und Freizeitsportler die körperlichen Anforderungen an die Hunde sowie das Ausmaß der Belastung in einem „Fun-Training“. Die Hunde sind aus sportphysiotherapeutischer Sicht oft viel schlechter vorbereitet, da in der Regel nicht darauf geachtet wird, dass außerhalb des Parcourstrainings auch die motorischen Hauptbeanspruchungsformen trainiert werden. Meist beschränkt sich das Training auch nur auf die Sommermonate ohne entsprechendes Ausgleichs- oder Erhaltungsprogramm im Winter. Darüber hinaus werden außerdem die Hunde meist einfach „irgendwie“ über Hürden und Hindernisse geschickt, ohne dass zuvor ein systematisches, auf die körperlichen Fähigkeiten ausgerichtetes Sprungtraining erfolgt. Da sich die meisten „Fun-Trainings“ vor allem daran orientieren, dass die menschlichen Sportler „Spaß“ haben, stehen außerdem in der Gestaltung der einzelnen Trainingsstunden oftmals „gesellschaftliche Aspekte“ im Vordergrund, während die Grundsätze der Sportphysiotherapie nur selten berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass es sich ja nicht um ein wettkampforientiertes Training handelt, scheint vielfach ausreichend, um auf ein Auf- und Abwärmen der Hunde zu verzichten. Vor und nach dem Training sowie zwischen den eigenen Trainingsläufen steht dann meist eher das Gespräch mit den anderen Teilnehmern und nicht die Vorbereitung oder das Auflockern des Hundes im Vordergrund.
2.2 Agility
2.2.1 Geschichte und Herkunft
Der Begriff Agility stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „Geschicklichkeit“ oder „Behändigkeit“. Im Rahmen der Crufts Dog Show im Jahr 1977 wurde Peter Meanwell gefragt, ob er nicht für das nächste Jahr ein Pausenprogramm organisieren könne. Daraufhin fand im Jahr 1978 die erste Agility-Vorführung von zwei Teams statt; für die Hindernisse und den Parcours diente der Pferde-Springsport als Vorbild. Das Publikum war so begeistert, dass die Veranstaltung im Folgejahr wiederholt bzw. fortgesetzt wurde und nun bereits ein Vorentscheid zur Ermittlung der besten drei Teams erfolgte. Seitdem fand die Sportart von England aus eine schnelle Verbreitung in andere Länder. In den 1980er-Jahren gelangte das Agility auch nach Deutschland und gehört hier jetzt mit zu den beliebtesten und am weitesten verbreiteten Hundesportarten und wird von fast allen Vereinen sowie einer Vielzahl von Hundeschulen angeboten. Dabei hat sich die Sportart vom Prinzip her kaum verändert: Im Mittelpunkt steht weiterhin die möglichst schnelle und fehlerlose Bewältigung eines Hindernisparcours. Prinzipiell können Hunde aller Rassen sowie Mischlinge im Agility geführt werden, dabei wird in verschiedenen Größenklassen gestartet.
In Deutschland sind die meisten Vereine und Verbände, die Turniere und Wettkämpfe organisieren, dem VDH angeschlossen und entsprechend dient hier die Prüfungsordnung des VDH vom 01.01.2013 als zugrunde liegendes Regelwerk. Darüber hinaus existieren in Deutschland einige weitere Vereine und Verbände außerhalb des VDH, die sich eigene, z.T. abweichende Reglements vorgeben. Auf internationaler Ebene werden Meisterschaften von der FCI organisiert – anders als auf nationalem Niveau sind hier jedoch nur noch Rassehunde mit FCI-Zuchtpapieren anerkannt. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Organisationen, welche Europa- und Weltmeisterschaften veranstalten, die zum Teil auch für Hunde ohne Abstammungsnachweis und Mischlingshunde offen sind.
2.2.2 Die Sportart
Im Agility geht es darum, dass ein Hund – dirigiert von seinem Hundeführer – einen Hindernisparcours möglichst fehlerfrei innerhalb einer vorgegebenen Standardzeit bewältigt. Dabei umfasst der Parcours bis zu 22 verschiedene Hindernisse, die durch Nummern markiert sind und in der vorgegebenen Reihenfolge absolviert werden müssen. Diese Reihenfolge ist jedoch nicht fix, sondern variabel und der Parcoursverlauf wird auf jedem Wettkampf neu durch den Leistungsrichter vorgegeben. Agility ist eine auf Geschicklichkeit und Geschwindigkeit ausgelegte Sprungsportart, welche dadurch naturgemäß relativ hohe Anforderungen an die körperliche Fitness der Hunde stellt. Dennoch lautet der Leitspruch für diese Sportart: „Agility is fun“, d.h., der Spaß an der gemeinsamen sportlichen Betätigung sollte stets im Vordergrund stehen und eine Überforderung des Hundes unbedingt vermieden werden!
Im Agility läuft der Hund im Parcours prinzipiell frei. Auch, um kein Verletzungsrisiko einzugehen, trägt er weder Leine noch Halsband oder Geschirr. Der Hund darf darüber hinaus während des Laufes nicht vom Hundeführer berührt werden; er wird lediglich durch dessen Stimme (Hörzeichen) und Körpersprache durch den Parcours geführt. Daraus wird deutlich, dass in dieser Sportart nicht nur ein hohes Maß an Geschicklichkeit des Hundes gefordert ist, sondern dass auch die Kommunikation und Zusammenarbeit im Mensch-Hund-Team möglichst optimal funktionieren muss.
Da prinzipiell Hunde aller Rassen und Mischlinge zugelassen sind, erfolgt für eine bessere Chancengleichheit auf Wettkämpfen die Einteilung in verschiedene Größenklassen. Außerdem wird zwischen „A- oder Prüfungsläufen“ einerseits und dem „Jumping“ andererseits unterschieden; darüber hinaus gibt es weitere Läufe, die als „Spiele“ bezeichnet und nicht offiziell gewertet werden. Während der Parcours im „Jumping“ lediglich aus Hürden und Sprunghindernissen besteht, kann der Parcours im „A-Lauf“ alle Hindernisse, also zusätzlich zu den Sprüngen auch Tunnel, Slalom und die sog. Kontaktzonengeräte, enthalten. Die Bewertung der Läufe erfolgt ähnlich wie beim Springreiten: Für einen Fehler oder eine Verweigerungen an einem Hindernis erhält das Team Strafpunkte, eine dreimalige Verweigerung oder eine falsche Reihenfolge bzw. ausgelassene Hindernisse führen zu einer Disqualifizierung.
Ähnlich wie in anderen Hundesportarten existieren auch im Agility zusätzlich zu den Größenklassen noch verschiedene Leistungsklassen.
Da im Agility ausschließlich die Zeit gemessen und bewertet wird, die der Hund zur Absolvierung des Parcours vom ersten bis zum letzten Hindernis benötigt, kann der Hundeführer den Hund so führen, dass dieser einen möglichst optimalen Laufweg in kürzester Zeit nehmen kann. Der Hund kann also am Start abgesetzt und dann abgerufen werden, er darf wahlweise links oder rechts geführt werden, wobei die Seite auch beliebig gewechselt werden kann, und der Hund darf außerdem vorausgeschickt werden (dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum Turnierhundsport dar, wo der Hund ausschließlich links geführt werden darf und auf derselben Höhe mit dem Besitzer laufen sollte). Es werden „Belgische“ und „Französische Wechsel“ (jeweils vor dem Hund) vom Wechsel hinter dem Hund („Back Cross“) unterschieden.
2.2.3 Regelwerk, Leistungs- und Prüfungsklassen
Im Agility werden die meisten Wettkämpfe in Deutschland in VDH-assoziierten Vereinen bzw. Verbänden veranstaltet und entsprechend gemäß den Richtlinien der Prüfungsordnung des VDH durchgeführt. Um im Agility an Turnieren teilnehmen zu können, muss der Hund wie in den meisten anderen Hundesportarten auch die Begleithundprüfung bestanden haben.
Gestartet wird in verschiedenen Größen- und Leistungsklassen. Die Einteilung in Größenklassen soll einerseits für mehr Chancengleichheit in Bezug auf unterschiedlich große Hunde sorgen und andererseits die körperlichen Belastungen vor allem für die kleineren Hunde gering halten ( ▶ Abb. 2.1). Je nach Verband werden 2–4 Größenklassen unterschieden. Das VDH-Reglement sieht 3 Größenklassen vor. Die Einteilung erfolgt gemäß der Widerristhöhe der Hunde wie folgt:
Small (S): kleiner 35,00 cm
Medium (M): über 35,00 und unter 43,00 cm
Large (L): über 43,00 cm
In den verschiedenen Größenklassen sind die Abmessungen der Hindernisse unterschiedlich, wobei die Hindernishöhe in der kleinsten Größenklasse am niedrigsten und in der größten Klasse am höchsten ist. So betragen die Hürdenhöhen in den einzelnen Klassen:
Small (S): 25–35 cm
Medium (M): 35–45 cm
Large (L): 55–65 cm
Abb. 2.1 Im Agility erfolgt die Einteilung der Hunde in verschiedene Größenklassen. Border Collies fallen meist in die größte Klasse. Dabei liegt die Widerristhöhe vieler Border Collies oft nur knapp über der Grenze von 43 cm, dennoch müssen sie dadurch im Wettkampf Sprunghöhen von bis zu 65 cm überwinden. Aktuelle Studien haben ergeben, dass dadurch die Belastungen, die im Absprung an den Gelenken der Hinterhand sowie in der Flugphase und bei der Landung an den Gelenken der Vorderhand entstehen, besonders hoch sind ▶ [1], ▶ [6], ▶ [4], ▶ [50]. Das Verletzungsrisiko von Border Collies im Agility liegt deutlich höher als das von Hunden anderer Rassen.
(Foto: Silke Meermann)
Darüber hinaus erfolgt eine Einteilung in verschiedene Leistungsklassen, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beinhalten. Die unterste Leistungsklasse wird als A1 bezeichnet; der Hund muss hier ein Mindestalter von 18 Monaten aufweisen, um starten zu können. Die mittlere Leistungsklasse ist die A2 und die höchste Leistungsklasse die A3. Um von einer Klasse in die jeweils nächsthöhere aufsteigen zu können, muss mindestens dreimal ein Nullfehler-Lauf mit der Note „vorzüglich“ unter mindestens zwei verschiedenen Leistungsrichtern absolviert werden. Für einen Fehler an einem Hindernis erhält das Team fünf Fehlerpunkte; darüber hinaus wird ein Überschreiten der Standardzeit mit Zeitstrafpunkten geahndet. Von Leistungsklasse zu Leistungsklasse wird die Schwierigkeit zum einen durch eine größere Hindernishöhe gesteigert, zum anderen aber auch durch einen anspruchsvolleren Parcoursverlauf, der den Hund beispielsweise stärker verleitet, die Hindernisse in der falschen Reihenfolge zu nehmen.
Neben den drei verschiedenen Leistungsklassen gibt es eine zusätzliche Seniorenklasse; diese wurde eingerichtet, um älteren Hunden die Möglichkeit zu geben, weiterhin auf Turnieren starten zu können, und gleichzeitig aber die körperlichen Belastungen für diese Hunde gezielt zu verringern. Um in der Seniorenklasse starten zu dürfen, muss der Hund mindestens sechs Jahre alt sein – die Einstufung in diese Klasse liegt jedoch im Ermessen des Hundeführers, d.h., er kann seinen Hund auch weiterhin in den normalen Leistungsklassen starten lassen. Lediglich umgekehrt ist nach einem einmaligen Start in der Seniorenklasse keine Rückkehr mehr in die offene Klasse möglich. In der Seniorenklasse sollte der Parcours etwa das Niveau der Leistungsklasse A2 besitzen; die Hindernisse sind dabei etwa 5–10 cm niedriger als in der jeweiligen Größenklasse. Die Wand wird auf 1,50 cm abgesenkt und der Parcours der Seniorenklasse darf weder einen Reifen noch einen Slalom enthalten.
Die Geräte, die im Agility in den verschiedenen Größenklassen im Parcours vorkommen, sind prinzipiell gleich, unterscheiden sich aber in den verschiedenen Wettkampfklassen hinsichtlich ihrer Abmessungen und vor allem in ihrer Höhe. Zu den offiziellen Agility-Geräten gehören der Tisch, die Sprunghindernisse Hürde, Besenhürde, Viadukt, Mauer, Reifen und Weitsprung, der Slalom, die Kontaktzonengeräte Wippe, Steg und A-Wand sowie die Tunnel.
Hürden sind die häufigsten Hindernisse im Parcours; sie bestehen jeweils aus zwei Seitenteilen und einer Stange, wobei die Stange nur lose aufliegen darf, sodass sie bei einer Berührung durch den Hund sofort herunterfällt. Das Herunterfallen einer Stange bzw. eines Abwurfteils wird mit Fehlerpunkten bestraft ( ▶ Abb. 2.2).
Abb. 2.2 Hürden sind die häufigsten Geräte im Agility. Sie haben jeweils nur eine lose aufliegende Stange und ihre Höhe ist in den verschiedenen Größenklassen unterschiedlich. Der Hürdensprung wurde als eines der Geräte ermittelt, an denen es besonders häufig zu Verletzungen kommt. Die oft hohe Anzahl an Sprüngen im Training führt außerdem zu einer repetitiven Belastung des Bewegungsapparats. Die hohe Belastung bei der Landung auf dem erstauffußenden Vorderbein kann so zu Reizungen der Bizepsursprungssehnen führen.
(aus: Meermann S. Sportphysiotherapie für Hunde. ZGTM 2016; 30: 23–29)
Der Slalom im Agility besteht aus 12 Stangen, welche etwa 3–5 cm dick und 1–1,20 m hoch sind; die Weite zwischen den einzelnen Stangen beträgt 60 cm ( ▶ Abb. 2.3). Der Hund muss rechts von der ersten Stange in den Slalom einfädeln; ein falsches Einlaufen gilt als Verweigerung, das Auslassen von Stangen sowie das Verlassen des Slaloms an der falschen Stelle werden als Fehler gewertet. Bei Fehlern muss der Slalom entweder von der Fehlerstelle oder vom Anfang wiederholt werden.
Abb. 2.3 Der Slalom besteht aus 12 Stangen mit einem Abstand von jeweils 60 cm. Dabei können die Hunde ihn mit zwei unterschiedlichen Techniken, dem „Fädeln“, wie hier im Bild sichtbar, und dem „Wedeln“ durchlaufen. Das „Fädeln“ ist in der Regel die schnellere Technik, führt aber zu stärkeren Flexionsmomenten in der Wirbelsäule sowie zu höheren Torsionsbelastungen vor allem an den Gelenken der Vordergliedmaßen. Welche Technik ein Hund wählt, ist abhängig von der Trainingsmethodik, aber auch vom Verhältnis der Körperlänge des Hundes in Relation zum Abstand der Tore; längere Hunde bevorzugen in der Regel das „Fädeln“.
(Foto: Silke Meermann)
Wippe, Laufsteg und A-Wand sind im Agility als sog. Kontaktzonengeräte konzipiert; sie besitzen am Auf- und Abgang farblich gekennzeichnete Bereiche, die als Kontaktzonen bezeichnet werden und vom Hund mindestens mit einer Pfote berührt werden müssen ( ▶ Abb. 2.4).
Abb. 2.4 Die A-Wand ist eines der sog. Kontaktzonengeräte im Agility. Die Kontaktzone ist farbig markiert; sie muss beim Aufgang und Abgang mit mindestens einer Pfote getroffen werden. Harte Querlatten stellen ein Verletzungsrisiko für Pfotenballen und Zehenknochen dar; ungeeignete Beläge lassen die Wand bei Regen rutschig werden.
(Foto: Silke Meermann)
Durch diese Vorgabe soll insgesamt die körperliche Belastung der Hunde verringert werden, da sie einerseits am Aufgang des Gerätes abbremsen müssen und andererseits auch nicht einfach mit einem großen Sprung auf- und abspringen dürfen. Ein Auslassen der Kontaktzonen wird als Fehler bewertet. Alle Kontaktzonengeräte müssen eine rutschfeste Oberfläche besitzen. Die Kontaktzonen von Steg und Wippe sind jeweils 90 cm hoch, diese beiden Geräte besitzen dabei eine Breite von 30 cm. Die Kontaktzone der A-Wand ist 106 cm hoch und die Wand ist mindestens 90 cm breit. Bei den Tunneln werden zwei Arten unterschieden: Der feste Tunnel mit einem Durchmesser von 60 cm und einer Länge von 3–6 m einerseits und der Sack- oder Stofftunnel andererseits.
2.2.4 Körperliche Anforderungen und bevorzugte Rassen
Im Agility sind prinzipiell alle Hunderassen und Mischlinge zugelassen ( ▶ Abb. 2.5), lediglich auf internationalen Meisterschaften, die von der FCI veranstaltet werden, sind nur Rassehunde mit FCI-Zuchtpapieren zugelassen.
Durch die Einteilung in verschiedene Größenklassen spielt die Körpergröße alleine keine besondere Rolle, allerdings sieht man insgesamt relativ wenige sehr große Hunde. Diese haben oft einerseits Probleme mit den Abmessungen einiger Geräte (z.B. Durchmesser des Tunnels) und sind einfach nicht so schnell und wendig wie die mittelgroßen Hunderassen, die in die Large-Kategorie fallen. Da Agility als schnelle Sprungsportart konzipiert wurde, sind generell Laufhundtypen von der Körperform her im Vorteil (z.B. Small und Medium: Shelties; z.B. Large: Border Collies, Australian Shepherds), chondrodystrophische oder brachyzephale Hunde (z.B. Dackel, Bassets, Möpse, Bulldoggen) sind selten; siehe auch Kapitel ▶ Körperliche Voraussetzungen und Bewegungstypen




























