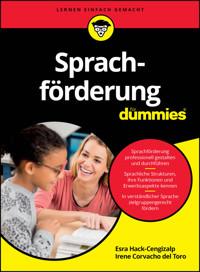
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Sprachkompetenz richtig fördern
Was ist eine Sprache überhaupt? Welche Funktionen hat sie und wie erwerben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sprache? Die Autorinnen Esra Hack-Cengizalp und Irene Corvacho del Toro erklären es Ihnen: Hier erfahren Sie verständlich, wie Sie professionell, wertschätzend und effektiv sprachfördern. Außerdem lernen Sie wirksame sprachdiagnostische Verfahren und ihre Anwendung in der täglichen Praxis sowie die konkrete Planung und Umsetzung sprachfördernder Maßnahmen in Kitas, Grundschulen und der Sekundarstufe kennen.
Sie erfahren
- Was Sprachförderung ist und wie sie funktioniert.
- Was Sprachkompetenz bedeutet und wie sie gefördert werden kann.
- Wie Sie Sprachförderung in der Praxis umsetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sprachförderung für Dummies
Schummelseite
GRUNDLEGENDE AUSSAGEN ÜBER SPRACHE UND SPRACHFÖRDERUNG:
Sprache ist die Grundlage für erfolgreiches Lernen und Lehren.Sie ermöglicht Kommunikation und erfüllt grundlegende Bedürfnisse nach Ausdruck, Wissen und sozialer Bindung.Sprachförderung bietet bedarfsorientierte Unterstützung bei sprachlichen Schwierigkeiten.Eine gute Sprachförderkraft kennt sprachförderliche Prinzipien, geht mit Sprache bewusst um, handelt gezielt und systematisch und sichert die Qualität der Förderung mithilfe bedarfsgerechter Mittel und deren Evaluation.SPRACHFÖRDERUNG IN ABGRENZUNG ZU WEITEREN SPRACHLICHEN UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTEN:
Sprachförderung: Sprachförderung umfasst pädagogische Maßnahmen, die darauf abzielen, die allgemeine Sprachentwicklung oder spezifische sprachliche Fähigkeiten gezielt anzuregen und zu unterstützen.
Sprachtherapie: Sprachtherapie richtet sich zwar auch an einzelne Schülerinnen und Schüler, ist jedoch eine medizinisch fundierte Interventionsmaßnahme, die beispielsweise Störungen der Stimm- und Sprechfunktionen behandelt. Sie wird in der Regel von Logopädinnen und Logopäden auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung durchgeführt.
Spracherziehung: Spracherziehung ist ein grundlegendes Erziehungsprinzip, das sämtliche erzieherischen Aktivitäten im sprachlichen Bereich umfasst und vor allem von Eltern im familiären Umfeld gestaltet wird. Sie kann als praktische Umsetzung sprachförderlichen Handelns betrachtet werden und bildet somit ein Teilziel der Sprachförderung.
Sprachbildung: Sprachbildung ist ein grundlegender Unterrichtsansatz und richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Sie wird als integrativer Ansatz in die Unterrichtsplanung mit einbezogen und erfüllt im Gegensatz zur Sprachförderung vorwiegend eine präventive und curriculare Funktion.
NEUN PRINZIPIEN DER GUTEN SPRACHFÖRDERUNG:
Prinzip 1: Gehe systematisch vor!
Ich berücksichtige in der Sprachförderung alle Prinzipien und setze sie um.
Prinzip 2: Orientiere dich am Kind!
Ich kenne die bildungsbezogenen Bedarfe des Kindes und richte die Sprachförderung daran aus.
Prinzip 3: Sei dir über den aktuellen und den nächsten Schritt klar!
Ich kenne die Ressourcen des Kindes und kann sie bedarfsorientiert ergänzen.
Prinzip 4: Sei und sprich authentisch!
Ich kann authentische Geschichten erfinden und meine Sprachförderziele einbetten.
Prinzip 5: Achte in der Zone der nächsten Entwicklung auf bewältigbare Herausforderungen!
Ich kenne den Lernstand, die nächsten Schritte der Sprachförderung konkret, zerlege die Aufgaben in kleinere Schritte und weiß das Kind herauszufordern, sodass es sich motiviert anstrengt.
Prinzip 6: Hilf dem Kind durch Scaffolding, sich den Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern!
Ich mache dem Kind so viele qualitativ hochwertige Angebote, wie es braucht, und baue das Angebot ( Gerüst) parallel zu seiner Entwicklung allmählich ab.
Prinzip 7: Subjektive Einschätzungen sind gut, aber das Überprüfen ist noch besser! Benutze zur Überprüfung stets objektive Verfahren!
Ich mache mir durch die Ergebnisse einer Diagnostik ein umfängliches Bild zum Sprachstand des Kindes und verifiziere damit meine Einschätzungen zur Sprachentwicklung.
Prinzip 8: Planen heißt Ziele haben!
Ich sorge mit der zielorientierten Planung der Sprachförderung für einen Ausbau der Sprachkompetenzen auf Grundlage der vorhandenen Stärken.
Prinzip 9: Der Förderplan ist in der Sprachförderung der Königsweg.
Ich schaffe mit der systematischen Planung der Sprachförderung gute Ausgangs- und Lernbedingungen.
HANDLUNGSSTRATEGIEN FÜR SPRACHFÖRDERUNG:
Handlungsstrategie
Worum geht es?
Funktion
handlungsbegleitendes Sprechen
geleitetes Fragen
Sie versprachlichen Ihre Handlungen; begleiten Ihre Handlungen also lautsprachlich.
stimulierend
Expansion
Sie wiederholen und ergänzen die Aussage des Kindes und betten sie dabei laufend in den Dialog ein.
modellierend ergänzen
Umformung
Sie wiederholen korrigierend die Aussage des Kindes in einem authentischen Dialog.
modellierend korrigieren
Extension
Sie wiederholen und erweitern die Aussage des Kindes und achten auf eine authentische Kommunikation.
modellierend erweitern
Sprachförderung für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: eric – stock.adobe.comKorrektur: Nicole Woratz
Print ISBN: 978-3-527-72113-9ePub ISBN: 978-3-527-84361-9
Über die Autorinnen
Dr. Esra Hack-Cengizalp lebt und arbeitet als Lehrkraft für besondere Aufgaben im nördlichen Hessen. Sie hat an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Deutsch als Fremdsprachenphilologie und Erziehungswissenschaft studiert. 2019 schloss sie an der Goethe-Universität Frankfurt im Fach Erziehungswissenschaften ihre Promotion zu einem sprachdidaktischen Thema ab. Im Anschluss arbeitete sie dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin bis 2023 und wechselte dann an die Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihre Arbeitsgebiete sind vorwiegend sprachdidaktische Themen des Grundschullehramts (Wortschatzarbeit, Leseförderung, Sprachförderung und Mehrsprachigkeit).
Dr. Irene Corvacho del Toro lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und Siegen. Sie hat an der Universität Hamburg Sprachlehrforschung und Anglistik studiert, in Bamberg und Frankfurt am Main im Rahmen der Grundschuldidaktik geforscht und im Fach Germanistik ihre Promotion erlangt. Ihre Themen in Forschung und Lehre umfassen Rechtschreibung, Rechtschreibförderung, Mehrsprachigkeit, Sprachförderung, Emotionswortschatz, Erzählfähigkeit und Professionalisierung im Bildungsbereich. Sie leitet die Kompetenzstelle Orthografie und ist geschäftsführende Mitherausgeberin der Zeitschrift Lernen und Lernstörungen.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorinnen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Sprachförderung verstehen
Kapitel 1: Warum Sprachförderung?
Sprachförderung für alle
Sprache ist bildungsrelevant
Kapitel 2: Was ist Sprachförderung – und was nicht?
Gestatten: Ires
Eine allgemeine Definition
Additiv oder integrativ?
Verwandte Konzepte
Auf bildungspolitischer Ebene
Auf wissenschaftlicher Ebene
Sprachförderung ist keine Nachhilfe
Sprachförderung ist kein »Unterricht«
Kein geschützter Beruf, aber …
Kapitel 3: Wer kann am besten unterstützen?
Sprachfördern kann (fast) jeder
Merkmale einer guten Förderkraft
Eine Fahrradtour mit Ires
Was können Lehrkräfte tun?
Förderkräfte sind Vorbilder
Teil II: Sprache und Sprachkompetenz verstehen
Kapitel 4: Nicht ohne Sprache!
Wozu Sprache?
Wir schreiben und sprechen
Kapitel 5: Was ist Sprachkompetenz?
Kompetent, kompetenter, am …?
Wie lernen Kleinkinder »neue« Sprachen?
Es gehören immer zwei dazu
Sprichst du noch oder erzählst du schon?
Erzähl! – Und ich unterstütze dich …
Teil III: Wie gehe ich nun vor? Sprachförderung in der Praxis
Kapitel 6: Neun Prinzipien – nicht zehn!
Sprachförderung hat System
Das Kind macht die Musik
Eins nach dem anderen
Sprich authentisch
Ja, schwer – aber du schaffst es!
Scaffolde!
Förderung nicht ohne Diagnose und umgekehrt
Nicht ohne Förderziele
Der Förderplan
Kapitel 7: Gehe strategisch vor
Sprich, während du handelst
Rege an mit deinen Fragen
Du bist ein Modell
Korrigiere unauffällig
Erweitere das, was das Kind gesagt hat
Was kann man noch tun?
Kapitel 8: Lege den Bereich fest
Grammatik
Wortschatz
Teil IV: Wirksamkeit von Sprachförderung überprüfen
Kapitel 9: Alles bestens, oder?
Kapitel 10: Wie Experten evaluieren
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 11: Zehn Tipps, die die Arbeit einer Sprachförderkraft erleichtern
Kapitel 12: Die Prinzipien in der Übersicht
Lösungen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Typische Fälle für Sprachförderung
Tabelle 1.2: Merkmale der Bildungssprache (im Kontext Schule)
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Sprachförderliche Unterrichtsmuster
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Merkmale von gesprochener und geschriebener Sprache
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Sprachförderarbeit mit Titus
Tabelle 6.2: Beispiele für systematische Beobachtungen in der Sprachförderung
Tabelle 6.3: Beispiel für ein Diagnosegespräch zur sprachlichen Anamnese
Tabelle 6.4: Entwicklung passender Förderziele
Tabelle 6.5: Ein beispielhafter Förderplan
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Funktionen der Sprachfördertechniken
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Beispiel für Grammatikförderung
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Sprachförderung und Schule
Abbildung 1.2: Sprachförderung und KMK
Abbildung 1.3: Frustrierte vs. friedliche Lerner
Abbildung 1.4: Zusammenhang zwischen Sprache und Fach
Abbildung 1.5: Sprachen der Schule
Abbildung 1.6: Beispiel Fachsprache (Beispielsätze aus Helfert/von Hesberg 2023, ...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Ires, die leidenschaftliche Sprachförderin
Abbildung 2.2: Sprachförderung kompensiert Sprachschwierigkeiten
Abbildung 2.3: Verwandte Konzepte zur Sprachförderung
Abbildung 2.4: Nicht geschützte Berufsbezeichnungen
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Sprachfördern kann jeder, der …
Abbildung 3.2: Merkmale einer guten Förderkraft
Abbildung 3.3: Grammatisches und orthographisches Wissen
Abbildung 3.4: Erfahrung – Wissen – Handeln
Abbildung 3.5: Was-Wie-Warum
Abbildung 3.6: Eine Fahrradtour mit Ires
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Organonmodell nach Bühler
Abbildung 4.2: Symbole
Abbildung 4.3: Ein internationales Symbol in verschiedenen Sprachen
Abbildung 4.4: Dimensionen der gesprochenen und geschriebenen Sprache
Abbildung 4.5: Das Vier-Ohren-Modell
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Kind sagt Hallo
Abbildung 5.2: Sprache, die sich an Babys und Kinder richtet
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Sprachförderung als System
Abbildung 6.2: Entwicklungszonen
Abbildung 6.3: Beispiele für Kasus
Abbildung 6.4: Sprachförderung fordert heraus
Abbildung 6.5: Zimmerbeschreibung mit Dativ
Abbildung 6.6: Förderung nicht ohne Diagnose
Abbildung 6.7: Von der Diagnose zur Förderung
Abbildung 6.8: Beobachtungsformen
Abbildung 6.9: Beispiele für systematische Analysen zu Förderzwecken (Kasus und G...
Abbildung 6.10: Äußere Bedingungen des Spracherwerbs erkunden
Abbildung 6.11: Spiralförmige Entwicklung der Sprachförderarbeit
Abbildung 6.12: Förderplan
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Beispiele für Redeverben und wörtliche Rede
Abbildung 8.2: Ires ist wieder da!
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorinnen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Lösungen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
7
8
9
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
187
188
Einführung
Bevor wir Sie mit unserem fundierten Einblick in das aus schulischer Sicht sehr aktuelle Thema »Sprachförderung« begeistern, möchten wir Ihnen einen groben Überblick über die zentralen Themen und Ziele des Buches geben. Das zentralste Thema des Buches ist die Sprache. Sprache ist ein äußerst komplexes System. Bevor man über Sprache(n) spricht, muss man deshalb Begriffliches einschränken, was man genau meint. Mit »Sprache« meinen wir in diesem Buch zunächst die in der Schule gelernte, verwendete und verlangte Sprache. Auch sie ist komplex. Gehen wir das doch an …
Über dieses Buch
Sprache als Schlüssel zur Welt, zu Mitmenschen und zum Wissen? Ja! Sprache schafft Zugang zur Welt. Da die sich ständig verändert, verändert sich auch unsere Sprache und wir uns mit ihr. Wir lernen, die Welt in Worte zu fassen und tauschen uns mit Mitmenschen über sie aus, eignen uns neues Wissen an und geben es weiter. Durch Sprache!
Sobald unser Herz schlägt, entwickeln wir uns in rasantem Tempo. Und dieses Tempo hat kein Limit. Wir lernen, denken, sprechen, fühlen und vieles mehr. Später lernen wir neue Dinge, denken anders, sprechen immer besser und können all das immer besser kommunizieren. Wir nutzen die Sprache, um unsere Gedanken, Empfindungen und unser Wissen an andere mitzuteilen. Mit Sprache sind wir unseres eigenen Lebens mächtig.
Doch was passiert, wenn uns dieser Schlüssel zur Welt fehlt, uns nur ansatzweise zur Verfügung steht oder uns nur schwer zugänglich ist? Für viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene bedeutet eine eingeschränkte Sprachkompetenz nicht nur eine Hürde im schulischen und beruflichen Kontext, sondern auch im sozialen Miteinander. In einer Welt, die zunehmend von Kommunikation und Informationsaustausch geprägt ist, wird Sprachkompetenz zum entscheidenden Faktor für persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe.
Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise in die faszinierende und vielschichtige Welt der Sprachförderung. Wir verbinden dabei wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Praxisbeispielen, um zu zeigen, wie Sprachförderung wirksam und nachhaltig gestaltet werden kann. Dabei stehen nicht nur klassische Sprachförderansätze im Mittelpunkt, sondern auch innovative Methoden, die den Wandel unserer Gesellschaft und ihrer Kommunikationsbedürfnisse berücksichtigen.
Konventionen in diesem Buch
Uns ist es bewusst, dass die deutsche Sprache angemessene Bezeichnungen enthält, die Diversität der Menschen in vielen Aspekten sprachlich zu widerspiegeln, also zu gendern. Gleichzeitig möchten wie dem Leser ermöglichen, das Buch fließend zu lesen. Es erscheint uns als ein Kompromiss, wo immer möglich, parallel zu gendersensiblen Bezeichnungen (Schülerinnen und Schüler, Leserinnen und Leser) auch allgemeine Bezeichnungen (Lehrkräfte, Fachpersonal, Kinder etc.) und Bezeichnungen mit generischem Maskulinum (Schüler, Lerner etc.) zu verwenden.
Wir gebrauchen in diesem Buch die Bezeichnung »Sprachförderkraft« (auch kurz: Förderkraft) und meinen damit alle Menschen, die sich als solche – neben vielen anderen Attributen – identifizieren. Es gibt also nicht DIE Förderkraft, sondern DEN Menschen, der sich zu einer Förderkraft weiterbilden möchte. Wir helfen Ihnen mit diesem Buch.
Wir verwenden sehr oft den Begriff »Kind« und meinen damit alle Personen, die sich in jungen Jahren befinden. Inbegriffen sind alle Kinder und Jugendlichen, die kürzlich über das kindliche Dasein hinausgewachsen sind.
Wir versuchen in diesem Buch, unsere Gedanken in einer allgemein verständlichen Sprache mitzuteilen. Wir gebrauchen abwechselnd eine fachspezifische und eine allgemeine Ausdrucksweise und versuchen so, einen fachlich fundierten und zugleich lebendigen Lesefluss aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns gerne über Ihr Feedback, ob uns dies gelungen ist!
Törichte Annahmen über den Leser
Dieses Buch richtet sich an alle, die Sprache nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern als Lebensessenz begreifen und sich für das sprachliche Wachstum junger Menschen interessieren und dieses mit Freude beobachten und begleiten.
Sprachförderung ist nicht nur ein individuelles Anliegen, sondern insbesondere ein gesellschaftliches. Wir sprechen mit diesem Buch gezielt Menschen an, die junge Menschen eine Zeit lang in ihrer schulischen Entwicklung systematisch begleiten und ihnen einen Weg ebnen, der sie in ihrer schulischen Bildungsreise vor allem auf sprachlich-kommunikativer Ebene gut unterstützt.
Konkret sind das fachliches und pädagogisches Personal an Schulen (insbesondere an Grund- und unteren Stufen der weiterführenden Schulen) wie Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, schulische Assistenten, Lerncoaches etc., die sich im Bereich der Sprachförderung weiterqualifizieren möchten.
Es ist jedoch unmöglich, sich einzig und allein mit einem Buch (selbst wenn dieses das unsere ist) alle nötigen Grundlagen für eine professionelle Sprachförderung zu verschaffen. Dieses Buch ergänzt die Fachliteratur in vielen Teilen, greift wichtige wirksame und in der Praxis gut etablierte Maßnahmen auf und reflektiert sie. Es setzt aber auch neue Impulse und Perspektiven für eine kindorientierte, wertschätzende und fachlich versierte Sprachförderung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit ganz vielen neuen Erkenntnissen!
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Die erste Station unserer Reise führt Sie in die theoretischen Grundlagen: Was ist Sprachförderung und warum ist diese so wichtig? Da die Sprachförderung sich mit Sprache und den sprachlichen Fähigkeiten der Menschen befasst, folgt ein weiterer theoretischer Blick: Was ist Sprache und welche Faktoren beeinflussen die Sprachkompetenz? Dabei werden wir punktuell auf wissenschaftliche Modelle schauen, die uns helfen können, die Sprachkompetenzen differenziert zu betrachten und zu verstehen. Anschließend wird es ein wenig praktischer: Wie können Förderkräfte Sprache gezielt fördern? Welche Strategien haben sich in der Praxis bewährt? Und wie können wir Barrieren überwinden, die einer erfolgreichen Sprachentwicklung im Wege stehen? Abschließend widmen wir uns mit einem Reflexionsteil der Frage, wie durchgeführte Sprachfördermaßnahmen evaluiert werden können.
Teil I: Sprachförderung verstehen
Im ersten Teil führen wir in die Bedeutung der Sprachförderung in bildungsbezogenen Kontexten ein. Im Mittelpunkt stehen hierbei nicht nur die Vermittlung von Alltagskommunikation, sondern auch die Förderung bildungssprachlicher und fachspezifischer Kompetenzen, die für den schulischen und beruflichen Erfolg essenziell sind.
Sprachförderung ist insbesondere ausgerichtet auf die Begleitung von sprachlichen Entwicklungsfortschritten und geht diese mit geeigneten pädagogischen Maßnahmen gezielt und systematisch an. Erzielt wird hauptsächlich eine nachhaltige Verbesserung sprachlicher Fähigkeiten und sorgt somit für bessere Bildungschancen. Im Bildungswesen existieren allerdings noch weitere Unterstützungsangebote. Diese grenzen wir aber fortlaufend vom Verantwortungsbereich der Sprachförderung ab. Sie erfahren dabei nach und nach, welche Praktiken in den Bereich der Sprachförderung fallen und welche eher nicht, sowie, woran Sie denken sollten, wenn Sie sprachförderlich handeln möchten.
Teil II: Sprache und Sprachkompetenz verstehen
Im zweiten Teil befassen wir uns mit den Verantwortungsbereichen der Sprachförderung noch genauer: der Sprache und den Sprachkompetenzen. Sprache verstehen wir dann als das zentrale Medium (und auch Ziel) des Lernens, die Grundlage der menschlichen Interaktion und die Basis der sozialen Bindung. In pädagogischen Kontexten nimmt sie eine Schlüsselrolle ein, da sie nicht nur als Werkzeug des Denkens und Lernens fungiert, sondern auch als Mittel, um individuelle und kulturelle Identitäten auszudrücken und zu gestalten.
Eines der zentralen Ziele der Sprachförderung ist, vorhandene Sprachressourcen auszubauen, sodass Lernende befähigt werden, Entwicklungsverzögerungen mithilfe geeigneter Maßnahmen selbst kompensieren und schließen zu können. Im Anschluss an den Aufriss über Sprache, betrachten wir Sprachressourcen und -kompetenzen aus einem funktionalen und kommunikativen Blickwinkel und konzentrieren uns auf die mündlichen Sprachkompetenzen. Diese sind grundlegend für eine sichere und nachhaltige sprachliche Bildung.
Teil III: Wie gehe ich nun vor? – Sprachförderung in der Praxis
In den ersten beiden Teilen soll ein fundiertes Grundlagenwissen geschaffen werden. In dem dritten Teil steigen wir dann in praktische Handlungsweisen ein und zeigen, wie Sprachförderung, basierend auf einer systematischen und planvollen Vorgehensweise, vollzogen werden kann. Wir machen deutlich, wie Sie individuelle sprachliche Bedarfe identifizieren und gezielt darauf eingehen können.
An ausgewählten Beispielen zeigen wir, wie Sie sprachförderlich und praxisorientiert handeln, wie Sie einen bedarfsorientierten Förderplan erstellen, welche Schwerpunkte Sie setzen können und wie Sie Ihr Konzept umsetzen. Dabei konzentrieren wir uns auch darauf, dass Sie die Maßnahmen an die Lernfortschritte der Kinder kontinuierlich anpassen und dass dies entscheidend für den Erfolg der Förderarbeit ist.
Teil IV: Wirksamkeit von Sprachförderung überprüfen
Im vierten Teil geht es darum, dass die Reflexion und Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen essenziell sind, um langfristig erfolgreiche Ergebnisse zu sichern und die Sprachförderung als effektives Bildungsinstrument zu etablieren. Dabei wird die Bedeutung einer kontinuierlichen Anpassung an die Bedürfnisse der Praxis und der Kinder hervorgehoben.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, worauf Sie achten müssen, um Ihr Förderkonzept wirksam und nachhaltig zu gestalten und durchzuführen. Doch was Sie noch nicht wissen, ist, wie Sie sichergehen können, dass Ihre Sprachförderung auch tatsächlich gewirkt hat. Dieser Teil beleuchtet die Planung, Durchführung und Evaluation von Sprachförderung, um ihre Effektivität und Nachhaltigkeit sicherzustellen.
Sie erfahren, dass die Überprüfung der Wirksamkeit der Qualitätssicherung dient und daher viele Vorteile mit sich bringt. Im Einzelnen dient sie der Optimierung und Nachweisbarkeit erzielter Fortschritte und stellt sicher, dass erworbene Fähigkeiten auf neue Situationen nachhaltig übertragen werden. Zudem müssen wissenschaftsbasierte Förderprogramme durch eine klare theoretische Fundierung, genaue Durchführungsvorgaben und empirische Wirksamkeitsnachweise überzeugen können.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Im letzten Teil fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zum einen in zehn zentralen Fragen zur Sprachförderung zusammen. Diese sind an den Kapitelaufbau angelehnt und heben die wichtigsten Prinzipien hervor, die wir empfehlen, in der Praxis zu beachten beziehungsweise umzusetzen. Zum anderen tragen wir die zehn Fakten zusammen, was eine gute Sprachförderung spannend macht. Mit nützlichen Handlungsempfehlungen zur praktischen Förderarbeit schließen wir dann unser Buch ab.
Tauchen Sie mit uns in die Welt der Sprachförderung ein! Wir entdecken gemeinsam, wie Sprache nicht nur Türen öffnet, sondern ganze Welten erschaffen kann, und was Sie dafür tun können.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wir nutzen im Buch folgende Symbole:
Das Erinnerungs-Symbol steht für die Hervorhebung der wichtigsten Erkenntnisse und fasst die wesentlichen Inhalte eines Kapitels zusammen.
Wir geben Tipps immer dann, wenn wir es für sinnvoll halten. Dabei geht es vorwiegend um Handlungstipps, die Sie in der Förderpraxis gut gebrauchen könnten.
Gelegentlich konkretisieren wir unsere Aussagen mit passenden Beispielen. Es geht dabei vorwiegend um Beispiele aus der deutschen Sprache.
Das Schloss-Symbol ist dazu da, um wissenschaftliche beziehungsweise theoretische Erkenntnisse kenntlich zu machen.
Das Aufgaben-Symbol verwenden wir, wenn wir einen speziellen Auftrag für Sie haben. Die Lösungen finden Sie am Ende des Buches.
Immer dann, wenn Ires, unsere Sprachförderkraft, spricht, verwenden wir das Ask-Woody-Symbol.
Das Definition-Symbol steht immer dann, wenn ein Begriff explizit erläutert werden muss.
Wie es weitergeht
Sie sind nun mit dem Aufbau und dem Umfang des Buches vertraut. Wir empfehlen Ihnen, die Teile nacheinander zu lesen. Sie können selbstverständlich auch querlesen. Um dies zu erleichtern, haben wir an vielen Stellen Querverweise eingebaut. An diesen Stellen empfehlen wir, kurz auf die verwiesenen Stellen zu wechseln, um nachzuvollziehen, was dort nicht vertieft werden konnte.
Auch wenn wir uns bemüht haben, lesefreundliche Maßnahmen (Querverweise, eine allgemein verständliche Sprache und Nachvollziehbarkeit) umzusetzen, sind wir für Anregungen und Verbesserungsvorschlägen offen. Kontaktieren Sie uns oder den Verlag gerne. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
So, jetzt aber: Viel Spaß beim Lesen!
Teil I
Sprachförderung verstehen
IN DIESEM TEIL …
Sprache ist ein zentraler Bestandteil schulischer Bildung und die Grundlage für erfolgreiches Lernen und Lehren.Für die vielfältigen Anforderungen im Unterricht benötigen Schülerinnen und Schüler neben Alltagssprache auch Fach- und Bildungssprache.Sprachförderung setzt gezielt bei Schwierigkeiten im Umgang mit verschiedenen Sprachformen an.Gute Förderkräfte verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung.Kapitel 1
Warum Sprachförderung?
IN DIESEM KAPITEL
Sprachförderung und schulische Anforderungen sind untrennbar miteinander verbundenSprachliche Schwierigkeiten und Sprachförderung können jeden Schüler betreffenAlle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf FörderungSprache ist Lernziel und Hauptwerkzeug, um in der Schule zu lernenSprache ist überlebenswichtig
Überlebenswichtig ist die Sprache insofern, dass die Menschen in sozialer Hinsicht auf sie angewiesen sind. Mit Sprache werden Beziehungen aufgebaut, Missverständnissen wird vorgebeugt, Probleme werden gelöst, höhere Denkprozesse angestoßen, Lernen wird ermöglicht und vieles mehr. Sie spielt in sozialen Kontexten eine überlebenswichtige Rolle.
Sprache als Mittel der Kommunikation und Verständigung
Sprache dient der Verständigung zwischen Menschen. Sie ist grundlegend für unsere Kommunikation miteinander. Das ist Fakt. Menschen sprechen miteinander, um sich zu verständigen (na ja, fast immer). Mit Verständigung meinen wir, den anderen klarzumachen, was unsere Absichten sind, was unsere Message ist. Sprache verbindet. Und Sprache(n) machen die Verbundenheit der Menschen sicht- und hörbar. Dabei identifizieren wir uns mit einer oder mehreren Sprache(n) und prägen somit ein gewisses Kulturgut mit. Das können wir dann Niederländisch, Urdu, Tagalog oder aber gemixt Türkischdeutsch, Hindideutsch oder Spanglish nennen.
Wir konservieren unsere Sprachen jedoch nicht nur, sondern verändern sie und nutzen sie als Ausdruck von Gedanken und Empfindungen. Menschen lernen sehr früh, dass sie ihre Empfindungen, und später ihre Gedanken, außer mit körperlichen (Mimik, Gestik, Stimme) vor allem mit sprachlichen Mitteln (sprechen, auffordern, schimpfen, rufen etc.) ausdrücken können. Viele dieser Mittel erwerben wir im Laufe unseres Lebens weitgehend beiläufig, das heißt, ohne dass wir uns dafür groß anstrengen müssen. Wir profitieren aber selbstverständlich auch von einer anregungsreich gestalteten sprachlichen Lernumgebung (Geschichten lesen und schreiben, Hörtexte, Chats, Gespräche und so weiter).
Warum lernen Menschen Sprachen?
Zunächst äußern wir unsere Grundbedürfnisse so, dass wir die Aufmerksamkeit der Menschen um uns herum auf uns ziehen können. Babys und Kleinkinder schreien, quengeln, brummen und tun so einiges mehr. Später lernen wir, unseren Grundbedürfnissen Worte zu verleihen und uns auch mithilfe der sprachlichen Mittel mitzuteilen (zum Beispiel ›nane‹ für Banane, ›sik‹ für Musik). Spätestens beim Eintritt in den sogenannten Ernst des Lebens (Schule) werden unsere Denkprozesse komplexer. Wir lernen eine Sprache kennen, die es uns ermöglicht, Aufgaben zu lösen, einen Vortrag zu halten, Experimente zu beschreiben, einen Text szenisch zu gestalten, uns mit dem Klassenlehrer, der Schulleiterin oder dem Schulsozialarbeiter zu unterhalten, einen Schulausflug zu planen und so weiter. Unsere Sprachkompetenzen boomen während der Schulzeit. Wir lernen, die Sprache gezielt zu nutzen, und eine gute Sprachfähigkeit beschleunigt das Lernen neuer Inhalte und Verhaltensweisen. Fehlende Sprachkompetenzen können das Lernen folgerichtig erschweren.
Sprache ist auch ein Machtinstrument. Nicht nur in der Politik. Wir nehmen durch hervorragende Sprachkompetenzen Einfluss auf unsere Mitmenschen. Gute Redner ziehen Menschen an, selbst wenn sie manchmal Mist erzählen. Und gesprächigere, erzählfreudige Schüler werden häufig wegen ihrer lebhaften, aktiven Art als kompetent wahrgenommen.
Es kann sehr beklemmend sein, wenn man seine Gedanken und Gefühle nicht treffend benennen oder aussprechen kann. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ihre Gedanken und Empfindungen auf den Punkt so präzise ausdrücken können, dass wir sie schnell verstehen. Werden wir schnell und richtig verstanden, genießen wir Vorteile. Wortgewandte Menschen begeistern mit ihrer Ausdrucksweise oft andere. Ist das nicht herrlich?
Professionelle Bildungsakteure wissen um die Vorteile einer ausgeprägten Ausdrucksfähigkeit und möchten diese Fähigkeit ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln. Wer sich sprachlich gut ausdrücken kann, wird nicht nur in der Schule davon profitieren, sondern sein Leben lang.
Sprachförderung für alle
Sprachförderung bezieht sich auf die sprachlichen Fähigkeiten eines Menschen. Diese sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt.
Sprachförderung konzentriert sich auf Sprachkompetenzen
Warum brauchen wir Sprachförderung? Es geht im Wesentlichen darum, dass jeder und jede eine gewisse sprachliche Kompetenz erreichen sollte. Dabei unterscheiden wir zwischen rezeptiver (Sprache verstehen/mündliche und schriftliche Texte verstehen) und produktiver Sprachkompetenz (Sprache ausdrücken/mündliche und schriftliche Texte produzieren). Sprachförderung soll dem Kind helfen, gute Sprachkompetenzen aufzubauen.
Gute Sprachkompetenzen sind als Bildungsziel unter anderem in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) festgelegt. Sie ermöglichen Schülerinnen und Schülern, die lebensweltlichen, schulischen und beruflichen Anforderungen zu meistern. Jedem Menschen sollte es möglich sein, die beste Bildung zu genießen – so wird er oder sie später das Leben in der Gesellschaft mit besten Mitteln meistern, Herausforderungen zum eigenen Wohl und zum Wohle der Gesellschaft angehen können, seinen Platz finden und einnehmen können.
Um die Frage, was Sprachkompetenzen in theoretischer und didaktischer Hinsicht sind, zu beantworten, müssen wir uns zweier Quellen bedienen, die sich gegenseitig ergänzen: die wissenschaftliche und die bildungspolitische Perspektive. Die wissenschaftliche Perspektive vermittelt uns, was Sprachkompetenzen sind und wie sie erlernt werden können. Die bildungspolitische Perspektive zeigt uns, wie die Schule und der Unterricht organisiert werden können, um unter anderem die Sprachkompetenzen unter optimalen Bedingungen zu fördern und weiterzuentwickeln. Die Bildungspolitik bezieht bei ihren Entscheidungen wissenschaftliche Erkenntnisse mit ein.
2008 entstand aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt PROSA ein wissenschaftlich begründeter Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung. Darin werden die Sprachkompetenzen unter Berücksichtigung von ein- und mehrsprachigen Aneignungsprozessen in mehreren Basisqualifikationen differenziert. In späteren Publikationen erweiterte das Autorenteam das Modell um andere Teilqualifikationen.
Phonische Basisqualifikation
Pragmatische Basisqualifikation
Semantische Basisqualifikation
Morphologisch-syntaktische Basisqualifikation
Diskursive Basisqualifikation
Literale Basisqualifikation
Diese Basisqualifikationen beschreiben Sprachkompetenzen konkret. Sie sind Teil des Modells zur Aneignung von Sprache in schulischen Lernkontexten. Im Vordergrund steht dabei die Annahme, dass Sprache ein Mittel zur sprachlichen Interaktion (Kommunikation), ein Mittel zur Wissensaneignung und -veränderung (Wissen) und ein Mittel zum Ausdruck und zur Erfahrung von Zugehörigkeit (Kultur) ist. Das Autorenteam betont außerdem, dass das Modell den Sprachaneignungsprozess keineswegs vollumfänglich abbilden kann und mit neuen Erkenntnissen immer auch erweitert werden muss.
Den Basisqualifikationen werden wir später noch einmal begegnen und deren Bezug zur Sprachförderung erläutern. Mehr dazu in Kapitel 8.
Interessierten Leserinnen und Lesern empfehlen wir folgende Quellen:
Ehlich, Konrad; Bredel, Ursula; Reich, Hans H. (2008): Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung. Berlin: BMBF (Bildungsforschung, Bd. 29.1). bildungsforschung_band_neunundzwanzig.pdf (tu-dortmund.de)
Ehlich, Konrad (2013): Sprachliche Basisqualifikationen, ihre Aneignung und die Schule. In: DDS – Die Deutsche Schule 105. Jahrgang 2013, Heft 2, S. 199–209.
Sprachförderung und Sprachkompetenzen sind eng miteinander verbunden. Die Sprachförderung geht vom Stand der Sprachkompetenzen aus und strebt das gewünschte Niveau an. Dabei bedarf sie sowohl des Engagements der Förderkraft als auch des Kindes. Sobald wir von Sprachförderung durch eine professionelle Förderkraft sprechen, gehen wir von einer systematischen Sprachförderung aus. Sie wird in der Regel an Kindertagesstätten, lerntherapeutischen Praxen oder an Schulen praktiziert.
Sprachförderung liegt in der Verantwortung von Schule
In den Schulen steigt aktuell der Bedarf an Sprachförderung stetig. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Eine Sprachförderung ist aber unabhängig von den jeweiligen Gründen immer das Mittel der Wahl, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Kinder Bildungsziele aufgrund von Sprachschwierigkeiten verfehlen könnten (siehe Abbildung 1.1).
Deshalb stellt die KMK die individuelle Förderung im schriftsprachlichen Bereich ins Zentrum der schulischen Unterstützungsmaßnahmen. Sprachförderung ist kein Selbstzweck. Sie verfolgt funktionale Ziele und soll unter anderem für den Aufbau von Sprachkompetenzen sorgen, die wiederum grundlegend für das Lernen in allen Fächern sind (siehe Abschnitt Sprache ist bildungsrelevant).
Abbildung 1.1: Sprachförderung und Schule
Die KMK ordnet die Sprachförderung als einen wichtigen Teilbereich der individuellen Förderung zu. Der Fokus liegt insbesondere auf der Ebene der Bildungssprache und den Kompetenzbereichen der allgemeinen Schulbildung. Basiskompetenzen





























