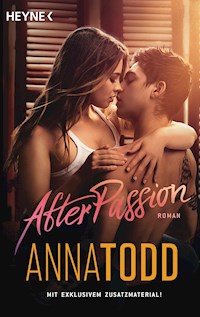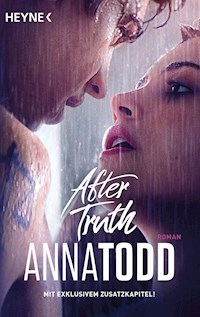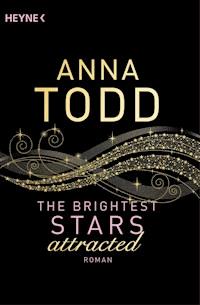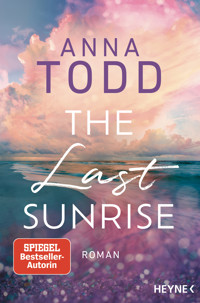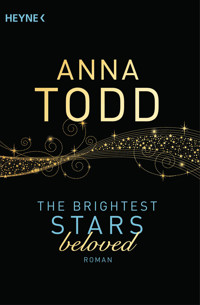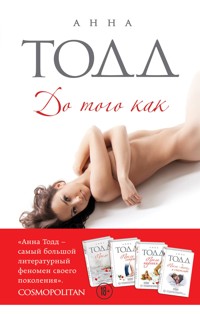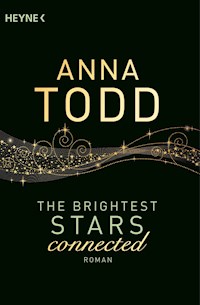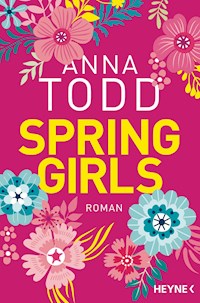
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Schwestern auf der Suche nach ihrem Weg ins Leben
Die Spring-Mädchen Meg, Jo, Beth und Amy leben zusammen mit ihrer Mutter in New Orleans. Ihr Vater ist im Irak stationiert, und jede der Schwestern durchlebt neben der beständigen Sorge um ihn die schwierigen Momente des Erwachsenwerdens. Meg will möglichst bald heiraten und Mutter werden, Jo will als Journalistin die Welt verändern, Beth hilft lieber im Haushalt, und die zwölfjährige Amy schminkt sich zum ersten Mal und ist mit ihrem Smartphone online unterwegs. Und obwohl jede der Schwestern ganz genau weiß, was sie will, kommt es dann doch ganz anders als ursprünglich gedacht …
Anna Todd erzählt Louisa May Alcotts Klassiker BETTY UND IHRE SCHWESTERN/LITTLE WOMEN neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Die Spring-Mädchen – Meg, Jo, Beth und Amy – leben zusammen mit ihrer Mutter in New Orleans. Ihr Vater ist für einen langen Auslandseinsatz im Irak und jede der Schwestern durchlebt neben der beständigen Sorge um ihn die schwierigen Momente des Teenager-Daseins und Erwachsenwerdens. Meg will möglichst bald heiraten und Mutter werden, Jo will als Journalistin die Welt verändern, Beth hilft lieber im Haushalt und die zwölfjährige Amy schminkt sich zum ersten Mal die Lippen und ist mit ihrem Smartphone in den Weiten des Internets unterwegs. Und obwohl jede der Schwestern ganz genau weiß, was sie will, kommt es am Ende doch ganz anders, als ursprünglich gedacht …
In SPRINGGIRLS erzählt Anna Todd Louisa May Alcott’s Klassiker BETTYUNDIHRESCHWESTERN neu.
»Ein wunderbarer Roman über Schwestern und ihre Beziehungen zueinander, die erste Liebe und das Abenteuer des Erwachsenwerdens.« Publisher’s Weekly
Die Autorin
Anna Todd ist die »New York Times«-Bestsellerautorin der »After«-Serie. Sie war schon immer eine begeisterte Leserin und schrieb die Geschichte um Tessa und Hardin auf ihrem Smartphone auf Wattpad. Innerhalb kürzester Zeit wurde sie zur meistgelesenen Serie der Plattform. Die gedruckte Ausgabe wurde 2014 veröffentlicht, ist seitdem in über 30 Sprachen erschienen, verkaufte sich über 8 Millionen Mal weltweit und war in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Anna Todd lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in Los Angeles. Mehr über die Autorin auf AnnaTodd.com, bei Twitter unter @imaginator1d, auf Instagram unter @imaginator1d und auf Wattpad unter Imaginator1D.
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Lucia Sommer
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe LITTLE WOMAN erschien bei Gallery Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 02/2020
Copyright © 2019 by Anna Todd, vertreten durch Wattpad
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Rabea Güttler
Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: © FinePic, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-19756-8V002
www.heyne.de
Für alle meine Schwestern da draußen,
die ihren Weg als Frau finden wollen.
Ich bin für euch da,
genau wie eure vielen anderen Schwestern.
1
Meredith
»Weihnachten ohne Geschenke ist kein Weihnachten«, sagte Jo von ihrem Platz auf dem Teppich aus.
Sie saß im Schneidersitz zu Füßen ihrer großen Schwester Meg. Ihre langen braunen Haare waren ungekämmt wie immer. Jo war meine Starke. Von meinen vier Mädchen brauchte sie als Einzige keine Ewigkeit im Badezimmer. Mit ihren grazilen Fingern, an denen der schwarze Nagellack abblätterte, zupfte sie an den ausgefransten Rändern des afghanischen Teppichs. Sein handgewebter schwarz-roter Stoff war einmal leuchtend und schön gewesen, als mein Mann ihn uns von seinem Posten in Kandahar zu unserem damaligen Zuhause in Texas geschickt hatte.
In meinem Kopf ermahnte mich Denise Hunchberg, die Leiterin unserer Familien-Rückhalts-Gruppe, mit ihrer kratzigen Stimme, korrekte Militärsprache zu verwenden: von der FOB – Forward Operating Base – meines Mannes in Kandahar. Des größten vorgeschobenen Feldpostens in Afghanistan, wie sie natürlich noch hinzufügen würde. Denise musste mich ständig kritisieren. Natürlich konnte sie sich damals auch ihre Bemerkung zum Teppich nicht verkneifen. Sie meinte, Frank hätte ihn genauso gut kostenlos zur Basis schicken können.
Meinen Mädchen war das egal. Von dem Moment an, als das riesige Paket von ihrem Dad ankam, der zu dem Zeitpunkt schon seit acht Monaten in Afghanistan stationiert gewesen war, liebten sie den Teppich genauso sehr wie ich. Sie freuten sich, einen so wunderschönen kulturellen Schatz vom anderen Ende der Welt zu besitzen, vor allem Jo. Meg war begeistert, dass wir in unserem einfachen Haus jetzt einen so luxuriösen Gegenstand hatten. Sie war meine materialistischste Tochter, aber ich hatte schon immer gewusst, wenn ich sie nur richtig erzöge, könnte sie ihre Liebe zu allem, was glänzte, dazu nutzen, etwas Schönes und Sinnvolles aus ihrem Leben zu machen. Amy war damals noch zu jung, um dem Teppich irgendeine Bedeutung beizumessen, und natürlich wusste Beth als Einzige, dass der Teppich auf dem Weg war, weil ihr Vater wusste, dass sie ein Geheimnis für sich behalten konnte. Außerdem konnte sie nach dem Postboten Ausschau halten, da sie Hausunterricht bekam. Später erklärte Frank mir, er habe den Teppich direkt zu uns nach Hause geschickt, weil er eine Überraschung sein sollte und nicht etwas, das von der Basis abgeholt werden musste. Ich bezweifelte, dass Denise das verstanden hätte, selbst wenn ich es ihr erklärt hätte.
Inzwischen war unser schöner Teppich gar nicht mehr so schön. Schmutzige Schuhe und schwere Körper hatten ihn so abgenutzt, dass die leuchtenden Farben zu einem schlammigen Braun abgestumpft waren, und auch wenn ich mein Bestes gab, ihn zu reinigen, kamen die Farben einfach nicht wieder.
Wir liebten den Teppich trotzdem kein bisschen weniger.
»Es wurde Schnee angekündigt. Für mich fühlt sich das wie Weihnachten an«, sagte Meg und fuhr sich mit den Fingern durch die braunen Haare. Inzwischen reichten sie ihr bis zu den Schultern, und Jo blondierte sie ihr immer, sodass sie einen dunklen Ansatz mit blonden Spitzen im Ombre-Look hatte. Es war diesen Winter tatsächlich so kalt in New Orleans, dass die Straßen teilweise vereisten und die Hauptverkehrsstraße gefühlt jeden Tag durch einen Unfall blockiert war. Das Schild draußen vor unserem Armee-Posten, das die Tage ohne Verkehrstote zählte, wurde fast täglich wieder auf null gestellt, statt wie sonst ungefähr wöchentlich. Die höchste Anzahl von Tagen, die das Schild in Fort Hood in Texas jemals angezeigt hatte, war zweiundsechzig.
An diesem Vormittag fühlte sich die Temperatur gar nicht so kalt an wie auf Channel 45 angekündigt. Ob meine Schwester es wohl zu uns schaffen würde, oder würde sie das Wetter als Ausrede vorschieben? Sie hatte immer alle möglichen Entschuldigungen parat. Ihr Mann war zusammen mit meinem im Irak stationiert, und inzwischen wussten alle über ihre Eheprobleme Bescheid, nachdem er sich vor einer Gruppe Soldaten über ihr Gewicht lustig gemacht und dann auch noch vor einem Monat mit einer Sanitäterin geschlafen hatte.
»Hat Tante Hannah schon angerufen?«, fragte ich meine Mädchen.
Die Einzige, die mich ansah, war Beth. »Nein«, antwortete sie.
Seit Hannahs Umzug nach Fort Cyprus vergangenen Sommer hatte sie sich schon zweimal verlobt und einmal geheiratet, und bald würde sie sich wieder scheiden lassen. Ich liebte meine kleine Schwester, aber ich war nicht unbedingt traurig gewesen, als sie vor ein paar Monaten näher an New Orleans herangezogen war. Sie hatte sich einen Wochenendjob als Barkeeperin auf der Bourbon Street besorgt, in einer kleinen Bar namens Spirit, wo es Cocktails in leuchtenden Schädeln und ein ziemlich gutes Po’boy-Sandwich gab. Hannah hatte genau die richtige Persönlichkeit für eine Barkeeperin.
»Kommt sie denn?«, fragte Jo vom Fußboden aus.
Ich sah Jo in die hellbraunen Augen. »Vielleicht. Ich ruf sie bald an.«
Amy gab ein leises Hmpf von sich, und ich blickte auf den schwarzen Bildschirm des Fernsehers.
Ich wollte mit meinen Töchtern nicht über die Probleme von Erwachsenen reden. Sie sollten möglichst lange jung bleiben. Natürlich sollten sie trotzdem nicht ganz ahnungslos sein. Ich erzählte ihnen, was um sie herum passierte. Ich besprach das aktuelle Zeitgeschehen mit ihnen, den Krieg. Ich versuchte, ihnen zu erklären, was für Gefahren es in sich barg, eine Frau zu sein, aber auch, was für ein Glück es bedeuten konnte. Doch je älter sie wurden, desto schwieriger fiel es mir. Ich musste ihnen verständlich machen, dass den Jungs und Männern um sie herum manches einfacher zufallen würde als ihnen, ohne guten Grund. Ich musste ihnen einbläuen, sich zu wehren, sollte einer dieser Jungs oder Männer ihnen zu nahe kommen. Vier Töchter zwischen zwölf und neunzehn zu erziehen war nicht nur der härteste Job, den ich jemals hatte, es war auch das Wichtigste, was ich jemals im Leben tun würde. Meine Aufgabe war nicht nur, die Frau eines Offiziers zu sein, sondern vor allem vier zuverlässige, verantwortungsbewusste, fähige junge Frauen großzuziehen und in die Welt zu entlassen.
Ich sah es als meine Pflicht an. Ich wollte nichts mehr in meinem Leben, als dass meine Mädchen stolz auf ihre eigene Stärke waren und gleichzeitig ein offenes Herz behielten.
Meg war unsere Prinzessin. Sie war unser Wunder. Nachdem ich zwei schmerzhafte und herzzerreißende Fehlgeburten hinter mir hatte, erblickte sie am Abend des Valentinstags das Licht der Welt. Anders als in anderen Jahren waren Frank und ich nicht romantisch aus und tranken Yellow-Tail-Merlot für zehn Dollar das Glas, wie es sich für Valentinstag gehörte. Stattdessen saß Frank hinter einem Tisch in seinem Kompanie-Gebäude und kämpfte damit, wach zu bleiben. Einmal pro Stunde musste er eine Runde um die Kaserne hinter dem Gebäude drehen. Manchmal schien es, als wäre er immer für Streifendienst eingeteilt – oder CQ, Charge of Quarters, wie Denise bemerkt hätte.
Er hasste es, wenn er Streifendienst hatte, genau wie die Mädchen, aber einmal im Monat verlangte es das Militär. An jenem Abend musste ich viermal in der Kompanie anrufen, bis endlich jemand ans Telefon ging und meinen Mann holte. Gerade als die Wehen unerträglich wurden, kam er nach Hause, und wir eilten zu seinem Auto. Wir dachten schon, sie würde direkt dort in unserem 1990er Chevy Lumina geboren werden. Ich blickte auf die Plüschwürfel am Rückspiegel, zählte, während die Würfel vor- und zurückschwangen, vor und zurück, und versuchte, den leichten Geruch nach Marlboros zu ignorieren, die Frank im Auto geraucht hatte, bevor wir wussten, dass ich schwanger war. Frank hielt meine Hand und erzählte mir Witze, und ich lachte so sehr, dass mir Tränen über die Wangen liefen und ich Angst hatte, auf den flauschigen schwarzen Sitzbezug zu pinkeln. So gelassen waren wir damals.
Als wir im Krankenhaus ankamen, waren die Wehen schon zu weit fortgeschritten, als dass ich noch eine Betäubung hätte bekommen können, und als Meg in dem kleinen Krankenhauszimmer schließlich schreiend zur Welt kam, schrie ich für zehn. Aber das war bloß ein Abend, ein Moment. Mutter zu werden veränderte etwas tief in mir. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Leben endlich einen Sinn ergeben, und ging in meiner neuen Rolle vollkommen auf.
Jo war die Nächste, und ihre Geburt war eine ziemliche Strapaze. Sie lag mit dem Po voran und weigerte sich hartnäckig, sich richtig herum zu drehen, sodass sie letztendlich mit Kaiserschnitt geholt werden musste.
Beths Geburt war einfach und innerhalb von dreißig Minuten vorbei. Die Entbindung verlief genauso ruhig, wie Beth werden sollte, und auch das Stillen war mit Beth leichter als mit meinen anderen Mädchen.
Unsere ungeplante kleine Amy überraschte uns an einem Taco Tuesday, als sich herausstellte, dass mein Magen auf einmal keine Tacos mehr mochte. Meine Jüngste war genauso feurig wie das Essen, auf das ich während ihrer Schwangerschaft Heißhunger hatte. Nach Amy bat ich meine Ärztin sicherzustellen, dass es keine weiteren Überraschungen mehr geben würde.
Als mein Blick jetzt von einem Mädchen zum nächsten wanderte, tat ich für ein paar Augenblicke so, als wäre Frank da, als säße er in seinem alten Sessel, den wir schon seit unserer ersten gemeinsamen Wohnung hatten. Ich stellte mir vor, wie er zu einem Lied im Radio mitsang. Er sang und tanzte wahnsinnig gern, auch wenn er grottenschlecht in beidem war.
»Im Internet steht, die White-Rock-Schule hat das Musik-Programm schon wieder gekürzt«, riss Beth mich aus den Gedanken.
»Ach du Schande, echt?«, fragte Meg.
»Ja. Die Kinder tun mir echt leid. Es gab ja schon vorher kaum eins, und jetzt ist so gut wie alles gestrichen, es gibt keine neuen Instrumente mehr, keine Ausflüge, nichts.«
Amy blickte zu ihren älteren Schwestern und versuchte, ihrem Gespräch zu folgen.
»Willst du mich verarschen?«, schimpfte Jo.
»Josephine, keine Schimpfworte«, sagte ich und beobachtete weiter Amy. Jo fluchte ständig, egal wie sehr sie sich angeblich bemühte, es zu unterlassen. Aber da sie schon fast siebzehn war, wusste ich auch nicht, was ich noch dagegen tun sollte.
»’tschuldigung, Meredith.«
Sie hatte außerdem aus irgendeinem Grund angefangen, mich beim Vornamen zu nennen.
»Ich gehe nach den Ferien sofort zu Mrs. Witt«, fuhr sie fort. »Das ist doch absolut –«
Das Telefon klingelte, und Amy sprang auf, um ranzugehen.
»Wer ist es?«, fragte ich.
Amy beugte sich vor und kniff die Augen zusammen, um die Buchstaben auf dem Display lesen zu können. »… irgendwas mit Bank. Fort Cyprus National Bank.«
Mir wurde eng um die Brust. An Heiligabend? Im Ernst? Die Bank war doch so schon korrupt genug mit ihren hohen Zinsen und dem alles andere als noblen Marketing. Die Bank war dafür bekannt, Soldaten mit schönen Frauen an den Eingängen vom PX und Walmart zu ködern, die sie mit einem Lächeln und dem Versprechen von angeblich schnelleren Gehaltseingängen zum Eröffnen eines Kontos zu überreden versuchen.
»Lass es einfach klingeln«, sagte ich.
Amy nickte und stellte den Klingelton leise. Sie wartete, bis das kleine rote Licht an der Buchse aufhörte zu blinken, dann fragte sie: »Wer ruft denn von der Bank an?«
Ich schaltete den Fernseher ein.
»Was wollen wir für einen Film gucken?«, fragte Meg. »Wie wär’s mit …« Sie fuhr mit ihren Kunstnägeln über die DVDs im Regal vor ihren Füßen und tippte auf eine Hülle. »The Ring?«
Ich war Meg dankbar für den Themenwechsel. Sie hatte schon immer ein gutes Gespür für Stimmungen im Raum und die Fähigkeit, fast wahre Geschichten zu erzählen, um jemanden abzulenken, zu entzücken oder zu entwaffnen.
»Ich hasse TheRing«, jammerte Amy und sah mich flehentlich an.
Jo hatte sich mal als das Mädchen aus dem Brunnen verkleidet. Es war überhaupt nicht lustig gewesen. Okay, vielleicht ein bisschen, aber ich war trotzdem wütend auf Jo gewesen, weil sie ihre kleine Schwester so erschreckt hatte.
»Wirklich?«, fragte Jo mit unheimlicher Stimme und streckte die Hand aus, um Amy zu kitzeln.
Amy sprang auf. »Bitte, Mom, sag Meg, wir gucken was anderes!« Sie zupfte an meiner Jogginghose.
»Wie wär’s mit Der verbotene Schlüssel?«, schlug Beth vor. Das war ihr Lieblingsfilm, sie liebte alle Filme mit Kate Hudson, und dass wir in der Nähe von New Orleans wohnten, machte den Film besonders gruselig.
»Jo, was willst du sehen?«, fragte ich.
Jo krabbelte zum DVD-Regal, und Amy schnappte nach Luft, als Jos Knie auf ihre Zehen traf.
»Cabin Fever oder …« Sie nahm Interview mit einem Vampir in die Hand.
Ich fühlte mich wie eine coole Mom, weil meine Mädchen die Filme mochten, die ich bereits als Teenie toll fand. Interview mit einem Vampir war seit gut zwanzig Jahren mein absoluter Lieblingsfilm. Bis zu diesem Tag war Anne Rice die einzige Autorin, deren komplettes Werk ich gelesen hatte.
Meg sagte leise: »Der Film erinnert mich an River …«
Allein den Namen des Jungen zu hören bewirkte, dass ich vor Wut innerlich zu kochen anfing, doch zum Glück lenkte Amys Hang zum Drama mich ab. Sie stand auf, riss Jo die DVD aus der Hand und warf sie unter den Weihnachtsbaum. Jo rief empört: »Hey!«, und Meg warf Amy einen Luftkuss zu.
»Das ist John!«, rief Meg und verschwand aus dem Zimmer, ehe ihr Handy überhaupt klingelte.
»Dann wohl Cabin Fever«, sagte Jo und nahm die Fernbedienung vom Tisch.
Während sie sich am DVD-Player zu schaffen machte, lief Amy ins Badezimmer, und Beth verschwand in der Küche. Das Haus war still, bis auf das Piepen der Mikrowelle, und kurz darauf hörte ich das leise Summen, als sich die Glasplatte darin drehte. Normalerweise war das Haus nie so still – vier Mädchen konnten einen ganz schönen Krach machen. Und wenn Frank da war, spielte immer Musik, oder man hörte ihn lachen oder singen … irgendwas war immer.
Doch die Stille würde nicht lange anhalten, und das wollte ich eigentlich auch gar nicht, aber solange sie andauerte, würde ich sie genießen. Ich schloss die Augen. Kurz darauf hörte ich Maiskörner platzen und roch den dekadenten Duft von geschmolzener Butter.
Jo saß inzwischen im Schneidersitz neben dem Fernseher und blickte auf ihre rot-weiß geringelten Socken. Auf einen Außenstehenden hätte sie vielleicht traurig gewirkt mit ihren geschürzten Lippen und dem gesenkten Blick, aber ich wusste, dass sie einfach nur in sich versunken war. Wahrscheinlich dachte sie über etwas Wichtiges nach. Ich wünschte, ich könnte ihre Gedanken lesen und ihr etwas von der Last auf ihren Schultern nehmen.
»Wie läuft es mit deinem Artikel?«, fragte ich sie. Ich hatte nicht mehr viel Zeit mit Jo allein, jetzt wo sie einen Job hatte. Einen Job, der ihr Spaß zu machen schien, so oft, wie sie dort war.
Jo zuckte die Achseln. »Gut. Glaub ich.« Sie rieb sich mit den Händen über die Wangen und sah mich an. »Ich glaub, es läuft gut. Richtig gut sogar.« Ein schüchternes, aber strahlendes Lächeln huschte über ihr Gesicht, und sie hielt sich die Hand vor den Mund. »Ich bin fast fertig. Soll ich ihn unter meinem richtigen Namen veröffentlichen?«
»Wenn du willst. Du kannst auch meinen Mädchennamen nehmen. Wann kann ich ihn lesen?« Ihr Lächeln verschwand noch schneller, als es gekommen war. »Schon okay«, sagte ich rasch, um ihr zu zeigen, dass ich nicht böse deswegen war. Ich verstand, warum sie ihn mir nicht zeigen wollte. Natürlich kränkte es mich, aber ich wusste, sie hatte ihre Gründe, und ich wollte sie zu nichts drängen.
»Du könntest ihn deinem Dad schicken«, schlug ich vor.
Sie dachte kurz darüber nach. »Meinst du, er hat Zeit? Ich will ihn nicht stören.«
Manchmal klang sie viel zu erwachsen für meinen Geschmack.
Auf dem Flur ging die Badezimmertür auf, und Amy kam zurück ins Wohnzimmer, ihre Steppdecke hinter sich herziehend. Meine Eltern hatten sie mir zu ihrer Geburt geschenkt, und inzwischen war sie ziemlich abgenutzt, und die bunten Flicken waren matter.
Amy mit ihrer Leidenschaft für Lipgloss und ihren langen blonden Haaren wollte viel zu schnell erwachsen werden, um so zu sein wie ihre älteren Schwestern, aber das war für die Jüngste ja normal. Meine Schwester war genauso gewesen, sie war mir immer überallhin gefolgt und hatte versucht, so zu sein wie ich. Amy war jetzt in der siebten Klasse, und das war angeblich die schwerste. Ich hatte an meine siebte Klasse nicht mehr viele Erinnerungen, so schlimm konnte es für mich also nicht gewesen sein. Aber die Neunte – daran konnte ich mich sehr wohl erinnern.
Jo zog Amy immer damit auf, dass sie jetzt schon anfangen müsse, sich auf die Highschool vorzubereiten. Doch Amy war in dem Alter, wo sie glaubte, alles zu wissen. Und sie war in dem unglücklichen Stadium, wo der Körper der geistigen Entwicklung noch hinterherhinkte. Die kleinen Biester in ihrer Klasse machten sich gern über ihren knochigen Körper und ihre fehlende Periode lustig. Erst letzte Woche hatte Amy mich gefragt, wann sie anfangen dürfe, sich die Beine zu rasieren. Ich hatte es immer so gehandhabt, dass meine Töchter sich von dem Zeitpunkt an rasieren durften, wenn sie zum ersten Mal ihre Periode bekamen, doch als ich Amy das sagte, war sie im Badezimmer in Tränen ausgebrochen, wie es nur eine Zwölfjährige kann. Eigentlich wusste ich noch nicht mal, woher ich diese Regel hatte – wahrscheinlich von meiner Mutter –, und so verzweifelt wie Amy war, half ich ihr noch am selben Tag, sich die Beine zu rasieren.
Meg war nicht bloß die Älteste, sondern nach mir auch verantwortlich für unser Haus von der Regierung, solange ihr Vater nicht daheim war. Manchmal konnte ich mir vormachen, es wäre unser Haus. Bis irgendetwas passierte. Wie zum Beispiel ein Strafzettel für einen nicht gemähten Rasen.
Einmal sah ich durchs Fenster einen Mann im Vorgarten stehen, der doch tatsächlich mit einem Zollstock unsere Rasenlänge maß. Als ich hinausging, stieg er rasch wieder in seinen Wagen, aber nicht, ohne mir vorher noch einen Strafzettel zu geben. Die Wohnbehörde hatte offenbar nichts Besseres zu tun, als den Rasen der Leute zu kontrollieren.
Eines Tages wären wir hoffentlich in der Lage, uns ein eigenes Haus zu kaufen, möglicherweise wenn Frank in Ruhestand ging. Vielleicht irgendwo in Neuengland. Oder in einer verschlafenen Stadt am Meer, wo man den ganzen Tag Flipflops tragen könnte. Natürlich würde es auch davon abhängen, wo unsere Töchter landeten. Amy würde die nächsten sechs Jahre noch zu Hause wohnen, und Beth … na ja, ich war mir nicht sicher, ob Beth jemals ausziehen würde, und das war auch okay.
Gerade trug sie zwei Schüsseln Popcorn herein, und alle machten es sich in dem kleinen Wohnzimmer gemütlich. Ich blieb auf Franks Sessel, Amy setzte sich zwischen Beth und Meg aufs Sofa, und Jo lümmelte weiter in der Nähe des Fernsehers auf dem Boden.
»Sind alle bereit?«, fragte Jo und drückte auf »Play«, ohne eine Antwort abzuwarten.
Der Film begann, und ich dachte weiter darüber nach, wie schnell meine Töchter groß geworden waren. Das hier könnte unser letztes gemeinsames Weihnachten sein. Nächstes Jahr würde Meg wahrscheinlich mit John Brookes Familie zusammen in Florida feiern, oder wo auch immer deren Ferienhaus war. Manchmal kam ich einfach nicht mehr hinterher. Dabei war es gar nicht so, dass Meg ständig einen Neuen hatte, aber mit ein paar Jungs war sie immerhin schon zusammen gewesen. Anders als meine Mom hatte ich ein wachsames Auge auf meine Töchter und die Jungs, die sie mit nach Hause brachten, auch wenn das bisher nur Meg betraf. Frank machte sich mehr Sorgen als ich, aber ich wusste, dass zu sehr auf unsere Töchter aufzupassen schlimmer sein konnte, als sicherzustellen, dass sie über Jungs und Beziehungen aufgeklärt waren.
Als Meg sechzehn war, habe ich ihr die Pille verschreiben lassen, womit ich mir eine Predigt meiner eigenen Mutter eingehandelt hatte. Dabei war sie die Letzte, die irgendwem einen Rat geben sollte. Immerhin hatte sie mit einundzwanzig Jahren schon zwei Kinder gehabt.
Wieder klingelte das Telefon. Jo beugte sich vor und schaltete es aus. Als Nächstes klingelte Megs Handy, ein Popsong, den Amy sofort mitsang.
»Nie hat man seine Ruhe«, kommentierte Jo vom Fußboden aus.
»Das ist Mrs. King«, seufzte Meg und stand auf.
Jo nahm die Fernbedienung und pausierte den Film, während sich Meg in die Küche zurückzog.
Amy legte sich derweil auf Megs Platz, obwohl sie gleich wieder aufstehen müsste, wenn ihre Schwester zurückkam. »Ich weiß, ich bin noch zu jung, um zu arbeiten, aber wenn ich alt genug bin, such ich mir einen besseren Job als im Café oder im Kosmetikstudio.«
»Du bist echt unausstehlich«, sagte Jo.
»Du bist echt unausstehlich«, äffte Amy sie nach.
Als Jüngste genoss Amy es, die anderen Mädchen bei jeder Gelegenheit auf deren Schwächen hinzuweisen. Es war wohl ziemlich hart für ihr Selbstbewusstsein, unter ihren drei Schwestern zu existieren, die sie gleichzeitig aber auch bewunderte. Geschwisterliebe war kompliziert. Amy liebte ihre Schwestern unendlich, war aber auch neidisch auf so gut wie alles an ihnen. Megs breite Hüften, Jos Selbstbewusstsein, Beths Kochkünste …
Als Meg zurück ins Wohnzimmer kam, schaltete Jo den Film wieder an.
»Hat sie dich schon bezahlt?«, fragte Beth und sprach damit aus, was ich dachte.
Ich hatte nichts dagegen, dass Meg für Mrs. King arbeitete, auch wenn die Frau mich mit ihrem riesigen Haus und ihren winzigen reinrassigen Hunden einschüchterte. Ihr persönlich war ich noch nie begegnet, nur ihren drei Kindern bei verschiedenen Anlässen. Meg hatte den Jungen, Shia, mal sehr gemocht, und ich verstand auch warum. Er war nett, hatte ein großes Herz und unglaublich viel Energie. Wenn es einen Mann gab, der mit Meg mithalten könnte, dann wäre es Shia King. Ich wusste nicht genau, was zwischen den beiden gelaufen war, aber wenn Meg wollte, dass ich es wusste, würde sie es mir sagen.
Meg zuckte die Achseln. »Noch nicht. Ich weiß nicht warum.«
Jo verdrehte die Augen und warf die Hände in die Luft. Zur Antwort stierte Meg sie mit ihren braunen Augen an.
»Hast du sie nicht gefragt?«, warf ich ein.
»Doch. Sie war aber zu beschäftigt.«
»Womit? Ihren Partys?«
Meg seufzte. »Nein.« Kopfschüttelnd sah sie mich an. »Es ist Weihnachten. Sie hat eben viel zu tun.«
»Dass du dir das gefallen lässt«, sagte Jo. »Ich dachte, du wärst tougher.«
»Bin ich ja auch.«
»Ja, ist sie«, sagte Amy. »Aber du bist nicht so tough wie Jo, Meg. Jo ist so tough wie ein Junge.« Sie lachte.
Jo sprang auf. »Was hast du gesagt?«
Ich seufzte. »Amy«, mahnte ich mit so strenger Stimme, dass sie mich schnell ansah. »Was habe ich dir dazu gesagt?« So etwas wollte ich in meinem Haus nicht hören.
»Ich hab gesagt, du benimmst dich wie ein Junge.« Amy richtete sich auf dem Sofa auf und wehrte Megs Versuch ab, sie auf den Schoß zu nehmen. Wenn es zu hitzig würde, müsste ich eingreifen, aber die Mädchen sollten wenigstens versuchen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Genau wie Meg mit Mrs. King, obwohl die Frechheit dieser Frau, für ehrliche Arbeit nicht zu bezahlen, mir gegen den Strich ging.
»Und was soll das heißen, Amy? Es ist nämlich Quatsch, dass Jungs angeblich stärker sind als Mädchen!«, rief Jo und malte Gänsefüßchen in die Luft. »Tough zu sein hat nichts damit zu tun, ein Junge zu sein. Wenn überhaupt …«
»Gar nicht wahr! Kannst du etwa das gleiche Gewicht heben wie ein Junge?«, forderte Amy sie heraus.
»Das ist nicht dein Ernst!« Jo presste die Lippen aufeinander.
Meg legte die Hände auf Amys schmale Schultern und grub ihre geblümten Fingernägel in das himmelblaue Nachthemd ihrer Schwester. Amy schnaufte, legte sich dann aber doch hin und ließ Meg mit ihren Haaren spielen.
Jo wartete, die Hände in den Hüften.
Im Hintergrund lief der Film.
»Jetzt lasst uns die Weihnachtsferien genießen. Das hier ist doch besser als Matheunterricht, oder?«
Meine süße Beth versuchte immer, die Dinge zu richten. In der Hinsicht war sie Frank am ähnlichsten. Jo hatte seine Leidenschaft für Politik und soziale Gerechtigkeit, aber Beth war diejenige, die sich gern um alle kümmerte.
Beth und Jo starrten einander an, bis Jo schließlich nachgab und sich wieder auf den Boden setzte.
Aber es dauerte nicht lange, bis Amy wieder mit ihrem Lieblingsthema der letzten Tage anfing. »So viel besser als Mathe ist es auch nicht. Es ist einfach ungerecht. Die Mädchen an meiner Schule werden nach den Ferien alle mit neuen Klamotten, neuen Handys und neuen Schuhen wiederkommen.« Sie zählte die Liste an ihren Fingern ab und hielt ihr Handy hoch. »Und wir sitzen hier ohne irgendwelche Geschenke unterm Baum.«
Es tat mir in der Seele weh, und die Schuldgefühle nagten an mir.
Diesmal ergriff Beth zuerst das Wort. »Wir haben mehr Geld als die Hälfte der Mädchen an deiner Schule. Sieh dir unser Haus an, und sieh dir ihre Häuser an. Und unser Auto. Du musst dich nur mal umsehen und daran denken, wie es war, bevor Dad Offizier war.« Beths Worte waren strenger als sonst. Und sie schienen bei Amy anzukommen, denn sie runzelte die Stirn und blickte zum 50-Zoll-Flachbildschirm, den wir beim PX gekauft hatten, steuerfrei natürlich.
Dann sah sie auf den Weihnachtsbaum. »Genau das meine ich. Wir könnten …«
Doch wie es schon so oft während der Ferien geschehen war, unterbrach Jo sie und erinnerte alle daran, dass wir nur dann zusätzliches Geld hatten, wenn Frank im Irak Kugeln und Sprengfallen auswich. Das müssten wir respektieren und sollten uns nicht auf seine Kosten opportunistisch verhalten.
Ich fand es schrecklich, wenn sie so redeten. Irgendwie war mir gerade alles ein bisschen zu viel. Ich fragte mich, ob ich immer noch den Baileys im Kühlschrank hatte. Ich glaubte schon.
»Außerdem«, fuhr Jo fort, sie war inzwischen ganz außer sich, »klauen die Mädchen in deiner Klasse die meisten Sachen. Oder glaubst du wirklich, Tiara Davis’ Familie könnte es sich leisten, ihr eine Chanel-Sonnenbrille zu kaufen? Das können nur Offiziersfamilien, und in deiner Klasse ist kein einziges Offizierskind, außer dem aus Deutschland, wie heißt er noch mal?«
Amy knurrte seinen Namen fast. »Joffrey Martin. Was für ein Trottel!«
Jo nickte. »Also, sei bloß nicht neidisch. Niemand hier hat Geld, es sei denn, es ist der Erste oder der Fünfzehnte des Monats.«
»Bis auf die Kings«, sagte Meg leise.
Es war nicht nur ihre Wut darüber, noch nicht bezahlt worden zu sein. Alle im Raum hörten ihr die Sehnsucht nach den feineren Dingen im Leben an, und die Kings hatten sie alle. Es gab Gerüchte, sie hätten sogar goldene Toiletten in ihrer Villa, obwohl Meg sagte, sie hätte keine gesehen.
Meg liebte ihren Job als Assistentin für Mrs. King. Ich war mir unsicher gewesen, wie meine Prinzessin damit klarkommen würde, den ganzen Tag Anweisungen auszuführen, aber seit Mrs. King sie bei Sephora entdeckt und für sich angeworben hatte, war Meg noch nicht wieder von ihr gefeuert worden. Außer dass sie Mrs. King das Make-up machen und ihre kleinen Kläffer ausführen musste, war noch nicht ganz klar, was ihr Job beinhaltete. Letzte Woche hatte Meg die Spülmaschine eingeräumt, woraufhin Mrs. King ihr sagte, sie solle nie wieder schmutziges Geschirr anfassen. Ich war mit der Botschaft nicht ganz glücklich, aber Meg war neunzehn und musste selbst wissen, was für eine Art Frau sie sein wollte.
»Die Kings mag sowieso keiner«, sagte Amy.
»Wohl!«, entgegnete Meg.
»Okay, du magst sie«, zog Jo sie auf. »Das hat nicht viel zu bedeuten. Das ist so, als würdest du sagen, die Leute mögen Amy.«
Meine Jüngste ging los wie ein Knallfrosch. »Immer musst du …«
Meg legte ihr eine Hand auf die Brust und zog sie wieder runter auf ihren Schoß. »Amy, das war ein Kompliment … Wie auch immer. John Brooke wird auch Offizier. Wenn er in ein paar Wochen von der West Point abgeht.«
Ich konnte nicht anders, ich musste die Augen verdrehen. »Gib nicht so an. Du klingst total eingebildet.«
Meg hatte nichts dagegen, eingebildet zu wirken, wenn sie dafür eine Chanel-Sonnenbrille oder einen eigenen Swimmingpool hätte wie Mrs. King – ich wusste das, weil ich sie letzte Woche genau das zu Amy habe sagen hören.
»Ja, genau, Meg«, sagte Amy.
»Halt den Mund, Amy.«
»Meredith, weißt du, wie reich die Kings sind?«, fragte Meg.
Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste nur, dass Mr. King großen Unternehmen half, heil aus Gerichtsverhandlungen rauszukommen. Ich war nicht so fasziniert von den Kings wie meine Töchter, und ich war das genaue Gegenteil meiner ältesten Tochter. Ich konnte es nicht leiden, wenn Leute sich für was Besseres hielten. Was bei den Militär-Frauen häufig der Fall war. Bevor Frank befördert worden war, hatte ich mich unter den Frauen der einfachen Soldaten und Unteroffiziere eigentlich gut aufgehoben gefühlt. Die Frauen waren alle gleichermaßen einsam, abgebrannt und besorgt wegen des Kriegs und der Aufgabe, sich allein um die Kinder kümmern zu müssen. Manche der Frauen arbeiteten sogar. Ich fand das gut. Ich hatte zwei Freundinnen, eine junge Frau, die gerade ihr erstes Kind bekommen hatte, und eine Frau in meinem Alter, deren Mann mit seiner Familie von Fort Bragg nach Fort Cyprus versetzt worden war.
Doch dann wurde Frank zum Offizier ernannt, und ich wurde von den Frauen der rangniedrigeren Männer nicht mehr akzeptiert. In den Kreis der Offiziersfrauen passte ich allerdings auch nicht. Offiziersfrau zu sein brachte mehr soziale Verantwortung mit sich, die ich schlicht nicht wollte. Ich hatte bereits vier Töchter zu erziehen und einen Mann, den ich während seiner Einsätze unterstützen musste.
Denise Hunchberg, die Leiterin unserer Familien-Rückhalts-Gruppe, war früher mal nett gewesen, doch mit der wenigen Macht, die sie inzwischen hatte, war sie immer gehässiger geworden. Es machte mich wahnsinnig, mit ansehen zu müssen, wie sie ihre angebliche Autorität dazu nutzte, jüngere Frauen zu tyrannisieren. Jedes Mal, wenn sie mich kritisierte oder mir gegenüber über eine andere Frau lästerte, hätte ich mir am liebsten auf die Finger gespuckt und ihr die angemalten Augenbrauen von ihrem selbstgefälligen Gesicht gewischt.
Denise tat so, als würde ihr Status in der Familien-Rückhalts-Gruppe sie dazu ermächtigen, die Welt zu regieren. Manchmal, wenn ich mich ihr gegenüber besonders klein fühlte, überlegte ich, ihr unter die Nase zu reiben, dass ihr Mann während des letzten Einsatzes mit der Sanitäterin geschlafen hatte, und das zweimal. Als Denise bei der letzten Wohltätigkeitsveranstaltung, zu der ich tatsächlich hingegangen war, tadelnd mit ihrem Finger vor meinem Gesicht herumwedelte, weil ich vergessen hatte, Hotdog-Brötchen mitzubringen, wäre es mir beinah rausgerutscht. Natürlich habe ich mich zurückgehalten. Es wäre schrecklich, jemandes Familie zu zerstören. Und außerdem würde letztendlich mein Mann für das lose Mundwerk seiner Frau bezahlen, also musste mein Verhalten zu jeder Zeit durchdacht und würdevoll sein.
Ich konnte Frank das nicht antun. Die Frauen der Offiziere wurden an einem höheren Standard gemessen. Manchmal kam ich mir in Fort Cyprus vor wie ein Fisch im Aquarium bei Walmart. Zu viele Fische, zu wenig Futter, und nirgendwo konnte man hin außer auf die andere Seite des schmutzigen Aquariums.
Unsere Töchter mussten auch auf ihren Ruf achten. Na ja, soweit vier Teenie-Mädchen das eben konnten. Auf einer Militärbasis verbreiteten sich Gerüchte mit Überlichtgeschwindigkeit, und die Töchter von Frank und Meredith Spring hatten genug Samen gesät, aus denen Gerüchte wachsen könnten.
Während ich über Denise nachgedacht hatte, hatte das Gespräch im Wohnzimmer eine andere Wendung genommen. Ich hörte Amy sagen: »Und Dads Job ist sicherer als die von allen anderen. Er muss noch nicht mal eine Waffe tragen.«
Niemand sagte ihr, dass das nicht stimmte.
Diese kleine Lüge hatte ich ihr einmal erzählt, damit es ihr besser ging. Was sollte ich meiner Siebenjährigen auch anderes sagen, als sie mich fragte, ob ihr Dad sterben würde?
Jo versuchte immer, das Gewehr ihres Vaters zu ignorieren, das auf jedem seiner Facebook-Fotos zu sehen war. Sie hasste Waffen und sagte das auch oft. Freiwillig würde sie nie im Leben eine Waffe in die Hand nehmen. Genau wie ich.
»Ich würde eine Basis mitten in Mossul nicht unbedingt sicher nennen«, sagte Jo, ohne den düsteren Ton ihrer Stimme zu verbergen. Sie hatte es schon lange aufgegeben, Amy irgendwas vorzuspielen.
Abgesehen davon, dass wir bei Amy ein paar Details ausgelassen hatten, wussten meine Töchter darüber Bescheid, wo ihr Dad war und wie gefährlich es im Irak war. Sie wussten, dass dort Menschen starben, aus beiden Ländern. Männer wie der Vater von Helena Rice. Zwei Tage vor ihrem letzten Jahr an der Highschool war er abgereist, und vor Weihnachten war er schon tot. Helena und ihre Mom zogen jetzt dahin zurück, wo sie früher gewohnt hatten. Ihnen blieben nur neunzig Tage, ihre Sachen auf der Basis zu packen.
Es war schrecklich. Es war einfach nur schrecklich.
»Es ist die sicherste Basis«, sagte Amy.
Noch eine Lüge, die ich ihr erzählt hatte.
»Nein …«, fing Jo an, aber ich unterbrach sie: »Jo.«
Auf einmal war ich unendlich müde. Manchmal wünschte ich mir, Frank wäre hier und könnte mir helfen, unseren Mädchen so schwierige Sachen zu erklären.
»Meredith«, fuhr Jo mich an.
»Jo, komm schon. Lass uns einfach den Film gucken«, versuchte Beth, sie zu besänftigen.
Ich saß mittendrin, aber ich war so müde. Am liebsten würde ich aufstehen und in die Küche flüchten.
»Tut mir leid, Beth, dass meine Sorge um das Leben unseres Vaters deinen Filmabend stört«, fauchte Jo und verschränkte die Arme.
Hätte Jo das zu Amy oder Meg oder gar zu mir gesagt, hätte sie ordentlich was zu hören bekommen. Amy hätte sie wahrscheinlich auch gehauen. Aber Beth sagte kein Wort. Ein paar Sekunden vergingen, dann stellte Jo den Fernseher wieder lauter. Ich fühlte, wie die Anspannung in ihren Schultern nachließ und damit auch in meinen.
Wir vermissten Frank einfach nur, das war alles.
Meine Mädchen vermissten ihren Vater zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich intensiv. Meg hatte ihren Dad am meisten vermisst, als ihr damaliger Freund den anderen Jungs an der Schule Fotos von ihr gezeigt hatte, die nur für seine Augen bestimmt gewesen waren. Jo hatte ihn am meisten vermisst, als sie zur jüngsten Redakteurin ihrer Schulzeitung gewählt worden war. Und dann hatte sie ihn noch mehr vermisst, als der Titel ihr wieder abgenommen wurde. Beth vermisste ihren Dad am meisten, wenn sie beim Klavierspielen nicht den richtigen Ton traf. Und Amy vermisste ihren Dad, wenn sie ihn ihre liebsten Disney-Lieder singen hören wollte. Und zu guter Letzt vermisste ihre Mutter ihren Mann besonders dann, wenn die Last des Lebens für ihre Schultern allein einfach ein bisschen zu viel wurde.
Wir fünf vermissten unseren Captain alle aus ganz unterschiedlichen Gründen und konnten es kaum erwarten, dass er nächsten Monat endlich wieder nach Hause kam. Es fühlte sich jetzt schon viel länger an als ein Jahr, seit er weg war, und die zwei Wochen Urlaub würden nicht annähernd genug sein.
Während der kurzen Zeit versuchte er immer, mit seinen Mädchen ein ganzes Jahr aufzuholen. Letztes Jahr waren wir von Louisiana nach Florida gefahren und hatten eine Woche in Disney World verbracht. Beim Feuerwerk am Abend spürte ich, wie Franks Beunruhigung mit jeder Farbexplosion größer wurde. Er konnte sich die Show nicht bis zum Ende ansehen. Ich würde nie vergessen, wie seine Schultern bebten, als er zurück zum Hotel ging, während das Feuerwerk den dunklen Himmel erhellte. Für Jo und Amy waren die Explosionen wunderschön. Doch das Knallen ließ auch meinen Puls schneller werden. Ich machte mir Sorgen um meinen Mann, der das laute Knallen nicht ertrug. Als Frank in der Menge verschwand, folgte ich ihm. Wie ich später erfuhr, ließ Meg Jo mit ihren zwei kleinen Schwestern allein und lief einem Jungen hinterher, den sie in der Schlange vor Cinderellas Schloss kennengelernt hatte.
In der Küche piepte der Ofen, und Beth sprang auf. Falls die anderen Mädchen es hörten, ließen sie sich nichts anmerken. Beth verbrachte eine Menge Zeit in der Küche. In letzter Zeit hatte ich immer weniger Lust gehabt zu kochen, und Beth war die einzige meiner Töchter, die gern kochte und es bemerkte, wenn die Wäscheberge sich türmten.
»Gucken wir jetzt den Film oder nicht? Jetzt bleibt doch mal sitzen und seid still!«, rief Amy, woraufhin Jo die Augen verdrehte.
Jedes Jahr guckte ich an Heiligabend mit meinen vier Mädchen Horrorfilme. Es war eine Tradition, die existierte, seit Frank und ich zum ersten Mal zusammen Weihnachten gefeiert hatten. Wir waren damals in Las Vegas stationiert, und ich hatte Heimweh. Halloween war für mich in meiner Kindheit immer die beste Zeit des Jahres gewesen. Meine Mom gab dann alles, und ich hatte ihre Liebe für Halloween übernommen. Als ich in dem Jahr an Weihnachten über einen die ganze Nacht andauernden Horrorfilm-Marathon im Fernsehen stolperte, fühlte ich mich an zu Hause erinnert, und mein Heimweh war gelindert. So wurden die Horrorfilme zur Gewohnheit, und irgendwann steckte ich auch meine Mädchen damit an.
Sie alle liebten Halloween und unheimliche Sachen, aber besonders Beth und Amy waren seit unserem Umzug nach New Orleans ganz fasziniert von den Voodoo-Geschichten und Legenden, die sich um The Big Easy rankten. Ich war stolz darauf, das unheimlichste Haus in der Umgebung zu haben, egal wo wir wohnten. Oft schwelgte ich in Kindheitserinnerungen und erzählte Geistergeschichten über spukende Orte in meiner Heimatstadt im Mittleren Westen. Als ich noch jung war, verbrachten meine Freundinnen und ich die Wochenenden damit, Spukhäuser in der Nähe unserer Kleinstadt aufzusuchen, das waren die paar guten Erinnerungen, die ich noch von dem Ort hatte. Wir konnten von Glück sagen, dass ich an jenem Weihnachtsabend auf den Horrorfilm-Marathon gestoßen war und nicht etwa auf Dokus über verarmte ländliche Gegenden und Alkoholismus.
Jo zeigte auf den Bildschirm. »Die Stelle liebe ich.«
Sie wählte jedes Jahr zu Weihnachten dieselbe Art von Horrorfilmen aus derselben Zeit aus, mit Zombies oder irgendeinem Virus. Letztes Jahr hatten wir 28 Tage später gesehen. Meg dagegen suchte Filme immer nach dem Hauptdarsteller aus. Zuletzt war sie in Tom Hardy verknallt gewesen, was ich absolut nachvollziehen konnte … eine Tatsache, die noch seltsamer war als Ketchup auf Tacos.
»Ich find die auch super.«
Jo lächelte Amy an, und mir wurde ganz warm ums Herz.
Das Haus wurde wieder still, bis auf die Schreie aus dem Fernseher.
2
Jo
Wie üblich war ich auch dieses Jahr die Erste, die am Weihnachtstag wach war. Normalerweise stand ich schon vor Sonnenaufgang auf und ging runter, um einen Blick auf die Geschenke vom »Weihnachtsmann« zu werfen. Danach würde ich Beth wecken, dann Meg. Amy wachte immer im selben Moment auf wie Beth, weil sie sich ein Zimmer teilten.
Dieses Jahr war allerdings anders. Ich hatte nicht den Drang, leise ins Wohnzimmer zu laufen und nach Geschenken zu sehen. Wenigstens hingen unsere Weihnachtsstrümpfe. Sie waren das, was ich an Weihnachten am liebsten mochte, weil unsere Eltern so viel Kram, vor allem Süßes, hineinstopften, wie nur reinpasste. Ich schüttete meinen Strumpf immer sofort auf dem Boden aus und musste aufpassen, dass meine Schwestern sich nichts davon krallten, obwohl sie ihre eigenen Sachen hatten. Amy war dabei die Schlimmste. Sie war dafür bekannt, heimlich ihre Sachen gegen unsere zu tauschen, wenn ihr unsere besser gefielen.
Wir besaßen alle einen eigenen kratzigen, selbst gestrickten Strumpf mit unserem Namen drauf. Moms Mom hatte jeder von uns einen zur Geburt geschenkt. Meiner war der hässlichste, er hatte als Motiv einen leicht gestört und ziemlich betrunken aussehenden Weihnachtsmann. Sein Bauch war schief und der Bart dunkelgrau, genau wie die Zähne. Sein Lächeln war leicht böse, und da das Ding über die Jahre immer mehr verschliss, sah es aus, als würde der böse Weihnachtsmann selbst den Stoff verrotten lassen. Ich musste jedes Jahr wieder lächeln, wenn wir die Strümpfe auspackten, um sie aufzuhängen.
Meg beschwerte sich immer, dass es selbst bei Target schönere Weihnachtsstrümpfe gab. Statt eines kostbaren Schmuckstücks von entfernten königlichen Verwandten hatten wir zur Geburt Weihnachtsstrümpfe von unserer Oma bekommen – Merediths Mutter, mit der sie inzwischen fast zwei Jahre lang nicht gesprochen hatte. Sosehr ich meine Oma auch mochte, ich musste mich für eine Seite entscheiden, und nur eine der beiden Frauen gab mir zu essen.
Auch dieses Jahr hatten wir die Strümpfe aufgehängt wie immer (und das schon am Tag nach Thanksgiving, Himmel). Mehr würden wir zu Weihnachten wohl nicht bekommen. Mir fehlten die Weihnachtsgeschenke gar nicht so sehr wie meinen Schwestern. Sogar Beth, die sich nicht so viel aus Klamotten machte wie Meg oder aus Büchern wie ich oder aus sich selbst wie Amy, war aufgeregt. Beth war Weihnachten in Person. Sie war frisch gebackene Plätzchen, leises Lachen und Nächstenliebe.
Ich wäre Halloween, dachte ich, als ich die oberste Schublade meiner Kommode öffnete und die kleinen Bücher, die ich für meine Schwestern gekauft hatte, herausnahm. Ich hatte die Hälfte meines Lohns dafür ausgegeben. Ich verdiente genug bei meinem Job bei Pages, einem Buchladen mit Coffeeshop, und ich genoss es sehr, mein eigenes Geld zu haben. Beth war wahrscheinlich die Einzige, die den Gedichtband lesen würde – und sie würde stolz auf mich sein, dass ich allen Geschenke gekauft hatte. Ich hoffte, Amy und Meg würden das Buch zumindest aufschlagen. Und wenn nicht, dann hätte die Autorin wenigstens ein paar Dollar verdient.
Eines Tages wollte ich selbst ein Buch schreiben. Ich wäre schon froh, wenn ich nur vier Exemplare verkaufen würde. Oder wenn auch nur eine einzige Person mein Buch kaufen und sich darin wiederfinden würde. Verdammt, wenn jemand es nur zu Ende lesen würde, wäre ich schon begeistert. Beth sagte immer, ich wäre zu selbstkritisch, zu schnell beleidigt und würde zu sehr in der Zukunft leben, aber ich fand das nicht. Wenn die Vergangenheit und die Gegenwart beide nicht so toll waren und niemand aus seinen Fehlern lernen wollte, warum sollte ich dann nicht in die Zukunft blicken? Die war irgendwie alles, worauf ich mich freute.
Beth las als Einzige jeden Artikel, den ich in der Schulzeitung veröffentlichen konnte, und sie sagte mir immer wieder, wie talentiert ich war. Sie lobte meine albernen Berichte über Schulbälle und Zusammenkünfte des Debattier-Klubs, aber ich konnte es nicht erwarten, endlich über die Welt außerhalb der Mauern der White Rock High zu schreiben. Ich wollte nicht davon berichten, dass Shelly Hunchberg eine funkelnde Krone aus billigem Plastik mit unechten Diamanten gewonnen hatte, die nur das reflektierte, was man schon bald als gescheiterte Träume bezeichnen würde.
Ich wollte über den Wahnsinn schreiben, der in meinem Land und in der Welt passierte. Ich wollte meine Stimme für etwas Sinnvolleres verwenden, als Bildunterschriften für eine ganze Seite Fotos von Mateo Hender auf dem Football-Feld zu verfassen und damit sein Ego noch weiter zu polieren. Ich hatte keine Lust mehr, über die Statistiken des Reserveoffizier-Ausbildungskorps zu schreiben, aber da die White Rock High zu neunzig Prozent aus Armee-Bälgern bestand, blieb mir nichts anderes übrig. Das war schon okay – das Ausbildungskorps war ziemlich cool –, aber ich brauchte mehr Freiheiten.
Ich wollte darüber schreiben, was in zwei Jahren wichtig wäre, wenn Shelly von Mateo schwanger und er Soldat wäre oder beim Drive-in arbeitete. Ich wollte über die Zahl der Truppen schreiben, die letzte Woche zu ihren Familien nach Hause gekommen waren – oder über die, die es nicht waren. Noch nicht mal die Geschichte von der Reihe von zwanzig Autos, die Meg und ich beim Starbucks gesehen hatten, wo die Leute alle den Kaffee für den nächsten in der Schlange gezahlt hatten, würde es jemals in die Schulzeitung der White Rock High schaffen. Dabei wäre es so einfach gewesen, es war eine harmlose, niedliche Geschichte. Mr. Geckle war ein Idiot.
»Unsere Schülerinnen und Schüler sind zu jung, das zu lesen«, sagte er und zeigte mit seinem faltigen Finger auf meinen Artikel über den aufkeimenden Protest überall im Land.
»Nein, Mr. Geckle, sind sie nicht. Es sind Teenager, die genauso alt sind wie ich«, rief ich aufgebracht und zeigte auf meinen Körper, als ob Mr. Geckle sich auch nur irgendwie vorstellen könnte, wie es war, im einundzwanzigsten Jahrhundert Teenager zu sein.
»Der Artikel ist zu einseitig, zu polemisch«, murmelte er und gab mir mit einem schwachen Wink zu verstehen, dass ich gehen sollte.
Aber ich ließ mich nicht einfach so abservieren, und er hatte auch garantiert mit meiner Reaktion gerechnet, immerhin kannte er mich schon seit zwei Jahren.
»Es ist wahr, es ist alles wahr.« Ich nahm das Blatt und folgte ihm um sein Pult.
Das falsche Holz des teuren Tischs war über und über mit Kritzeleien und Initialen beschmiert. Nach der zweiten Runde hatte die Schule aufgegeben, die Tische zu ersetzen. Die Initialen aufs Lehrerpult zu schreiben war irgendwie so ein Muss an meiner Highschool. Bisher hatte ich das für ziemlich unreif gehalten. Erst als ich jetzt vor ihm stand und er das Beste, was ich jemals geschrieben hatte, ablehnte, weil er seinen Schülerinnen und Schülern geistig nichts zutraute, sah ich die Schmierereien als etwas anderes. Als einen Akt der Rebellion. Ich liebte sie. Am liebsten hätte ich über den beschmierten Tisch gegriffen, Mr. Geckle den mit seinem Namen gravierten Füller aus dem Hemd gerissen und meine Initialen ins falsche Holz geritzt. Ich nahm mir vor, später noch mal wiederzukommen und es dann zu tun, damit er niemals vergessen würde, wie falsch er damit gelegen hatte, meine Ideen abzuschmettern.
Mr. Geckle sagte immer nur Nein, wieder und wieder. Ich würde meine Mitschülerinnen und Mitschüler niemals mit echten Berichten versorgen können. Jedenfalls nicht hier an dieser winzigen Highschool am äußersten Ende von Louisiana. Zum Glück für sie gab’s das Internet, sie waren also nicht vollkommen ahnungslos, was die Vorkommnisse in der Welt außerhalb des Armee-Postens anging. Ich musste wohl akzeptieren, dass meine Artikel niemals auf der Titelseite der Schulzeitung stehen würden. Der Platz war für die Mateos und Shelleys dieser Welt reserviert.
Mein Handy in der Hosentasche vibrierte, und ich steckte die vier kleinen schwarzen Bücher in die Kängurutasche meines Kapuzenpullis und stellte den Handywecker aus.
Ich musste bei der Arbeit anrufen und Bescheid sagen, dass ich während der Weihnachtsferien jede Schicht übernehmen würde. Meine Kolleginnen wollten alle freihaben, aber ich liebte die Ferien bei Pages. Der Laden war der Stoff, aus dem die Träume einer jeden Autorin sind. Ein postmoderner Coffeeshop mit schwarzen Metall- und Holztischen, großen Wandbildern lokaler Künstlerinnen und Künstler und Trinkgeldgläsern mit popkulturellen Anspielungen. Am Tag meines Vorstellungsgesprächs konnten sich die Kunden aussuchen, ob sie ihr Trinkgeld lieber Voldemort oder Dumbledore geben wollten. Ich warf einen Dollar bei Voldemort rein, weil das Glas leer war, und fühlte mich unglaublich rebellisch, als ich mich lächelnd beim aufgekratzten Mädchen hinterm Tresen bedankte. Sie hieß Hayton und musste an dem Morgen schon ein oder zwei Espresso getrunken haben.
Zwischen Hyper-Hayton und meinem Chef, der meine kreative Arbeit schätzte und alles von mir lesen wollte, liebte ich meinen Job meistens.
Ich schickte meinem Chef eine Nachricht, dann fiel mir ein, dass es noch ziemlich früh war und außerdem Feiertag.
Egal, er hatte mir auch schon zu unmöglichen Zeiten geschrieben. Ich nahm die Bücher und ging leise zu Megs Bett auf der anderen Seite des Zimmers. Sie schlief noch und schnarchte leise (obwohl sie immer behauptete, sie würde nicht schnarchen). Mit angezogenen Beinen lag sie da. Sie bewegte sich, und ihr Shirt rutschte zur Seite, sodass ihre eine Brust zu sehen war. Meg hatte irgendwie alle guten Gene unserer Eltern geerbt. Sie hatte Merediths Brüste und Hüften und das Lächeln von unserem Dad. Mir fiel wieder ein, wie ich mich damals in der Junior High immer im Spiegel betrachtet hatte und mir, verglichen mit den Kurven meiner Schwester, total unterentwickelt vorgekommen war. Jetzt wünschte ich mir gar nicht mehr so sehr, größere Brüste zu haben, aber die waren auch nicht das Einzige, was Meg hatte. Sie hatte Spitzenunterwäsche in der Schublade und Sex mit River Barkley und auch schon ein paar anderen Jungs gehabt.
Außerdem hatte sie einen roten Prius. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich selbst Auto zu fahren. Ich hatte gerade meinen Führerschein bekommen, und Meg zählte die Tage, bis ich ihr helfen würde, alle durch die Gegend zu kutschieren. Sie hasste es, wenn sie Tante Hannah zurück ins French Quarter oder Amy zu den Girl Scouts bringen musste. Meg hatte aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass ihre Zeit wertvoller war als meine. Vielleicht stimmte es auch. Sie war schon seit einem Jahr raus aus der Highschool und viel mehr eine richtige Frau als ich.
Sie bewegte sich wieder. Ob sie einen Albtraum hatte? Vielleicht waren bei Sephora die Lidschatten-Paletten ausgegangen oder Shia King hatte sie auf Twitter blockiert.
Als alle ihre alten Freunde in Texas sie blockiert hatten, war sie am Boden zerstört gewesen. Sie hatte uns nicht erzählen wollen, was genau passiert war und warum ihre Freundinnen alle auf Rivers Seite waren. Genauso wenig wie den Grund, warum sie Shia King nicht mehr mochte.
Meg stalkte ihn gern online. Sie folgte ihm von Kambodscha nach Mexiko und schaute alle seine Fotos durch (ohne sie zu liken, natürlich). Sie erzählte mir immer, wie schrecklich er sei, aber das war schwer zu glauben, wenn ich mir die Fotos von ihm in kleinen Dörfern überall auf der Welt ansah. Auf einem Bild hatte ein kleines Mädchen in Uganda ihm die Arme um die schlanken Schultern geschlungen, während er ihm etwas vorlas. Die beiden hatten fast dieselbe Hautfarbe, das Mädchen war nur ein bisschen dunkler. Sie war so schön.
Meg konnte Shia aus irgendeinem Grund nicht ausstehen, aber ich war fasziniert von ihm. Er war ein gut aussehender, beliebter, reicher Junge, der das College geschmissen hatte, um als Aktivist durch die Welt zu reisen und das Geld seines Treuhandfonds für Gutes einzusetzen. Wahrscheinlich war es das, was Meg ärgerte, aber ich fand es cool und war beeindruckt, dass er und seine beiden Schwestern von hier weggezogen waren. Ich weiß noch, wie Meg Meredith gefragt hatte, ob es sie stören würde, dass Shia schwarz war, und Meredith hatte uns über eine Stunde lang erklärt, dass wir zusammen sein konnten, mit wem wir wollten, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe. Meg fragte nie wieder. Sie schien eh keinen besonderen Typ zu haben. Jeder Junge, den sie mit nach Hause brachte, war anders als der vorherige.
Vorsichtig hob ich den Zipfel ihres Kissens an und schob den Gedichtband unter ihren Kopf. Sie rührte sich nicht, schnarchte nur und sah wunderschön dabei aus. Ich hatte schon immer gedacht, dass sie Glück mit ihrem guten Aussehen hatte. Ihre runden Hüften und der große Busen hatten mich früher neidisch gemacht, doch je älter ich wurde, desto weniger machte ich mir aus Brüsten und so. Aber Meg war stolz auf ihren Körper, auch wenn sie sich ständig beschwerte, weil sie BHs mit extra starkem Halt tragen und so viel Gewicht mit sich rumschleppen musste.
Als Beths Busen zu wachsen begann, warnte Meg sie, dass die Jungs sie jetzt noch mehr belästigen könnten, als sie es bei mir tun könnten. Worauf Meredith sagte, das stimme nicht – Jungs könnten jede Art von Mädchen belästigen. Ich wusste nicht, was wahr war, aber ich hoffte, dass Beth und ich es nie herausfinden müssten.
Meg wusste ihr gutes Aussehen auf jeden Fall für sich einzusetzen, und sie versuchte, Beth Ratschläge zu geben, wie sie mit Jungs umzugehen hatte, aber Beth wurde immer nur rot und schüttelte den Kopf, ohne Meg Gehör zu schenken. Ich nahm an, Meg wusste, wovon sie redete. Besonders, wo wir in einer Stadt voller Soldaten lebten. Meg fand es toll. Sie sagte immer, sie liebte Männer in Uniform. Wie ihren Freund, John …
»Was ist?!« Meg sprang auf, und ich zuckte zusammen. Verwirrt blickte sie sich um, die dunklen Haare klebten ihr am Mund. »Was machst du da, Jo? Du hast mich zu Tode erschreckt.« Sie fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und strich sich die Haare hinter die Ohren.
Ich hielt mir die Bücher vor den Mund und unterdrückte ein Lachen. »Santa Claus spielen.«
Meg steckte lächelnd die Hände unters Kissen und zog das Buch hervor. Sie wirkte richtig aufgeregt und sah unglaublich jung aus. Sie betrachtete mein Geschenk, und obwohl es keine Schminksachen waren, strahlte sie mich an und kreischte sogar ein bisschen, während sie es sich an die Brust drückte. »Danke.« Ich hielt mir die Hand vor den Mund, aber Meg sah mein Lächeln trotzdem. »Ich wusste, du würdest irgendwas machen, Jo.«
Die Vorstellung, dass sie damit gerechnet hatte, gefiel mir. Normalerweise war Beth diejenige, die an alle anderen zuerst dachte. Aber nicht dieses Jahr, dieses Jahr war ich es.
Vielleicht würden wir die Ferien ja doch alle gut überstehen.
»Bitte schön, damit habe ich meine gute Tat fürs Jahr getan.«
Meg verdrehte die Augen. »Du hättest auch einfach deinen Führerschein abholen können, damit ich Amy und Beth nicht allein herumfahren muss. Das wäre ein besseres Geschenk gewesen.«
»Beth will doch nie irgendwohin.«
»Du weißt, was ich meine.«
»Nicht wirklich.«
Ich starrte auf Megs Poster von einem Schauspieler, den sie mochte. Er hatte in diesem Jahr in so gut wie jedem Film mitgespielt. Sie folgte ihm auf Twitter und hatte ihn eigentlich im Herbst auf einer Convention in New Orleans treffen wollen. Doch als er eine Woche vorher seine Verlobung bekannt gab, hatte Meg ihr Meet-and-greet-Ticket wieder verkauft.
»Erinner Meredith einfach dran, dass sie den Führerschein mit dir abholt. Ich versteh nicht, warum du nicht darauf brennst, ihn endlich zu haben.«
»Meg, es ist sieben Uhr morgens. Beruhig dich. Ich hab Meredith diese Woche schon dreimal gefragt. Sie hat einfach zu viel zu tun.«
Meg kniff die Augen zusammen. »Womit?«
Ich zuckte die Achseln und ging zur Tür. Darauf wusste ich keine Antwort, aber ich hatte noch drei Bücher zu verteilen.
»Meredith macht mehr als du, Prinzessin«, rief ich ihr in Erinnerung.
Meg zeigte mir den Mittelfinger.
»Diesmal solltest du das Buch wirklich lesen.«
Als ich mich noch mal nach ihr umdrehte, schlug sie es an einer zufälligen Stelle auf. Ich hoffte, die Worte würden sie so bewegen wie mich. In letzter Zeit hatte ich das Bedürfnis, ein engeres Verhältnis mit Meg zu entwickeln. Ich wollte erwachsen werden. Natürlich wünschte ich mir, dass alle drei meiner Schwestern sich in den Worten der Autorin wiederfanden. Aber besonders Meg. Sie würde mit den Gedichten mehr anfangen können als wir anderen, da war ich mir sicher. Einige der Gedichte weckten die Sehnsucht in mir, mich zu verlieben. Ich sehnte mich sogar nach dem Liebeskummer danach.
Ich schlich in Beths und Amys Zimmer auf der anderen Seite des Flurs. Es war dunkel, und die Tür quietschte. Amy hatte gestern Abend ein Schild an die Tür geklebt – ZUTRITTNURFÜRSPRING-GIRLS –, nachdem sie sich mit ihrer Freundin Tory gestritten hatte. Amy war nie besonders lange mit irgendwem befreundet, aber da sie drei Schwestern hatte, die sie bedingungslos liebten, machte das nicht so viel. Wir mussten mit ihrer rechthaberischen Art klarkommen, Tory nicht. Und auch nicht Sara oder Penelope oder Yulia …
Amys Hälfte des Zimmers war ein einziges Chaos, schlimmer als Megs und meine Seiten zusammengenommen. Beth hielt ihre Hälfte immer aufgeräumt. Amys Seite machte sie halb wahnsinnig. Amy musste nur abwarten, bis Beth wieder einmal genug hatte und das Zimmer für die jüngere Schwester aufräumte, was ziemlich genau einmal in der Woche passierte.
Amys Bett war leer. Ich blickte rüber zu Beths Bett, ob die beiden in dem etwas größeren Bett zusammen kuschelten, aber nein, Amy war nicht da.
Ich strich über das Buch, über das weiche schwarze Cover mit der gezeichneten Biene darauf. Sogar das Cover war perfekt. Ich liebte jedes einzelne Gedicht in dem Buch.
Als ich Beths Kissen anhob, wachte sie auf. »Was ist?«
Ich schüttelte den Kopf und legte mir den Finger an die Lippen. »Nichts, schlaf weiter. Tut mir leid.«
Nachdem ich die Weihnachtsgeschenke verteilt hatte, ging ich runter in die Küche. Unsere vier Strümpfe waren alle vollgestopft mit Süßigkeiten, und auf dem Tresen lagen drei Geschenke. Sie lagen in einer geraden Reihe neben dem leeren Obstkorb, den Mom zu Dekozwecken gekauft hatte, sich aber weigerte, mit unechtem Obst zu füllen – weil das irgendwie albern gewesen wäre.
Die drei Geschenke waren nicht eingepackt, sollten also offenbar von Santa Claus sein. Natürlich glaubten wir nicht mehr an Santa, auch wenn Meredith immer noch so tat. Sie wollte, dass ihre Mädchen so lange wie möglich jung blieben, was schwierig war, wo unsere Welt doch so voller Hass und Krieg und Ungerechtigkeit war. Doch als ich auf die Geschenke blickte und das letzte in der Reihe sah, ein Buch, machte mein Herz einen Sprung.
Die Glasglocke stand auf dem Cover. Ich hatte mir den halb autobiografischen Roman von einer meiner Lieblingsautorinnen, Sylvia Plath, gewünscht, es war eins der wenigen Bücher von ihr, die ich noch nicht gelesen hatte. Meredith verstand meine Besessenheit mit der Frau, deren Name quasi für Depressionen stand, nicht, aber ich war schon immer völlig fasziniert von ihr, seit ich auf Tumblr einmal über einen Post über sie gestolpert war, bevor Dad verlangte, dass ich meinen Account löschte. Ich drückte mir das Buch an die Brust. Meredith hatte dieses Jahr alles gegeben.
Sie tat wirklich, was sie konnte, wo unser Dad zum vierten Mal in acht Jahren im Mittleren Osten stationiert war. Als alleinerziehende Mutter von vier Töchtern im Teenie-Alter hatte sie es wirklich nicht leicht. Ich strich sanft über das Bild der Frau auf dem Cover. Es war wunderschön, mein Herz hämmerte wie wild. Nur Bücher konnten mich so berühren. Ich wünschte, ich könnte irgendwann mal einen Roman schreiben, auch wenn ich eher Journalistin war. Ich wollte gern für Vice schreiben, oder vielleicht sogar die New York Times.
Und wer sagte, dass ich das nicht konnte? Wenn ich es aus dieser Armee-Stadt rausschaffte, könnte ich alles machen.
Megs Geschenk war eine Tasche für noch mehr von ihren Schminksachen und Beths ein Kochbuch, das gleichzeitig auch ein Geschenk für unsere Mom war, denn es bedeutete, dass Beth noch mehr zu unserer aller Dienerin werden würde. Beth tat so ziemlich alles im Haus, und kaum eine dankte ihr dafür. Ihre ruhige Ordnung passierte einfach wie von selbst – sie räumte Megs herumliegendes Schminkzeug auf, warf meine Socken in den Wäschekorb und wusch die Wäsche. Das Gute war, dass das Kochbuch Dreißig-Minuten-Gerichte versprach, Beth würde also mehr Zeit zum Wäschewaschen haben.
Als hinter mir der Kühlschrank geöffnet wurde, legte ich erschrocken das Kochbuch auf den Tresen. Amy stand da und durchsuchte den Kühlschrank. Ein Glas Marmelade fiel heraus und rollte unter die Kücheninsel.
»Schh, du weckst noch alle auf!«, schimpfte ich.