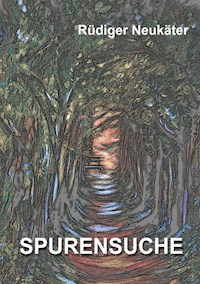
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Nordsee
- Sprache: Deutsch
'Spurensuche' Ist eine Mischung aus Wahrheit und Erfundenem, Biografie und Roman. Der Autor schildert sein Leben von der Geburt 1940 bis zu seinem 30. Lebensjahr. Es ist die Geschichte eines schwierigen Erwachsenwerdens in bewegten Zeiten und an vielen Orten. Der Leser nimmt teil an den Mühen der Selbstfindung, den Kompliziertheiten der Liebesbeziehungen und er folgt dem Autor auf Exkursionen zu erinnerungsrächtigen Orten und Erlebnissen. Der Erzähler berichtet von seiner "zweiten Heimat" Griechenland (Pilion), von Gipfelbesteigungen auf den Mosesberg im Sinai und den Ayer's Rock in Australien und von den Nyepi (Neujahrs-) Feierlichkeiten auf Bali. Was der Autor erzählt und erinnert, ist immer nahe an der Wirklichkeit. Wo ihn das Gedächtnis im Stich ließ, hat er sich seiner Fantasie anvertraut. So liest sich 'Spurensuche' wie eine ironische und abwechlungsreiche Chronologie einer langwierigen Jugend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1.
Erinnerungen
2.
Anfänge
Annahütte: Er ist da!
Fritz und Erna
Dora und der Beginn einer Schwimmkarriere
Kleine Schwester
Die Russen kommen
Doberlug
Blut
3.
Wie ein Staat sich seiner Gegner entledigt
4.
Nach Berlin
5.
Am Niederrhein
6.
Exkurs: Heimat
7.
Kato Gatzea in Griechenland
Gatzea forever
Camping Hellas
Das erste Mal
Erste Liebe
Sturm
Folklore
Tines Brüste
Die Griechen aus Bottrop
Mein Freund Api
8.
Jung sein in Niederbayern
In Zwiesel bei Schott und Genossen
Kino-Kiosk-Knacker
Was heißt hier Liebe?
Peter Pechmann
Von hier nach dort
9.
Januar 2019
10.
Heilige Gipfel
Mosesberg
Uluru (Ayer’s Rock)
11.
Im Frühling nach Mainz (1958)
Das ‚Kuschlo‘ und die ‚Fassenacht‘
Alles Theater
12.
Soldat Soldat
13.
‚Nyepi‘ - Ein Tag der Stille
14.
Mainzer Intermezzo
15.
An der schönen blauen Donau
Überleben in Wien
Anette
16.
Zurück zu ‚Vater Rhein‘
Die erste Griechenlandreise
Probieren geht über Studieren
17.
London und die Hudson’s Bay Company
18.
Cherchez les femmes
Die Suche nach Liebe
19.
Ildiko und das Ende der Suche
1. Erinnerungen
Erinnerungen sind wie schlafende Hunde.
Weckst du den Hund, könnte er, aus glücklichen Träumen gerissen, kläffen oder beißen. Er könnte sich auch behaglich rekeln, gähnen und sich erneut zum Schlaf zusammenrollen. Möglich auch, dass er schwanzwedelnd deine Waden beschnupperte, dir vor Wiedersehensfreude das Gesicht leckte. Nichts ist vorhersehbar. Weckst du den Hund, musst du mit allem rechnen.
So ist es auch mit den Erinnerungen. Sind sie da, aus der Tiefe des Gedächtnisschlafs gerissen, können sie beißen, schmeicheln, Wunden ins Ich reißen, lächeln, heulen, Zähne fletschen. Es ist schwierig, sie wieder einzuschläfern. Und mehr noch. Jede schleppt ein Gefolge mit sich.
Weckst du einen Hund, sind plötzlich viele wach und ihr Gebell durchdringt die Dunkelheit.
2. Anfänge
Annahütte: Er ist da!
Wer weiß schon Genaueres über die Vorbereitungen der eigenen Ankunft? Bis zum späten Kindesalter ist die Erzeugung vom Nimbus des Geheimnisvollen umhüllt und selbst, wenn man mehr darüber weiß, mag man sich kaum vorstellen, dass die Eltern daran mitgewirkt haben. Man ist plötzlich da und die Freude aller Beteiligten überdeckt die eigene Fremdheit.
Ich kam wahrscheinlich wie üblich mit einem Schrei zur Welt. Was für ein Schrei, sei dahingestellt. Als eher stilles Kind neigte ich schon damals nicht zu Freudenoder gar Siegesschreien. Eher ein verhaltenes Lautgeben, ein zaghaftes Quietschen vielleicht, schien meiner Persönlichkeit angemessen. Ich flutschte aus Mutter Erna heraus, öffnete die verschleimten Augen, erschrak über die unerwartete Helligkeit und gab Laut.
Hurra, ein Junge! Weiß der Teufel, ob sich Erna einen Jungen gewünscht hatte, Fritz jedenfalls, der Gatte, war scharf auf einen männlichen Erstgeborenen. Wie das damals, 1940, so üblich war. Fritz Neukäter und Erna, geborene Schmitt, waren in ihren besten Jahren, als er sie erkannte. Sie empfing, wurde schwanger und Rüdiger entstand. Ich erfuhr nie, was Vater und Mutter empfanden beim ersten Anblick des Stammhalters. Auch so ein Wort von damals, als ob ich jemals einer sein würde, der imstande wäre, einen Stamm zu halten. War selbst so ein Halm im Wind, schwankend und Halt suchend von allerlei Seiten. Von wegen Stammhalter! War Vater Fritz gerührt? Oder war er entsetzt, enttäuscht? Hatte er Besseres erwartet?
Aus Schilderungen der Mutter weiß ich, dass ich glatzköpfig war, mit abstehenden Ohren und häufig und laut quietschte. „Aber wie ich dich geliebt habe“, sagte Mutter Erna immer wieder. Auch noch in späteren Jahren. Ich mochte es irgendwann nicht mehr hören, denn danach folgte immer wieder dieselbe Geschichte: „Wie ich dich geliebt habe! Im Kinderwagen habe ich dich geschoben und da kam jemand und sagte: So ein hässliches Kind!, aber geliebt habe ich dich! Wie ich dich geliebt habe!“ Mutter war einfachen Gemütes. Ob mein Name ihre Idee war? Namen haben immer ihre Zeit. Saisonal bedingt, so wie Spargel oder Erdbeeren. Irgendwann heißen alle Mädchen Julia, wenig später Natalie und danach sind die Yvonnes dran. Bei den Jungen gibt es den Jahrgang der Kevins, dann der Markos und so weiter. Vielleicht waren damals gerade die Rüdigers dran. Horst Rüdiger! Weder Fritz und schon gar nicht Erna waren Kenner nordgermanischer Mythologie. Und wenn doch, warum dann gerade Rüdiger? Ja, da gab es im Nibelungenlied einen Rüdiger von Bechlarn, Markgraf und dem Hunnenkönig untertan. Aber wer wusste das schon! Horst verlor sich zum Glück sehr bald, war wie nicht mehr vorhanden, stand später im Pass nur noch als H mit Punkt, schließlich gar nicht mehr. Und Rüdiger? Bis 1945 war das in Ordnung, klang gut deutsch, und danach, zu Besatzungszeiten wurde in der amerikanischen Zone Rudi daraus, dann wieder Rüdiger. Das war aber schon zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Dabei blieb es dann. Ein guter, brauchbarer Name, zeitübergreifend solide. Mit Rüdiger ließ sich’s leben. Später, in den Achtzigern wünschte ich es kürzer, ließ es aber bleiben, nach neuen Namen zu suchen. Doch so weit sind wir noch nicht. Also: Ich wurde 1940 in die Welt gesetzt. Es hätte bessere Zeiten gegeben, geboren zu werden. 1940, ein Jahr wie die Jahre davor. Unruhige Zeiten. Fritz, der Vater, ging seiner täglichen Arbeit als Ingenieur nach. Er las regelmäßig Zeitung und hörte Volksempfänger. Er war skeptisch, was die großen Zeiten betraf. Erna war mit ihrem Fünf-Monatsbauch beschäftigt und machte den Haushalt. Ihr war egal, dass im Januar Hermann Göring zum Leiter der Kriegswirtschaft ernannt und den Juden in Deutschland der Bezug von Schuhen und Leder verboten wurde. Als sie im Februar hörte, dass die Sowjetunion und das Deutsche Reich ein Wirtschaftsabkommen schlossen, das den Austausch kriegswichtiger Rohstoffe vorsah, konnte sie damit gar nichts anfangen. Als Fritz versuchte, ihr die Bedeutung dieser Meldung zu erklären, sagte sie: „Der Junge strampelt arg herum. Das ist ein Wilder.“ Woher wusste sie, dass es ein Junge wird. Es war wohl mehr der Wunsch, dem Gatten eine Freude zu bereiten und ihm zu zeigen, dass es Wichtigeres gab als irgendwelche Wirtschaftsabkommen. Auch, als es der Roten Armee gelang, mit einer Großoffensive die finnische Verteidigungslinie zu durchbrechen, ließ sie das kalt. Nicht aber, als am siebten März das größte Schiff der Welt, der Luxusdampfer Queen Elizabeth, nach seiner geheimen Jungfernfahrt in New York eintraf. Es wurde von nun an als Truppentransporter benutzt. „So ein schönes Schiff“, seufzte Erna. Sie hatte jetzt oft wahren Heißhunger auf eingelegte Heringe. Als am 18. März Adolf Hitler und Benito Mussolini sich auf dem Brenner-Grenzbahnhof trafen und die Meldung im Volksempfänger mit einer Siegesfanfare angekündigt wurde, wurde ihr auf einmal schlecht. Sie bekam kaum Luft, hauchte im Wegtaumeln „Fritz!“ Und der, obwohl er aufmerksam dem Radiosprecher lauschte, war geistesgegenwärtig genug, die strauchelnde Erna aufzufangen und so möglicherweise mein embryonales Dahinscheiden zu verhindern. Der herbeigerufene Arzt konstatierte die Ohnmacht als nicht besorgniserregend. Von Stund an tupfte Erna regelmäßig Klosterfrau-Melissengeist auf die Schläfen und ich wuchs ohne weitere Beeinträchtigungen im Mutterleib. Ob ich mitbekam, dass am 9. April die deutsche Wehrmacht ohne Kriegserklärung in Dänemark und Norwegen einmarschierte und Dänemark nach einem Tag kapitulierte, ist unwahrscheinlich. Der Winzling hatte knapp einen Monat vor seiner Sichtbarwerdung andere Sorgen. Wer weiß, ob mir das Fruchtwasser nicht zu kalt war. Später wurde ich begeisterter Schwimmer. Rückenschwimmer vor allem. Vielleicht rührten Ernas Klagen daher, dass der Fötus sich bereits mit heftigen Bewegungen auf eine Schwimmkarriere vorbereitete. Die Niederkunft kam näher. Der norwegische König floh aus Oslo in den Norden des Landes. Schweden erklärte seine Neutralität gegenüber dem deutschen Überfall und dann, am Dienstag, den 14. Mai war es so weit. Die Wehen setzten am späten Vormittag ein. Um 12.30 Uhr erblickte Horst-Rüdiger das Licht der Welt. Man hatte schon zwei Tage vor dem berechneten Termin im ehelichen Schlafzimmer alles vorbereitet. Vater Fritz war ausquartiert worden, hatte auf dem Sofa im Wohnzimmer nächtigen müssen. Die Tür zum Schlafzimmer war offengeblieben, für alle Fälle. Am Morgen des 14. hatte man Decken, Tücher, warmes Wasser bereitgestellt. Als die Hebamme eintraf, war Horst Rüdiger schon auf halbem Wege, den Kopf voran, wie es sich gehörte. Erna presste nach allerbesten Leibeskräften, die Hebamme half nach und Vater hielt sich die Ohren zu. Das Erste, was Klein-Rüdi von sich gab, war so eine Art Rülpsen, als ob er schlecht gegessen hätte. Die beiden Frauen waren beunruhigt, doch dann entrang sich der Säuglingsbrust ein Schrei, quäkend, grell, eindringlich. Erna fiel in die nach geleisteter Arbeit wohlverdiente Bewusstlosigkeit, die Hebamme trennte die Nabelschnur ab, säuberte den Kleinen und gab ihm einen Klaps auf den Hintern. Was mich zu einem länger andauernden Brüllen veranlasste. Vater Fritz wurde verständigt, kam zögernd und begrüßte erleichtert, aber auch befremdet den Stammhalter. Er hatte sich anderes darunter vorgestellt. Doch immerhin war ich ein Knabe. Also war es ein denkwürdiger Tag. „Gut gemacht, Erna-Mädchen!“ Fritz umarmte seine Gemahlin und trank ein großes Glas Schnaps. Erna drückte das kleine Etwas an die Brust. Ich hatte ein rotes Gesichtchen und schrie immer noch aus Leibeskräften. In der Reichskanzlei in Berlin öffnete man zur gleichen Stunde mehrere Flaschen Sekt, denn der Wehrmacht war mit dem Durchbrechen der französischen Front bei Sedan die Abspaltung der französischen Truppen von Briten, Belgiern und Niederländern gelungen. Mir war das schnurzegal: Mir war wichtig, dass ich zum ersten Mal die mütterliche Brust fand. Etwas Weiches, angenehm Warmes. Heftig saugte ich am rechten Nippel, schrie auf, als die Mama mich davon trennte, war aber kurz darauf auch mit dem linken zufrieden. Ich ahnte noch nicht, in welche unruhigen Zeiten ich hineingeboren worden und dass das Leben kein Zuckerschlecken war.
Ich war also da. Es war alles in Ordnung an mir, nichts fehlte. Vater Fritz hatte kaum anderes erwartet: Wie konnte seinen Lenden etwas entsprungen sein, das nicht den Regeln entspräche. Mutter Erna war nicht so sicher. Sie untersuchte sehr bald nach der Arbeit des Gebärens und den ersten impulsiven Mutterfreuden den Winzling. Das von den Anstrengungen des Sich-Heraus-Schälens durch den engen Kanal noch rote Gesichtchen wies alle Anzeichen des Üblichen auf: Nase, Mund, Ohren, Augen. Dass die noch geschlossen und von einem durchsichtigen Schleim verschmiert waren, mochte Erna leicht übersehen. Der Kopf war haarlos, aber, das werde sich bald geben, tröstete die Hebamme, die sich, nachdem sie das Kind übergeben hatte, verabschiedete. „Meine Arbeit ist getan! Viel Glück denn auch. Und wenn etwas sein sollte, Sie wissen, wo ich zu finden bin.“ Mutter dankte strahlenden Auges und setzte die Inspektion des Nachkömmlings fort. Arme, Beine, zehn Finger, zehn Zehen. Der Bauch war etwas aufgeblasen, was, wie sie hoffte, weniger auf einen Defekt, als auf einen Fresssack schließen ließ. Ich war dreiundfünfzig Zentimeter lang, bei gestrecktem Körper, was aber zunächst selten vorkam. Mein Geburtsgewicht war mit 4220 Gramm im Normbereich. Gewichtig aber nicht dick. In den nächsten Tagen schlief ich viel, schrie, wenn ich aufwachte, was den Vater nervte, die Mutter aber für normal hielt. Während sie mich windelte, schaute Fritz bisweilen zu, aus sicherer Entfernung. Dann gab sie mir die Brust. Sie verfügte über reichliche Vorräte an Muttermilch und war sich sicher, dass sich darin alle für das Wachstum des Säuglings wichtigen Nährstoffe befanden. Sie hatte auch gelesen, dass mit der Muttermilch das Baby mit so genannten Immunglobulinen versorgt wird und dass diese Stoffe das Kind vor Infektionen schützen. Das machte sie glücklich: Sie konnte ihrem Kind etwas geben, was Fritz nicht zu geben vermochte. Zu dieser Zeit fand Erna ihren Mann sehr klotzig und überflüssig. Ich wuchs schnell und nahm an Gewicht zu. Mitte Juni stellte Mutter erfreut fest, dass ihr Sohn mit den Augen ihrem Finger folgte, den sie hin und her bewegte. Er fixierte ihn und lauschte offensichtlich ebenso interessiert den Geräuschen, die sie von sich gab.
Ich brüllte laut und viel, war nur zufrieden, wenn ich Ernas Nippel fand und mich an ihrer Milch labte. Wo ich war und warum, war mir in diesen ersten Lebensmonaten egal.
Ich kam in einem Ort namens Annahütte an. Für meinen Vater war Annahütte ein „Muster an negativer Schönheit mitten im Braunkohlerevier“. Annahütte war ein Ortsteil von Schipkau in Brandenburg. Seit 1856 gab es dort eine Glashütte und später wurde Braunkohle abgebaut. Das Dorf wuchs und als die Glashütte zu einem Industriekomplex ausgebaut wurde, erhielt der Ort eine Schule, eine Post, einen Eisenbahnanschluss und sogar ein Freibad. Zu Dienstmädchen Doras größter Freude. Vater Fritz war der technische Leiter des Glaswerkes, das hochwertiges Bleikristall herstellte. Seine Position verschaffte den Neukäters etliche Privilegien.
Im Oktober, gerade mal fünf Monate nach meiner Ankunft, überraschte Fritz seine Frau damit, dass er mit ihr nach Berlin zu fahren gedenke. Dort werde ein Film gespielt, von dem alle redeten: Jud Süß. Fritz machte sich nichts aus Filmen, darum wunderte sie sich über die Idee. Sie hatte den Verdacht, dass ihr Gatte eifersüchtig auf den Sprössling war. Erna allerdings liebte Filme. Sie hatte ihre Idole, Veit Harlan und Christina Söderbaum. Sie fand, dass die Söderbaum herrlich spielte, Heinrich George als Jud Süß aber fand sie grob und ungeschlacht. Der Film gefiel ihr nicht.
In Berlin schlief sie das erste Mal nach der Geburt wieder mit dem Gatten und war enttäuscht.
Mich hatte man zu Hause in guten Händen zurückgelassen. Dorothea, das Dienstmädchen, genannt Dora, kümmerte sich um mich. Nur die Brust konnte sie mir nicht geben. „Aber“, sagte Erna, „zwei Tage wird er es wohl mal mit Milch aus dem Fläschchen aushalten“. Dem Vernehmen nach quengelte ich ein wenig, fand aber offensichtlich an Dora Gefallen. Ich wiederholte häufig meine eigenen Laute, lachte viel und jauchzte. Auch betastete ich gerne Doras Gesicht.
Nach ihrer Rückkehr von Berlin konnte Erna ihre Enttäuschung darüber nicht verhehlen, dass ich mich mehr mit dem Gesicht Doras als mit dem ihren beschäftigte. Als Vater mich auf den Arm nahm, soll ich sogar gebrüllt und die Hände nach Dora ausgestreckt haben. Dennoch beschlossen meine Eltern, Dorothea dauerhaft als Kindermädchen zu engagieren. Man konnte es sich leisten.
Fritz und Erna
Wann beginnt man, sich Gedanken über seine Erzeuger zu machen? Sicher nicht in frühen Jahren. Während des Heranwachsens sind sie einfach da, haben dafür zu sorgen, dass man etwas zu essen und ab und zu neue Klamotten bekommt, verdienen Geld und verwalten den Haushalt, passen auf, dass einem nichts geschieht, befehlen, was zu tun und lassen ist, ärgern, schränken ein, sanktionieren, dirigieren. Manchmal will man nichts mit ihnen zu tun haben, aber meistens braucht man sie, und die Vorstellung, sie wären nicht da, kann einen sogar zur Verzweiflung bringen. Wird man älter, fängt man an, über sie nachzudenken. Der hohe Sockel, auf dem Vater und Mutter stehen, wird brüchig. Die hehren Standbilder beginnen zu bröckeln. Erste Risse zeigen sich. Die Erzeuger erweisen sich als nicht mehr unfehlbar. Die Pubertät greift um sich, das Leben zeigt einem die Zähne.
Aber so weit bin ich hier noch längst nicht.
Vater Fritz war bäuerlicher Herkunft. Ein Bauernhof im Dorf Voerde am Niederrhein prägte seine frühen Jahre. Zwischen zwei Brüdern und zwei Schwestern, alle älter als er, umgeben von Kühen und Schweinen und aufgezogen mit den Produkten intensiver Milchwirtschaft und zweitrangiger Schweinezucht, wuchs er auf. Fritz war schmächtiger als seine Brüder, so eine zerbrechliche halbe Portion. Bei einer Kindheit zwischen Kuh- und Schweinestall wurde ihm früh klar, dass er nicht Bauer werden wollte, zumal bei zwei älteren Brüdern für ihn sowieso kein Platz im Elternhaus bleiben würde. Johann, der Erstgeborene und kräftigste würde den Hof übernehmen. Caspar, der Mittlere, lernte das Schmiedehandwerk und wurde nach dem Verlust seines rechten Armes Postmeister. Mit Fritz wusste man lange nichts anzufangen. Die beiden Schwestern wurden, wie es sich gehörte, weggeheiratet. Fritz suchte nach Auswegen aus der Landwirtschaft. Zunächst führte an der Dorfschule mit prügelndem Lehrer kein Weg vorbei. Er biss sich durch und schaffte später irgendwie die mittlere Reife. Da ihm alle attestierten, dass er technisch nicht unbegabt sei, suchte er eine technische Hochschule, die weit genug vom Heimatort entfernt, aber nah genug war, um kein Heimweh zu bekommen. In Hagen in Westfalen gab es eine Ingenieurschule. Die Eltern, die eigentlich so etwas wie Studieren für überflüssig hielten, sahen aber schließlich doch ein, dass, wenn es denn unbedingt sein müsste, der Junge etwas Geld zum Leben brauchte und so konnte Fritz ein kleines Zimmer in der sauerländischen Stadt an der Lenne beziehen. Um sich nicht zu einsam zu fühlen, trat er umgehend einer studentischen Verbindung bei, trug Käppi, trank eifrig Bier, vermied es aber, sich sein schmales Gesicht durch Mensuren verunstalten zu lassen. Er wurde älter und war irgendwann so weit, ein respektables Ingenieurdiplom vorzuweisen.
Ich erlebte meinen Vater immer als einen ‚Homo technicus‘. Alles, was sich drehte, bewegte, sich zusammenfügen ließ, faszinierte ihn. Ihm fehlte aber das Gespür für das Nicht-Abwägbare, Irrationale. Gefühle oder Leidenschaften konnte er zwar nicht leugnen, doch sie waren ihm unheimlich und am liebsten hätte er sie für nicht vorhanden erklärt. Er litt darunter, dass es sie trotzdem gab und dass sie ihn bedrängten, doch es fehlte ihm die Fähigkeit, damit umzugehen. Er zog sich einen Mantel von Unnahbarkeit und Forschheit über und stieß die, für die er so stark empfand, vor den Kopf. Wenn er, freigiebig, wie er war, etwas gab, warf er einem das Geschenk quasi vor die Füße. „Da nimm, und kein Wort mehr darüber!“ Das kleine Streicheln, das sanfte Mit-der-Hand-über-den-Kopf-Fahren, das war ihm nicht gegeben. Ich weiß nicht, warum meine Schwester und ich Vater zeitlebens Papi nannten. Von einem bestimmten Alter an reden Kinder ihre Eltern mit den Vornamen an. Fritz und Erna, das hätte auch ganz gut zu meinen Eltern gepasst. Aber wir blieben bei Mami und Papi. Eigentlich entsprach das so gar nicht der eher kühlen Distanziertheit unseres familiären Miteinanders. Das war wohl der Erbteil niederrheinisch-bäuerlicher Reserviertheit.
Nicht weit von Hagen entfernt liegt die Kleinstadt Hohenlimburg. Dort war Erna als zweites Kind des Arbeiters Gustav Schmidt und seiner Frau Auguste zu einem stattlichen Backfisch herangereift. Im großstädtischen Hagen besuchte das Mädchen, dem der Sinn nach Höherem stand, die Höhere Töchterschule, mit dem Ziel, perfekt in Kurzschrift und Schreibmaschine, in einem Büro Karriere zu machen und vielleicht dort den Mann fürs Leben zu finden. Doch sie war unternehmungslustig genug, selbst auf die Suche zu gehen. Sie tanzte Charleston und Tango, liebte zu lachen und zu flirten. An manchen Samstagabenden turtelte sie verwegen mit einer Freundin über die Tanzböden der näheren Heimat. Wie sie den Weg zu den Studenten fand, blieb ihr Geheimnis.
Wie mochten Erna und Fritz zusammengekommen sein? Es war vielleicht anlässlich eines jener damals häufigen Sängerfeste oder eines feucht-fröhlichen studentischen Verbindungsabends. Fritz stand mit dem Rücken an den Tresen gelehnt, ein halbvolles Bierglas in der Hand und sah dem Treiben auf der Tanzfläche zu. Er war kein guter Tänzer, ihm fehlte der Mut zu gewagten Schritten. Die Kapelle spielte einen Charleston, mehr schlecht als recht, es war schon nach Mitternacht. Erna trug ein geblümtes Kleid und tanzte, dass sich beim Drehen der Rock hob und ansehnliche Beine freigab. Der runde Ausschnitt des Frühlingsblumenkleides ließ wohlgeformte Brüste erkennen. Als der Tanz zu Ende war, atmete sie tief aus und ließ sich an einem Tisch in seiner Nähe nieder. Ihre Blicke trafen sich. Er überwand seine Scheu und fragte sie nach ihrem Namen. Sie hieß Erna und er war Fritz. Ob der Blitz einer plötzlichen Liebe die beiden traf, bleibt ungeklärt, jedenfalls beschlossen sie, ein Jahr nach der ersten Begegnung, im Jahre 1938 den Bund der Ehe einzugehen. Es war das Jahr des Anschlusses Österreichs ans Deutsche Reich, der Reichspogromnacht, aber auch der Erstbesteigung der Eiger-Nordwand durch Heinrich Harrer. Waren das Ereignisse, die dazu beitrugen, sich das Jawort zu geben und zu versprechen, füreinander da zu sein, bis der Tod sie scheide? Eher nicht. Vielleicht war es einfach die große und immerwährende Liebe. Rüdiger war noch nicht vorhanden, nicht einmal als Gedanke und wenn man mich um Rat gefragt hätte, hätte ich wohl der unsicheren Zeiten wegen von einer Verehelichung abgeraten. Erna war in jungen Jahren und auch in mittleren das, was man viel später einen flotten Feger nannte. Und Fritz, der ließ auch nichts anbrennen. In Jünglingsjahren durfte ich ab und zu Ernas Tränen auffangen, die sie wegen außerehelicher Fehltritte des Gatten vergoss. Aber unter dem Strich blieben sich beide nur wenig schuldig. Auch damals schon galt es, zu leben und leben zu lassen. Die Ehegemeinschaft funktionierte: Erna war gut aussehend, fleißig, gefügig und fruchtbar, Fritz erfinderisch, strebsam und geschickt genug, sich unentbehrlich zu machen. Erna war einfachen Gemütes, unkritisch, politikfern, doch den Nazis durchaus gewogen. Fritz hingegen mochte die Braunen nicht, hielt sich von ihnen fern und schaffte es, dank seiner Stellung in einem für die Rüstung wichtigen Betrieb um einen Fronteinsatz herumzukommen. In der Heimat brauchte man seine Kenntnisse und Fähigkeiten dringender. Fritz bekleidete einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz und als das Ehepaar nach einem Wohnortwechsel ein neues Zuhause bezog, stand 1940 einer familiären Zuwachsplanung nichts im Wege. Meinen Erzeugern ging es gut, selbst in diesen unsicheren Zeiten. So kam es, dass sie im Mai erfreut einen strammen Knaben begrüßen konnten. Es spricht für Vaters Schlitzäugigkeit oder auch für seine Fähigkeiten als vorausschauender und sorgender Familienvorstand, dass die junge Familie in diesen von Krieg und Entbehrung gebeutelten Zeiten gut über die Runden kam. Meinen Eltern ging es den Umständen entsprechend prächtig. Fritz‘ Stellung im Betrieb, dessen Erzeugnisse als kriegswichtig galten, war unangreifbar und erlaubte es, ein Haus zu bewohnen, das beinahe schon als herrschaftlich zu bezeichnen war. Man konnte sich sogar ein Dienstmädchen leisten, das viel zu Rüdigers Heranwachsen beitrug. Dora war Amme, Putzfrau und Köchin zu gleichen Teilen.
Zu essen und trinken gab es bei Neukäters stets genug und da Vater Jäger war und regelmäßig mit der Flinte durch die Reviere zog, fehlte es auch hin und wieder nicht an herzhaftem Wildbret. Zwei- oder dreimal hatte ich als Vierjähriger neben ihm in der Morgenfrühe auf einem Hochsitz gesessen. Papi hatte den Drilling im Anschlag, lauerte irgendeinem Rotwild auf und ich langweilte mich. Doch ich durfte kein Wort reden. Im Wald hatte man zu schweigen. Mir tat das Reh leid und Fleisch mochte ich gar nicht. Fritz sah bald ein, dass aus mir kein Weidmann werden würde und nahm mich nicht mehr mit auf die Pirsch. Er war enttäuscht von mir. Auch dass Erna mich lange stillen musste, störte ihn. Doch ich wuchs und gedieh dank der nahrhaften Muttermilch und der selbstgemachten Breie. Man sagt, ich habe aber häufig genörgelt und sogar von kleinkindhaften Wutanfällen war die Rede.
Nicht etwa, dass Fritz und Erna die Zeitläufte ignorierten, sie sorgten sich schon, vergaßen aber über allem Nachdenken nicht, dass das Leben auch seine angenehmen Seiten hatte. Sie machten das Beste daraus und das schien ihnen auch ganz gut gelungen zu sein. Immerhin waren sie noch nicht einmal in der Mitte des Lebens.
Kleinkinder verfügen kaum über Erinnerungen an frühe Ereignisse und Erlebnisse, aber bestimmte Bilder der frühen Kindheit tauchen schon bisweilen auf. In meinen verschwommenen Erinnerungen gibt es eine Bildfolge, die sich seltsamerweise mit dem Begriff ‚Bad Erna‘ verbindet. Vielleicht ist die Namensgleichheit ein Omen, denn in Bad Erna gab es zum ersten Mal in meinem Leben erinnerten Kummer und frühe Verlustängste. Viele Jahre später erzählte mir meine Mutter, dass es sich bei besagtem Bad Erna um eine größere Kiesgrube handelte. Wie auch heute noch üblich, waren auch damals solche Bade- oder Baggerseen Örtlichkeiten, in denen man sich ausgelassen zu bierseligen Geselligkeiten und Grillgelagen traf, um die Alltagssorgen für eine Weile hinter sich zu lassen.
Möglicherweise war es ein milder Sommerabend, an dem Fritz und Erna Getränke, Grillgut und den Nachwuchs ins Auto packten. Fritz war der stolze Besitzer eines DKW F8. Dieser in Zwickau gebaute sogenannte Frontwagen, der seit 1939 auf dem Markt war, war sein ganzer Stolz und auch Beweis dafür, dass er sich als technischer Betriebsleiter einiges erlauben konnte. Erna glänzte mit bescheidenem Stolz auf dem Beifahrersitz. Die Autofahrt überstand der Sprössling Rüdiger klaglos. Auch dass ich am Ufer des Sees abgestellt wurde, Grillgerüche, Qualm und fröhliche Gesänge der Eltern und deren Freunde ertrug, sprach für meine kräftige Konstitution. Es ist anzunehmen, dass ich zwischenzeitlich durchaus von der fürsorglichen Mutter gefüttert und wahrscheinlich auch gewindelt wurde, aber irgendwann verfrachtete man das möglicherweise plärrende Kleinkind in den Fond des DKW und vergaß über nächtlichem Feiern und Fröhlichsein den Knaben. An dieser Stelle etwa setzt bei mir eine schemenhafte Erinnerung ein: Ich sehe mich in einem käfigähnlichen Gehäuse liegen, über mir eine graue Decke und die Wärme der Sommernacht macht mir zu schaffen. Weil mir heiß ist und ich Angst habe, tue ich das, was ich am besten kann: Ich weine, heule, brülle! Aus Leibeskräften. Eigentlich war ich gewohnt, dass auf mein Brüllen hin immer jemand kam und mir Erleichterung verschaffte. In dieser erinnerungsträchtigen Nacht aber kümmerte sich niemand um mich. Ich vernahm das nahe Singen der Erwachsenen, hörte sogar Vaters Stimme heraus, schöpfte Hoffnung, als eine Gesangspause eintrat und verzweifelte schier, als der Gesang mit noch höherer Inbrunst wieder einsetzte. Ich holte tief Atem, füllte Brustkorb und Lunge und erhob meine Stimme zu vollster Stärke. Ich brachte so kräftige, Mark und Bein durchdringende, schrille Schreie zustande, dass mir selbst davon Angst und bange wurde. Als das auch nichts half und ich die stimmungsvollen Gesänge vom Seeufer nicht zu übertönen vermochte, ging ich zu einem leisen Schluchzen und schließlich zu resignierendem Wimmern über. Ob Erna und Fritz mich schlichtweg vergessen hatten, weil sie ganz in ihrer kriegs- und notvergessenen Fröhlichkeit im Kreise der Freunde aufgegangen waren, oder ob sie vielleicht der Theorie anhingen, dass beständiges Schreien eines Kindes die Lungen stärke, sei dahingestellt. Auch die längste Nacht nimmt einmal ein Ende und, da bin ich mir sicher, nach einer Ewigkeit stillen Leidens nahm Mama Erna mich in ihre gütigen Arme und alles war wieder gut. Zwar roch ihr Atem etwas seltsam und die Brust mochte sie mir auch nicht geben, aber ich war so froh, nicht mehr allein und verlassen schreien zu müssen, dass ich sehr bald und zufrieden einschlief.
Im tiefsten Innern meines Herzens bin ich mir sicher, dass dieses Erlebnis eine kleine bleibende Delle in meine Psyche geschlagen und hinterlassen hat. Was wäre aus mir geworden, wenn nicht Bad Erna mir so früh die Grenzen meines Wollens aufgezeigt hätte. Auf diese prägende Nacht hin angesprochen, wollten weder Fritz noch Erna zufriedenstellend Auskunft geben. Ausweichend und beschwichtigend hörte ich immer wieder, man habe immer nur das Beste für mich gewollt. Das Beste aber war mir nicht genug. Jedenfalls nicht in Bad Erna.
Doch nicht nur Bad Erna hatte mögliche schädliche Folgen für meine Psyche. Auch ein anderes Ereignis hinterließ Kerben in meinem Ich. Eigentlich war Vater eine warmherzige, liebevolle Seele. Dass er seine Gefühle nicht richtig zu zeigen verstand, dafür konnte er nichts, da war seine trockene, bäuerliche Erziehung dran schuld. Fritz aß gerne gut und Erna kochte vorzüglich und reichlich. Vielleicht deshalb galt der Spruch „Was auf den Tisch kommt, wird auch gegessen“ ohne Einschränkung. Nur war ich aber ein mäßiger Esser und manchmal schmeckte es mir gar nicht. So etwas war aber nicht vorgesehen und schon gar nicht geduldet im Neukäterschen Haushalt. So geschah es, dass ich in meinem Essen herumstocherte, Eintopf, Kartoffelbrei, irgendetwas Weiches, Gemüsiges. Mutter Erna ermahnte: „Nun iss mal schön auf, das schmeckt doch lecker.“ „Ich mag das nicht!“, maulte der undankbare Sohn, was Vater zu einem mit dunklem Unterton gemurmelten „Iss jetzt endlich!“ veranlasste. Ich verweigerte wie ein Pferd, das störrisch vor einem Hindernis blockt und starrte auf den halbvollen Teller. „Iss jetzt auf, sonst ...!“ Das „sonst“ kannte ich schon. Neben dem Küchentisch gab es eine Tür zur Speisekammer. In der war es dunkel, und vor einem Regal voller Gläser mit Marmeladen und eingemachten Gemüsen standen ein kleiner Tisch und ein Stühlchen. Ich hasste diese Möbel und fürchtete mich vor der dunklen Kammer. Aber der Abscheu vor dem breiigen Essen war stärker als die Furcht vor dem Dunkel. Ich holte tief Luft und plapperte: „Nicht essen mag! Nicht schmeck lecker!“ Und um der Ablehnung noch einen letzten Schub zu geben, fügte ich noch ein bekräftigendes „Bäähh“ hinzu, was Vaters Ärger zur Wut anschwellen ließ. Fritz, der Warmherzige, vergaß sein sanftes Gemüt und erhob die Stimme: „Ab mit dir in die Speisekammer!“ Mutter versuchte zu beschwichtigen: „Aber Fritz, lass ihn doch!“ „Nichts da, es wird gegessen, was auf den Teller kommt. Los, steck ihn ins Loch!“ „Ach Fritz ...!“ Aber der fuhr ihr ins Wort: „Nein, der Bursche muss lernen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Andere wären froh, wenn sie überhaupt etwas zu essen hätten. Basta!“
Ich glaube, dass ich eine Stunde lang in der Finsternis saß, erst leise weinend, dann lauter, aber aufgegessen habe ich nicht. So entstand mein zweites Trauma, das mir viele Jahre später noch einmal zu schaffen machte.
Ich war längst im Beruf und war auch schon eine Weile verheiratet, als wir mit Freunden einen Tag der offenen Tür im anthroposophischen Zentrum in Kassel besuchten. Neben anderen Vorführungen gab es auch eine dramatische Bearbeitung des Märchens Dornröschen, die sich großen Besucherandrangs erfreute. Die Aufführung fand in einem Raum statt, dessen Fenster vollständig verdunkelt waren und als der Raum bis zum letzten Platz besetzt war, verschloss man auch die Eingangstür. Es war stockdunkel. Ich vernahm ein leises „Dornröschen schlafe hundert Jahr“ und auf einmal saß ich wieder eingesperrt und umfangen von der Dornenhecke auf meinem Stühlchen in der finsteren Speisekammer. Mein Herz begann zu rasen, ich bekam Schweißausbrüche und mir wurde schwindlig vor den Augen. Ich wollte schreien, doch mir versagte die Stimme. Ich wollte hinaus, aber alle Türen waren verschlossen. Ich hörte ferne Worte, Vaters herrische Stimme, und ich war zugleich außer mir. Meine Augen suchten Licht, meine Lungen Luft. Es war so eng und kalt in dem Raum. Bis ich die Hand meiner Frau auf meiner spürte. Sie war warm und hielt mich fest. Zum Glück fanden wir den Ausgang und zum Glück war ein befreundeter Arzt zur Stelle, der meinen Anfall ernst nahm. Wir fuhren zu ihm. Auf der Fahrt ließ mein Herzrasen etwas nach. Aber erst, als ich eine Valium-Tablette geschluckt hatte, wurde ich ruhiger. Ich begann zu erzählen, wie ich damals in der dunklen Kammer vor dem Breiteller gesessen hatte. Als ich von diesen frühen Kindheitserinnerungen berichtete, wurde mir allmählich besser und mein Herzschlag normalisierte sich.
Dora und der Beginn einer Schwimmkarriere
Heute macht alle Welt sich von allem ein Bild. Wir ertrinken in der Flut von Abbildungen der Realität und dem, was uns geschickte Manipulateure als Realität verkaufen wollen. Doch davon soll hier nicht die Rede sein, wohl aber davon, dass ich kaum Bildhaftes aus meiner frühen Kindheit vorzuweisen habe. Fotos waren damals selten und stellten etwas Bleibendes dar, etwas fürs Leben. Eines der wenigen Fotos zeigt mich als Dreijährigen: auf einem Tischchen stehend, auf gleicher Höhe mit der sitzenden Erna. Aus dem Matrosenblüschen ragt halslos ein Pausback. Der linke Mundwinkel schickt ein Fältchen zum stumpfen Nasenflügel. Die großen Kugelaugen wissen nicht recht, was sie suchen. Rüdiger mit brav gescheitelten Haaren, einer abstehenden Haartolle wie ein Entenschwänzchen und einem Kleinkindlachen auf dem runden Gesicht. Weißes Hemd und kleinkariertes Pepitahöschen bis zu den stämmigen Knubbelknien. Weiße Söckchen lappen über die geschnürten Kleinkinderstiefel. Erstaunlich, was man damals schön fand.
Von Dorothea, Dora, dem Dienstmädchen, das mich schaukelte, in die Luft warf, wieder auffing und mich herumschleuderte, bis ich vor Jubel jauchzte, gab es kein Bild. Wenn ich versuche, mich an Dora zu erinnern, stellt sich nur so ein Gefühl von Fülle und Weichheit ein und ich glaube mich zu erinnern, dass sie gut roch. Nach Vanille vielleicht, oder Zimt und Zucker. Dorothea war immer da, Mama oft, Papa selten. Als ich sprechen lernte, sagte ich Mami zu Mutter, Papi zu Vater und Dora zu der, die ich damals am meisten liebte. Mami und Papi blieben, Dora aber geriet irgendwann in Vergessenheit, verschwand aus meinem Leben, wurde zu einer Fee aus dem Märchenland. 1943 aber war sie noch sehr da.
Was für ein Jahr voller schicksalhafter Ereignisse, von denen der kleine Rüdiger nichts mitbekam und schon gar nichts verstand. Wenn seine Eltern besorgt schauten, hatte er ein schlechtes Gewissen: Er hatte wieder einmal in die Hose gemacht. Aber eigentlich verlangte noch niemand von einem Dreijährigen die Beherrschung des Schließmuskels. Es waren die schlimmen Meldungen, die Fritz zu Ohren kamen und die er seiner Erna berichtete, die aber nur mit halbem Ohr zuhörte und ihn besänftigte: „Es wird nichts so heiß gegessen …“ Sie ließ oft solche Halbsätze stehen und dann wusste man nicht, woran man war. Aber schlimm waren die Nachrichten schon. General Paulus kapitulierte mit seinen Truppen vor Stalingrad und Joseph Goebbels proklamierte in der Sportpalastrede den totalen Krieg. Mein Vater hielt beides für gleich folgenschwer. Zu meinem dritten Geburtstag bombardierten amerikanische Flugzeuge den Kieler Hafen, Mutter Erna backte trotzdem einen Rhabarberkuchen und zündete drei Kerzen darauf an.
Einen Monat später lernte ich schwimmen. Und das kam so: Wir wohnten immer noch in der großen Werkswohnung und dank Vaters Position ging es uns gut und meine Eltern konnten sich immer noch ihre Dorothea leisten. Dora war der gute Geist im Haus. Sie wusch und bügelte, half beim Aufräumen und als Ende des Jahres die kleine Schwester in Mutters Bauch zu wachsen begann, sorgte Dora dafür, dass es ihr an nichts fehlte. Ohne Dora war das Haus leer und das Leben schal und ohne Gewürze. In der Erinnerung steht sie vor mir als eine stämmige, breitschultrige Brünette. Dora lief auf kurzen Beinen durchs Leben und wenn sie mich an ihre ausladende Brust drückte, bekam ich warme Gefühle. Dora strahlte Geborgenheit aus und immer währende Sicherheit. Dora war in vieler Hinsicht einmalig und etwas Besonderes. Unter anderem verfügte sie über eine Fähigkeit, die damals selten war und für Frauen geradezu anrüchig: Sie konnte schwimmen, vermochte es, sich auch in tiefem Wasser vorwärts zu bewegen. Ob sie sogar einen bestimmten Schwimmstil beherrschte, habe ich nie herausgefunden. Fritz und Erna, die beide von jeglicher Bewegung in freiem Wasser nichts hielten und überhaupt des Schwimmens nicht mächtig waren, betrachteten Doras Wasserneigung mit Misstrauen, wollten sie ihr aber, da ihr sonst kein Fehlverhalten nachzusagen war, nicht verbieten.
Es gab in Annahütte so eine Art Schwimmbad, ein zementiertes Becken mit Leitern zum Hineinklettern, vielleicht sogar einem federnden Sprungbrett. Jedenfalls verbrachte Dora einen Teil ihrer gering bemessenen Freizeit in diesem Bad, um sich mit sportlicher Betätigung von der Hausarbeit zu erholen. Natürlich trug sie dabei zeitgemäß angemessene Bekleidung. Dora war der Ansicht, dass der Schwimmsport äußerst gesund und anregend sei und da sie meine Eltern nicht davon überzeugen konnte, hielt sie sich an den Sohn und nahm mich an einem sommerlichen Tag mit in das Bad. Sicherlich war das Wasser nicht so warm, dass ich freiwillig zum Plantschen bereit war und ganz sicher war mir nicht danach, mich mit dem ganzen Körper in das Nass zu begeben. Jedenfalls waren Doras Versuche, mich hinein zu locken, zunächst vergeblich. Mag sein, dass sie irgendwann die Lust verlor oder sie eine stille Wut überkam, weil ich mich sträubte, mich den Annehmlichkeiten des Badens hinzugeben, jedenfalls packte sie mich in einem Ansturm von Gewaltanwendung, machte mich gehörig nass und warf mich einfach ins Wasser. Was dann geschah, verschwindet im Nebel der Geschichtslosigkeit. Möglicherweise strampelte ich und hielt mich, dem Überlebenstrieb gehorchend, eine Weile über Wasser. Vielleicht sank ich aber auch wie ein Stein dem Grunde entgegen und wurde erst im letzten Moment von der Schwimmerin aufgefangen, an die Brust gedrückt und in die Wärme des Lebens zurückgeholt. Denkbar war aber auch die Version der leichtsinnigen Dora. „Denkt nur“, erzählte sie stolz am Abend den Eltern, „Der kleine Rüdiger kann schwimmen. Er ist eine richtige Wasserratte.“ Wasserratten hatte es noch nie, weder in Fritz‘ noch in Ernas Familie gegeben, und als etwas Wünschenswertes konnte das auch nicht gelten. Aber da Fritz und Erna keine Vorstellung davon hatten, was Schwimmen bedeutete, nahmen sie es als gegeben hin, dass ihr Sohn etwas konnte, was ihnen nicht gegeben war. Dora hätte auch sagen können, dass der kleine Rüdiger in der Nase bohren oder auf einem Bein stehen könne. Lauter zu gar nichts nützliche Tätigkeiten. Aber schwimmen, was heißt das schon? Kein Dreijähriger kann schwimmen. So ein Knirps mag aber sehr wohl, mit den Händen rudernd und den Beinen schaufelnd, sich über Wasser halten, ja sogar mit dem Kopf unter Wasser prusten und schnauben, aber richtig schwimmen kann man das nicht nennen. Unwiderlegbare Tatsache aber ist, dass ich nach diesem Wasserwurf des Dienstmädchens Dora nicht ertrunken bin. Und es muss auch Beweise für meine Wassergewöhnung gegeben haben, denn Mutter Erna erzählte mir oft und später auch mit Stolz in der Stimme, dass ich schon sehr früh habe schwimmen können und dass eine gewisse Dora mir das beigebracht habe.
Dora entschwand im Dunkel der Lebensgeschichte. Ich wurde, wie es sich gehört, von Jahr zu Jahr älter, aber die Schwimmerei blieb mir zeitlebens ein Lebenselixier. Mit acht brachte ich mir allein das Kraulen bei, ließ mich jahrelang bei meinen Schwimmübungen auch von schlechtem Wetter nicht abhalten und trat mit sechszehn einem Verein bei, in welchem ich endlich mehrmals wöchentlich unter Anleitung trainierte. Das war eine harte Arbeit: 400 Meter Beinarbeit mit einem Brettchen vor den gestreckten Armen, dann Armarbeit und schließlich noch Intervalltraining. Ich brachte es immerhin einmal zur Teilnahme an deutschen Meisterschaften unter den Vereinen ohne Winterbad. Es gab damals Vereine mit und ohne Winterbad. Ich schwamm die Rückenstrecke in der Lagenstaffel. Die goldglänzende Medaille, die ich erhielt, verwahrte ich lange Zeit in einem Holzkästchen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Dora, wenn sie noch lebte, stolz auf mich wäre. Bis ins hohe Alter, bis heute, bin ich ein eifriger, um nicht zu sagen, hervorragender Schwimmer geblieben. Derjenigen, die den Grundstein zu meiner Schwimmerkarriere gelegt hat, der fast vergessenen Dora, gebührt ein Ehrenplatz in meinem Leben.
Kleine Schwester
An einem Sonnabend, den 20. Mai 1944, wurde mir ein Schwesterchen geboren. Es war beileibe nicht so, dass mir etwas gefehlt hätte. In meinem vierten Lebensjahr war ich mit mir und dem Leben im Großen und Ganzen zufrieden und die Ankündigung, ich werde ein Schwesterchen bekommen, ließ mich kalt, sofern man so etwas bei einem Vierjährigen sagen konnte. Genaugenommen wäre mir ein lebendes Kaninchen lieber gewesen. Mami hatte einen dicken Bauch, sagte ständig, ich solle mein Ohr drauf legen, dann würde ich meine Schwester hören und auch fühlen, wie sie strampelte, weil sie heraus zu uns wollte. Aber ich mochte gar nicht an Mutters Bauch herumhorchen, viel lieber wollte ich mit den Bauklötzen, die Papi mir geschnitzt hatte, einen Turm bauen.
Ich kann kaum Gründe finden, warum Fritz und Erna sich in diesen Zeiten zu einem zweiten Kind entschlossen haben. Wahrscheinlich war es auch gar kein freier Entschluss, sondern die Schwester war ein Kind des Zufalls. Wie weit sich Erna mit Knaus-Ogino und ihrem Eisprung vertraut gemacht hatte, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Ein Wunschkind war mein Schwesterchen bestimmt nicht. Am gleichen Tag wie die Schwester wurde Joe Cocker geboren, aber dessen Musik interessierte Rüdiger bestenfalls viele Jahre später, und Wolfgang Borchert wurde 23 Jahre alt. Weder das eine noch das andere war ein Grund, an diesem Tag geboren zu werden. Dem winzigen Baby war es egal, es erblickte am frühen Morgen das Licht der Welt und begann mit einem Schrei. Die Zeiten waren auch einfach zu miserabel. Im März begann die sowjetische Frühjahrsoffensive, Einheiten der Wehrmacht und der SS besetzten Ungarn und gut zwei Wochen nach der Geburt begann die Invasion der Alliierten in der Normandie. Was für denkbar schlechte Voraussetzungen für ein unbeschwertes Heranwachsen und ein glückliches Leben! Was den Namen anbetraf, fiel Fritz und Erna auch nichts Besonderes ein. Der Höhepunkt germanisch-nordischer Namensgebung war überschritten. Man wusste ja nicht, wie es weiter ging und was kommen würde. Also lieber keine Hiltrud, Sieglinde oder Waltraud. Ein weniger mythenträchtiger Name sollte es auch tun. Das Kind bekam den geläufigen, unverdächtigen Namen Christel. Es reichte nicht einmal mehr für einen zweiten.
Christel war von Anfang an ein schwächliches Kind, brachte wenig Gewicht auf die Waage und nahm auch entsetzlich langsam zu, was natürlich auch an dem wachsenden Mangel an wertvolleren Nahrungsmitteln lag. Alles war knapp und rationiert. Vater konnte zwar dank seiner Jägerei Hasenbraten und manchmal sogar eine Rehkeule herbeischaffen, aber was nützte das dem Säugling. Erna macht sich Sorgen, immerhin sprach man ganz offen davon, dass die Russen näherkamen und der Krieg vielleicht verloren wäre. Erstmals äußerte sie Zukunftsängste: „Was soll nur aus uns werden, Fritz?“ Was schlimmer war, der Kummer schlug sich auf ihre Milchbildung. Klein-Christel saugte an der Brust, fand nur tröpfchenweise Befriedigung und gab ihrer Unzufriedenheit darüber plärrend Ausdruck. Dora kam nicht in Frage. Sie hatte mit Rüdiger genug zu tun, der auch immer schwieriger wurde, weil er eindeutig der Meinung war, dass man sich den ungebetenen Schreihals vom Hals schaffen sollte. „Baby weg, bäääh alle!“, plapperte ich und bekam dafür von Fritz einen Klaps auf den Po, was mich nun auch zum Wehklagen veranlasste. Die Stimmung in der Familie war nicht zum Besten.
Erna tröstete sich mit ihrem Volksempfänger, hörte neben den Siegesmeldungen der Wehrmachtsberichte aber vor allem die Wunschkonzerte mit Schlagern wie „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ und besonders gefiel ihr Lale Andersens „Lili Marleen“, bei der ihr fast immer die Tränen kamen. Vater Fritz fand das sentimentale Gedudel nervig und musste seine Frau bisweilen fast rabiat vom Empfänger verjagen, wenn er BBC hören wollte. Natürlich war ihm bewusst, dass das Hören des Feindsenders strafbar war, aber, „man muss doch wissen, was Sache ist.“, meinte er. Was er hörte, machte ihn zunehmend ratlos. Die Meldung, dass am 17. September 1944 die Alliierten mit der größten Luftlandeaktion des Weltkriegs 35.000 Mann hinter der deutschen Westfront in den Niederlanden absetzten, gab ihm Grund zu der Annahme, dass der Krieg nun bald zu Ende sein würde und als er am 25. September vernahm, dass Hitler die Erfassung aller wehrfähigen Männer zwischen sechszehn und sechzig Jahren für den Volkssturm anordnete, erfasste ihn eine gewisse Verzweiflung. Er konnte zwar mit dem Jagdgewehr auf Bock und Sau anlegen, aber wehrfähig, so, wie sich das der Führer vorstellte, war er ganz und gar nicht. „Abwarten und Tee trinken“, sagte er sich und ging erst mal wie gewohnt seinen Arbeiten im Betrieb nach. Christel schrie nach Muttermilch, Rüdiger plärrte, das Baby solle aufhören ’bäh‘ zu machen. Dora kümmerte sich um den Haushalt und Erna versuchte, ihre Zukunftsängste durch intensives Hören der Wunschkonzerte im Volksempfänger zu verdrängen. Das Leben ging seinen Gang.
Knapp acht Monate später, am 8. Mai 1945, war der Zweite Weltkrieg offiziell zu Ende. Doch eigentlich war er schon früher vorbei. Die Rote Armee war im April in den Osten einmarschiert und die Berichte von Vergewaltigungen waren auch bis Annahütte gedrungen.
Die Russen kommen
Am 14. Mai 1945 wurde ich fünf, doch es gab keinen Grund zum Feiern.
Ab welchem Alter setzt das Leben Erinnerungsmarken? Wenn ich versuche, mich auf die frühen Kindheitsjahre zu besinnen, gibt es da, wenn auch nur bruchstückhaft und verschwommen, Momente und Orte, die sich mit Bildern verbinden. Ich denke nach: Was hat sich aus eigenem Erleben in meine Matrix eingeprägt, was ist sekundär, vermittelt und zurechtgerückt durch die Erzählungen anderer, der Eltern, Tanten, Freunde. Nein, Freunde hatte ich ja gar nicht mit fünf Jahren, also gab es nur die Geschichten, die Vater und Mutter in späteren Jahren von sich gaben.
Die Ereignisse kurz vor meinem Geburtstag erscheinen mir wie eine verblasste Fotografie, auf der sich collagenhaft Bildelemente vermischen.
Da ist eine Höhle, mitten im Wald. Der kleine Rüdiger fühlt das trockene Laub unter seinen nackten Füssen. Es fühlt sich gut an. Er fährt mit den Zehen hinein, wirbelt es auf, jauchzt, als die Blätter aufstieben und wieder fallen. Es müssen warme Tage gewesen sein, trocken mit sommerlichen Temperaturen.
Jahre später erzählt man mir, die Geschichte sei folgendermaßen verlaufen. Annahütte im Mai 1945: Alles redete davon, dass die Russen immer näher kommen. Man hatte Angst, wusste, dass sie brandschatzten, vergewaltigten und mordeten. Vater genoss dank seiner Position in den Glaswerken einen gewissen Schutz, er war nie Nazi gewesen, war auch nicht in der Partei. Aber er war nicht eingezogen, war nicht an der Front gewesen. Allein, dass er in der Heimat geblieben war, musste ihn für die Russen verdächtig machen. Was würde mit ihm geschehen, wenn sie da wären. Kein Wunder, dass eine unklare Mischung aus Angst und Verzweiflung meine Eltern beherrschte und die Frage aufwarf, wie man sich und die Familie im Ernstfall in Sicherheit bringen konnte.





























