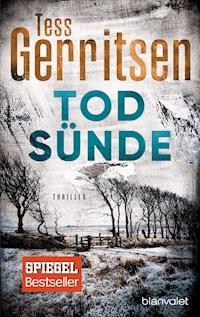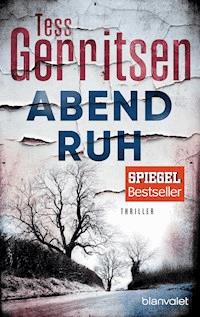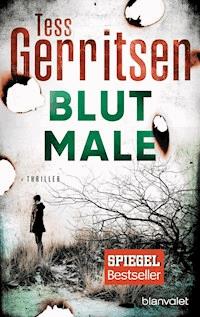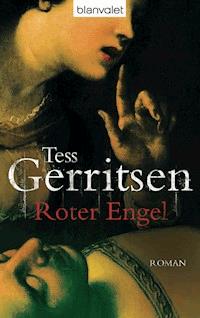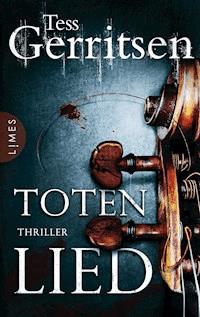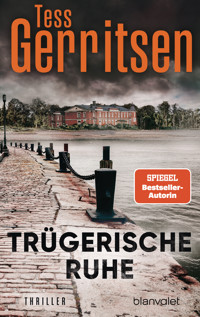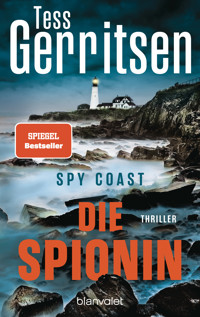
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Martini-Club
- Sprache: Deutsch
Alte Spione rosten nicht: Eine Bande von Spionen im Ruhestand mischt das internationale Geheimdienstgeschäft auf. Clever und unglaublich unterhaltsam. Von Weltbestsellerautorin Tess Gerritsen!
Über Maggie Bird kann man einiges erzählen: Sie züchtet Hühner, ist eine zuvorkommende Nachbarin und lebt ein ruhiges Leben im idyllischen Purity in Maine. Die scheinbar durchschnittliche Sechzigjährige besucht regelmäßig einen Buchclub, wo sie mit ihren ebenfalls pensionierten Freunden Martinis trinkt – gerührt, nicht geschüttelt. Sie kann hervorragend mit einem Gewehr umgehen. Und sie spricht nie über ihre Vergangenheit.
Als eines Tages eine tote Frau in ihrer Auffahrt liegt, ist Maggie sofort klar: Dies ist eine Nachricht aus der »guten alten Zeit«. Vor sechzehn Jahren arbeitete sie für die CIA, und nun scheint die Vergangenheit sie eingeholt zu haben. Zusammen mit ihren Freunden aus dem Buchclub – alles ehemalige Spione wie sie – nimmt Maggie die Ermittlungen auf, denn sie alle wissen: Für die lokale Polizei ist dieser Fall eine Nummer zu groß …
Entdecken Sie auch die mitreißenden Thriller um Detective Jane Rizzoli & Gerichtsmedizinerin Maura Isles von Tess Gerritsen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Über Maggie Bird kann man einiges erzählen: Sie züchtet Hühner, ist eine zuvorkommende Nachbarin und lebt ein ruhiges Leben im idyllischen Purity in Maine. Die scheinbar durchschnittliche Sechzigjährige besucht regelmäßig einen Buchclub, wo sie mit ihren ebenfalls pensionierten Freunden Martinis trinkt – gerührt, nicht geschüttelt. Sie kann hervorragend mit einem Gewehr umgehen. Und sie spricht nie über ihre Vergangenheit.
Als eines Tages eine tote Frau in ihrer Auffahrt liegt, ist Maggie sofort klar: Dies ist eine Nachricht aus der »guten alten Zeit«. Vor sechzehn Jahren arbeitete sie für die CIA und nun scheint die Vergangenheit sie eingeholt zu haben. Zusammen mit ihren Freunden aus dem Buchclub – alles ehemalige Spione wie sie – nimmt Maggie die Ermittlungen auf, denn sie alle wissen: Für die lokale Polizei ist dieser Fall eine Nummer zu groß …
Autorin
Tess Gerritsen ist eine der erfolgreichsten Spannungsautorinnen der Welt. Nach ihrem Medizinstudium an der University of California arbeitete sie als Ärztin, bevor sie mit dem Schreiben von Romanen begann. Der große internationale Durchbruch gelang ihr mit den Thrillern um Detective Jane Rizzoli und Gerichtsmedizinerin Maura Isles, die als Inspiration und Vorlage für die bekannte TV-Serie »Rizzoli & Isles« dienten.
Die Autorin lebt in einem ruhigen Städtchen in Maine, wo sie eines Tages eine verblüffende Entdeckung machte: Einige ihrer pensionierten Nachbarn waren früher als Spione tätig und führten ein aufregendes Leben, über das sie nicht sprechen dürfen. So entstand die Idee zu ihrer neuer Thrillerreihe SPYCOAST um eine Gruppe von Spionen im Ruhestand, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören.
Von Tess Gerritsen bereits erschienen
Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied · Das Schattenhaus · Die Studentin
Die Rizzoli-&-Isles-Thriller
Die Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · Blutzeuge · Mutterherz
Tess Gerritsen
SPY COAST
DIE SPIONIN
Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Spy Coast« bei Thomas & Mercer, Seattle.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Tess Gerritsen
Published by Arrangement with TESSGERRITSENINC.
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Textredaktion: Gerhard Seidl
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
WR · Herstellung: DiMo
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31360-9V003
www.limes-verlag.de
Für Will
1
Diana
Paris, vor zehn Tagen
Sie war immer das Golden Girl gewesen. Wie schnell sich alles ändern kann, dachte sie, während sie in den Spiegel blickte. Ihr Haar, vor Kurzem noch kunstvoll mit sonnenhellen Strähnchen durchsetzt, hatte jetzt eine Farbe, die man nur als straßenköterbraun bezeichnen konnte. Es war der unauffälligste Farbton, der in den Regalen des Monoprix zu finden gewesen war. Dorthin war sie zum Einkaufen gefahren, nachdem eine Nachbarin erwähnte, dass ein Mann nach ihr gefragt habe. Das war der erste Hinweis gewesen, dass etwas nicht stimmte, auch wenn es dafür eine vollkommen harmlose Erklärung geben mochte. Der Mann war vielleicht ein heimlicher Bewunderer oder einfach irgendein Zusteller, aber sie wollte auf alles vorbereitet sein, also war sie zu einem Monoprix im dritten Arrondissement gefahren, einem Viertel, wo niemand sie kannte, und hatte dort Haarfarbe und eine Brille gekauft. Dinge, die sie eigentlich immer parat haben sollte, doch im Lauf der Jahre war sie überheblich geworden. Und damit unvorsichtig.
Sie betrachtete die Brünette im Spiegel und entschied, dass die neue Haarfarbe nicht reichte. Also griff sie zur Schere und begann zu schneiden. Gnadenlos ruinierte sie ihre Dreihundert-Euro-Frisur von L’Atelier Blanc, und mit jedem Schnitt schien ein kleines Stück ihres neuen Lebens zu sterben, des Lebens, das sie sich so sorgfältig aufgebaut hatte. Während sie schnitt, während eine Handvoll Haare nach der anderen auf die Badezimmerfliesen fiel, schlug ihr Bedauern in Wut um. Alles, was sie geplant hatte, alles, was sie riskiert hatte, war auf einmal vergebens, aber so lief das nun mal. Ganz gleich, für wie schlau du dich hältst, immer gibt es jemanden, der noch schlauer ist – und das war ihr Fehler gewesen: Sie hatte die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass jemand sie austricksen könnte. Zu viele Jahre lang war sie die Klassenbeste gewesen – diejenige, die immer zwei Schritte voraus war und alle anderen im Team ausmanövrieren konnte. Das Geheimnis ihres Erfolgs war, sich nicht von irgendwelchen Regeln aufhalten zu lassen – eine Vorgehensweise, die die anderen nicht immer zu schätzen wussten. Ja, manchmal passierten Fehler. Ja, manchmal wurde unnötig Blut vergossen. Sie hatte sich im Lauf der Zeit Feinde gemacht, und manche ihrer Kollegen verachteten sie mittlerweile, aber dank ihrer Initiative wurde der Auftrag jedes Mal erfüllt. Das hatte sie zum Golden Girl gemacht.
Bis jetzt. Schnipp.
Sie betrachtete ihr Spiegelbild nun mit kühlem und kritischem Blick. In den zehn Minuten, die es gedauert hatte, ihre kostbaren Locken abzuschneiden, war sie durch alle Phasen der Trauer um ihr verlorenes Leben gegangen. Leugnung, Wut, Depression. Jetzt hatte sie das Stadium der Akzeptanz erreicht, und sie war bereit, die tote Hülle der alten Diana abzustreifen und einer neuen Diana Leben einzuhauchen. Nicht länger das Golden Girl, sondern eine von der Erfahrung gehärtete und gestählte Frau. Sie würde auch das überleben.
Sie warf die abgeschnittenen Haare in den Mülleimer und die leere Packung Haarfarbe gleich hinterher. Es blieb ihr keine Zeit, die Wohnung zu sterilisieren, also würde sie massenhaft Spuren ihrer Anwesenheit hinterlassen, aber das ließ sich nun mal nicht ändern. Sie konnte nur hoffen, dass die Pariser Polizei sich auf ihre typischen sexistischen Instinkte verlassen und davon ausgehen würde, dass die Frau, die in diesem Appartement gewohnt hatte und die jetzt verschwunden war, entführt worden war. Ein Opfer, keine Täterin.
Sie setzte die Brille auf und zerraufte ihre neue Kurzhaarfrisur zu einem wilden Wuschellook. Es war nur eine oberflächliche Tarnung, aber sie sollte reichen, um die Nachbarn, denen sie auf dem Weg nach draußen begegnen könnte, in die Irre zu führen. Sie band den Müllbeutel zu und trug ihn aus dem Bad ins Schlafzimmer, wo sie ihre Fluchttasche hervorholte. Es war jammerschade, dass sie alle ihre schönen Schuhe und Kleider würde zurücklassen müssen, aber sie musste mit leichtem Gepäck reisen, und einen ganzen Schrank voller Designermode zurückzulassen, würde den Eindruck eines unfreiwilligen Verschwindens noch verstärken. Ebenso wie die Tatsache, dass sie die Kunstwerke nicht mitnehmen würde, die sie über die Jahre gesammelt hatte, nachdem ihr Kontostand sich so erfreulich entwickelt hatte: die antiken Chinavasen, der Chagall, die zweitausend Jahre alte römische Büste. Sie würde all das vermissen, aber Opfer mussten gebracht werden, wenn sie überleben wollte.
Mit ihrer Fluchttasche und dem Müllbeutel mit ihren abgeschnittenen Haaren ging sie ins Wohnzimmer. Dort stieß sie wieder einen bedauernden Seufzer aus. Hässliche Blutspritzer verunstalteten ihr Ledersofa und zogen sich im Bogen über die Wand, an der der Chagall hing, wie eine abstrakte Verlängerung des Gemäldes selbst. Und zusammengesunken unter dem Chagall lag die Quelle des Bluts. Der Mann war als Erster in ihre Wohnung eingedrungen und somit auch der erste Angreifer, den sie ausgeschaltet hatte. Er war der klassische virile Typ, dessen viele Stunden im Fitnessstudio ihm pralle Bizepse eingebracht hatten, aber keinen Zuwachs an grauen Zellen. So hatte er sich das Ende seines Arbeitstags nicht vorgestellt und er war mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht gestorben – weil er wohl nie damit gerechnet hätte, dass es eine Frau sein könnte, die ihn außer Gefecht setzte.
Offenbar war er nicht ausreichend über seine Zielperson informiert worden.
Als sie hinter sich ein leises Atemgeräusch vernahm, drehte sie sich zu dem zweiten Mann um. Er lag an der Kante ihres kostbaren Perserteppichs und sein Blut sickerte in das verschlungene Muster von Ranken und Tulpenblüten. Zu ihrer Verwunderung war er noch am Leben.
Sie ging zu ihm hin und stieß seine Schulter mit der Schuhspitze an.
Seine Lider flackerten, dann schlug er die Augen auf und starrte sie an. Er tastete nach seiner Waffe, doch sie hatte sie bereits mit einem Tritt aus seiner Reichweite befördert, und so schlug seine Hand nur wie ein sterbender Fisch auf den Fußboden und patschte in seinem eigenen Blut herum.
»Qui t’a envoyé?«, fragte sie.
Seine Hand begann noch hektischer zu flattern. Die Kugel, die sie ihm in den Hals geschossen hatte, musste sein Rückgrat verletzt haben, denn seine Bewegungen waren spastisch, sein Arm zuckte roboterhaft. Vielleicht verstand er kein Französisch. Sie wiederholte ihre Frage, diesmal auf Russisch: Wer hat dich geschickt?
Seine Augen ließen keine Reaktion erkennen. Entweder baute er so schnell ab, dass sein Gehirn nicht mehr funktionierte, oder er verstand sie nicht, und beides war gleich beunruhigend. Mit den Russen konnte sie fertig werden, aber wenn jemand anderes diese Männer geschickt hatte, dann hatte sie ein Problem.
»Wer will mich ausschalten?«, fragte sie, diesmal auf Englisch. »Sag’s mir und ich lass dich am Leben.«
Sein Arm hörte auf zu zucken. Der Mann lag jetzt ganz still, aber sie sah seinen Augen an, dass er die Frage verstanden hatte. Er hatte jedoch auch begriffen, dass es eigentlich keine Rolle spielte, ob er ihr die Wahrheit sagte – so oder so war er ein toter Mann.
Sie hörte Männerstimmen auf dem Flur vor ihrem Appartement. Hatten sie noch weitere Männer als Verstärkung geschickt? Sie hatte sich zu lange aufgehalten, und es blieb keine Zeit mehr, diesen hier zu befragen. Sie richtete den Schalldämpfer auf seinen Kopf und drückte zweimal ab. Gute Reise.
Sie brauchte nur Sekunden, um durchs Fenster auf die Feuertreppe zu klettern. Der letzte Blick in ihr Appartement war bittersüß. Hier war sie einigermaßen glücklich gewesen, hier hatte sie die wohlverdienten Früchte ihrer Mühen genossen. Jetzt war die Wohnung ein Schlachtfeld und das Blut zweier namenloser Männer befleckte ihre Wände.
Sie sprang von der Feuertreppe in die Gasse darunter. Um 23 Uhr war in den Straßen von Paris immer noch einiges los, und sie hatte keine Mühe, sich unter die Fußgänger zu mischen, die sich auf dem Gehsteig drängten. In der Ferne hörte sie eine Polizeisirene. Sie kam näher, doch Diana beschleunigte ihre Schritte nicht. Der Abstand war zu kurz – die Sirenen konnten nicht ihr gelten.
Fünf Häuserblocks weiter warf sie den Beutel in den Müllcontainer eines Restaurants und ging weiter, die Fluchttasche über die Schulter geworfen. Sie enthielt alles, was sie für den Moment brauchte, und es mangelte ihr auch nicht an anderen Mitteln. Sie hatte mehr als genug, um von vorne anfangen zu können.
Aber zuerst musste sie herausfinden, wer ihren Tod wollte. Leider war diese Frage unmöglich zu beantworten. Sie hatte angenommen, dass es die Russen wären, aber jetzt war sie sich nicht mehr so sicher. Wenn man mehrere Interessengruppen vor den Kopf stößt, macht man sich ebenso viele Feinde, und jeder einzelne davon besaß sein spezielles Talent, Unheil anzurichten. Die Frage war: Wie war ihr Name durchgesickert? Und warum waren sie jetzt, nach sechzehn Jahren, plötzlich hinter ihr her?
Wenn sie ihren Namen kannten, dann mussten sie auch von den anderen wissen. Wie es aussah, war ihre Vergangenheit dabei, sie alle einzuholen.
Das war’s dann mit dem komfortablen Ruhestand. Zeit, sich wieder an die Arbeit zu machen.
2
Maggie
Purity, Maine, heute
Hier ist jemand gestorben.
Ich stehe in meinem Feld und blicke auf die Spuren der Bluttat im Schnee hinunter. Der Täter hat das Opfer durch den frischen Pulverschnee geschleift, und obwohl die Flocken immer noch lautlos herabrieseln, haben sie die Fährte noch nicht unter sich begraben, und auch nicht die Furchen, die der tote Körper hinterlassen hat, als er in den Wald gezerrt wurde. Ich sehe einen Blutfleck, verstreute Federn und Klumpen von schwarzen Daunen, die im Wind zittern. Mehr ist nicht übrig von einer meiner besten Araucana-Hennen, die ich besonders geschätzt habe, weil sie so zuverlässig diese hübschen blaugrünen Eier produzierte. Obwohl der Tod nur ein einzelner Punkt im weiten Kreislauf des Lebens ist, und obwohl ich ihm in der Vergangenheit schon viele Male begegnet bin, trifft mich dieser Verlust hier besonders hart. Ich seufze, und mein Atem verwirbelt zu einem Dampfwölkchen in der kalten Luft.
Ich werfe einen Blick durch den Maschendrahtzaun auf den Rest meiner Hühnerschar. Nur drei Dutzend sind noch übrig von den fünfzig Küken, die ich letztes Frühjahr großgezogen habe. Es ist gerade mal zwei Stunden her, dass ich die Tür des Stalls geöffnet und die Hühner für den Tag in den Auslauf gelassen habe, und in diesem kurzen Zeitfenster hat der Räuber zugeschlagen. Ich habe noch einen letzten Hahn, den einzigen, der die wiederholten Adlerattacken und Waschbärenüberfälle überlebt hat, und nun stolziert er im Gehege umher, alle Schwanzfedern intakt, offenbar nicht im Geringsten beunruhigt durch den Verlust einer weiteren Henne aus seinem Harem. Was für ein Versager.
Wie so viele dieser aufgeblasenen Gockel.
Als ich mich wieder aufrichte, registriere ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung, und mein Blick geht zum Waldrand, der sich dunkel jenseits des Hühnergeheges abzeichnet. Die Bäume sind hauptsächlich Eichen und Ahorne, dazu ein paar armselige Fichten, die Mühe haben, im Schatten ihrer übermächtigen Nachbarn hochzukommen. Fast verborgen im Unterholz kann ich ein Augenpaar ausmachen und es ist auf mich gerichtet. Einen Moment lang starren wir einander nur an, zwei Widersacher, die sich auf einem verschneiten Schlachtfeld gegenüberstehen.
Ganz langsam entferne ich mich von meinem mobilen Hühnerstall. Ich mache keine plötzlichen Bewegungen, gebe keinen Laut von mir.
Mein Gegner beobachtet mich die ganze Zeit.
Gefrorenes Gras knirscht unter meinen Stiefelsohlen, als ich auf meinen Kubota RTV zuschleiche. Lautlos öffne ich die Tür des Quads und greife nach meinem Gewehr, das hinter den Sitzen verstaut ist. Es ist immer geladen, sodass ich nicht erst lange mit der Munition herumhantieren muss. Ich schwenke den Lauf herum, richte ihn auf den Waldrand und visiere mein Ziel an.
Der Schuss kracht, laut wie ein Donnerschlag. Aufgeschreckte Krähen flattern aus den Baumkronen auf und schlagen hektisch mit den Flügeln, und meine Hühner flüchten sich unter panischem Gegacker in den sicheren Stall. Ich lasse das Gewehr sinken und spähe mit zusammengekniffenen Augen zum Wald hinüber, suche das Unterholz ab.
Nichts rührt sich.
Mit meinem RTV fahre ich über das Feld zum Waldrand und steige aus. Das Unterholz besteht aus dichtem Brombeergestrüpp und der Schnee verdeckt eine Schicht toten Laubs und trockener Äste. Jeder Schritt, den ich mache, wird von explosionsartigem Knacken begleitet. Noch habe ich kein Blut gesehen, aber ich bin sicher, dass ich es finden werde, denn man weiß es immer, man spürt es irgendwie in den Knochen, wenn die Kugel ihr Ziel getroffen hat. Endlich entdecke ich den Beweis dafür, dass ich gut gezielt habe: ein blutbespritztes Laubbett. Der verstümmelte Kadaver meiner Araucana-Henne liegt da, wo der Räuber sie hat fallen lassen.
Ich stapfe tiefer ins Unterholz hinein, schiebe Äste und Zweige beiseite, die an meiner Hose hängen bleiben und mein Gesicht zerkratzen. Ich weiß, dass das Tier in der Nähe sein muss – wenn nicht tot, dann auf jeden Fall ernsthaft verletzt. Es hat weiter fliehen können, als ich gedacht habe, aber ich gehe entschlossen weiter, während mein Atem in Dampfwolken aufsteigt. Früher einmal hätte ich durch diesen Wald rennen können, sogar mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken, aber ich bin nicht mehr die Frau, die ich einmal war. Meine Gelenke sind von vielen Strapazen und dem unerbittlichen Zahn der Zeit verschlissen, und seit einer harten Landung bei einem Fallschirmsprung habe ich einen versteiften Knöchel, der immer wehtut, wenn die Temperatur oder der Luftdruck sinkt. So auch jetzt. Das Altern ist ein grausamer Prozess. Es hat meine Knie steif gemacht, meine einst schwarzen Haare grau werden lassen und die Falten in meinem Gesicht tiefer eingegraben. Aber meine Augen sind immer noch scharf, und ich habe meine Fähigkeit nicht eingebüßt, die Landschaft zu lesen, die Spuren im Schnee zu deuten. Ich gehe vor einem Pfotenabdruck in die Hocke und bemerkte die Blutspritzer auf dem Laub.
Das Tier leidet. Und es ist meine Schuld.
Ich hieve mich wieder hoch. Meine Knie und meine Hüftgelenke protestieren, anders als in den Tagen, als ich aus einem engen Sportwagen springen und sofort lossprinten konnte. Ich breche durch ein Brombeergebüsch und komme auf einer Lichtung heraus. Dort finde ich endlich meine Widersacherin. Eine Fähe. Sie sieht gesund und wohlgenährt aus und ihr dichtes rotes Fell glänzt. Ihr Maul steht offen und lässt die messerscharfen Zähne sehen, die mit einem Biss der kräftigen Kiefer einem Huhn den Hals brechen können. Meine Kugel hat sie mitten in die Brust getroffen, und ich bin überrascht, dass sie noch so weit gekommen ist, ehe sie zusammenbrach. Ich tippe den Körper mit der Stiefelspitze an, um mich zu vergewissern, dass sie tot ist. Damit ist dieses eine Problem aus der Welt geschafft, doch ich empfinde keine Befriedigung über den Abschuss. Als ich durchatme, ist es ein Seufzer des Bedauerns, der mir entweicht.
Und in meinen sechzig Jahren hatte ich schon mehr als reichlich Übung im Bedauern.
Das Fell ist viel zu wertvoll, als dass ich es hier im Wald zurücklassen könnte, also packe ich die Fähe am Schwanz. Sie hat sich mit meinen Hühnern den Bauch vollgeschlagen und ist entsprechend schwer, als ich sie hinter mir her schleife und ihr Kadaver eine Schneise durch totes Laub und Schnee zieht. Am Quad angekommen, hebe ich sie hoch und werfe sie auf die Ladefläche, wo sie mit einem dumpfen Geräusch aufschlägt. Ich selbst kann mit dem Pelz nichts anfangen, aber ich kenne jemanden, der davon begeistert sein wird.
Ich steige in den Kubota und fahre über das Feld zum Haus meines Nachbarn.
Luther Yount mag seinen Kaffee verbrannt, und der Geruch steigt mir schon in die Nase, als ich in seiner Einfahrt aus dem RTV steige. Von hier aus kann ich über das schneebedeckte Feld zu meinem eigenen Bauernhaus sehen, das auf einem kleinen Hügel hinter einer Reihe ansehnlicher Zuckerahorne steht. Es ist kein großes Haus, aber es ist solide gebaut, im Jahr 1830 laut Auskunft der Maklerin, die es mir verkauft hat. Ich weiß, dass ihre Information korrekt ist, denn ich habe den Original-Kaufvertrag für die Blackberry Farm ausfindig gemacht. Ich glaube nur das, wovon ich mich mit eigenen Augen überzeugen kann. Mein Haus hat freie Sicht in alle Richtungen, und wenn sich jemand nähert, sehe ich ihn oder sie schon von Weitem, vor allem an einem klaren Wintermorgen, wenn die Landschaft kahl und weiß ist.
Ich höre eine Kuh muhen und Hühner gackern. Eine Spur aus kleinen Schuhabdrücken zieht sich durch den Schnee, von Luthers Hütte zum Stall. Sicher ist seine vierzehnjährige Enkelin Callie gerade dort drin und versorgt ihre Tiere, wie sie es jeden Morgen macht.
Ich stapfe die Verandastufen hinauf und klopfe an. Luther öffnet die Tür, und mir schlägt der ätzende Geruch von Kaffee entgegen, der zu lange auf dem Herd gestanden hat. Luther ist ein Schrank von einem Mann mit weißem Weihnachtsmann-Bart, er trägt ein rot kariertes Hemd und Hosenträger, und sein Atem geht pfeifend vom Holzrauch und dem Staub, der in seiner Hütte permanent in der Luft hängt.
»Ah, guten Morgen, Maggie!«, sagt er.
»Guten Morgen. Ich habe ein Geschenk für dich und Callie mitgebracht.«
»Was ist denn der Anlass?«
»Es gibt keinen. Ich dachte mir bloß, dass ihr etwas damit anfangen könntet. Es liegt draußen im Kubota.«
Er verzichtet darauf, eine Jacke überzuziehen, und tritt in seinem wollenen Hemd, Jeans und Gummistiefeln ins Freie. Er folgt mir zum Quad, und als er die tote Füchsin erblickt, murmelt er anerkennend und streichelt dann ihr Fell.
»Sie ist ’n richtiges Prachtstück. Dann war das also der Schuss, den ich vorhin gehört hab. Hast du sie mit einer einzigen Kugel erlegt?«
»Sie hat es trotzdem noch geschafft, fünfzig Meter in den Wald reinzulaufen.«
»Ist wahrscheinlich dieselbe, die sich zwei von Callies Hennen geholt hat. Gut gemacht.«
»Trotzdem, eigentlich ist es eine Schande. Das Tier wollte doch auch nur überleben.«
»Wollen wir das nicht alle?«
»Ich dachte mir, du könntest den Pelz gebrauchen.«
»Bist du sicher, dass du ihn nicht behalten willst? Ist ’n schönes Stück.«
»Und du weißt bestimmt genau, was damit zu tun ist.«
Er beugt sich über die Ladefläche und hievt den Kadaver heraus. Von der Anstrengung geht sein Atem noch geräuschvoller. »Komm doch rein«, sagt er, während er das tote Tier im Arm hält wie ein Enkelkind. »Ich hab mir gerade ’nen Kaffee eingeschenkt.«
»Danke, aber lieber nicht.«
»Dann darf ich dir aber wenigstens ein bisschen frische Milch mitgeben.«
Dazu sage ich bestimmt nicht Nein. Die Weidemilch von Callies Jersey-Kuh ist mit nichts zu vergleichen, was ich je gekostet habe, bevor ich nach Maine gezogen bin – so gehaltvoll und süß, dass man gerne das Risiko eingeht, sie unpasteurisiert zu trinken. Ich folge ihm in sein Haus, wo er den Fuchskadaver auf eine Bank wirft. In der schlecht isolierten Blockhütte ist es nur unmerklich wärmer als draußen, trotz der Hitze des Holzofens, deshalb behalte ich meine Jacke an, während Luther sich in Hemd und Jeans pudelwohl zu fühlen scheint. Ich will seinen Kaffee nicht, aber er stellt dennoch zwei Becher auf den Küchentisch. Es wäre unhöflich, die Einladung auszuschlagen.
Ich setze mich.
Luther schiebt mir eine Kanne mit Sahne hin. Er weiß, wie ich meinen Kaffee mag – oder vielmehr, wie ich seinen gerade noch ertragen kann –, und er weiß auch, dass ich der Sahne von Callies Kuh nicht widerstehen kann. In den zwei Jahren, seit ich seine Nachbarin bin, hat er sicherlich schon eine ganze Reihe von Details über mich in Erfahrung gebracht. Er weiß, dass ich jeden Abend gegen zehn Uhr das Licht ausschalte, dass ich früh aufstehe, um meine Hühner zu füttern und zu tränken. Er weiß, dass ich ein Neuling beim Anzapfen von Ahornbäumen bin, dass ich zumeist für mich bleibe und dass ich keine lauten Partys schmeiße. Und seit heute weiß er, dass ich auch ganz gut schießen kann. Es gibt eine Menge Dinge, die er von mir nicht weiß – Dinge, die ich ihm nie erzählt habe und ihm auch nie erzählen werde. Ich bin froh, dass er nicht der Typ ist, der allzu viele Fragen stellt. Ich weiß einen diskreten Nachbarn zu schätzen.
Umgekehrt weiß ich eine ganze Menge über Luther Yount. Es ist nicht schwer, sich ein Bild von einem Menschen zu machen, indem man sich einfach nur in seinem Haus umsieht. Seine Bücherregale sind selbst gebaut, wie auch der rustikale Küchentisch, und Bündel von getrocknetem Thymian und Oregano, beides in seinem Kräutergarten geerntet, hängen an einem Deckenbalken. Er besitzt auch Bücher – Unmengen von Büchern über eine verwirrend breite Palette von Themen, von Teilchenphysik bis Tierzucht. Auf manchen der Fachbücher steht sein Name als Autor, ein Hinweis auf Luther Younts früheres Leben als Professor für Maschinenbau am MIT in Boston. Das war, bevor er den Universitätsbetrieb und die Großstadt hinter sich gelassen hat – und vielleicht auch ein paar persönliche Dämonen –, um sich hier als leicht verwahrloster, aber glücklicher Farmer neu zu erfinden. Ich weiß das alles über ihn, nicht weil er es mir erzählt hat, sondern weil ich seine Vorgeschichte, wie die aller meiner Nachbarn, sehr gründlich recherchiert habe, bevor ich die Blackberry Farm gekauft habe.
Luther hat die Prüfung bestanden. Deshalb kann ich jetzt auch ganz entspannt an seinem Küchentisch sitzen und mit ihm Kaffee trinken.
Auf der Veranda sind trampelnde Schritte zu hören, dann geht die Tür auf, und die vierzehnjährige Callie betritt den Raum, begleitet von einem kalten Luftschwall. Luther unterrichtet sie zu Hause, mit der Folge, dass Callie auf einnehmende Weise unkonventionell ist, in manchen Dingen klüger, in anderen naiver als andere Mädchen in ihrem Alter. Wie ihr Großvater schert sie sich wenig um ihr Äußeres – ihre Stalljacke ist verdreckt und verirrte Hühnerfedern haben sich in ihren braunen Haaren verfangen. Sie hat zwei Körbe mit frisch gelegten Eiern dabei und stellt sie auf den Küchentresen. Ihr Gesicht ist von der Kälte so gerötet, dass ihre Wangen aussehen, als wäre sie geohrfeigt worden.
»Hallo, Maggie«, begrüßt sie mich, während sie ihre Jacke aufhängt.
»Schau mal, was sie uns mitgebracht hat«, sagt Luther.
Callie betrachtet die tote Füchsin, die auf der Bank liegt, und streicht mit der Hand über das Fell, ohne Zögern, ohne eine Spur von Scheu oder Ekel. Sie hat den größten Teil ihres Lebens bei Luther gewohnt, seit ihre Mutter in Boston an einer Überdosis Heroin gestorben ist, und das Leben auf der Farm hat sie gelehrt, den Tod gleichmütig hinzunehmen.
»Oh, es fühlt sich immer noch warm an«, sagt sie.
»Ich bin damit gleich zu euch gekommen«, sage ich. »Ich dachte mir, du und dein Großvater könntet vielleicht etwas Schönes daraus machen.«
Sie strahlt mich entzückt an. »Das Fell ist wunderschön. Danke, Maggie! Ob es wohl für eine Mütze reichen wird?«
»Bestimmt«, sagt Luther.
»Weißt du, wie man eine macht, Grandpa?«
»Wir machen uns vorher schlau – zusammen werden wir es schon hinkriegen. So was Schönes darf man doch nicht verkommen lassen, hm?«
»Ich würde gerne sehen, wie du das machst, Luther«, sage ich.
»Willst du auch zuschauen, wie ich sie abziehe?«
»Nein, ich weiß schon, wie das geht.«
»Wirklich?« Er lacht. »Du schaffst es immer wieder, mich zu überraschen, Maggie.«
Callie stellt die Eier ins Spülbecken und macht sich daran, sie unter fließendem Wasser mit einem Lappen zu reinigen, damit sie nachher im Karton makellos aussehen. Im örtlichen Co-op werden sie für sieben Dollar das Dutzend verkauft, was wirklich günstig ist für Bio-Eier, in Anbetracht des Arbeitsaufwands, der Kosten fürs Futter und des ständigen Kampfs gegen Rotluchse, Füchse und Waschbären. Nicht, dass Luther und Callie für ihren Lebensunterhalt auf den Eierverkauf angewiesen wären, denn Luther hat eine beträchtliche Summe in Aktien angelegt. Das ist ein weiteres kleines Detail über ihn, das ich herausgefunden habe. Es sind Callies Hühner und Callies Einnahmen, und sie ist jetzt schon eine richtig gute Geschäftsfrau. Ich habe noch nie eine Vierzehnjährige gesehen, die so geschickt eine alte Legehenne schlachten und ausnehmen kann.
»Es ist traurig, dass du sie erschießen musstest, aber ich habe auch zu viele von meinen Hennen verloren«, sagt Callie.
»Dann wird halt ein anderer Räuber ihren Platz einnehmen«, brummt Luther. »Das ist der Lauf der Welt.«
Callie sieht mich an. »Wie viele hast du verloren?«
»Ein halbes Dutzend allein in der letzten Woche. Die Fähe da hat heute Morgen eine von meinen Araucanas geholt.«
»Vielleicht sollte ich mir auch ein paar Araucanas besorgen. Die Kunden scheinen die blauen Eier zu mögen. Da könnte ich wahrscheinlich mehr für verlangen.«
Luther schnaubt. »Blaue Eier, braune Eier. Die schmecken doch alle gleich.«
»Na, dann sollte ich mich mal auf den Weg machen«, sage ich und stehe auf.
»Schon?«, ruft Callie. »Du bist doch gerade erst gekommen.«
Es gibt sicher nicht viele Vierzehnjährige, die darauf Wert legen würden, sich mit einer Frau meines Alters zu unterhalten, aber Callie ist nun mal ein ungewöhnliches Mädchen. Sie fühlt sich in der Gesellschaft von Erwachsenen so wohl, dass ich manchmal vergesse, wie jung sie noch ist.
»Wenn dein Großvater die Zeit findet, diese Fuchspelzmütze zu nähen, schaue ich noch mal vorbei«, erwidere ich.
»Und dann koche ich uns Hähnchen mit Dumplings.«
»Dann komme ich ganz bestimmt.«
Luther kippt den Rest seines Kaffees in einem Zug herunter und steht ebenfalls auf. »Warte, ich hol dir noch die Milch, die ich dir versprochen habe.« Er öffnet den Kühlschrank, worauf die Milchflaschen in der Tür ein melodisches Klirren von sich geben. »Wenn wir nicht diese verflixten Gesundheitsvorschriften hätten, könnten wir unsere Milch direkt am Hof verkaufen. Uns einfach zurücklehnen und das Geld einstreichen.«
Geld, das er nicht braucht. Manche Leute tragen ihren Reichtum gerne zur Schau, aber Luther scheint seiner eher peinlich zu sein. Oder vielleicht ist es eine Taktik zum Selbstschutz – was die anderen nicht sehen, können sie dir auch nicht wegnehmen. Er nimmt vier Flaschen mit Milch heraus, jede mit einer dicken Rahmschicht obendrauf, und stellt sie in eine Papiertüte. »Wenn du das nächste Mal Besuch hast, Maggie, lass deine Gäste davon probieren. Und dann schick sie gleich zu mir, damit sie sich noch mehr kaufen können. Ein rein privater Verkauf natürlich. Der Staat Maine braucht davon nichts mitzubekommen.«
Ich bin schon an der Tür mit meiner kostbaren Milch, als mir aufgeht, was er gerade eben gesagt hat. Ich drehe mich noch einmal zu ihm um. »Wie meinst du das – das nächste Mal?«
»War nicht gestern jemand bei dir zu Besuch?«
»Nein.«
»Hmm.« Er sieht Callie an. »Vielleicht hast du dich verhört.«
»Wie verhört?«, frage ich.
»Da war eine Frau auf dem Postamt«, sagt Callie. »Ich habe unsere Post abgeholt, und da habe ich gehört, wie sie Greg am Schalter nach dem Weg zur Blackberry Farm gefragt hat. Sie hat ihm gesagt, sie wäre eine Freundin von dir.«
»Wie hat sie ausgesehen? Jung, alt? Welche Haarfarbe?«
Callie wirkt überrumpelt von den Fragen, mit denen ich sie bombardiere. »Ähm, sie war eher jung, denke ich. Und sah total gut aus. Ihre Haare konnte ich nicht sehen, weil sie einen Hut aufhatte. Und sie hatte eine schöne Daunenjacke an. So eine blaue.«
»Du hast ihr doch nicht gesagt, wie sie zu mir findet, oder?«
»Nein, aber Greg hat es ihr gesagt. Stimmt etwas nicht?«
Darauf weiß ich keine Antwort. Ich stehe da in der offenen Tür, meine Tüte mit Milchflaschen im Arm, mitten im kalten Luftzug. »Ich habe niemanden erwartet. Ich mag keine Überraschungen, das ist alles«, sage ich. Dann drehe ich mich um und ziehe die Tür hinter mir zu.
Stimmt etwas nicht?
Die Frage beschäftigt mich immer noch, als ich etwas später in den Ort fahre, um einzukaufen. Wer hat da nach dem Weg zu meiner Farm gefragt? Es könnte eine völlig harmlose Erklärung geben – etwa, dass jemand zu der früheren Eigentümerin will und nicht mitbekommen hat, dass die alte Dame schon vor drei Jahren im Alter von achtundachtzig Jahren gestorben ist. Ich habe gehört, dass sie für ihren scharfen Verstand und ihr aufbrausendes Temperament berüchtigt war. Eine Frau von meinem Kaliber. Das wäre ein plausibler Grund, nach der Blackberry Farm zu fragen, denn es gibt keinen Grund, weshalb irgendjemand hierherkommen sollte, um nach mir zu suchen. In den zwei Jahren, die ich hier in Purity wohne, ist das kein einziges Mal passiert.
Und ich will, dass es so bleibt.
Im Ort mache ich meine gewohnte Runde: Futtermittelgeschäft, Post, Lebensmittelladen. Das sind alles Orte, wo ich unter all den anderen grauhaarigen Frauen nicht weiter auffalle, alle in Winterjacken und Schals gehüllt, so wie ich auch. Und so wie sie ziehe ich nur selten interessierte Blicke auf mich. Das Alter verleiht Anonymität, und das macht es zur effektivsten Tarnung überhaupt.
Im Lebensmittelgeschäft nimmt niemand von mir Notiz, als ich meinen Wagen durch die schmalen Gänge schiebe und Haferflocken und Mehl, Kartoffeln und Zwiebeln hineinlege. Wenigstens muss ich bis auf Weiteres keine Eier mehr kaufen. Die Alkoholauswahl in diesem kleinen Nest ist armselig, aber immerhin führen sie zwei verschiedene Marken Single-Malt-Whisky, und obwohl beide nicht gerade nach meinem Geschmack sind, kaufe ich dennoch eine Flasche. Ich versuche, meinen kostbaren dreißig Jahre alten Longmorn möglichst wenig anzugreifen, denn ich weiß nicht, wann ich noch mal eine Bezugsquelle dafür finden werde. Und jeder Whisky ist besser als kein Whisky.
Als ich in der Schlange an der Kasse stehe, könnte man mich für irgendeine Farmerin oder Hausfrau oder pensionierte Lehrerin halten. Jahrelang habe ich mich darin geübt, nicht aufzufallen, keine Aufmerksamkeit zu erregen, und inzwischen gelingt es mir mühelos, was sowohl traurig als auch eine Erleichterung ist. Manchmal vermisse ich die Zeit, als ich noch bemerkt wurde, die Tage, als ich kurze Röcke und spitze Absätze trug und die Blicke der Männer auf meinem Körper spürte.
Die Kassiererin tippt meine Einkäufe ein und macht große Augen, als sie die Summe sieht. »Das macht – ähm – wow. Zweihundertzehn Dollar.« Sie blickt zu mir auf, als ob sie damit rechnet, dass ich Einwände erhebe, aber das tue ich nicht. Der Whisky ist schuld. Es ist nicht mal meine Lieblingsmarke, aber manche Dinge im Leben sind einfach unverzichtbar.
Ich bezahle und trage die Tüten nach draußen. Als ich sie in meinen Pick-up lade, sehe ich zufällig, wie Ben Diamond, bekleidet mit seiner üblichen schwarzen Lederjacke, gerade das Café Marigold auf der anderen Straßenseite betritt. Wenn irgendjemand in diesem Städtchen weiß, woher der Wind weht, dann ist es Ben. Vielleicht weiß er auch, wer nach mir gefragt hat.
Ich überquere die Straße und folge Ben ins Marigold.
Ich entdecke ihn sofort an einem Ecktisch, wo er mit Declan Rose sitzt. Wie üblich haben sich beide Männer mit Blick zum Eingang gesetzt, eine Gewohnheit, die sie auch im Ruhestand nicht ablegen können. Declan sieht genauso aus wie der Geschichtsprofessor, der er war, mit seinem Tweedsakko und seiner beeindruckenden Löwenmähne. Mit achtundsechzig ist sein einst schwarzes Haar schon halb ergraut, doch es ist immer noch so voll wie damals, als ich ihn kennengelernt habe, vor fast vier Jahrzehnten. Anders als der professorenhafte Declan wirkt Ben Diamond latent bedrohlich, mit seinem kahl geschorenen Schädel und der schwarzen Lederjacke. Es gehört eine Art angeborene Autorität dazu, im reifen Alter von dreiundsiebzig mit einem solchen Look nicht peinlich zu wirken, aber Ben besitzt sie immer noch. Die beiden blicken auf, als ich auf ihren Tisch zusteuere.
»Ah, Maggie! Setz dich zu uns«, sagt Declan.
»Hab dich länger nicht gesehen. Was hast du so getrieben?«, fragt Ben.
Ich nehme auf der Bank Platz. »Ich musste mich um ein Fuchsproblem kümmern.«
»Und jetzt ist der Fuchs tot, nehme ich an.«
»Seit heute Morgen.« Ich blicke auf, als die Kellnerin vorbeikommt. »Einen Kaffee, bitte, Janine.«
»Speisekarte?«, fragt sie.
»Heute nicht, danke.«
Ben betrachtet mich eingehend. Gesichter zu lesen, ist eines seiner Talente, und er spürt wohl, dass ich mich heute aus einem ganz bestimmten Grund zu ihnen gesellt habe. Ich warte, bis Janine außer Hörweite ist, bevor ich den Männern meine Frage stelle.
»Wer könnte nach mir suchen?«
»Es sucht jemand nach dir?«, fragt Declan.
»Eine Frau, offenbar neu in Purity. Ich habe gehört, dass sie gestern im Postamt war und nach dem Weg zur Blackberry Farm gefragt hat.«
Die Männer tauschen einen Blick und sehen dann mich an.
»Davon weiß ich nichts, Maggie«, sagt Ben.
Janine bringt meinen Kaffee. Er ist dünn, aber wenigstens ist er nicht verbrannt wie der von Luther. Wir warten, bis sie wieder gegangen ist, ehe wir weiterreden. Bei uns dreien ist das einfach die Macht der Gewohnheit. Der Grund, warum die Männer immer diesen einen Tisch wählen, ist, dass er wie ein isolierter Außenposten ist, wo man sich sicher fühlen kann, weit weg von neugierigen Mithörern.
»Machst du dir Sorgen deswegen?«, fragt Declan.
»Ich weiß nicht, ob ich Grund dazu habe.«
»Hat die Frau nach deinem Namen gefragt? Oder nur nach dem der Farm?«
»Nur nach der Farm. Es hat vielleicht nichts zu bedeuten. Woher sollte sie wissen, dass ich dort wohne?«
»Die können alles rausfinden, wenn sie es wirklich darauf anlegen.«
Wir halten inne, als zwei Gäste von ihrem Tisch aufstehen und auf dem Weg zur Kasse an uns vorbeikommen. Die Pause gibt mir Gelegenheit, über Declans Worte nachzudenken. Wenn sie es wirklich darauf anlegen. Das ist es, worauf ich heutzutage vertraue: dass ich nicht der Mühe wert bin, mich aufzuspüren. Ich bin nur ein kleiner Fisch, oder allenfalls ein mittelgroßer, und es gibt Wichtigere als mich. Wozu Zeit und Mühe in die Suche nach einer Frau investieren, die nicht gefunden werden will? In den sechzehn Jahren, seit ich mich zur Ruhe gesetzt habe, bin ich allmählich immer unvorsichtiger geworden. Inzwischen identifiziere ich mich so mit der Rolle der Hühnerzüchterin in einem kleinen Provinznest, dass ich fast schon selbst glaube, nie etwas anderes gewesen zu sein. So, wie Ben nur ein Vertreter für Hotelbedarf im Ruhestand ist, und Declan nur ein pensionierter Geschichtsprofessor. Wir kennen die Wahrheit, aber wir bewahren die Geheimnisse der anderen, weil wir unsere eigenen zu hüten haben.
Erpressbarkeit auf Gegenseitigkeit ist die beste Versicherung.
»Wir werden die Ohren aufsperren«, sagte Ben. »Wir finden schon raus, wer diese Frau ist.«
»Danke, das ist nett von euch.« Ich lege zwei Dollar für den Kaffee auf den Tisch.
»Kommst du heute Abend zum Buchclub? Es ist zwei Monate her, dass du zuletzt dabei warst. Wir vermissen dich.«
»Über welches Buch sprecht ihr gerade?«
»Die Reisen des Ibn Battuta. Ingrid hat es ausgesucht«, antwortet Ben.
»Das habe ich schon gelesen.«
»Dann kannst du uns ja eine Zusammenfassung geben«, sagt Declan. »Ben und ich haben nämlich unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Wir treffen uns heute Abend bei Ingrid und Lloyd. Sechs Uhr, es gibt Martini. Wenn wir erst ein paar intus haben, können wir vielleicht die Diskussion über das Buch überspringen und gleich zum Dorftratsch übergehen. Dürfen wir mit dir rechnen?«
»Ich denke drüber nach.«
»Das ist doch keine Antwort«, knurrt Ben. Er versucht, mir Druck zu machen, damit ich komme. Ich habe mich immer gefragt, wie viel Erfolg er mit dieser Gangster-Masche gehabt hat, als er noch im Einsatz war. Mir hat er jedenfalls nie Angst gemacht.
»Okay, ich werde dort sein«, sage ich.
»Und ich sorge dafür, dass dein Lieblingswodka schon auf Eis liegt«, sagt Declan.
»Belvedere.«
Declan lacht. »Also wirklich, Mags. Glaubst du wirklich, ich hätte dieses Detail vergessen?«
Natürlich weiß er, was mein bevorzugter Wodka ist. Unter Declans beeindruckender Löwenmähne sitzt ein ebenso beeindruckender Verstand mit einem Talent für Details – und für Fremdsprachen, von denen er gleich sieben beherrscht. Ich habe nach dreien aufgegeben.
Ich gehe zurück zu meinem Truck und mache mich auf den Nachhauseweg, über holprige Nebenstraßen mit Frostschäden, durch eine schwarz-weiße Szenerie aus kahlen Bäumen und schneebedeckten Feldern. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal meinen Lebensabend in einer Landschaft wie dieser verbringen würde. Ich bin in einer Gegend mit Staub und Hitze und gleißend hellen Sommern aufgewachsen, und mein erster Winter in Maine war eine Herausforderung. Ich lernte, Brennholz zu hacken, auf vereisten Straßen zu fahren und eingefrorene Wasserleitungen aufzutauen, und ich lernte, dass man nie zu alt ist, um sich an Neues zu gewöhnen. Als ich jung war und mir überlegte, was wohl der perfekte Rahmen für meinen Ruhestand wäre, da träumte ich von einer Villa auf einem Hügel in Koh Samui oder einem Baumhaus auf der Osa-Halbinsel in Costa Rica, wo mir Vögel und Brüllaffen Ständchen bringen würden. Das waren Orte, die ich kannte und liebte – Orte, an die zu fliehen mir am Ende verwehrt war.
Denn dort genau würden sie mich vermuten. Berechenbar zu sein, ist immer der erste Fehler.
Ein Alarmsignal piepst auf meinem Handy.
Ich werfe einen Blick aufs Display, und was ich sehe, lässt mich abrupt auf die Bremse steigen. Ich fahre rechts ran und starre die Bilder an. Es ist die Videoübertragung von meiner Alarmanlage. Jemand ist gerade in mein Haus eingedrungen.
Ich könnte die örtliche Polizei einschalten, aber die würden bestimmt Fragen stellen, die ich nur ungern beantworten möchte. Das Police Department von Purity ist nur mit sechs Vollzeitbeamten besetzt, und bis jetzt hatte ich nie einen Anlass, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und ich will, dass das so bleibt, auch wenn es bedeutet, dass ich diese Sache hier selbst in die Hand nehmen muss.
Ich setze meine Fahrt fort.
Mein Puls hat sich zu einem schnellen Galopp gesteigert, als ich an der Reihe von Zuckerahornen vorbeifahre und vor meinem Bauernhaus anhalte. Einen Moment lang bleibe ich noch im Truck sitzen und beobachte die Veranda. Ich kann nichts Ungewöhnliches bemerken. Die Haustür ist geschlossen, und meine Schneeschaufel ist noch da, wo ich sie abgestellt habe, an den Brennholzstapel gelehnt. Der Eindringling will mich in dem Glauben wiegen, es sei alles in Ordnung.
Dann werde ich auch so tun, als ob ich das glaube.
Ich steige aus und trage den Sack Kartoffeln und das Hühnerfutter auf die Veranda. Dort lasse ich beides geräuschvoll auf die Bodenbretter plumpsen. Während ich meinen Hausschlüssel hervorhole, sind meine Nerven aufs Äußerste gespannt, alle Sinne geschärft. Ich höre den Wind in den Bäumen rauschen, spüre seinen kalten Hauch auf meiner Wange.
Dann sehe ich, dass der Faden am Türpfosten zerrissen ist.
Es ist eine so primitive Methode in diesen Zeiten der elektronischen Überwachungsanlagen, aber digitale Systeme können immer versagen oder gehackt werden. In den letzten paar Monaten bin ich unvorsichtig geworden und habe nicht immer daran gedacht, den Faden – fein wie Spinnweben – anzubringen, doch was ich heute Morgen bei Luther erfahren habe, hat mich wieder zu dieser Vorsichtsmaßnahme greifen lassen.
Ich entsperre die Tür und schiebe sie mit der Stiefelspitze auf. Im Windfang sieht auf den ersten Blick alles normal aus. Meine Schuhe sind unter der Bank aufgereiht, meine Jacken hängen an Haken. Der Boden ist körnig von Sand und Erde, die ich an meinen Sohlen hineingetragen habe. Zur Linken ist das Wohnzimmer. Ich werfe einen Blick hinein und sehe das Sofa, die Ohrensessel, das gestapelte Brennholz vor dem Kamin. Von einem Einbrecher keine Spur.
Ich wende mich nach rechts und gehe weiter in die Küche, wobei ich darauf achte, nicht auf das knarrende Bodenbrett zu treten. Ich sehe meine Kaffeetasse und das Frühstücksgeschirr im Spülbecken, die Grapefruitschalen im Komposteimer. Auf dem Tisch glitzern ein paar verschüttete Zuckerkörnchen. Alles ist so, wie ich es zurückgelassen habe, mit einem Unterschied: Ich rieche ein fremdes Shampoo.
Das störende Bodenbrett hinter mir knarrt. Ich fahre herum und stehe dem Eindringling gegenüber.
Sie ist jung und schlank, ihre Bewegungen sind geschmeidig wie die einer Sportlerin. Anfang dreißig, mit glatten schwarzen Haaren und geradem Pony. Dunkle Augen, hohe Wangenknochen. Sie wirkt erstaunlich ungerührt angesichts der Tatsache, dass der Lauf meiner Walther, die ich seit meinem Gespräch mit Callie heute Morgen bei mir trage, auf ihre Brust gerichtet ist.
»Hallo, Maggie Bird«, sagt sie.
»Ich glaube nicht, dass wir uns kennen.«
»Wieso haben Sie sich eigentlich diesen Namen zugelegt?«
»Wieso nicht?«
»Lassen Sie mich raten. Bird wegen ›Free as a Bird‹?«
»Man darf schließlich träumen.«
Sie zieht sich einen Stuhl heran. Setzt sich an meinen Küchentisch und wischt beiläufig die Zuckerkörnchen weg, die ich beim Frühstück verschüttet habe. Es scheint sie nicht zu kümmern, dass ich nur einen Finger am Abzug krümmen muss, um ihr den Schädel wegzupusten. »Das ist wirklich nicht nötig«, sagt sie und deutet mit dem Kopf auf meine Walther.
»Das entscheide ich. Im Augenblick sehe ich nur eine Frau vor mir, die in mein Haus eingedrungen ist, ohne dass ich sie eingeladen hätte. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind oder warum Sie hier sind.«
»Sagen Sie doch bitte Bianca zu mir.«
»Klarname oder Deckname?«
»Ist das so wichtig?«
»Die Polizei wird sicher nach dem Namen der Leiche fragen.«
»Oh, ich bitte Sie. Ich bin hier, weil wir ein Problem haben. Und wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen.«
Ich betrachte sie eine Weile, registriere die entspannten Schultern und die langen, schlanken Beine, die sie jetzt lässig übereinandergeschlagen hat. Sie sieht mich nicht einmal an, sondern zupft seelenruhig an einem Niednagel herum.
Ich setzte mich ihr gegenüber und lege meine Walther auf den Tisch.
Sie streift die Pistole mit einem Blick. »Ja, ich kann verstehen, warum Sie glauben, die zu brauchen. Sie haben den Ruf, sehr misstrauisch zu sein.«
»Ich habe einen Ruf?«
»Deswegen hat man mich geschickt. Weil Sie vermutlich eine Frau als weniger bedrohlich empfinden würden.«
»Wenn Sie überhaupt irgendetwas über mich wissen, dann wissen Sie auch, dass ich nicht mehr dabei bin. Ich bin jetzt Hühnerfarmerin. Und ich bin es gerne.«
Ihre Lippen lassen nicht den leisesten Anflug eines Lächelns erkennen. Sie hat überhaupt keinen Sinn für Humor, sondern gibt sich ganz geschäftsmäßig – eine Frau, die einen Auftrag zu erfüllen hat. Offenbar hat die Behörde an ihrem Rekrutierungsverfahren gefeilt, seit ich nicht mehr für sie arbeite.
»Ich weiß nicht, warum man Sie geschickt hat«, sage ich. »Aber nachdem Sie mich nun gesehen haben, wissen Sie, dass ich meine besten Zeiten hinter mir habe, und ich bin auch ziemlich eingerostet. Ich bin nicht daran interessiert, noch einmal für die Firma zu arbeiten.«
»Man würde Sie gut bezahlen.«
»Ich habe alles Geld, was ich brauche.«
»Sehr gut sogar.«
Ich runzle die Stirn. »Wirklich? Das klingt so gar nicht nach dem geizigen Uncle Sam, den ich kenne.«
»Dieser Auftrag dürfte für Sie eine besondere Bedeutung haben.«
»Ich bin trotzdem nicht interessiert.« Ich stehe auf, und obwohl die schnelle Bewegung einen stechenden Schmerz durch mein Knie jagt, verbietet mir mein Stolz, sie ein Stöhnen hören oder ein schmerzverzerrtes Gesicht sehen zu lassen. »Ich begleite Sie jetzt nach draußen. Sagen Sie ihnen, wenn sie das nächste Mal jemanden schicken, um mit mir zu reden, soll der- oder diejenige doch einfach anklopfen wie jeder normale Besucher.«
»Diana Ward ist von der Bildfläche verschwunden.«
Ich erstarre mitten in der Bewegung. Einen Moment lang schaue ich sie nur an und versuche, ihre Miene zu deuten, sehe aber nichts als kalte Perfektion und ein vollkommen ausdrucksloses Gesicht.
»Lebendig oder tot?«, frage ich.
»Das wissen wir nicht.«
»Zuletzt wo gesehen?«
»In Person? Vor einer Woche in Bangkok. Seitdem ist sie verschwunden und ihr Handy sendet nicht mehr.«
»Sie ist seit Jahren im Ruhestand. Hat die Behörde nicht lange nach mir verlassen. Warum ist es Ihnen so wichtig zu wissen, wo sie sich jetzt aufhält?«
»Wir sind besorgt um ihr Wohlergehen. Tatsächlich machen wir uns Sorgen um alle, die in die Operation Cyrano involviert waren.«
Ich kann meine Reaktion auf diese zwei Worte nicht verbergen. Es ist ein Schock, der mir durch Mark und Bein geht, so heftig wie die Druckwelle einer Explosion. »Warum kommt das jetzt wieder hoch?«
»Es hat kürzlich einen Angriff auf die automatisierten Informationsdienste der Behörde gegeben. Dieser unberechtigte Zugriff löste einen Alarm aus, aber die einzige Datei, auf die der Hacker zugegriffen hat, war die zur Operation Cyrano.«
»Die Operation war vor sechzehn Jahren.«
»Und die Informationen sind nach wie vor unter Verschluss, im Interesse der Sicherheit aller Beteiligten. Aber jetzt fürchten wir, Ihre Namen könnten geleakt worden sein, und deshalb suchen wir Sie alle auf, um uns zu vergewissern, dass Sie wohlauf sind. Und zu fragen, ob Sie Hilfe benötigen. Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass es Sie an einen Ort wie diesen verschlagen würde.« Ihr Blick wandert über meinen Kiefernholztisch zu der Leiste mit den aufgehängten gusseisernen Pfannen. Draußen hat es zu schneien begonnen und dicke Flocken trudeln am Fenster vorüber – die Sorte Schnee, in der zu laufen das reinste Vergnügen ist. Bianca sieht nicht aus wie eine Frau, die Freude an Schneeflocken hat.
»Wie Sie sehen können, habe ich mich hier eingelebt, und ich habe einen neuen Namen«, erkläre ich ihr. »Ich habe überhaupt nichts zu befürchten.«
»Aber Diana könnte in Schwierigkeiten sein.«
»Diana in Schwierigkeiten?« Ich lache. »Das ist ja wohl der Normalzustand bei ihr. Aber sie ist eine Überlebenskünstlerin, und sie ist durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Also, wenn Sie nur gekommen sind, um mich das zu fragen, wird es jetzt Zeit, dass Sie verschwinden.« Ich gehe zur Haustür und reiße sie auf. Trotz der kalten Luft, die hereinweht, halte ich sie offen und warte darauf, dass die ungebetene Besucherin mein Haus verlässt.
Endlich tritt Bianca hinaus auf die Veranda, dann dreht sie sich noch einmal um und sieht mich an. »Helfen Sie uns, sie zu finden, Maggie. Sie müssen doch wissen, wo sie hingegangen ist. Sie haben mit ihr zusammengearbeitet.«
»Vor sechzehn Jahren.«
»Trotzdem – Sie kennen sie wahrscheinlich besser als irgendjemand sonst.«
»Ja, da haben Sie wohl recht. Und genau deshalb interessiert es mich einen feuchten Dreck, was mit ihr passiert«, sage ich und schlage ihr die Tür vor der Nase zu.
3
Jo
Bei manchen Männern hilft eben nur ein Messer in den Bauch, dachte Jo Thibodeau, als sie zusah, wie die Sanitäter die Trage mit Jimmy Kiely in den Rettungswagen luden. Er würde seine Verletzungen mit ziemlicher Sicherheit überleben, und das war je nach dem Standpunkt, den man einnahm, gut oder schlecht. Gut, weil Megan, seine Frau, nicht wegen Mordes angeklagt würde. Schlecht, weil es bedeutete, dass Jimmy zurückkommen und Megans unglückliches Leben noch unglücklicher machen und das Drama ihrer Ehe sich fortsetzen würde, bis Jo und ihre Leute erneut eingreifen mussten. Selbst in einem so kleinen Ort wie Purity spielten sich immer Dramen ab, manchmal hinter verschlossen Türen, wo niemand sonst das Schluchzen und das Klatschen der Schläge hören konnte. Manchmal jedoch verlagerten sich diese privaten Dramen in die Öffentlichkeit, und dann nickten die Nachbarn, die die blauen Augen und die ständig zugezogenen Vorhänge gesehen hatten, einander zu und sagen: Wir haben doch gewusst, dass das eines Tages passieren würde.
Heute Abend war es wieder einmal passiert. Ein Dutzend dieser Nachbarn standen auf dem Parkplatz vor dem Whale Spout herum und hörten, wie Jimmy im Rettungswagen wüste Drohungen ausstieß, so laut, dass nicht einmal die dröhnende Musik aus dem Pub ihn übertönen konnte.
»Wart’s nur ab, du Schlampe! Wart nur ab, bis ich nach Hause komme!«
Zu schade, dass das Messer Jimmys Lunge verfehlt hatte.
»Das wird dir noch leidtun! Wart’s nur ab!«
Mit flackerndem Blaulicht fuhr der Rettungswagen davon, und Jo stieß einen Seufzer aus, der sich in der frostigen Luft zu einer Dampfwolke formte. Die Schaulustigen auf dem Parkplatz des Pubs machten keine Anstalten, sich zu zerstreuen, denn das hier war das Aufregendste, was in Purity passiert war, seit Fernald Hobbs am Steuer seines Pick-ups einen Herzinfarkt erlitten hatte und mitten durch die Bootswerft geradewegs ins Hafenbecken gerast war. Obwohl das Thermometer zehn Grad unter null zeigte und es wieder zu schneien begonnen hatte, standen sie da und glotzten, wie hypnotisiert vom Blaulicht der zwei Streifenwagen. Wenn man in Maine aufwächst, sind zehn Grad minus an einem Februarabend angenehm mild.
»Geht jetzt bitte nach Hause, Leute!«, rief Jo. »Hier gibt es nichts zu sehen.«
»Das geschieht ihm nur recht, Jo!«, rief Dorothy French.
»Das haben die Geschworenen zu entscheiden. Und jetzt macht euch bitte auf den Heimweg, bevor ihr euch noch alle was abfriert. Die Bar ist für heute geschlossen.«
Nachdem das einzige Lokal mit Alkoholausschank, das den Winter über geöffnet blieb, für heute dichtgemacht hatte, würde der Rest der Nacht hoffentlich ruhig verlaufen. Es sei denn, jemand fuhr zu schnell durch eine Kurve und schlitterte in eine Schneewehe, oder irgendein Kind schloss die Haustür auf und spazierte in die Nacht davon. Aus Polizeisicht machte die Kälte alles noch komplizierter, von Verkehrsunfällen bis hin zu vermissten Kindern. Wenn dann noch ein schwerer Fall von Hüttenkoller dazukam und lang angestaute Wut sich in Kombination mit zu viel Alkohol schlagartig entlud, dann war das Ergebnis … nun ja, genau das, was sich heute Abend hier im Whale Spout abgespielt hatte.
Sie betrat das Lokal und stampfte sich den Schnee von den Stiefeln. Nach der Kälte draußen kam es ihr hier drin vor wie in einem Backofen. Die Heizung war voll aufgedreht, und es war bestimmt vierundzwanzig Grad warm, wenn nicht mehr. Was für eine Energieverschwendung. Jo blickte zur Bar, wo sie ein paarmal den Sommer über gejobbt und für die auswärtigen Horden Wein ausgeschenkt und Cocktails gemixt hatte – sonnengebräunte Touristen, die ihr kleines Küstennest malerisch fanden und fragten, was die Leute hier eigentlich im Winter machten. Tja, das ist es, was wir hier machen: Wir nehmen zu, trinken zu viel und gehen einander auf die Nerven. Sie sog den Hefegeruch von Bier ein und dachte sich, wie gut jetzt ein Glas kühles Sea Dog Ale schmecken würde, aber das würde warten müssen. Stattdessen öffnete sie den Reißverschluss ihrer Jacke, zog Handschuhe und Wollmütze aus und konzentrierte sich auf den Grund, warum sie hier war: die junge Frau, die zusammengesunken an einem Tisch in der Ecke saß, bewacht von dem Polizisten, der neben ihr stand.
Megan Kiely hatte zweifellos schon bessere Zeiten erlebt. Auf der Highschool hatte sie zu den beliebtesten Mädchen gehört, ein temperamentvoller Rotschopf mit einem Lachen, das man noch am anderen Ende der Langlaufbahn hören konnte. Ihre Haare waren immer noch rot, und sie hatte immer noch eine Wahnsinnsfigur, aber das Lachen war ihr mit ihren gerade mal zweiunddreißig Jahren gründlich vergangen, und zurück blieb nur die traurige Hülle der Frau, die sie einmal gewesen war.
»Hallo, Megan«, sagte Jo, laut genug, um bei der wummernden Musik verstanden zu werden.
Megan blickte auf und erwiderte matt: »Hallo, Jo.«
»Mike, lässt du uns mal kurz allein?«, wandte Jo sich an ihren Officer. »Und mach diese grauenhafte Musik aus, ja?«
Sie wartete, bis Mike hinter den Tresen gegangen war und die Anlage ausgeschaltet hatte. Endlich – himmlische Stille. Als sie sich gegenüber von Megan an den Tisch setzte, landete ihre Hand in etwas Klebrigem auf der Tischplatte, und sie sah, dass ihr Handballen mit Blut verschmiert war. Es musste das Blut dieses Dreckskerls sein, denn Megan schien keine offenen Wunden zu haben, nur ein geschwollenes rechtes Auge, das sich bis morgen früh zu einem prächtigen Veilchen auswachsen würde.
»Also – wollen wir darüber reden?«, fragte Jo.
»Nein.«
»Wir müssen aber, das weißt du.«
»Ja.« Megan seufzte. »Ich weiß.«
Jo zog eine Papierserviette aus dem Spender und wischte sich das Blut von der Hand. »Was ist passiert?«
»Er hat mich geschlagen.«
»Wo?«
»Ins Gesicht?«
»Ich meine, wo ist es passiert?«
»Zu Hause. Ich weiß nicht mal mehr, worüber er sich so aufgeregt hat. Ach ja, es war, weil ich zu spät vom Besuch bei meiner Mom zurückgekommen bin. Er hat mir eine gelangt und ich hab mich umgedreht und bin gegangen. Ich bin hierhergekommen, weil ich dachte, ich warte einfach ab, bis er sich wieder beruhigt hat. Aber er ist mir gefolgt. Kam hier reingeplatzt und hat sich auf mich gestürzt, als ich am Tresen gesessen habe. Ich hab wohl einfach nur … reagiert. Ich bin zurückgewichen und hab nach einem Steakmesser gegriffen. Ich kann mich nicht erinnern, es getan zu haben. Ich weiß nur noch, dass er plötzlich losgeschrien hat, und dann war alles voller Blut, und ich hatte irgendwie das Messer in der Hand.«
Jo sah zu Mike, der sagte: »Wir haben es sichergestellt. Und wir haben ein halbes Dutzend Zeugen, die gesehen haben, wie sie es getan hat.« Er zuckte mit den Schultern. »Klarer Fall.«
Aber so klar war der Fall nicht. Eine Frau hatte auf ihren Ehemann eingestochen, das war der schlichte Sachverhalt, aber dem vorausgegangen war die traurige und verwickelte Geschichte einer Frau, die sich zu jung verliebt hatte, zu jung geheiratet hatte. Zu jung in die Falle geraten war.
»Ich muss ins Gefängnis, nicht wahr?«, wisperte Megan.
»Für heute Nacht, ja. Bis dein Anwalt morgen früh die Sache regeln kann.«
»Und danach?«
»Es liegen mildernde Umstände vor. Ich weiß es und die meisten Leute im Ort wissen es auch.«
Megan nickte und lachte betrübt auf. »Irgendwie freu ich mich fast aufs Gefängnis. Das wäre wie ein kleiner Urlaub, weißt du? Ich könnte ruhig schlafen und müsste nicht fürchten, dass Jimmy …«
»Megan, es muss nicht so sein.«
»Aber es ist so.« Sie sah Jo an. »Es ist nun mal so.«
»Dann ändere es. Schick Jimmy in die Wüste.«
Megans Mundwinkel verzogen sich zu einem angedeuteten Lächeln. »Ja, dass du so was sagst, ist doch klar. Das ist die Jo Thibodeau, die wir kennen, die vor nichts Angst hat. Du hast dich kein bisschen verändert seit der Highschool.« Sie schüttelte den Kopf. »Was tust du eigentlich noch hier? Du hättest dich längst absetzen können. Irgendwohin, wo es wärmer ist, nach Florida zum Beispiel.«
»Ich mag die Hitze nicht.«
»Was ich sagen will, ist: Du könntest woanders sein.«
»Ja, könnte ich. Genau wie du.«
»Du bist aber nicht an den falschen Mann geraten.«
»Das kannst du jederzeit ändern.«
»Du hast gut reden – als ob das so leicht wäre. Du verstehst einfach nicht, wie schwierig es ist.«
»Nein«, seufzte Jo. »Da hast du wohl recht.« Und sie verstand auch nicht, wie eine Frau wie Megan dem Süßholzgeraspel eines Jimmy Kiely erliegen konnte. Aber Männer wie Jimmy machten auch stets einen großen Bogen um Jo, weil ihr ein gewisser Ruf vorauseilte. Alle Typen im Ort wussten: Wenn du Jo Thibodeau schlägst, dann schlägt sie zurück, und zwar doppelt so fest.
Jo stand auf und half Megan hoch. »Das Auge solltest du unbedingt anschauen lassen. Mike bringt dich jetzt erst mal ins Krankenhaus. Einbuchten können wir dich später immer noch.«
»Und dann kann ich endlich schlafen«, sagte Megan. Tatsächlich konnte sie sich auf eine ruhige Nacht freuen, denn sie würde die einzige Insassin des Gefängnisses sein. Um diese Jahreszeit waren die Zellen in Purity fast immer leer. Das war in Jos Augen das Gute am Winter: keine betrunkenen Sommertouristen, die in Rennbooten im Hafenbecken herumknatterten, keine Bagatelldiebstähle, begangen von Schülern, die sich in den Sommerferien langweilten. Wenn die Nächte länger wurden und es zu schneien begann, schien der ganze Ort in eine Art Winterstarre zu fallen und sich in eine verschlafenere, friedlichere Version seiner selbst zu verwandeln.
Es war dieses verschlafene Purity, das Jo sah, als sie später am Abend die Main Street entlangfuhr, wo schon um sieben die Schaufensterbeleuchtungen ausgeschaltet wurden und wo auf den verlassenen Gehsteigen das Eis im Schein der Straßenlaternen glitzerte. Ein verwunschenes Städtchen, friedlich schlummernd an einem Winterabend. Aber auch wenn es wie ein Ort wirkte, an dem die Zeit stehen geblieben war, hatte Jo doch in den zweiunddreißig Jahren ihres Lebens schon allzu viele Veränderungen miterlebt. Wo früher der Antiquitätenladen gewesen war, der bunt zusammengewürfeltes Porzellan und verblichene Ansichtskarten verkauft hatte, wurden jetzt Marmeladen, Konfitüren und Süßigkeiten in ausgefallenen Verpackungen feilgeboten. Die alte Eisdiele, wo ihr Dad immer Vanille-Cola getrunken hatte, war von einer Weinhandlung verdrängt worden, und die wiederum von einer Coffee-Bar namens »Fine Grind«, wo sie Kaffee in so vielen verschiedenen Varianten anboten, dass man ein Italienisch-Wörterbuch brauchte, um zu wissen, was man bestellte. Immerhin hatte die Eisenwarenhandlung noch nicht dichtgemacht, doch der dreiundachtzigjährige Inhaber wollte sich bald zur Ruhe setzen, und eines nicht allzu fernen Tages würde man hier keine Hämmer und Schraubenzieher mehr kaufen können, sondern höchstens noch T-Shirts für Touristen. Diese Backsteinhäuser mochten hundertfünfzig Jahre auf dem Buckel haben, aber unter ihren Dächern wechselten die Geschäfte und die Inhaber in einer endlosen Parade, denn wenn man sich auf etwas verlassen konnte im Leben, selbst in einem so kleinen Nest, dann darauf, dass nichts so blieb, wie es war.
Sie dachte an Megans Worte: Was tust du eigentlich noch hier? Du hättest dich längst absetzen können. Und es stimmte – Jo hätte Purity verlassen können, aber sie wusste, dass sie niemals weggehen würde, weil sie es nun mal nicht wollte. Hier war sie aufgewachsen, genau wie ihr Vater und ihr Großvater und dessen Großvater, Generationen von Thibodeaus, die in zweihundertfünfzig Jahren ihre Wurzeln tief in den steinigen Boden getrieben hatten. Und jetzt war sie für die Sicherheit in dieser Gemeinde verantwortlich, für diese knapp dreißig Quadratmeilen zwischen der Penobscot Bay im Osten und Mount Cameron im Westen. Zu ihrem Revier gehörten der Hafen und die Bootswerft, Ackerland und Wald, ein See, zahlreiche Teiche mit und ohne Namen, und dreitausend ganzjährig ansässige Einwohner, von denen die meisten entlang der Küste lebten, wo der Geruch des Meeres in der Luft lag.
An diesem Winterabend war es allerdings zu kalt, als dass man den Ozean hätte riechen können, selbst dann, als Jo zum Anlegeplatz hinunterfuhr und am Kai parkte. Sie ließ ihr Fenster herunter und lauschte auf Anzeichen von Ärger, doch sie hörte nur das Plätschern der Wellen an der Hafenmauer. Die beiden Windjammer der Stadt, die Amelie und die Samuel Day, waren für den Winter in Schrumpffolie gehüllt und sahen aus wie Geisterschiffe, die dort an ihrem Ankerplatz dümpelten. Im Sommer würden diese zwei Segelschiffe jeden Nachmittag, wenn das Wetter es zuließ, in See stechen, vom Bug bis zum Heck vollgepackt mit zahlenden Passagieren. Der Fang des Tages, nannten die Einheimischen sie, und während sie nur zu gerne das Geld einstrichen, waren sie alles andere als glücklich über den Verkehr und das Chaos und überhaupt die ganzen Probleme, die diese Touristen dem Ort bescherten.
Probleme, die Jo für sie lösen sollte.