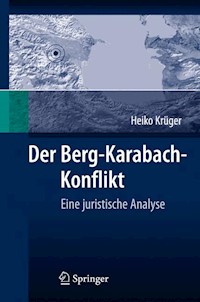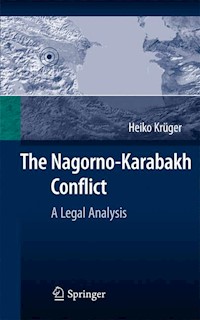Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Sprechen eines Tages Maschinen Recht? Verwalten uns Algorithmen? Entwerfen neuronale Netze in unglaublicher Geschwindigkeit Gesetze, die keine Schlupflöcher mehr haben, keinen Interpretationsspielraum? Ersetzen künstliche Intelligenzen Tausende von Arbeitskräften im Staatsapparat? Wie weit kann das gehen? Wie schnell wird das gehen? Und: Wie sollten wir das finden? In seinem neuen Buch geht Prof. Heiko Krüger diesem Themenkomplex erstmals auf den Grund und sucht nach Antworten auf die brennendsten Fragen. Seine These: Wir können und sollten optimistisch in die Zukunft blicken – uns aber klarmachen, dass wir vor umwälzenden Veränderungen auch dort stehen, wo wir es nie erwartet hätten: im Zentrum unserer Demokratie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STAAT 3.0 · PROF. DR. HEIKO KRÜGER
Copyright 2024:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Gestaltung Cover: Daniela Freitag
Gestaltung, Satz und Herstellung: Sabrina Slopek
Vorlektorat: Elke Sabat
Korrektorat: Sebastian Politz
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-68932-000-3
eISBN 978-3-68932-001-0
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 ⬩ 95305 Kulmbach
Tel: +4992219051-0 ⬩ Fax: +4992219051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenbuchverlage
www.instagram.com/plassen_buchverlage
Für meine Eltern
INHALT
EINLEITUNG
TEIL 1 JAGS (Joint Artificial Governing System)
1.1 Ein technisches Mirakel
1.2 Der Traum von einer sozialen Weltformel
1.3 Die Grenzen einer Künstlichen Superintelligenz
TEIL 2 Führung und Kontrolle: Strukturen gesellschaftlicher Lenkung
2.1 Fokus
2.2 Von Makrosoziologen und geplatzten Träumen
2.3 Auf der Jagd nach Erkenntnis
2.4 Die Grobmechanik der Gesellschaftssteuerung – oder: Von den Kissen und Federn des Weißen Hauses
Wie Steuerungsapparate unsere Welt formen
Steuerungsprozesse: Die Pfade der Macht
2.5 Vom Ende der Theorie
TEIL 3 Steuerung im digitalen Zeitalter: Bits und Bytes, die Gesellschaften lenken
3.1 Hinter den Glasfronten des MIT
3.2 Echo der Gesellschaft: Digitale Impulse für politische Reaktionen
Technologiebasierte Problemdefinition für moderne Politik
Digitale Dirigenten: KI-geleitetes Agenda-Setting?
3.3 Rechtsschöpfung durch KI und Co: Die Zukunft der legislativen Planung
Die Vision
Wahre Gesetzgebungsmaschinen
Die Komplexität und Veränderlichkeit der Welt
Die Imitation der Planungskreise
Menschliche Schwarmintelligenz
Das Gespenst der postfaktischen Politik
3.4 Smarte Gesetzgebungstechnologien
Intelligente Forschungs- und Recherchetools
Digitale Zwillinge
Normierungstechnologien
3.5 Die Steuerungsentscheidung
3.6 Digitale Wächter und Vollzieher des Rechts: Die neue Ära der Rechtsumsetzung
Technologischer Aufbruch
Schneisen in die Zukunft
Was da noch wartet
3.7 Rechtsanwendungstechnologien
Der erste Automatisierungsschub
Auswirkungen auf uns Bürger
3.8 Entscheidungstechnologien
Chancen des KI-Zeitalters
Die große Skepsis
Der juristische Kernbereich
Die Robustheit des juristischen Kernbereichs
Anforderungen an zukünftige Maschinengenerationen
Entwicklung zukünftiger Maschinengenerationen
Die Zeichen der Zeit
3.9 Kontra Maschinen
Das Primat der menschlichen Revision
Vom Ende des Gesetzes
Das Blackbox-Problem
TEIL 4 Die Stabilität des Staates im Zeitalter der Digitalisierung: Rückblick und Neubewertung
4.1 Die Zehnerjahre: Grüße aus der Zukunft
4.2 Ein sich lohnender Rückblick: Der Arabische Frühling und der demokratische Horizont
4.3 Die liberalen Demokratien
4.4 Risse, Erosion und Transformation: Düstere Visionen
4.5 Update: Das Rückgrat liberaler Demokratien
Der Glaube an die demokratische Grundordnung und die Transformation in autoritäre Regierungsformen
Die Verformung des Volkswillens
Künstliche Intelligenz in der Kommunikation mit dem Wähler
Künstlich-intelligente Wahlempfehlungssysteme
Milderung und Abwehr von Bedrohungen
4.6 Vitalisierung der Demokratie
Demokratische Exoten
Direkte Demokratie: Neue Horizonte?
Parlament und Volk: Die neue Balance
Digitale Bürgerbeteiligung: Eine Sackgasse?
4.7 Der soziale Stoff, der uns zusammenhält: Neue Aussichten
KI und die Arbeitswelt: Eine Neubewertung
Wirtschaftliche Ungleichheit: Wie gefährlich ist die sich vertiefende Kluft tatsächlich?
AUSBLICK Ausblick in ein Zeitalter digitaler Steuerung
ENDNOTEN
LITERATURVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Ich wurde Mitte der Siebzigerjahre in die sanft hüglige Landschaft der Altmark hineingeboren. Abgesehen von so mancher Scheidung hatten wir Kinder des Ostens, die der zweiten Nachkriegsgeneration, nicht viel auszustehen. Sicherlich fehlte uns so manche Banane, Mango und der zarte Schmelz in der Schokolade. Das machte uns aber noch lange nicht zu Unglückswürmern. Die Schlagbäume und Fesseln des Kommunismus warteten jedoch unmerklich auf unser Älterwerden. Nördlich und westlich Salzwedels, meiner Heimatstadt, zog sich eine unüberwindbare Barriere durch die Wälder, der Eiserne Vorhang. Bis in die späten Achtzigerjahre teilte er Deutschland, Europa und irgendwie den ganzen Erdball in zwei Lager. Stacheldraht und Mauern sollten aufhalten, was am Ende nicht aufzuhalten war: die Implosion marxistischer Ideen und der Autokratien, die sich darauf stützten. Letztlich bedurfte es nur eines einzigen Tores, das im Spätsommer 1989 im ungarisch-österreichischen Grenzland aufgestoßen wurde, um die kritische Phase einer Dynamik einzuleiten, an deren Ende alle Machthaber des Ostblocks entthront wurden und dieser selbst kollabierte.
Lange Zeit schien der damalige Zusammenbruch der kommunistischen Systeme die markanteste Wendung zu sein, die die Geschichte vor meinen Augen vollführen würde – aber weit gefehlt. Je mehr ich die Augen öffne, desto mehr bemerke ich, dass die Geschichte in diesen Tagen eine Wendung nimmt, die den Fall der Mauer und die folgende Transformation des Ostblocks noch verblassen lässt. Mit ihr verglichen schrumpft der Kommunismus zu einem Intermezzo der Historie, zu einem untauglichen, für viele gleichwohl einschneidenden Versuch, unsere Spezies in die Zukunft zu führen.
Derzeit werden wir Zeugen eines wahrhaft epochalen Umbruchs. Er ist vergleichbar mit anderen anthropologischen Großereignissen wie der Ausbreitung des Ackerbaus, der Erfindung des Buchdrucks oder der Entdeckung der Elektrizität. Die Rede ist von der Digitalisierung. Seit geraumer Zeit schleicht sie sich in unser Leben und entfaltet mit dem Aufkommen Künstlicher Intelligenz ihr wahres Potenzial. Sie hat begonnen, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, lernen, arbeiten, altern und sowohl kreativ als auch wissenschaftlich tätig sind, zu überformen. ChatGPT, Google Gemini und Claude gehören zu ihren ersten künstlich-intelligenten Formen, auf die wir alle zugreifen können. Zahlreiche weitere werden hinzukommen. Es warten Weichenstellungen in allen Bereichen der menschlichen Existenz, in deren Folge wir zu ungeahnten Horizonten aufbrechen werden. Sie können Utopien und Dystopien wahr werden lassen.
Die Prognose fällt nicht schwer, dass der Mensch als soziales Wesen auch in fernen Tagen ein Zusammenleben in großen Gesellschaften bevorzugen wird. Er wird nicht zu einem Leben in Kleinstgruppen von Jägern und Sammlern zurückkehren. Die Steuerung dieser Gesellschaften aus Millionen von Individuen bleibt zentral für das Wohlergehen der menschlichen Art. Sie wird sich jedoch ändern. Aber wie genau? Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf diesen für uns alle entscheidenden Aspekt des Zusammenlebens haben?
Das vorliegende Buch sucht nach Antworten auf diese Fragen. Es handelt von der Zukunft der Steuerung der Gesellschaft durch einen Staat 3.0. In einem solchen geht es nicht mehr nur darum, dass Internettechnologie die Kommunikation zwischen Bürgern und Staat auf ein neues Niveau hebt – ein Konzept, das vor Jahren als Staat 2.0 bezeichnet wurde.1 Vielmehr liegt der Schwerpunkt darauf, wie Menschen und Maschinen unsere Gesellschaften in zunehmendem Maße digital lenken werden.
Ich gehe fest davon aus, dass neue Technologien und insbesondere Künstliche Intelligenz die Art und Weise der Steuerung von Gesellschaften, von unseren Familien und uns als Individuen regelrecht revolutionieren werden. Es ist damit zu rechnen, dass sie die existierenden Gesellschaftssysteme und die uns schützenden Rechte der Freiheit und Gleichheit noch erheblich stärker unter Druck setzen werden, als das derzeitige Technologien tun. Zum Schutz von Demokratie und Freiheit werden wir gezwungen sein, unser politisches Entscheidungsmonopol gegenüber Maschinen zu verteidigen und in deren Entwicklung und Verwendung wirksam einzugreifen.
Das Thema der Gesellschaftssteuerung im anbrechenden Hochtechnologiezeitalter wartet mit einer gewissen Komplexität auf. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass es sich in zwei große Themenblöcke teilt. Der erste betrifft konstruktive Fragen, also die Art und Weise, wie staatliche Entscheidungsträger und die ihnen assistierenden Ressorts Technologie gezielt zu Steuerungszwecken einsetzen werden oder einsetzen könnten. Der zweite Themenblock betrifft eher destruktive Fragen, also wie Technologie Steuerungsapparate und Steuerungsfundamente gefährden und Gesellschaften von eigentlich angedachten Kursen abbringen könnte.
Dem ersten, konstruktiven Themenblock ist der überwiegende Teil des Buches gewidmet. In ihm wird im Sinne eines Staates 3.0 erörtert, wie Maschinen und Künstliche Intelligenz Aufgaben innerhalb der üblichen Steuerungsketten übernehmen werden und könnten, vom politischen Agenda-Setting über die Gesetzesplanung bis hin zur behördlichen und richterlichen Normumsetzung. Und er geht den Auswirkungen nach, die eine derartige Automatisierung andererseits für uns Bürger, Abgeordnete, Beamte und Richter haben wird. Auch die Einflüsse der Digitalisierung auf die Anwaltschaft gilt es zu berücksichtigen.
Ich gehe dabei futuristisch klingenden, aber ebenso naheliegenden Detailfragen nach, etwa ob die Zukunft mit einer Art künstlichem Superhirn aufwartet, welches die komplette Steuerung unserer Spezies übernimmt. Fragen wie, ob Künstliche Intelligenz für zukünftige Parlamente Gesetzeswerke mit hochwirksamen Steuerungsinstrumenten kalkuliert. Ob sich Smart Cities zu Kommunen transformieren, in denen Entscheidungsautomaten das Sagen haben, ob selbst manche zentrale Aufgabe von Rechtsberatern, Beamten und sogar Richtern nicht doch bald antiquiert sein wird oder ob in Zukunft Protestbewegungen dank KI weniger Kraft aufbringen müssen, um politische Entscheidungsträger zum Handeln zu bewegen. Die für einen solchen Ausblick erforderlichen theoretischen Grundlagen der Gesellschaftssteuerung lege ich in einem Extrakapitel dar.
Ende der Zehnerjahre wurden wir Zeugen, wie die „Neue Rechte“, Russland und mazedonische Halbstarke mittels Social Bots, Internettrollen und Falschmeldungen versuchten, Bevölkerungen zu spalten, Wahlen zu manipulieren oder einfach nur schnelles Geld zu verdienen. Sie trugen dazu bei, dass sich der mit dem Fall des Eisernen Vorhangs erledigt geglaubte Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie erneut entfaltete und sich ein breiteres Feld an Aspekten destruktiver Natur öffnete: Aspekte des zerstörerischen Potenzials neuer Technologien für demokratisch ausgerichtete Steuerungsapparate und deren Korsette aus Freiheitsrechten, aber auch stärkende Effekte, die der möglichen Destruktion etwas entgegensetzen.
Dieser Themenblock soll schließlich im Fokus des finalen Teils des Buches stehen. Dabei geht es nicht allein um die Wiederholung der wissenschaftlichen Debatten der letzten Jahre. Vielmehr sollen ebenso die neuesten Entwicklungen im Bereich der Technologie, insbesondere der Künstlichen Intelligenz, berücksichtigt werden. Diese Entwicklungen versprechen starke Impulse für Gegenwart und Zukunft und zwingen zu einer Neubewertung. Unter diesen Vorzeichen werden insbesondere folgende Fragen genauer betrachtet: Führen smarte Algorithmen, die unsere Entscheidungen an Wahltagen mit beeinflussen, zu einer stärkeren Verwässerung der Demokratie? Werden KI-bedingte Umstrukturierungen auf den Arbeitsmärkten sogar die gesellschaftliche Tektonik aufbrechen? Werden wir Bürger mit einer manipulationssicheren App letztlich doch über Gesetze mitbestimmen, um so für die notwendige Vitalisierung der Demokratie zu sorgen? Sollte der Staat jede Regelverletzung, etwa jede Verletzung von Straßenverkehrsregeln, obsessiv verfolgen, schlicht weil er es digital kann und es sich finanziell für ihn lohnt? Wird die Digitalisierung ebenso die Leistungsfähigkeit von Gerichten, Staatsanwaltschaften und Verwaltungen gewährleisten, wenn die geburtenschwachen Jahrgänge zusehends weniger Fachkräfte stellen?
Über welche Art von Technologien sprechen wir auf diesen Seiten aber überhaupt? Es handelt sich um Maschinen, die auf vier Arten von Bausteinen aufbauen. Dazu zählt erstens vernetzte, teils mit Sensoren verbundene IT-Hardware, die mit weiterhin fulminant wachsenden Rechenkapazitäten aufwartet. Hinzu kommt zweitens ausgeklügelte Software mit hochkomplexen Algorithmen. Diese Software wird drittens noch mehr das herausformen, was man Künstliche Intelligenz nennt. Und viertens zählt zu diesem Quartett Big Data, also große Informationsbestände mit immer minutiöseren Daten über uns und unsere Umgebung.
Wir und unsere Kinder werden Zeugen, wie aus diesen vier Basiskomponenten nutzstiftende und auch beängstigende Anwendungen entstehen, die die Menschheit und den Planeten weit in die Zukunft führen.
Schon in der jüngeren Vergangenheit begann auf diese Basiskomponenten aufbauende Hochtechnologie nicht nur unseren Alltag zu überformen, sondern auch die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften kontrollieren und lenken. Neuartige Supercomputer, raffinierte Algorithmen, erste Formen Künstlicher Intelligenz und ein unablässiger Strom von Daten ermöglichten Geheimdiensten bereits vor Jahren, neue Wege der Überwachung einzuschlagen. Denken wir zurück an die einst von Edward Snowden enthüllten Programme, mit denen vor allem die USA zu Beginn des letzten Jahrzehnts die globale Telekommunikation ausspähten. Im Reich der Mitte animierten die neuen technischen Möglichkeiten den kommunistischen Parteiapparat, mit digitalen Sozialkreditsystemen zu experimentieren, die ganz neue Dimensionen gesellschaftlicher Steuerung eröffneten.
Bei alldem handelte es sich jedoch nur um Vorboten weiterer Innovationsschritte und Technologien auf dem Gebiet der staatlichen Steuerung – Wegbereiter, die die Sicht gen Zukunft klärten und die durch neue künstlich-intelligente Anwendungen nunmehr Verstärkung bekommen. Es ist Zeit, sich mit dem, was vor uns liegt und liegen könnte, entschiedener auseinanderzusetzen, und zwar aus menschlicher Neugier und um regulierend in das Geschehen eingreifen zu können. Bestimmen wir die Zukunft zum Schutz unserer Freiheit und der unserer Kinder mit!
TEIL 1JAGS (Joint Artificial Governing System)
1.1Ein technisches Mirakel
Spekulieren wir einmal gleich zu Beginn unserer Suche nach Zukunftsperspektiven über weit entfernte Tage. Das erlaubt uns, den Horizont für das technisch Mögliche abzustecken und vielleicht auch Szenarien auszusortieren, über die wir uns nicht allzu viele Gedanken zu machen brauchen. Stellen wir uns eine futuristische Maschine mit dem Namen JAGS vor. JAGS soll für „Joint Artificial Governing System“ stehen. Bei der Maschine handelt sich um eine äußerst leistungsfähige Künstliche Intelligenz, die den fiktiven Stadtstaat Nesotopia durch das ausgehende 21. Jahrhundert steuert.
JAGS greift auf zahllose Datenclouds zu und gleicht deren Informationen, wenn nötig in Echtzeit, dank einer Verknüpfung mit Zehntausenden Straßensensoren, Supermarktkassen, elektronischen Gesundheitsakten, privaten Klimaanlagen oder sozialen Netzwerken ab. JAGS lernt dabei in endlosen Schleifen alles über uns, unser Zusammenleben, unsere Umgebung und darüber, wie sie uns lenken und kontrollieren kann. Die Künstliche Intelligenz entwirft, berechnet und modelliert steuernde Eingriffe und erlässt diese im Auftrag der lokalen Regierung. Das tut sie in Form von Gesetzen sowie von an Einzelpersonen adressierten Verhaltensanweisungen. Schließlich überwacht JAGS die Einhaltung der Regelungen und setzt diese, wenn nötig mittels Sanktionsinstrumenten, um: Bußgelder werden vom Lohn abgezogen, der kostenfreie Zugang zu öffentlichen Einrichtungen gestrichen und besonders dreiste Missetaten mit Klarnamen der Übeltäter in Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Die Regierung des Stadtstaates ist mit der Arbeit von JAGS äußerst zufrieden und hat sich allein darauf zurückgezogen, der KI Ziele, Präferenzen und Bewertungsmaßstäbe vorzugeben. So weit die Fantasie. Wie wahrscheinlich ist aber die Verwirklichung einer solch verlässlichen Künstlichen Superintelligenz? Steckt in den heutigen und zukünftigen technischen Innovationen das Potenzial, JAGS wahr werden zu lassen?
Ohne Zweifel setzt eine derartige Maschine weitere Revolutionen auf dem Gebiet der IT-Hardwareentwicklung voraus. Es bedarf neuer Generationen leistungsstarker Quantenprozessoren und auch genialer Speicherwerke, die die immensen Mengen von Daten ohne Schwierigkeiten verdauen können. Zuvor müssten noch ausreichende Datenquellen erschlossen werden, die die enorme Informationslust von JAGS befriedigen.
Im Herzen einer solchen Steuerungsmaschine müssten selbstlernende Algorithmen arbeiten, die das gesamte gesellschaftliche Universum und zahllose Aspekte, die dieses beeinflussen, reproduzieren. Die Algorithmen müssten widerspiegeln, wie die komplexen Netzwerke aus menschlichen Gruppen und Individuen funktionieren und wie sie sich steuern lassen. Mit ihrer Hilfe wäre es der Maschine möglich, steuernde Eingriffe zu entwerfen, deren Wirkungen zu kalkulieren und hocheffektive, enorm effiziente und absolut nebenwirkungsarme Regelungsinstrumente zu verfassen.
Konzentrieren wir uns hier auf diesen einen letzten, alles entscheidenden Punkt der selbstlernenden Algorithmen, also einer äußerst ausgefeilten Software. Wird die Menschheit oder Künstliche Intelligenz in der Lage sein, eine solche zu erschaffen, um damit einen hochpotenten Quantencomputer zu einer äußerst zuverlässigen JAGS zu transformieren?
1.2Der Traum von einer sozialen Weltformel
Jede Software arbeitet auf Basis von Algorithmen, von Codes, die oft theoretische Modelle der realen Welt oder imaginäre Welten widerspiegeln. Eine Software zur Steuerung von Gesellschaften müsste auf einem Modell aufbauen, das die Funktionsweise und Steuerbarkeit der Gesellschaft abbildet. Gefragt ist nach einer Art Modell der sozialen Welt, einer komplexen sozialen Weltformel oder einer „sozialen Physik“, wie sie einst Auguste Comte, dem Vater der Soziologie, vorschwebte. Leider verfügen wir nicht über eine derartige geschlossene Vorstellung. Könnte sich das aber zukünftig dank neuer Maschinengenerationen ändern, die uns wissenschaftlich auf die Sprünge helfen?
Auf den ersten Blick scheint das durchaus möglich zu sein. Zumindest bekommt man einen solchen Eindruck, wenn man sich den derzeitigen technologischen und wissenschaftlichen Aufbruch vergegenwärtigt, den das neue Maschinenzeitalter auslöst. So prognostizieren Zukunftsforscher, dass Maschinen in fernen Tagen in der Lage sein werden, unsere Gedanken auszulesen und diese in Datenclouds hochzuladen. Zusammen mit anderen Informationen über Gesellschaft und Umwelt könnten so große Teile unseres Wissens und Fühlens zu einem einzigen Datenuniversum verschmelzen. Supercomputer könnten diese riesige Datenwolke auslesen und weitreichende Erkenntnisse über unsere Spezies gewinnen, um sich so immer mehr einem kompletten Verständnis der sozialen Welt und einer sozialen Weltformel anzunähern.
Aber auch fern von dieser Vorstellung verspricht der technologiebedingte wissenschaftliche Fortschritt erheblichen Erkenntnisgewinn, was die Steuerbarkeit von Gesellschaften anbelangt. So haben Neurowissenschaftler damit begonnen, das menschliche Gehirn bis zu den letzten Neuronen zu erforschen. In nicht allzu ferner Zukunft werden sie kritische Zellkomplexe identifizieren, die Rückschlüsse auf unser aller Fühlen, Denken und Verhalten zulassen. Damit eröffnen sich nicht nur innovative Wege, mentalen Erkrankungen den Garaus zu machen, sondern auch neue Erkenntnisse über Möglichkeiten der psychologischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Steuerung, Kontrolle und Manipulation von Menschen, Gemeinschaften und ganzen Gesellschaften.
Vor einigen Jahren führten die neuen technischen Möglichkeiten zudem zur Begründung eines rechnergestützten Zweiges der Sozialwissenschaften – der Computational Social Science. Diese begann, immer mehr soziale Phänomene unter Auswertung großer Datenbestände tiefgehend auszuleuchten. Spezielle Forschungszentren wurden gegründet und die thematischen Veröffentlichungen nahmen rasant zu.2 Indem das weltweit renommierte Wissenschaftsmagazin Nature 2021 dem neuen Spross der Soziologie eine Extraausgabe widmete, wurde ihm sozusagen der akademische Ritterschlag zuteil.
Innerhalb der Computational Social Science nimmt die Vorhersageforschung, die sogenannte prädiktive Analytik (englisch: Predictive Analytics), eine besondere Rolle ein. Seit einiger Zeit versorgt sie Unternehmen, Behörden, Geheimdienste und die Justiz mit Vorhersagemodellen und ersten Formen Künstlicher Intelligenz.3 Die computergestützte Vorhersage von Kriminalitäts-Hotspots, Unruhen, Grippeepidemien und der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern – sie steht hinter den neuen zukunftsträchtigen technischen Möglichkeiten.
Zweifelsohne wartet die Zukunft mit weiteren Sprüngen bei der Entwicklung von selbstlernenden Maschinen auf. Mit ihrer Hilfe werden wir die jüngst eingeschlagenen Wege der computergestützten Wissenschaft kontinuierlich fortführen und verbreitern. Sie werden Mensch und Maschine zu immer tieferen Erkenntnissen und passgenaueren Modellen der Gesellschaftssteuerung führen. Werden diese aber wirklich genügen, um auf ihrer Basis eine höchst zuverlässige selbstlernende Steuerungssoftware entwickeln zu können?
1.3Die Grenzen einer Künstlichen Superintelligenz
Machen wir es kurz. All die Erkenntnisse, die Mensch und Maschine in Zukunft erlangen, werden nicht ausreichen, um eine komplette Vorstellung von der Funktionsweise der sozialen Welt, ihrer Umgebung und Steuerbarkeit zu bekommen. JAGS wird daher dem Reich der Science-Fiction nicht entspringen, sondern ihm verhaftet bleiben.
Unsere Welt ist schlicht zu komplex und zu starken Änderungen unterworfen, als dass sie von uns oder Maschinen je in Gänze durchdrungen und als einheitliches Modell oder abschließendes Set von Mustern abgebildet werden könnte. Wir mögen hinter sozialen Phänomenen deterministische Regeln vermuten, die man theoretisch mathematisch und algorithmisch darstellen kann. Das Problem bleibt jedoch, dass wir bei ihrer tatsächlichen Beobachtung nie alle Details, nie alle Determinanten, die zu ihrer konkreten Ausgestaltung führen, betrachten, sondern nur einen Ausschnitt von Aspekten, Ursächlichkeiten und Auswirkungen. Bei näherer Betrachtung sind soziale Phänomene in die Unendlichkeiten der Kausalitäten des Universums eingebettet. Je genauer man hinsieht, desto komplexer wird sowohl das Bild der Zusammenhänge, welche die innere Dynamik unserer sozialen Welt ausmachen, als auch das Bild der Umwelteinflüsse.
Das wird Menschen wie auch Maschinen selbst in der entferntesten Zukunft weiterhin zu vereinfachenden Wahrnehmungen der Realität zwingen. Und diese Vereinfachungen werden dazu führen, dass Menschen und Maschinen immer wieder von Effekten überrascht werden, die ihren technischen Linsen, theoretischen Vorstellungen und Algorithmen entgehen. Für uns und Künstliche Intelligenz als Beobachter mit beschränktem Blick wird sich daher das Universum trotz seines Determinismus weiterhin im Sinne der Chaostheorie bis zu einem gewissen Grad als chaotisch darstellen.
Damit tut sich ein selbst für ausgereifteste Technik unerreichbarer Horizont auf. An diesem Horizont beginnt das Gebiet der ewigen Science-Fiction. Allenfalls dort ist es surrealen Maschinen und fiktiver Künstlicher Intelligenz möglich, einen Grad höchster Zuverlässigkeit zu erreichen, der es vielleicht erlauben würde, sie weitgehend unbeobachtet über unser Schicksal entscheiden zu lassen. Vor diesem Hintergrund sollte der Mensch weder bewusst noch willentlich die Kontrolle über seine Gesellschaften komplett oder nahezu komplett an Maschinen übertragen. Zum Schutz der eigenen Selbstbestimmung und Freiheit sollte er alles dafür tun, sein Monopol der Letztentscheidung zu verteidigen. Das gilt nicht erst ab dem Zeitpunkt einer möglichen Bewusstwerdung Künstlicher Intelligenz oder einem ebenso denkbaren Moment technologischer Singularität, in welchem KI der menschlichen Intelligenz endgültig enteilt. Das gilt bereits jetzt, zu dem Zeitpunkt, an dem der Stern der KI aufgeht und wir als Nutzer ihre Datenquellen, Lernmethoden und Algorithmen schon nur schwer verstehen. Freilich bedeutet das nicht, dass der Mensch keinerlei Steuerungsaufgaben an Maschinen abgeben sollte und auch wird. Ganz im Gegenteil, wie wir in Teil 3 sehen werden, sieht die Zukunft ein enges Miteinander von Mensch und Maschine auch bei der Gesellschaftssteuerung vor.
TEIL 2Führung und Kontrolle:Strukturen gesellschaftlicher Lenkung
2.1Fokus
Makrosoziologen zogen mich schon immer magisch an. Nicht wegen ihres Hangs, alltägliche Sachverhalte in für Außenstehende kaum verständliche Begriffsmonstren zu packen. Da sind wir Juristen ja Schwestern und Brüder im Geiste. Nein, das Faszinierende besteht darin, dass Makrosoziologen aus einer fernen Perspektive auf die Bande blicken, die zwischen uns Menschen existieren. Sie versuchen, sie zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen – zu Gemeinschaften, zu Gesellschaften, generell zu sozialen Systemen.
Schauen wir genauer hin, sind diese Bande psychischer, physischer oder biochemischer Natur und damit bereits Gegenstand anderer Disziplinen. Indem Makrosoziologen aber aus der Distanz auf die Gesamtheit dieser Verbindungen schauen und sie deuten, können sie elementare Züge unserer Gesellschaft ausmachen. Es ist ein wenig so, als wenn wir bei einem Waldspaziergang einen Ameisenhügel passieren. Wir nehmen all die emsigen Individuen und die sie leitenden Pheromonspuren nicht wahr. Wir sehen aber den massiven, wabernden Hügel und all die zu ihm führenden Pfade der Aktivität. Wir erkennen den Staat und einige seiner grundlegenden Strukturen.
Aber was hat das mit diesen Seiten zu tun? Im Folgenden soll geklärt werden, was sich hinter dem Phänomen der Gesellschaftssteuerung verbirgt und wie sie grundsätzlich funktioniert. Ohne Wissen darüber, welche größeren Räder wie ineinandergreifen, bleiben Annahmen über Effekte und Potenziale neuer Technologien, die einen Staat 3.0 formen können, blass. Der Blick auf den größeren Kontext fehlt. Um dem Phänomen der Gesellschaftssteuerung auf den Grund gehen zu können, sollten wir aussagekräftige Theorien und solide Vorstellungen oder zumindest eine passende Optik zur Hand haben. Möglicherweise hilft uns dabei ein Okular aus der Makrosoziologie. Die Gesellschaft als übergeordnetes Urphänomen liegt in ihrem Zuständigkeitsbereich. Dazu sogleich mehr.
Zuvor steht noch die Klärung eines zentralen Aspekts aus. Und zwar, was sich hinter dem Begriff der Gesellschaftssteuerung verbirgt. Die Antwort darauf lässt sich kurz zusammenfassen: Man kann darüber trefflich streiten. Der Begriff gehört weder zu dem Wortschatz, der uns allen jeden Tag einigermaßen klar vorschwebt, noch gibt die Fachliteratur ein eindeutiges Bild ab. Keine Wissenschaft hat den Gesamtbegriff oder einen seiner beiden Bestandteile – Gesellschaft und Steuerung – für sich vereinnahmen können. Ein einheitliches Verständnis hat sich nicht herausgebildet. Wichtig ist aber, dass wir, wenn wir auf diesen Seiten über die Steuerung von Gesellschaften nachdenken, eine gemeinsame Vorstellung entwickeln, was hinter diesen Begriffen steckt.
Deshalb schlage ich folgende Deutung vor: Unter Gesellschaft verstehe ich einen Verband von Menschen, menschlichen Gemeinschaften und deren institutionalisierte Einrichtungen. Dieser Verband konstituiert auf einem bestimmten geografischen Gebiet einen Staat. Er integriert sich durch Identifikationsmerkmale verschiedenster Natur, sei es Kultur, Sprache, Religion, Rechts- oder Herrschaftsunterworfenheit. Im Gegensatz zum Terminus „Staatsvolk“ umschließt der Begriff „Gesellschaft“ auch die für eine gewisse Dauer auf dem Gebiet befindlichen und etwa rechtlich integrierten Ausländer. Sie zählen zu dem Verband, den es zu steuern gilt.
Unter Steuerung subsumiere ich die beabsichtigte Beeinflussung dieses Verbandes oder seiner Teile durch Reize jeglicher Art – etwa ein Belohnungssystem, Sanktionsregeln, die Kundgabe kritischer Informationen. Steuerungsmaßnahmen müssen nicht am gesamten Korpus der Gesellschaft zerren. Sie können auch einzelne Teile, also deren Untergliederungen betreffen. Der Begriff erfasst damit nicht nur die großen Reformprojekte, sondern auch die zahllosen kleinteiligen Ansätze der Einflussnahme. Ein engeres Begriffsverständnis würde diesen größeren Teil der Steuerungsrealität in einem toten Winkel verschwinden lassen. Steuerung muss nicht von Erfolg gekrönt sein; sie kann fehlschlagen. Ich sehe Parallelen zur Nautik. Auch Kolumbus sprechen wir nicht ab, dass er die Santa Maria über den Atlantik steuerte. Obwohl er von Strömungen und Winden hin- und hergeworfen wurde. Und obwohl er letztlich Asien nie erreichte und sein Flaggschiff in die Untiefen vor Hispaniola rammte. Um Asien trotz des im Wege liegenden massiven kontinentalen Hindernisses zu erreichen, fehlte ihm Wissen und Technologie. Er war dennoch ein Steuermann.
Gesellschaftssteuerung bedeutet in wesentlichen Teilen Politik, geht aber nicht vollständig in diesem Begriff auf.4 Sie fokussiert nicht nur die Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse politischer Akteure. Sie betont gleichberechtigt Prozesse der Umsetzung von gesellschaftsbezogenen Entscheidungen durch Rechtsprechung, Verwaltungen, Vollzugsapparate sowie durch freiwillige Normbefolgung. Wer auch hier Überschneidungen mit dem Feld der Politik sieht, gesteht möglicherweise zumindest zu, dass der Begriff der Steuerung den Prozess der gezielten Beeinflussung der Gesellschaft prägnant aus dem Gebiet der Politik heraushebt – einem Gebiet, auf dem sich die Akteure zur Erhaltung ihrer Macht auch um sich selbst drehen, also nicht nur um die zu lösenden Probleme der Gesellschaft.
2.2Von Makrosoziologen und geplatzten Träumen
Kommen wir auf die Frage zurück, wie Gesellschaftssteuerung funktioniert und ob sich eine aussagekräftige Theorie, ein passendes Modell ausfindig machen lässt, das bei der Klärung hilft. Weiterbringen sollte uns dabei eigentlich der Theoriebestand der Makrosoziologie oder alternativ natürlich auch der Fundus anderer Wissenschaften.
Auf der Suche nach Erkenntnis bin ich zunächst auf zwei deutsche Soziologen, Wolfgang Streeck und Helmut Wiesenthal, gestoßen. Wiesenthal beschäftigte sich während seiner Hauptschaffenszeit um die Neunzigerjahre mit den massiven gesellschaftlichen Umwälzungen in der östlichen Hemisphäre, genauer mit den Umwälzungen, die dem Fall des Eisernen Vorhangs folgten. Umwälzungen, die nahezu alle Sektoren der betroffenen Länder überformten: Wirtschaft, Politik, Recht, Arbeit und Soziales. Streeck hingegen beschäftigte sich ausgiebig mit der gegenüberliegenden Hemisphäre des Westens. Unter westlichen Himmeln hatten in den Achtzigerjahren Ölkrise, wirtschaftliche Stagnation und andere Ereignisse tiefe Spuren auf den Arbeitsmärkten hinterlassen. Stetig mehr Menschen ohne Lohn und schwer schulterbare Belastungen für die Sozialkassen folgten. Die Regulierung der Arbeitsmärkte entwickelte sich zu einer der größten Herausforderungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts.
Doch die Steuerungserfolge auf den westlichen Arbeitsmärkten fielen ernüchternd aus. Zumindest war das die Wahrnehmung von Streeck in Bezug auf die von ihm und seinen Kollegen anvisierten Maßnahmen.5 Im Osten sah die Gesamtbilanz anders aus. Die osteuropäischen Transformationsprozesse können kaum als gescheitert gelten, wenn man sich etwa die Entwicklungen im Osten Deutschlands, in Slowenien und in den baltischen Staaten anschaut. Trotz enormer Schwierigkeiten und einiger gewaltiger Schieflagen, die teilweise bis heute bestehen, wurde nicht nur die Teilung Europas überwunden, auch die vor dem Ende des Kalten Krieges existenten Gesellschaftsordnungen kamen zu Fall. Getragen von großen Teilen der Bevölkerungen fegten die neu gewählten Regierungen die alten Systeme sozialistischer Prägung hinweg. Sodann konnten sie zumindest teilweise erfolgreich in neue Fahrwasser aufbrechen.6
Die Erkenntnisausbeute für die Steuerungsdiskussion fiel bei Streeck und Wiesenthal dennoch mager aus. Streeck legte sein Resümee im Oktober 2014 dar. Was er im Rahmen seiner Abschiedsvorlesung zu referieren hatte, war jedoch alles andere als ein energiegeladenes Vermächtnis.7 Es handelte sich im Kern um eine Kapitulationserklärung. Sie schien die Einsicht einer ganzen Zunft widerzuspiegeln. Schon zu Zeiten des US-amerikanischen New Deals, also in den 1930er-Jahren, waren Soziologen angetreten, Kausalmodelle zu entwickeln, auf deren Basis Gesellschaften planmäßig und rational geformt werden können. Doch nach Jahrzehnten der Forschung, nach unzähligen Versuchen der praktischen Anwendung diesseits und jenseits des Atlantiks sah die Makrosoziologie, ja die Soziologie im Ganzen ihr Unternehmen als gescheitert an, zuverlässige Modelle der Steuerung von Gesellschaften aufzustellen. Einige Jahre zuvor war Wiesenthal zu einem ähnlichen Schluss gekommen.8
Während Streeck und Wiesenthal der eigenen Gilde nur das Platzen von Euphorien und Theoriefantasien attestierten, gingen andere wesentlich weiter. In ihren Augen sind Gesellschaften aufgrund ihrer ureigenen Natur schlicht unsteuerbar. Aber wäre dem so, dann ergäben Parlamente keinen Sinn mehr und ich sollte die Tastatur beiseiteschieben. Diese recht radikale Theorie der Unsteuerbarkeit von Gesellschaften geht auf einen bedeutenden Vertreter der Soziologie zurück, auf Niklas Luhmann.9 Nach dessen Weltsicht setzen sich moderne Gesellschaften aus autarken Teilsystemen zusammen, darunter Politik, Wirtschaft, Recht und Religion. Diese Teilsysteme folgen jeweils eigenen Zielen, funktionieren nach jeweils eigenen Logiken. Luhmann folgerte daraus, dass keine dieser Einheiten in der Lage sei, eine andere Einheit, geschweige denn die Gesellschaft insgesamt zu steuern. Er verdeutlichte dies mit reichlich abstrakten, nur schwer verständlichen Gedankengängen, die sicherlich einiges an Wahrheit in sich bergen, aber gleichwohl in ihrer Absolutheit der Realität kaum standhalten dürften. Das gilt insbesondere, wenn es um die Frage der Steuerbarkeit von Gesellschaften geht.10 Abgesehen davon ging Luhmann offenbar von einem für die tagtägliche politische Praxis weniger relevanten, äußerst engen Steuerungsbegriff aus. Danach erfasst Steuerung nur wahre, beabsichtigte, vollständig realisierte Systemwechsel, also ein Phänomen, das nicht viel mit dem politischen Alltagsgeschäft zu tun hat. Ziel dessen ist weniger, die Gesellschaft oder ihre Teilsysteme, wie Wirtschaft und Politik, komplett neu zu programmieren. Vielmehr geht es der Politik und damit auch der Steuerung im hier verstandenen Sinne um das Lenken und Leiten von Individuen und Gruppen sowie um das Ausbalancieren ihrer Interessen.
Streeck sah dies ähnlich.11 Seine herbstlichen Abschiedsworte machten einen anderen Umstand als Ursache für seine Enttäuschung aus. Es war nicht die Unsteuerbarkeit von Gesellschaften. Es lag vielmehr an dem Unvermögen seiner Zunft, die Steuerungsvariablen und -zusammenhänge vollumfänglich zu erkennen und in soziologischen