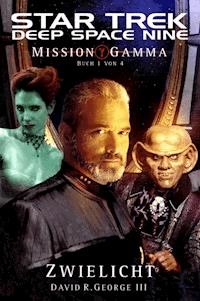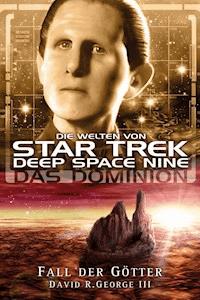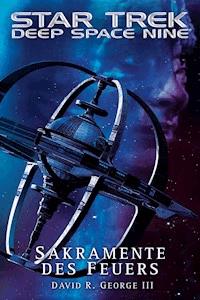Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Star Trek - The Original Series
- Sprache: Deutsch
In einem einzigen Augenblick ... werden sich die Leben dreier Männer für immer verändern. In diesem Sekundenbruchteil, der paradoxerweise sowohl durch Errettung als auch durch Verlust bestimmt wird, werden sie die Welt zerstören und sie dann wiederherstellen. Vieles war zuvor geschehen und vieles sollte noch danach kommen, aber nichts davon würde ihre Leben stärker beeinflussen als dieser eine, abgeschiedene Augenblick am Rande der Ewigkeit. In einem einzigen Augenblick ... rettet der in der Zeit zurückversetzte Leonard McCoy eine Frau vor dem Tod durch einen Verkehrsunfall und verändert dadurch die Geschichte der Erde. Gestrandet in der Vergangenheit, kämpft er darum, einen Weg zurück in sein eigenes Jahrhundert zu finden. Doch während er eine Existenz führt, die es nicht hätte geben sollen, sieht er sich schließlich gezwungen, all das hinter sich zu lassen und sich den Schatten zu stellen, die sein verlorenes Leben hervorgebracht hat. In einem einzigen Augenblick ... wird der in der Zeit zurückversetzte Leonard McCoy davon abgehalten, eine Frau vor dem Tod durch einen Verkehrsunfall zu retten, wodurch die Geschichte der Erde unverändert bleibt. Als er in die Gegenwart zurückkehrt, trifft er auf ein medizinisches Rätsel, zu dessen Lösung er sich verpflichtet. Doch die Echos einer Existenz, die er nie erlebt hat, suchen ihn heim, und der Geist eines verfrühten Todes wird ihn wieder zu den Schatten zurückbringen, denen er sich nie gestellt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1167
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STAR TREK®
FEUERTAUFE: MCCOY
DIE HERKUNFT DER SCHATTEN
DAVID R. GEORGE III
Based onStar Trekcreated by Gene Roddenberry
Ins Deutsche übertragen vonAnika Klüver
Die deutsche Ausgabe von STAR TREK – FEUERTAUFE: MCCOY – DIE HERKUNFT DER SCHATTENwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, Übersetzung: Anika Klüver;verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Andrea Bottlinger, Sabine Elbersund Gisela Schell; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: John Picacio.Die Print-Ausgabe wurde gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice.Printed in the Czech Republic.
Titel der Originalausgabe: STAR TREK – CRUCIBLE: McCOY – PROVENANCE OF SHADOWS
German translation copyright © 2011 by Amigo Grafik GbR.
Original English language edition copyright © 2006 by CBS Studios Inc. All rights reserved.
™, ® & © 2011 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc.
This book is published by arrangement with Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc.,pursuant to an exclusive license from CBS Studios Inc.
Print ISBN 978-3-942649-51-3 (Dezember 2011) · E-Book ISBN 978-3-942649-97-1 (Dezember 2011)
WWW.CROSS-CULT.DE · WWW.STARTREKROMANE.DE
Für Anita Carr Smith,ein strahlendes Licht in meinem Leben,deren bemerkenswerter Geistund grenzenloses Herzalle um sie herum stets aufmuntern
VORWORT
DIE HERKUNFTDER FEUERTAUFE
Während wir zusammen in der Lobby eines Hotels in Hollywood sitzen und an einem anderen Manuskript arbeiten, sagt mein unerschrockener Redakteur – der talentierte Marco Palmieri – plötzlich zu mir: »Du solltest darüber nachdenken, einen Roman zur Classic-Serie zu schreiben. Vielleicht eine Trilogie.« Nach außen reagiere ich recht zurückhaltend, aber es freut mich, dass meine bisherige Arbeit als Autor dazu geführt hat, dass man mich als Verfasser weiterer Romane in Betracht zieht. Doch nach unserem Treffen denke ich nicht weiter darüber nach, weil ich das aktuelle Manuskript zu Ende bringen muss und meine nächsten beiden Projekte bereits in der Warteschleife sind.
Dann ruft mich Marco irgendwann an und bringt das Thema wieder auf den Tisch. Es sei nicht einfach nur ein Buch zur Classic-Serie und auch nicht nur eine Trilogie, denn die Veröffentlichung falle mit dem vierzigjährigen Jubiläum der Serie zusammen1. Wow. Das ist schon etwas Besonderes. Da STAR TREK bereits seit über drei Jahrzehnten überregional im Fernsehen ausgestrahlt wird, wuchs ich damit auf, die Episoden immer und immer wieder zu sehen, und natürlich kannte ich auch alle Kinofilme – ganz zu schweigen von den Nachfolgeserien THE NEXT GENERATION, DEEP SPACE NINE, VOYAGER und ENTERPRISE. Ich liebte die Helden von STAR TREK ebenso wie die Themen, und mehr als alles andere liebte ich seine Botschaften der Toleranz und der Gleichberechtigung. Das würde großartig werden. Ich sagte sofort zu und dann setzte ich mich mit einem Notizblock und meinem silbernen Stift an meinen Schreibtisch und …
Nichts.
Ich erkannte schnell mein Dilemma. Was, so fragte ich mich, gab es über diese Charaktere überhaupt noch zu erzählen? Zusätzlich zu zwei Pilotfolgen, drei Staffeln, einer Zeichentrickserie und sieben Kinofilmen waren bereits Hunderte von Romanen und Kurzgeschichten erschienen. Außerdem gab es einige unverfilmte, unveröffentlichte Details – wie zum Beispiel Dr. McCoys Vorgeschichte, die eine Tochter aus einer gescheiterten Ehe beinhaltet –, die in Fankreisen seit Jahren als allgemein akzeptierte Fakten galten. Wie sollte ich da eine neue Geschichte finden, die ich erzählen konnte? Und wie sollte ich das tun, ohne zuvor veröffentlichten Geschichten zu widersprechen?
Marco und ich sprachen über meine Bedenken und kamen zu dem Schluss, dass es die beste Strategie wäre, die Geschichte einzig auf den Fernsehepisoden und den darauffolgenden Kinofilmen basieren zu lassen. Auf diese Weise würde ich mir keine Sorgen darum machen müssen, mit den existierenden Romanen und Kurzgeschichten in Konflikt zu geraten, und ich würde das ganze Material nicht erneut lesen müssen. Außerdem würde ich den Fans, die zuvor noch keine STAR TREK-Romane gelesen hatten, damit eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.
Also setzte ich mich wieder hin, um zu überlegen, was ich schreiben sollte. Nach einigen Erwägungen entschied ich mich dafür, jedes der drei Bücher auf einen der Hauptcharaktere – Kirk, Spock und McCoy – zu konzentrieren. Auch wenn ich die Nebencharaktere wie Scotty, Sulu, Uhura und Chekov (und andere, wie zum Beispiel Chapel, Rand, Kyle, Leslie und M’Benga, um nur ein paar zu nennen) sehr mag, hat sich die Serie selbst doch immer hauptsächlich auf die »großen drei« konzentriert, daher erschien mir meine Herangehensweise angemessen. Ich würde alle Charaktere in jeder Geschichte vorkommen lassen, aber im Wesentlichen einen Kirk-Roman, einen Spock-Roman und einen McCoy-Roman schreiben.
Doch die wichtigste Frage blieb immer noch: Was wissen wir über diese Personen? Ich sah mir noch einmal jede Episode und alle Filme an und bemerkte einen gewissen Aspekt in Leonard McCoys persönlicher Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Autoren der Serie und der Filme es tatsächlich beabsichtigt hatten. Wahrscheinlich war es vielmehr ein Resultat ihrer gemeinsamen Arbeit.
Dann entdeckte ich außerdem einen Abschnitt in McCoys Leben, der meines Wissens nie weiter erforscht worden war. Plötzlich erkannte ich eine Möglichkeit, wie ich diesen Teil nicht nur mit meiner ersten Beobachtung verbinden konnte, sondern auch mit der Episode, die weithin als eine der besten, wenn nicht sogar als die beste STAR TREK-Episode überhaupt gilt. Das ermöglichte es mir zudem, die Trilogie tief in der Classic-Serie selbst zu verankern, was ich für angebracht hielt.
Während ich die Handlung für den McCoy-Roman entwarf, erkannte ich, wie die Ereignisse dieser einen großartigen Episode auch Kirk und Spock beeinflusst haben könnten. Tatsächlich sah ich vor mir, wie diese Verkettung von Umständen, die jeden von ihnen auf unterschiedliche Weise geprüft hatte, bedeutende Auswirkungen auf sie alle gehabt haben könnte. Mit der Trilogie konnte ich aufzeichnen, wie dieses einzelne Ereignis, diese Feuertaufe, den Rest ihrer Leben beeinflusste wie kein anderes.
Und dann, nachdem Marco und Paula Block von CBS Consumers Products ihr Einverständnis gegeben hatten, setzte ich mich endlich hin, um zu schreiben.
1 In den USA erschien dieser Roman vor fünf Jahren zum vierzigjährigen Star Trek-Jubiläum. In Deutschland erscheint er nun bei Cross Cult zum fünfundvierzigjährigen Jubiläum.
Du dunkles Haus! Ich kann’s nicht lassen,
Hier steh’ ich wie in frühen Tagen;
Hier hat mein Herz oft rasch geschlagen
Voll Hoffnung seine Hand zu fassen,
Die ich nicht mehr umfassen kann –
Schau her, denn schlafen kann ich nicht,
Und gleich dem Diebe schleich’ ich dicht
Zur Tür im Morgengrau’n heran.
Er ist nicht hier; von ferne wieder
Wird das Getös’ des Lebens laut,
Und todesbleich durch Regen schaut
Der fahle Tag auf mich hernieder.
– Alfred, Lord Tennyson,In Memoriam A.H.H., VII
Natira: War das Leben, das du bis jetzt geführt hast, denn so einsam?
McCoy: Ja. So könnte man es nennen.
– »Der verirrte Planet«
OUVERTÜRE
FEUERTAUFE
Innerhalb eines Augenblicks wurde ihm klar, wie sie sterben würde.
Sobald Leonard McCoy eine der Doppeltüren am Eingang der Mission aufgezogen hatte und in die kalte, feuchte Nacht hinausgetreten war, fiel sein Blick auf Edith Keelers Gestalt, die von der anderen Straßenseite auf ihn zukam. Ein langer dunkler Mantel umhüllte ihre schlanke Figur, und ein hellblauer Topfhut krönte ihre kurzen braunen Locken. Straßenlaternen tauchten die Szene in einen matten Schimmer, ihr Licht spiegelte sich hier und da in den Pfützen, die der frühabendliche Regen hinterlassen hatte. McCoy lächelte Keeler an, doch obwohl ihr Weg sie direkt auf ihn zu führte, schien sie seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Ihre reglosen Züge deuteten darauf hin, dass sie vollkommen in Gedanken versunken war.
Bewegung und ein Rattern links von ihm zogen McCoys Aufmerksamkeit auf sich. Ein großes, kantiges Bodenfahrzeug raste die nasse Schotterstraße entlang. McCoy riss den Kopf wieder zu Keeler herum, die immer noch nachdenklich vor sich hin starrte. Sie sah das herannahende Fahrzeug offensichtlich nicht, hörte nicht das heisere Rumpeln seines Motors. In wenigen Sekunden würde sie seinen Weg kreuzen.
In diesem Moment vertrieb ein Adrenalinstoß McCoys Erschöpfung, und plötzlich nahm er seine Umgebung richtig wahr. In seinem durch das Cordrazin hervorgerufenen Wahn hatte er das alles für eine Art Trugbild gehalten und hätte es später auf Verwirrtheit oder eine Halluzination zurückgeführt, die mit der versehentlichen Überdosis zusammenhing. Doch mit einem Mal wurde ihm klar, dass nichts davon zutraf. Als er mit ansah, wie sich Edith Keeler nichts ahnend in Gefahr begab, lösten sich all seine Erklärungen und Rationalisierungsversuche für diese ungewöhnlichen Umstände auf wie Träume beim Erwachen.
McCoy setzte sich in Bewegung und rief ihren Namen – »Miss Keeler!« –, aber selbst das konnte ihre Konzentration nicht durchbrechen. Er machte einen Schritt, dann einen weiteren, aber seine Reaktionen schienen schwerfällig. Dieser erstarrte Zustand war zweifellos eine Auswirkung der starken Chemikalie, von der sich immer noch Spuren in seinem Körper befanden. Selbst als er von der Bordsteinkante auf die Straße sprang, fühlten sich seine Beine so an, als würden sie durch Sirup treten. Er wusste, dass er sie nicht rechtzeitig erreichen würde.
Trotzdem bewegte er sich.
Drei weitere große Schritte, und McCoy brachte sich selbst in die Gefahrenzone. Er hörte, wie das Fahrzeug auf ihn zuratterte, das mechanische Brummen des Motors donnerte in seinen Ohren. Sekunden bevor er nach vorne stürzte, kreischte das Geräusch der Bremsen durch die städtische Nacht. Er sah, wie sich Keelers Gesichtsausdruck veränderte, als die Frau endlich aus ihrer Träumerei gerissen wurde.
McCoy lief mit ausgestreckten Armen auf Keeler zu und versuchte, sie zu erreichen, während das Fahrzeug unaufhaltsam nach vorn schlitterte. Seine Reifen kratzten laut über den regennassen Untergrund. Er erwischte Keeler an der Hüfte, und sein Schwung riss sie von den Füßen. Sie taumelte rückwärts, fuchtelte mit den Armen in der Luft herum und fiel. Ein überraschter Aufschrei entkam ihren Lippen, als sie mitten auf die Straße stürzte.
McCoy landete auf ihren Beinen und bereitete sich auf den Zusammenprall vor, da er nicht sicher war, ob er Keeler und sich vollständig aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Als nach einem Moment nichts passierte, wurde ihm klar, dass er keine quietschenden Bremsen oder über den Boden rutschenden Reifen mehr hörte. Stattdessen näherten sich Schritte, und er riskierte einen Blick über die Schulter. Das linke Vorderrad des Fahrzeugs war weniger als einen halben Meter vor seinen Schienbeinen zum Stehen gekommen. Er erschauderte kurz aber heftig, eine Reaktion, die von der krassen Realität der Gefahr hervorgerufen wurde, der er nur knapp entkommen war.
McCoy sammelte sich, löste sich von Keeler und richtete sich auf die Knie auf. Er sah sie an, und sie starrte mit unverhohlenem Schock, weit aufgerissenen Augen und offenem Mund, zurück. Ansonsten wirkte sie unverletzt. Um sie herum kamen die Leute aus allen Richtungen herbeigelaufen. Einige knieten sich neben Keeler auf den Boden, während sich ein Mann in einem dunkelgrauen Mantel und einem hellbraunen Filzhut über McCoy beugte.
»Sind Sie in Ordnung, Mister?«, fragte der Mann. Er sprach laut, um sich über das Brummen des Fahrzeugmotors verständlich zu machen. Seine Besorgnis schien aufrichtig.
»Ja«, brachte McCoy zwischen tiefen Atemzügen hervor. Er schob seinen Körper in eine angenehmere Position, bewegte prüfend seine Arme und Beine, untersuchte seine Hände und versuchte, seinen allgemeinen körperlichen Zustand einzuschätzen. Seine Knie und Ellbogen schmerzten, und diverse blutige Abschürfungen bedeckten seine Handflächen, aber ansonsten schien er unverletzt. »Ein wenig durchgeschüttelt«, gab er zu, »aber ich bin in Ordnung.«
Hinter dem Mann, der über McCoy gebeugt stand, verstummten die Geräusche des Fahrzeugs und die Fahrertür schwang auf. Der Fahrer sprang auf die Straße. Sein Gesicht war aschfahl und seine geweiteten Augen spiegelten den Schock in Keelers Blick wider. »Sie ist einfach vor meinen Laster gelaufen«, stammelte er hektisch. Er richtete die Worte an McCoy, hatte aber einen Arm erhoben und deutete damit auf die am Boden sitzende Keeler. »Als ich sie über die Straße gehen sah und mir klar wurde, dass sie nicht stehen blieb, bin ich sofort auf die Bremse getreten.« Der Fahrer sah auf der Suche nach Bestätigung zu dem Mann in dem grauen Mantel. »Mehr hätte ich nicht tun können. Ich war einfach …«
»Schon gut«, unterbrach McCoy, der jetzt besser sprechen konnte, nachdem er wieder zu Atem gekommen war. Er stemmte sich von der Straße hoch und stand auf. Der Mann im grauen Mantel bot ihm eine helfende Hand an. Als McCoy wieder sicher auf den Beinen stand, sah er den Fahrer des Lasters an. »Es war nicht Ihre Schuld«, versicherte er ihm. »Außerdem geht es uns gut.« Der Fahrer starrte zurück und versuchte offensichtlich, den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen abzuschätzen. Schließlich atmete der Mann geräuschvoll aus, und sein Körper schien sich nach und nach zu entspannen, wie eine Sprungfeder, der man langsam die Spannung entzog.
McCoy drehte sich zu Keeler um, die gerade damit begonnen hatte, sich wieder aufzurappeln. Auf beiden Seiten griff je ein Mann nach einem Arm und half ihr auf die Beine. Um sie herum drängten andere Zuschauer herbei, von denen viele wild durcheinander über das soeben Erlebte plapperten und Beobachtungen und Mitgefühl anboten. Keeler wirkte immer noch verwirrt und schien nicht in der Lage, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. McCoy ging zu ihr hinüber. Ihr Hut war vom Kopf gefallen, und das Haar war völlig zerzaust. Einige lose Strähnen hingen in die Stirn. Ihr hochgeschlossener marineblauer Mantel war verrutscht, sodass man den rechten Ärmel ihrer weißen Bluse sehen konnte, der an mehreren Stellen zerrissen war. Auch die blasse Haut unter der ramponierten Kleidung wies diverse Kratzer und Schürfwunden auf.
»Sind Sie in Ordnung, Miss Keeler?«, fragte McCoy. Sie hob langsam den Kopf, um zu ihm aufzusehen – er war fast ein Dutzend Zentimeter größer als sie –, und es dauerte ein paar Sekunden, bis ihre Augen die seinen fanden. Sie nickte vorsichtig, sagte jedoch nichts. Um sie herum wurde die kleine Menge still. Sie schien darauf zu warten, dass sie sprach.
McCoy bückte sich und hob Keelers Hut auf, bevor er sich an ihre Seite stellte, woraufhin die beiden Männer, die Keeler hochgeholfen hatten, zurücktraten. Er streckte eine Hand aus und richtete ihren Mantel. Dann nahm er vorsichtig ihren Ellbogen und ihre Hand. Die Ansammlung von Gaffern und Samaritern teilte sich vor ihnen, und McCoy führte Keeler in Richtung der Tür, durch die er erst vor ein paar Minuten in die Nacht hinausgetreten war. Obwohl die Erinnerung daran noch frisch war, schien sie paradoxerweise zu einem anderen Leben zu gehören.
»Sind Sie sicher, dass sie in Ordnung ist, Mister?«, fragte der Fahrer, als sie an ihm vorbeigingen.
»Keine Sorge«, erwiderte McCoy, ohne stehen zu bleiben. »Ich bin Arzt. Ich werde mich um sie kümmern.«
McCoy ging mit Keeler an der Vorderseite des Lasters vorbei. Das graue metallene Schutzgitter des Fahrzeugs wirkte wie die langen Fangzähne eines furchterregenden Ungeheuers, aus dessen Rachen der beißende Gestank von verbranntem Gummi und erhitztem Öl wehte wie fauliger Atem. Als sie die Bordsteinkante erreichten, hörte er, wie die hinter ihnen versammelten Leute wieder zu reden begannen. Ihre Stimmen klangen aufgeregt, während sie über den schrecklichen Unfall sprachen, der sich soeben beinahe ereignet hatte. McCoy geleitete Keeler auf den Bürgersteig und von dort zu den Doppeltüren, die zur Mission in der Einundzwanzigsten Straße führten. Er streckte einen Arm aus, um eine der Türen aufzudrücken, doch dann drehte sich Keeler plötzlich zu ihm um und zog ihren Arm aus seinem Griff. Sie starrte ihn an, und in ihrem Gesicht schien sich ein gewisses Maß an Erkenntnis abzuzeichnen.
»Wie dumm«, sagte sie. »Ich habe diese Straße schon tausend Mal überquert. Ich hätte getötet werden können.« Sie sprach in einem monotonen Tonfall und hatte sich offensichtlich noch nicht von ihrem Trauma erholt.
»Aber Sie wurden nicht getötet«, erwiderte McCoy. Er fügte seinen Worten ein Lächeln hinzu, von dem er hoffte, dass sie es als beruhigend empfinden würde. »Versuchen Sie, nicht darüber nachzudenken. Das ist jetzt Vergangenheit.« Er winkte mit der Hand in Richtung Straße, als wollte er mit dieser Geste den Gedanken verscheuchen, dass sie beide um ein Haar schwer verletzt worden oder sogar ums Leben gekommen wären. »Alles kommt wieder in Ordnung«, schloss er.
Keeler blickte für eine Sekunde zum Laster hinüber und sah dann wieder McCoy an. Sie schenkte ihm ein schwaches Lächeln und nickte, als müsste sie sich bemühen, sich selbst von seinen Worten zu überzeugen.
»Wirklich«, beharrte McCoy und griff erneut nach der Tür. »Alles kommt wieder in Ordnung.« Aber als er Edith Keeler in die Mission führte, wurde ihm klar, dass er in einer Stadt auf der Erde stand, dreihundert Jahre bevor er geboren worden war – dreihundert Jahre bevor er geboren werden würde. McCoy gehörte weder an diesen Ort noch in diese Zeit. Er mochte soeben das Leben einer Frau gerettet haben und selbst dem Tod entgangen sein, aber nun wurde ihm bewusst, dass es zumindest für ihn keine Garantie gab, dass irgendetwas jemals wieder in Ordnung kommen würde.
I
Blindlings geht der Sterne Lauf
Sie flüstert: »Blindlings geht der Sterne Lauf;
Der Himmel ist mit einem Flor umsponnen;
Von wüsten Städten und erloschnen Sonnen
Tönt gellend nur ein Klageschrei herauf:
Dort stehet das Phantom, Natur genannt!
Mit seinen Harmonien im weiten All
Nichts als mein eigner hohler Widerhall,
Ein leerer Schatten nur mit leerer Hand.«
Soll ich vertrauen solcher blinden Macht,
Als mein natürlich Erbteil zu ihr beten?
Soll ich als sünd’ges Erbe sie zertreten,
Die auf der Schwelle meiner Seele wacht?«
– Alfred, Lord Tennyson,In Memoriam A.H.H., III
EINS
2267
Als das Außenteam an Bord der Enterprise materialisierte, spürte McCoy sofort, dass etwas nicht stimmte. Seine Mannschaftskollegen machten sich daran, die Transporterplattform in Zweiergruppen zu verlassen – Jim und Spock, Scotty und Uhura und ein Paar Sicherheitsleute, Galloway und … Davis, oder? Doch McCoy blieb zurück und versuchte, das Durcheinander aus Gedanken und Erinnerungen zu sortieren, das durch seinen Kopf schwirrte. Noch vor wenigen Augenblicken war er zusammen mit Jim und Spock in einer jahrhundertealten Stadt auf der Erde gewesen und hatte entsetzt zusehen müssen, wie eine Frau – Edith Keeler, erinnerte er sich – bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und dann stand McCoy plötzlich ohne Vorwarnung mit einem halben Dutzend seiner Mannschaftskollegen inmitten der Ruinen eines toten Planeten.
Aber nicht völlig tot, dachte er jetzt. Dort gab es eine seltsame … was? Maschine? Kreatur? McCoy hatte keine Ahnung, worunter er es einordnen sollte. Zwischen den nackten Felsformationen, den verfallenen architektonischen Strukturen und umgeben von zerbrochenen Säulen, die überall verstreut lagen, wirkte das Objekt wie das vergessene Überbleibsel einer verlorenen Zivilisation. An seinem Rand verlief ein unregelmäßiger Ring von vielleicht sechs oder sieben Metern Durchmesser. Es ähnelte keinem lebenden Wesen, dem McCoy je begegnet war, und doch schien seine gefleckte gelbbraune Oberfläche irgendwie organisch zu sein. Außerdem hatte es gesprochen, wobei seine asymmetrische fließende Form im Rhythmus mit den Worten der tiefen widerhallenden Stimme geglüht hatte.
»Die Zeit läuft wieder ihren alten Gang; alles ist, wie es vorher war«, hatte es gesagt. »Viele solcher Reisen sind möglich. Lasst mich das Tor zu diesen Reisen sein.«
Doch bevor McCoy überhaupt in der Lage gewesen war, die Bedeutung dieser Aussage zu überdenken, war das Außenteam zurück auf die Enterprise gebeamt worden, was seinen ohnehin schon verwirrten Orientierungssinn nur noch stärker durcheinandergebracht hatte. In einem Moment stand er in einer alten Stadt auf der Erde, im nächsten auf einer verlassenen fremden Welt und dann, nur eine Minute später, war er wieder auf seinem Schiff. Sein Verstand schwirrte aufgrund der rapiden Abfolge dieser nahezu unmittelbaren Reisen von einem Ort zum nächsten.
McCoy ging zur Vorderseite der Transporterplattform. Zusätzlich zu seiner Verwirrung kämpfte er immer noch gegen die geistigen und körperlichen Auswirkungen der Überdosis Cordrazin an, die vor einigen Tagen unbeabsichtigt in seinen Körper gepumpt worden war. Tatsächlich hatten ihn diese chemischen Spinnweben, die sein Bewusstsein bedeckten und während seiner Genesung immer wieder in Schüben über ihn kamen, aus dem Hinterzimmer der Mission in der Einundzwanzigsten Straße und in die Nacht hinausgetrieben. Er hatte gehofft, dass ihm ein Spaziergang an der kalten Winterluft in seinem geschwächten Zustand guttun und es ihm ermöglichen würde, seine Gedanken wieder zu sammeln.
Die Mission in der Einundzwanzigsten Straße, wiederholte McCoy in Gedanken. Bilder der Suppenküche standen ihm lebhaft vor Augen, doch die Klarheit dieser Erinnerungen übertrug sich nicht auf seine Emotionen. Sein inneres Gleichgewicht drohte ihm wieder zu entgleiten, daher bemühte er sich, seine Gefühle zu stabilisieren, indem er sich auf seine unmittelbare Umgebung konzentrierte.
Auf der anderen Seite des Raumes signalisierte ein vertrautes Klicken die Aktivierung einer Interkom-Verbindung. McCoy sah, wie Jim sich über die freistehende Konsole lehnte, in der sich die Sprechanlage befand. »Kirk an Brücke«, sagte er. Spock und der Rest des Außenteams warteten hinter ihm, und Lieutenant Berkeley, der den Transporter bediente, beobachtete alles von der anderen Seite des Raumes aus.
»Brücke, DeSalle hier«, kam die körperlose Antwort des Navigators, der in der Befehlskette der Enterprise an fünfter Stelle stand. »Sprechen Sie, Captain.«
»Verlassen Sie sofort den Orbit, Lieutenant«, befahl Kirk. »Setzen Sie Kurs auf Sternenbasis 10, Warp sechs.« Die Worte erregten McCoys Aufmerksamkeit, jedoch nicht wegen ihres Inhalts, sondern weil Jim sie in einem seltsam leblosen Tonfall ausgesprochen hatte. Auch Spock schien das bemerkt zu haben, denn er starrte zu McCoy herüber, während der Captain die Befehle gab.
Jim wartete auf DeSalles Bestätigung und sagte dann: »Kirk Ende.« Er streckte eine Hand über die Konsole aus und schlug mit der Faust auf die Interkom-Kontrolle, um den Kanal zu schließen.
»Captain«, sagte Spock und trat neben ihn. McCoy verspürte den Drang, seinem Freund ebenfalls zur Seite zu stehen, aber er war noch immer zu wacklig auf den Beinen, um zu ihm gehen zu können. Stattdessen sah er einfach zu, wie Jim sich zu seinem Ersten Offizier umdrehte.
»Ja, was gibt es, Mister Spock?«, wollte der Captain wissen. McCoy bemerkte erneut einen ungewöhnlichen Gleichklang im Tonfall des Captains. Ihm wurde klar, dass das mit dem zusammenhängen musste, was – zumindest aus seiner Sicht – vor ein paar Minuten geschehen war. Jim hatte ihn davon abgehalten, Edith Keelers Leben zu retten. McCoy hatte ihm das sogar vorgeworfen – Weißt du, was du da getan hast? –, und Spock hatte ihm versichert, dass dem so war – Er weiß es, Doktor. Er weiß es sehr gut. McCoy konnte die Entscheidung des Captains nicht nachvollziehen, aber er hatte sicher einen guten Grund dafür gehabt. Dennoch schien es nun so, als würde Jim seine eigenen Handlungen hinterfragen – vermutlich Handlungen, die er hatte ausführen müssen. McCoy hatte diese abwesende Haltung schon zuvor bei seinem Freund gesehen. Die Verantwortung des Kommandos über die Enterprise lastete schwer auf den Schultern des Captains.
Spock begegnete Jims teilnahmslosem Gebaren mit seinem eigenen. »Ich sehe mich gezwungen«, begann er, »auf die beträchtliche Bedeutung für den wissenschaftlichen Fortschritt hinzuweisen, die weitere Untersuchungen des Hüters mit sich bringen würden.«
Der Hüter, dachte McCoy. Die Bezeichnung hallte in seiner Erinnerung nach, als hätte er sie vorher schon einmal gehört, vielleicht in einem Traum. Trotzdem wusste er sofort, dass Spock sich auf das ringförmige Objekt – oder Wesen – bezog, das sich auf der Oberfläche des Planeten befand.
»Zumindest«, fuhr Spock fort, »könnten genaue Beobachtungen zur Beschaffung historischer Informationen beitragen, die lange in der Zeit verloren geglaubt waren.« Er sprach eindeutig nicht nur in seiner Funktion als stellvertretender Kommandant des Schiffes, sondern auch als dessen leitender Wissenschaftsoffizier. »Außerdem könnte sich eine gründliche Untersuchung solcher Daten als außerordentlich wertvoll für diverse Bereiche erweisen, einschließlich Anthropologie, Archäologie, Genetik, Kosmologie …«
»Aus diesem Grund«, unterbrach der Captain, »werde ich auch beantragen, dass das Sternenflottenkommando so bald wie möglich ein geeignetes Wissenschaftsschiff an diesen Ort schickt.« Auf den ersten Blick erschien das McCoy wie eine vernünftige Idee. Doch das Hauptziel der fünfjährigen Mission der Enterprise – das sich auch mit Jims persönlichen Vorlieben deckte – bestand in der Erforschung des Unbekannten. Daher schien es seltsam und sogar bemerkenswert, dass der Captain diese Gelegenheit nicht sofort nutzen wollte und sie seiner Besatzung vorenthielt.
»Sir«, beharrte Spock. Er neigte den Kopf ein wenig und senkte die Stimme, als wollte er den Eindruck vermeiden, die Entscheidung seines vorgesetzten Offiziers anzuzweifeln. »Ich muss auch auf die potenziell zerstörerischen Konsequenzen hinweisen, die entstehen könnten, wenn wir zulassen, dass dieser Planet unter die Kontrolle einer Macht gerät, die der Föderation feindlich gesinnt ist.« McCoy bemerkte Anzeichen dafür, dass der Vulkanier Unbehagen verspürte, was er bisher nur äußerst selten beobachtet hatte. Spocks Gesichtsmuskeln spannten sich ein wenig an, er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und sprach sogar noch förmlicher als gewöhnlich.
»Ich bitte um Verzeihung, Captain«, schaltete sich Scotty ein und schlenderte zu den beiden Senior-Offizieren hinüber. »Ich muss Mister Spock in dieser Sache zustimmen. Wir sind nicht weit vom romulanischen Raum entfernt und befinden uns sogar noch näher an der klingonischen Grenze. Friedensvertrag von Organia hin oder her, wenn die …«
»Ich verstehe, was Sie meinen«, fiel Kirk dem Chefingenieur ins Wort. Der Captain hielt einen Moment inne und versuchte offenbar, seine Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Er sah von Scotty zu Spock und wandte sich dann wieder der Transporterkonsole zu. Erneut schlug er mit der Faust auf die Interkom-Kontrolle. »Kirk an DeSalle.«
»DeSalle hier«, antwortete der Lieutenant sofort. »Die Navigation berechnet gerade den Kurs nach Sternenbasis 10, Captain.«
»Vergessen Sie meinen vorherigen Befehl«, sagte Kirk. »Bleiben Sie bis auf Weiteres in einem Standardorbit und führen Sie Langstreckenscans des umliegenden Gebiets durch. Achten Sie besonders darauf, ob sich irgendwelche Schiffe diesem System nähern.«
»Aye, Sir«, bestätigte DeSalle.
Der Captain trennte die Verbindung und schloss den Kanal. Über die Konsole hinweg wandte er sich an Lieutenant Berkeley. »Sichern Sie den Transporter«, wies er ihn an. »Niemand darf auf den Planeten hinunterbeamen. Unter keinen Umständen.«
»Ja, Sir«, erwiderte Berkeley. Seine Finger glitten gekonnt über die Konsole und führten den Befehl des Captains aus.
Kirk warf Spock einen kurzen Blick zu und wandte sich dann an den Rest des Außenteams. »Lieutenant Uhura, melden Sie sich auf der Brücke«, sagte er. »Senden Sie eine verschlüsselte Botschaft an das Sternenflottenkommando. Verweisen Sie darin auf die Logbucheinträge, die wir ihnen schon geschickt haben, und fassen Sie die Ereignisse auf dem Planeten zusammen. Übermitteln Sie ihnen mein dringendes Anliegen, hier eine sofortige und möglicherweise permanente Militärpräsenz zu stationieren, sowie meine Empfehlung für ein langfristiges Wissenschaftskontingent.«
»Wird erledigt, Sir«, bestätigte Uhura, doch bevor sie zur Tür gehen konnte, ergriff Spock noch einmal das Wort.
»Captain«, sagte er, »angesichts der außergewöhnlichen Natur dessen, was das Außenteam auf dem Planeten vorfand, wollen Sie doch sicher, dass wir uns alle für eine medizinische Untersuchung auf der Krankenstation melden.«
McCoys Augenbrauen schossen unfreiwillig nach oben, als Spock auf so untypische Weise mit dem Versuch fortfuhr, dem Captain vorzuschreiben, wie er seinen Job zu machen hatte. »Vor allem«, sagte der Vulkanier und sah dabei zu McCoy, der immer noch auf der Kante der Transporterplattform stand, »bin ich sicher, dass Sie den Doktor wegen der beträchtlichen Menge Cordrazin untersuchen lassen wollen, die kürzlich in seinen Körper injiziert wurde.«
Jim drehte abrupt den Kopf und sein Gesichtsausdruck wurde sanfter, als er zu McCoy herüberschaute. »Ja, natürlich«, stimmte er zu. Er kam zur Plattform herüber und sah hoch. »Wie geht es dir, Pille?«
»Um ehrlich zu sein, mein Kopf dreht sich im Moment ein bisschen«, gab McCoy zu und massierte sich mit einer Hand die Schläfen. Er ging vorsichtig die Stufen hinunter, bis er dem Captain auf dem Boden des Transporterraums gegenüberstand. »Ich habe mich recht gut von der Überdosis erholt«, erklärte er, »aber ich denke, es wird noch ein wenig dauern, bis ich wieder ganz der Alte bin.«
»Du … hast eine Menge durchgemacht«, sagte Jim. Er hob die Hände und griff nach McCoys Oberarmen. »Lass dich von Doktor Sanchez gründlich untersuchen.«
McCoys linke Mundhälfte verzog sich zu einem schiefen Grinsen. »Ja, Sir«, sagte er. Jim drückte McCoys Arme noch einmal freundschaftlich, ließ seine Hände dann sinken und wandte sich wieder an den Rest des Außenteams.
»Sie alle melden sich bitte auf der Krankenstation«, befahl er den versammelten Mannschaftsmitgliedern, bevor er direkt zu Uhura sprach. »Lieutenant, Sie gehen zuerst zur Brücke und kümmern sich darum, dass meine Botschaft ans Sternenflottenkommando geschickt wird. Danach lassen auch Sie sich untersuchen.«
»Ja, Sir«, bestätigte sie.
McCoy sah zu, wie Jim in Richtung Tür ging. Die hellgrauen Platten teilten sich vor ihm, doch dann meldete sich Spock erneut zu Wort. »Captain«, sagte er. Jim blieb stehen und warf ihm über die Schulter einen Blick zu. »Darf ich fragen, ob Sie sich ebenfalls auf die Krankenstation begeben werden?«
»Ich werde in mein Quartier gehen«, erwiderte Jim, dessen ernster Gesichtsausdruck zurückgekehrt war. »Und ich wünsche, nicht gestört zu werden.« McCoy dachte einen Moment lang, dass Spock die Vorschriften zitieren würde, um den Captain dazu zu bewegen, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen, aber der Erste Offizier sagte nichts mehr. Jim verließ den Transporterraum, und die Türen glitten hinter ihm zu.
Wie aufs Stichwort sahen alle Mitglieder des Außenteams zu Spock, und McCoy wurde klar, dass er nicht der Einzige war, der das abwesende Verhalten des Captains bemerkt hatte. Spock ignorierte die Aufmerksamkeit der Besatzung allerdings und wandte sich stattdessen an McCoy. »Benötigen Sie Unterstützung, Doktor?«, fragte er.
»Nein«, erwiderte McCoy. »Das schaffe ich schon allein.«
»Wie Sie meinen«, sagte Spock. »Dann sollten wir nun alle die Befehle des Captains befolgen.«
McCoy schloss sich den Mitgliedern des Außenteams an, als sie den Transporterraum verließen und sich auf den Weg zur Krankenstation machten. Er nahm sich vor, später noch einmal unter vier Augen mit Spock zu reden. Das Verhalten des Captains hing offenbar mit Edith Keelers Tod zusammen, aber er fragte sich, ob dort unten auf dem Planeten noch etwas anderes vorgefallen war.
ZWEI
1930
Edith’ Knie zitterten, als McCoy sie durch den Vordereingang der Mission führte. Sie war zwar mit seiner Hilfe von der Mitte der Straße bis hierher gelangt, doch ihre Beine hatten bereits zu schwanken begonnen, als sie aufgestanden war. Sie konnte die Tatsache, dass sie um ein Haar vor einen heranrasenden Laster gelaufen wäre, einfach nicht aus ihren Gedanken vertreiben und vermutete, dass sich ihr Körper aufgrund des Zwischenfalls in einer Art Schockzustand befand.
Im Inneren des Gebäudes wurde die Dunkelheit der städtischen Nacht von der warmen Beleuchtung abgelöst, die die von der Decke baumelnden nackten Glühbirnen spendeten. Edith kniff die Augen zusammen und hob eine Hand, um sich gegen die plötzliche Helligkeit abzuschirmen, doch die hektische Bewegung brachte sie sofort wieder aus dem Gleichgewicht. Reflexartig streckte sie den Arm zur Wand aus, um sich abzustützen. Ihre gespreizten Finger fanden den beigefarbenen Putz zwischen dem öffentlichen Telefon und dem kleinen Schreibtisch, der direkt daneben stand.
»Ganz ruhig«, sagte McCoy, während er seinen unterstützenden Griff an ihrem anderen Arm noch verstärkte. »Sorgen wir erst mal dafür, dass Sie sich hinsetzen können.« Edith hörte und verstand die Worte, aber sie klangen, als wären sie sehr weit entfernt ausgesprochen worden.
McCoy führte sie langsam zum nächsten der vier langen Tische, die den großen Hauptraum der Mission ausfüllten. Auf den Tischen standen umgedrehte Stühle, die Edith nach der letzten Mahlzeit des Tages selbst dort platziert hatte, damit sie den Boden wischen konnte. Jetzt streckte sie die Arme aus, und für einen Moment beobachtete sie, wie ihre Hände unkontrolliert zitterten, bis sie sie schließlich mit den Handflächen nach unten auf die Tischplatte drückte. Das flachsfarbene Holz war aufgrund der jahrelangen Nutzung voller Kerben und Kratzer und fühlte sich rau an.
Edith konzentrierte sich so gut sie konnte auf diese Empfindung und lehnte sich schwer auf ihre Hände, um den Beinen zumindest einen Teil der Last abzunehmen. Neben ihr kratzte Holz auf Holz, als McCoy einen der Stühle vom Tisch zog. Er stellte ihn hinter ihr auf den Boden, nahm sie dann sanft bei den Schultern und half ihr auf den Stuhl. Edith ließ die Hände dennoch flach vor sich auf dem Tisch liegen, da sie befürchtete, das Zittern nicht unterdrücken zu können, wenn sie sie hob. Erst jetzt bemerkte sie, dass die Ärmel der Bluse zerrissen waren. Dunkle Schmutzflecken bedeckten den zerfetzen weißen Stoff, und zwischen dem Schmutz entdeckte sie rote Kratzer und Blutergüsse, die ihre Haut übersäten, zweifellos das Ergebnis des Aufpralls auf die Straße. Die meisten ihrer Wunden schienen nur oberflächlich zu sein, aber aus einer tiefen Schnittwunde, die von der Oberseite des rechten Handgelenks bis zur Unterseite des Daumens reichte, tropfte Blut. Seltsamerweise spürte sie keinen Schmerz – aber vielleicht war das gar nicht so seltsam, da sie praktisch überhaupt nichts spürte. Ihr Körper und Geist waren von den Ereignissen dieser Nacht wie gelähmt.
»Dann wollen wir Sie doch mal genauer ansehen«, sagte McCoy. Seine Stimme schien immer noch aus weiter Ferne zu kommen. Er legte ihren hellblauen Topfhut auf den Tisch, knöpfte ihren Mantel auf, zog ihn ihr vorsichtig aus und legte ihn neben den Hut auf den Tisch. Nachdem er einen weiteren Stuhl vom Tisch gezogen hatte, setzte er sich vor sie und nahm behutsam ihre Hände in seine, zuerst die eine und dann die andere. Selbst im benebelten Zustand konnte Edith erkennen, dass er die Verletzungen mit großer Sorgfalt untersuchte. Sie beobachtete ihn dabei, doch als ihr Blick erneut auf ihre verunstaltete Porzellanhaut fiel, spürte sie plötzlich Druck hinter den Augen aufwallen. Sie biss die Zähne zusammen und bemühte sich, ihre Tränen zurückzuhalten.
»Alles halb so wild«, meinte McCoy, und Edith klammerte sich an diese Aussage, als hinge ihr Leben davon ab. »Ich werde mal nachsehen, was ich hier finden kann, um Sie zu behandeln«, sagte er und stand auf. »Dauert nur eine Minute.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!