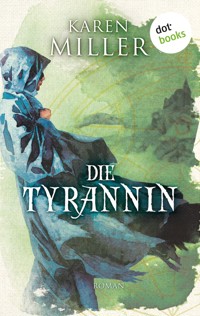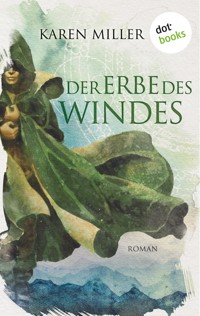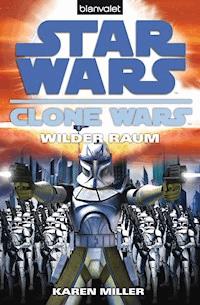
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Clone Wars
- Sprache: Deutsch
Der Aufbruch zu neuen fantastischen Welten!
Der schwer verwundete Obi-Wan Kenobi erfährt von kriegsentscheidenden Informationen. Trotz seiner Verletzungen bricht er auf, um diese zu überprüfen. Er erkennt nicht, dass er und seine Gefährten genau das tun, was die dunklen Sith-Lords von ihnen erwarten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Karen Miller
Wilder Raum
Aus dem Englischen
von Firouzeh Akhavan
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Star Wars™. Clone Wars™ 2« bei Del Rey / The Ballantine Publishing Group, Inc., New York.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München.
Copyright © 2008 by Lucasfilm Ltd. & ® or ™ where indicated.
All rights reserved. Used under authorization.
Translation Copyright © 2009 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Cover Art Copyright © 2008 by Lucasfilm Ltd.
Cover illustration by John Van Fleet
Redaktion: Peter Thannisch
HK · Herstellung: RF
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-07786-0V002
www.blanvalet.de
Ewan McGregor gewidmet, dem wunderbaren Schauspieler, der den jungen Obi-Wan Kenobi perfekt und herzzerreißend zum Leben erweckte.
Eins
Geonosis, grell roter Planet. Fels und Staub und gnadenlose Hitze, Wind und Sand und ein Himmel voller Gesteinsbrocken. Harte Lebensbedingungen. Launischer Tod. Alles fruchtbare Grün, Labsal für die Augen, längst verdorrt. Kein sanfter Ort, der zweite Chancen gibt oder einen weich fallen lässt. Geheimnisse, Aufruhr und Engstirnigkeit. Ehrgeiz, unersättliche Gier und Sehnsucht nach dem Tod. Zufluchtsort für die einen, letzte Ruhestätte für andere. Das Blut der Republik versickert in der trockenen Erde. Der endlose Wind – schwach die Laute zu vernehmen von Qual und Leid. Und in der Arena weinende Jedi …
… deren Tränen im Innern rannen, wo man sie nicht sah. Denn um einen gefallenen Kameraden zu weinen, wäre die Zurschaustellung einer unziemlichen Bindung an diesen. Ein Jedi band sich gefühlsmäßig nicht an andere, an Dinge, an Orte, an Welten oder deren Bewohner. Die Stärke eines Jedi beruhte auf seiner inneren Ruhe, Zurückhaltung und Liebe, die nicht auf eine bestimmte Person gerichtet war.
Das zumindest war das Ideal …
Yoda stand schweigend neben seinem Freund Mace Windu, der wie er Meister war. Er war müde und spürte schmerzhaft sein Herz, während er beobachtete, wie gewandt Klonkrieger die letzten gefallenen Jedi rasch und systematisch auf Repulsorlift-Bahren hoben, um sie mit einer Hand aus der grausamen Arena Poggles des Geringeren zu den Kanonenbooten der Republik, die jenseits der hohen Mauern warteten, zu transportieren. Das Ganze wurde von den wenigen Jedi beaufsichtigt, die das Gemetzel und den folgenden Kampf überlebt hatten – und nicht ganz so gelassen waren, wie ihre Philosophie es ihnen vorschrieb.
Die Schlacht von Geonosis war vorüber, die Droidenarmee der Separatisten hatte eine vernichtende Niederlage erlitten. Doch ihr Anführer, Count Dooku, war geflohen – genauso wie sich auch der Verräter und seine Untergebenen aus der Handelsföderation, der Techno-Union, der Handelsgilde, dem Intergalaktischen Bankenverband, dem Hyperkommunikationskartell und der Handelsallianz in Sicherheit gebracht hatten. Sie waren geflohen, um weiter eine Verschwörung gegen die große Errungenschaft der Galaxie – die Republik – zu planen.
»Ich bedaure es nicht, hierhergekommen zu sein«, sagte Mace, und über sein ohnehin schon dunkles Gesicht legte sich ein Schatten. »Wir haben unserem Feind einen schweren Schlag versetzt und dabei feststellen können, zu was die Klonarmee in der Lage ist. Das ist nützlich. Aber Yoda, wir haben dafür einen höheren Preis gezahlt, als ich mir vorstellen konnte oder vorauszusehen war.«
Yoda nickte, seine knorrigen Finger lagen fest auf seinem alten Gimerstock. »Die Wahrheit Ihr sprecht, Meister Windu. Gewinn ohne Verlust es nicht gibt, denn im Gleichgewicht die Waagschalen müssen sein.« Langsam stieß er einen langen, tiefen Seufzer aus. »Narren wir würden wirklich sein, wir dächten, ungeschoren davonzukommen bei so einem Kampf. Aber diesen Verlust der Tempel wird nur schwer verwinden. Zu Jedi-Rittern wir unsere ältesten Padawane bald schlagen müssen, ich fürchte.«
Padawane wie Anakin Skywalker, so intelligent, so verwegen – und noch so verletzlich. Der bereits wieder auf dem Weg nach Coruscant war, zusammen mit Obi-Wan und der entschlossenen, kühnen und genauso verwegenen jungen Senatorin von Naboo.
Schwierigkeiten auf ihn und sie zukommen, ich spüre. Wenn doch ich nur sehen könnte klar. Aber in einen Schleier die dunkle Seite gehüllt ist. Uns mit seiner Undurchdringlichkeit erstickt.
»Was ist?«, fragte Mace und runzelte die Stirn. Wie immer spürte er die innere Unruhe von Yoda. »Was ist los?«
Talia Moonseeker, eine junge Argauun, die erst seit vier Monaten Jedi-Ritter war, kniete mit gesenktem Kopf neben ihrem gefallenen früheren Meister Va’too. Mühsam riss Yoda den Blick von ihrer Trauer und der grässlichen Arena los, in der immer noch sengende Hitze herrschte. Auf Geonosis dauerte ein Tag so lang. Es würden noch viele Stunden vergehen, ehe die Sonne über dieser kargen Landschaft unterging.
»Euch antworten klar, ich kann nicht, Meister Windu«, erwiderte er mit schwerer Stimme. »Zeit zu meditieren ich brauche.«
»Dann solltet Ihr in den Tempel zurückkehren«, meinte Mace. »Ich kann die Säuberungsaktion beaufsichtigen. Ihr seid unser Leitstern in der Dunkelheit, Yoda. Ich bezweifle, dass wir uns ohne Eure Weisheit und Euren Weitblick behaupten können.«
Seine Worte waren freundlich gemeint und sollten das Vertrauen ausdrücken, welches Yoda genoss. Doch sie legten sich mit bleierner Schwere ob ihrer schrecklichen Endgültigkeit auf Yodas Schultern.
Zu alt ich bin, um zu sein die letzte Hoffnung der Jedi.
Er beobachtete, wie sich Talia Moonseeker taktvoll zurückzog, sodass der Leichnam ihres gefallenen früheren Meisters ohne Probleme von den unermüdlichen Klonen aus der Arena geschafft werden konnte. Jene Klone, die an diesem Tag gekämpft und gestorben waren, so zielstrebig und furchtlos, dass er sie eher als Droiden denn Menschen betrachtete – Droiden aus Fleisch und Blut, die zu perfekten absolut disziplinierten Tötungsmaschinen gedrillt waren. Nur zu dem einzigen Zweck gezüchtet zu sterben, damit die Völker der Republik lebten. Die Hintergründe und Umstände ihres Einsatzes waren ein Geheimnis, das wohl nie enthüllt werden würde.
Yoda musste ein Schaudern unterdrücken, als er an die Klon-Anlage auf Kamino dachte – deren strahlend weiße Sterilität, die unpersönliche Fürsorge, die man den gezeugten Wesen dort so effizient, so außerordentlich, so völlig bedenkenlos angedeihen ließ.
Gravierende Fragen nach Ethik und Moral diese Klone lassen aufsteigen. Aber Antworten, da sind? Keine weiß ich. So verzweifelt wir sie brauchen, dass über Bord geworfen werden dadurch alle ethischen Bedenken.
Mace ließ sich auf ein Knie sinken. »Geht es um Dooku, Yoda? Macht er Euch Gedanken?«
Bitterer, stechender Schmerz durchfuhr ihn. Dooku. Yoda schob den Namen, das Entsetzen beiseite. Später würde noch Zeit sein, über diesen gefallenen Mann nachzudenken. »Zum Tempel zurückkehren ich werde jetzt, Meister Windu. So bald wie möglich mir kommt nach. Wichtige Dinge es gibt, die der Rat besprechen muss.«
Mace nahm die freundliche Zurückweisung hin und stand auf. »Ich wünsche Euch eine sichere Reise, Yoda. Ich sehe Euch dann auf Coruscant, sobald hier alles erledigt ist.« Mit einem Fingerschnippen rief er einen Klonkrieger herbei. »Meister Yoda kehrt nach Coruscant zurück. Er braucht jemanden, der ihn zum Schiff begleitet.«
Der Krieger nickte. »Ja, Sir.«
Yoda beobachtete vom Schiff aus, wie sie den tödlichen Asteroidengürtel hinter sich ließen und der grausame rote Planet Geonosis erst verschmierte und dann zu einem Streifen wurde, als der Hyperantrieb ansprang. Mit einem erneuten langen und tiefen Seufzer ließ Yoda von der Trauer, die ihn ob der kürzlichen Ereignisse immer noch umhüllt hatte, ab. Trauer war nur ein Hinweis, dass eine emotionale Bindung bestand. Sie diente keinem nützlichen Zweck. Wenn er dem Licht dienen wollte, wie es eigentlich sein Daseinszweck war, dann musste er wieder zu jener inneren Gelassenheit zurückfinden, die ihm eine sichere Haltung gab, weil er dann auf festem Grund stand.
Sobald er Coruscant erreicht hatte, würde die schwere Aufgabe, die Republik zu retten, erst beginnen.
Die Hallen des Heilens im Jedi-Tempel waren wunderschön. Sie hatten hohe Decken und riesige Fenster, durch die goldenes Licht auf die blauen, grünen und rosaroten Wände und Böden fiel. Durchtränkt von den zartesten Seiten der Macht, Liebe, Fürsorge und Frieden, waren sie erfüllt vom Duft herrlicher Blumen, an grünen Sträuchern und Pflanzen konnte sich das Auge laben, und der liebliche Klang von plätscherndem Wasser schuf eine Atmosphäre neu erstarkender Lebenskraft. Hier war der perfekte Rückzugsort für jene, die Schaden an Körper und Geist genommen hatten, hier wurden alle widerwärtigen Beschwernisse, die mit dem Leiden einhergingen, einfach fortgespült.
Padmé, die sich gar nicht der heiteren Gelassenheit um sie her gewahr zu sein schien, funkelte die ältere, elegante Twi’lek-Jedi-Heilerin, die ihr im Weg stand, wütend an. »Ich brauche nicht lang, Meisterin Vokara Che. Nur einen Moment. Aber ich muss Anakin Skywalker wirklich dringend sehen.«
Die tentakelartigen Lekku am Hinterkopf der Twi’lek zuckten leicht, als sie Padmés Hände ergriff. »Es tut mir leid, Senatorin Amidala, aber das geht nicht.« In ihrer Stimme lag die vertraute Heiserkeit der Twi’lek, doch ihre Sprache wies keine Fehler auf. »Anakin ist schwer verletzt. Er ist in eine tiefe Heiltrance versetzt worden und darf nicht gestört werden.«
»Ja, ich weiß, dass er schwer verletzt ist. Ich bin doch gerade mit ihm zusammen von Geonosis hierhergekommen.« Padmé deutete auf ihr zerfetztes, eng anliegendes weißes Gewand, ohne auf die Schmerzen zu achten, die auch die kleinste Bewegung hervorrief. »Seht Ihr, Jedi? Das ist sein Blut. Glaubt mir, ich weiß genau, wie schwer er verletzt ist!«
Um das eben Gesagte noch zu unterstreichen, hätte sie der obersten Heilerin des Tempels ihre gequetschte Hand zeigen können, an die sich Anakin geklammert hatte, während die Schmerzen von seiner Wunde seinen Leib erbarmungslos und nicht enden wollend in qualvollen Schüben erschütterten.
Aber lieber nicht. Er sollte eigentlich niemandes Hand so halten – und ganz gewiss nicht meine. Schlimm genug, dass Obi-Wan es mitbekommen hat.
Die Jedi-Heilerin schüttelte den Kopf. »Senatorin, Ihr seid selber verwundet. Lasst Euch von uns helfen.«
»Macht Euch meinetwegen keine Gedanken«, erwiderte Padmé ungeduldig. »Das sind kaum mehr als ein paar Kratzer, und davon abgesehen habe ich auch keine Schmerzen.«
Vokara Che bedachte sie mit einem missbilligenden Blick. »Senatorin, glaubt ja nicht, dass Ihr mich hinters Licht führen könnt. Ich berühre Euch noch nicht einmal, und trotzdem spüre ich Eure körperlichen Beschwerden.« Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss dabei die Augen. »Irgendetwas hat Euch angegriffen, nicht wahr? Und Ihr seid aus großer Höhe herabgestürzt. Euer Kopf schmerzt. Eure Rippen sind gequetscht. Euer Rückgrat gestaucht. Es grenzt an ein Wunder, dass Ihr Euch nichts gebrochen habt.« Die Twi’lek-Heilerin öffnete die Augen und richtete ihren gelassenen, aber unnachgiebigen Blick auf sie. »Soll ich fortfahren?«
Padmé biss die Zähne zusammen, denn ihr tat tatsächlich von Kopf bis Fuß alles weh. Die Wunden, die ihr der Nexu mit seinen Krallen zugefügt hatte, brannten, und ihre geprellten Rippen pochten bei jedem Atemzug. »Das ist alles nichts Ernstes, und nur fünf Minuten mit Anakin würden es in Ordnung bringen. Meisterin Vokara Che, Ihr versteht nicht. Ich muss ihn wirklich sehen. Anakin ist mein Leibwächter, und somit trage ich die Verantwortung für ihn.«
Und es ist meine Schuld, was ihm widerfahren ist. Ich drängte ihn dazu, nach Geonosis zu gehen, und er wäre fast gestorben. Wenn Ihr also denkt, dass ich ihn jetzt im Stich lassen würde …
»Ihr tragt keinerlei Verantwortung für Anakin Skywalker«, erwiderte die Jedi-Heilerin scharf. »Er ist ein Jedi und befindet sich in der Geborgenheit seines Zuhauses bei seinen Jedi-Gefährten, die genau wissen, was sie für ihn tun müssen. Bitte, lasst uns auch Euch behandeln, damit Ihr den Tempel in guter körperlicher Verfassung verlassen könnt.« Ein Anflug von Missbilligung war in den Augen der Twi’lek-Heilerin zu erkennen. »Ich muss wirklich darauf hinweisen, dass Euer Hiersein sehr unangemessen ist, dass Ihr überhaupt …«
»Und wo sollte ich sonst sein?«, wollte Padmé wissen, der es egal war, dass sie mit ihrer lauten Stimme die Aufmerksamkeit von drei Heiler-Schülern erregte, die umhereilten und ihren geheimnisvollen Jedi-Aufgaben nachgingen. Padmé kümmerte es nicht, dass sie kurz davor stand, eine Szene zu machen und sich dabei eines ungebührlichen Verhaltens schuldig machte, das einer früheren Königin von Naboo, einer Senatorin der galaktischen Republik, einer Politikerin mit einem sehr bekannten Gesicht nicht würdig war.
Ich gehe nicht eher, als bis man mich ihn hat sehen lassen.
Vokara Ches Miene wurde hart. »Wenn es Euch nicht zusagt, nach Jedi-Art behandelt zu werden, Senatorin, kann ich dafür sorgen, dass man Euch zu einem Medcenter begleitet oder …«
»Ich lasse mich nirgendwo hin begleiten! Ich will …«
»Padmé«, sagte eine leise Stimme hinter ihr.
Meister Vokara Che eilte vor. »Meister Kenobi! Was tut Ihr hier?«
Mit wild pochendem Herzen drehte Padmé sich um. Obi-Wan. Er hatte immer noch seine zerfetzte und versengte Jedi-Tunika an. Auch um ihn hatte sich noch kein Heiler gekümmert. Mühsam hielt er sich auf der Schwelle zu einem kleineren Raum aufrecht, wobei er sich an den Türrahmen klammerte, um nicht zu fallen. Sein Gesicht war ganz bleich und seine Augen dunkel vor Erschöpfung, Schmerz und noch irgendetwas anderem.
Verzweiflung?Nein. Das konnte nicht sein. Ein Jedi hegte nicht solche Empfindungen. Zumindest … dieser Jedi nicht.
»Es tut mir leid, Vokara Che«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Aber ich möchte einen Augenblick lang mit der Senatorin allein sein.«
»Ich halte das nicht für angeraten«, meinte die Jedi-Heilerin, die eine seiner Schultern umfasst hatte und sich dabei nicht scheute, ihre Verärgerung deutlich zu zeigen. »Ihr steht kurz davor zusammenzubrechen, Obi-Wan. Ich verstehe das nicht. Ihr hättet längst geheilt sein sollen. Ich hatte eigens jemanden zu Euch geschickt …«
»Und ich habe sie wieder weggeschickt«, erwiderte Obi-Wan entschuldigend. »Ich wollte erst meinen Padawan sehen, ehe ich in Heil-Trance versetzt werde.«
»Ihr seid genauso schlimm wie sie.« Vokara Che gab ein abfälliges Schnalzen von sich. »Na gut. Ihr habt einen Augenblick.«
Padmé beobachtete, wie sich die Heilerin zurückzog, und sah dann wieder zu Obi-Wan hin. Sie zögerte kurz, ehe sie sich ihm näherte, und fühlte sich plötzlich jung und linkisch wie ein kindlicher Schüler. Sie legte den Kopf zur Seite. »Vokara Che hat recht. Ihr seht schrecklich aus.«
»Meint Ihr wirklich, Ihr würdet Anakin helfen?«, fragte Obi-Wan. Seine Stimme klang gepresst, und sein Blick war getrübt. »Das tut Ihr nicht. Ihr gehört nicht hierher, Padmé. Lasst Euch von ihnen behandeln, und dann geht heim. Ehe Yoda zurückkehrt. Ehe alles … kompliziert wird.«
Schockiert sah sie ihn an. Sie wollte ihn anschreien. Sie wollte in Tränen ausbrechen. Doch stattdessen drehte sie sich um und ging.
Was hätte sie sonst tun sollen?
Nach seiner Ankunft auf Coruscant kam für Yoda an erster Stelle die Pflicht. Statt sich sofort in die Hallen des Heilens im Tempel zu begeben, folgte er der gebieterischen Aufforderung aus dem Büro des Obersten Kanzlers, sofort zu erscheinen. Naboos früherer Senator war eindeutig darauf erpicht, aus erster Hand über die Ereignisse auf Geonosis informiert zu werden. Die Sprache, in der die Aufforderung formuliert war, entsprach kaum den für solche Mitteilungen vorgeschriebenen üblichen Protokollen.
Es war kein Treffen, dem er mit irgendwie gearteter Freude entgegensah. In letzter Zeit schienen die Jedi immer mehr in die Politik hineingezogen zu werden, in juristische und legislative Bereiche, die nie ihr Fach gewesen waren. Die Aufgabe der Jedi war es, die Republik aufrechtzuerhalten und deren Ideale zu schützen, und nicht sich in das Geschick irgendeines Kanzlers hineinziehen zu lassen. Politische Karrieren gehörten nicht zu ihren Angelegenheiten. Einzelpersonen und deren Absichten sollten für die Jedi eigentlich keine Rolle spielen.
Doch irgendwie änderte Palpatine etwas daran. Nicht indem er schikanierte und einschüchterte oder versuchte, seinen Willen durchzusetzen. Sondern eher im Gegenteil: Er sträubte sich immer wieder gegen die Bemühungen des Senats, ihm mehr Macht zu übertragen. Er sträubte sich, der Senat beharrte darauf, und schließlich erklärte sich Palpatine widerstrebend einverstanden. Und jedes Mal, wenn er sich den Wünschen des Senats fügte, wandte er sich wieder ratsuchend an die Jedi.
Das war kaum eine wünschenswerte Situation, denn der Hohe Rat der Jedi war keine Abteilung der Exekutive. Aber wie konnte man einem Mann, der so demütig um Rat fragte, reinen Gewissens die Hilfe verweigern? Ein Mann, der bei jeder Gelegenheit für die Jedi eintrat? Der unermüdlich für den Frieden arbeitete, seitdem er das höchste politische Amt in der Galaxie übernommen hatte und sich nun der erschreckend einschüchternden Aufgabe gegenübersah, die riesige Republik zusammenzuhalten? Wie konnte der Hohe Rat der Jedi so einem Mann den Rücken kehren?
Er konnte es natürlich nicht. Im Angesicht so außergewöhnlicher Ereignisse mussten die Jedi von ihren Traditionen abrücken und den Mann unterstützen, den eine ganze Galaxie als ihren Erlöser ansah.
Das bedeutete jedoch nicht, dass die Jedi darüber froh sein mussten.
Nachdem sein Schiff sicher am privaten Landeplatz des Tempels angedockt hatte, stieg Yoda in eine Fähre, mit der er auf dem schnellsten Wege in den Senatsbezirk gelangte. Sein Padawan-Pilot, T’Seely, begrüßte ihn respektvoll, war jedoch so vernünftig, nicht zu reden, während er die Fähre in die endlose Schlange des Luftverkehrs von Coruscant lenkte und in Richtung des weitläufigen Senatviertels flog.
Der Flug verlief ohne weitere Vorkommnisse. Direkt vor ihnen tauchte das Senatsgebäude auf, welches silbern in der Sonne Coruscants schimmerte. Wiege und Schmelztiegel der Demokratie zugleich stand es für alles, was richtig und gut war in der Galaxie. Yoda, der in den Anfängen der Republik geboren war und sich noch lebhaft an die Anfangsschwierigkeiten und Umwälzungen erinnerte, schätzte die symbolische Kraft dieses Gebäudes mit allem, was es repräsentierte, genauso sehr wie er seinen geliebten Jedi-Orden schätzte.
Das Silber jetzt aber etwas matter scheint. Nie zuvor in der Geschichte der Galaxie die Demokratie hat gewankt, wie sie wankt jetzt.
Das war ein grässlicher Gedanke. Nicht ein einziges Mal hätte er sich träumen lassen, Zeuge des Falls der großen galaktischen Republik zu werden. Alles starb irgendwann – das stimmte zwar. Aber irgendwie hatte er angenommen, dass die Republik davon ausgenommen sein würde. Er hatte geglaubt, dass sie sich entwickeln, wandeln, sich neu definieren, weiter bestehen würde.
Die Jedi waren durch Eid daran gebunden, dafür zu sorgen, dass sie das tat. Und jetzt starben sie, um diesen heiligen Schwur zu halten. Kein Opfer würde zu groß sein, um den Erhalt des Friedens und der Republik zu sichern. Es war undenkbar, dass diese Opfer vielleicht umsonst sein könnten …
Der Transponder der Fähre piepte, als das automatische Lotsensystem vom Tower des Senats ihr Signal erfasste, die Steuerung übernahm und sie zu ihrer Landeplattform brachte. Dabei handelte es sich um eine neue Sicherheitsmaßnahme, die von Palpatine eingeführt worden war, nachdem sich die Kriegslust der Separatisten vermehrt auf Planeten richtete, welche weniger stark verteidigt und überwacht wurden als Coruscant. Nicht jeder war über diesen Schritt erfreut, bedeutete er doch eine Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten.
Bemüht sich sehr, Palpatine, zu sorgen für Sicherheit und Freiheit gleichzeitig. Ein leichter Weg, den er beschreitet, ist das nicht.
Als ihre Fähre von der höhlenartigen Raumstation des Senatsgebäudes verschluckt wurde und sich in eine lange Reihe anderer eintreffender Luftschiffe einfädelte, räusperte sich Padawan T’Seely, und seine roten Kopfschuppen liefen scharlachrot an, was bei den Hasiki ein Zeichen für Sorge war.
»Meister Yoda?«, fragte er stockend.
»Sprich, Padawan.«
»Man hört Gerüchte im Tempel. Viele Tote auf Geonosis.«
Yoda seufzte. Das war zu erwarten gewesen, wenn die Verletzten heimkehrten. »Kein Gerücht, Padawan, sondern Tatsache.«
T’Seelys Kopfschuppen wurden ganz weiß. »Man hat mir erzählt … Meister Kenobi … Anakin …«
»Nicht tot sie sind, aber verletzt.«
»Oh.« T’Seelys Stimme war ein entsetztes Hauchen.
Yoda runzelte die Stirn. Bei den Jedi war es nicht üblich, einen Jedi-Ritter über einen anderen zu stellen, einen Schüler als besser zu bezeichnen als den nächsten. Aber im Falle von Obi-Wan und Anakin galten die gängigen Gepflogenheiten wohl einfach nicht. Anakin Skywalker war nach der Prophezeiung der Auserwählte, Obi-Wan sein Meister und sein Ruf vorzüglich. Zusammen schienen sie unbesiegbar. Zumindest hatten sie so gewirkt – bis Geonosis.
Aber er konnte es sich nicht leisten, jetzt darüber nachzudenken.
»Sterben sie nicht werden, Padawan«, erklärte er T’Seely mit fester Stimme. »Kein Gerede verbreiten über sie wirst du.«
»Nein, Meister Yoda«, versprach ihm der wieder gefasste T’Seely.
Ihre Fähre glitt weich in den für sie vorgesehenen Anlegeplatz. Überall um sie herum, so weit das Auge reichte, sah man andere Fähren in Erfüllung der endlosen Aufgaben für die Republik an- und ablegen. Yoda schickte T’Seely zum Tempel zurück und begab sich ins Innere des Senatsgebäudes. Durch ein verwirrendes Labyrinth von Gängen und Turboliften führte ihn sein Weg in den Verwaltungsabschnitt und die Büroräume des Obersten Kanzlers Palpatine.
Wie immer drohte einen das überladene Rot der Einrichtung zu erdrücken. Eine ungewöhnliche Farbwahl für einen so zurückhaltenden, bescheidenen Mann. Darauf angesprochen hatte Palpatine etwas verlegen gelacht. »Wenn ich an meine neuen Aufgaben denke, wird mir vor Angst ganz kalt«, hatte er erklärt. »Das Rot verschafft mir zumindest die Illusion von Wärme.«
Senator Bail Organa von Alderaan wartete in Palpatines ansonsten leerem Vorzimmer. Er trug nicht die von ihm sonst bevorzugte aufwändige Kleidung, sondern eine schlichte dunkle Tunika und Hosen, die einen eindeutig militärischen Schnitt aufwiesen. Vielleicht ein Hinweis auf die Zeiten, in denen sie sich im Moment befanden. Da er sowohl Mitglied im Loyalisten-Komitee war als auch an den Debatten, bei denen es um die Sicherheit der Republik ging, teilnahm, überraschte es nicht weiter, dass auch er aufgefordert worden war zu erscheinen.
»Meister Yoda!«, sagte er und sprang auf. »Was für ein Segen zu sehen, dass Ihr wohlbehalten von Geonosis zurückgekehrt seid.« Er hielt inne, und sein erleichtertes Lächeln verblasste. »Ist es wahr? Mir ist zwar zugetragen worden, dass wir siegreich waren, aber … viele Jedi gefallen sind?«
Yoda nickte. »Wahr es ist, Senator.«
»Oh«, sagte Organa und ließ sich wieder auf seinen Stuhl fallen. »Es tut mir sehr leid, das zu hören. Mein herzliches Beileid.«
Er war ein guter Mann und wirklich betroffen. »Danke.«
Organa zögerte, dann meinte er: »Die Klonkrieger, Meister Yoda … Waren sie kampftauglich?«
»Sehr kampftauglich, Senator. Ihr Eingreifen viel gebracht hat.«
»Nun, ich freue mich für die Jedi, das zu hören, trotzdem ist es in gewisser Hinsicht ärgerlich«, murmelte Organa. »Denn jetzt wissen die Separatisten, dass wir ein Instrument haben, mit dem wir ihnen beikommen können … sie schlagen können. Ich fürchte, Senatorin Amidala hatte doch recht. Sie werden die Bildung der Großen Armee der Republik als eindeutige Kriegserklärung auffassen. Jeder Versuch, diese Krise noch auf diplomatischem Wege zu lösen, wird von ihnen als reines Hinhaltemanöver betrachtet werden, ein Trick, uns Zeit zu verschaffen, damit wir unsere neuen Truppen zusammenziehen können.«
»Die Situation Ihr habt ganz richtig erfasst, Senator«, stimmte Yoda ihm grimmig zu. »Schatten der Krieg wirft überall voraus. Viel Leid ich sehe in den vor uns liegenden Monaten.«
Organa stand wieder auf und begann, im Vorzimmer auf und ab zu gehen. »Es muss einfach eine Möglichkeit geben, das zu verhindern, Meister Yoda. Ich weigere mich hinzunehmen, dass unsere große und edle Republik einfach so ohne Widerstand zu leisten in ein schreckliches Blutvergießen hineingezogen wird! Der Senat muss handeln. Er muss die gewalttätigen Ausschreitungen stoppen, ehe sie sich ausweiten. Wenn wir zulassen, dass Kummer und Wut über Geonosis uns zu Vergeltungsmaßnahmen greifen lässt, wenn wir anfangen zu meinen, dieser Tod rechtfertige einen anderen, dann sind wir wahrhaft verloren. Und die Republik ist dem Untergang geweiht.«
Ehe Yoda darauf etwas erwidern konnte, öffneten sich die Türen zu Palpatines Büro, und Mas Amedda trat ins Vorzimmer.
»Meister Yoda, Senator Organa«, begrüßte er sie höflich. »Der Oberste Kanzler möchte Sie jetzt sehen.«
Zwei
Palpatine stand am Transparistahl-Fenster hinter seinem Schreibtisch und beobachtete mit ernster Miene den endlos verschlungenen Verkehr, der sich durch Coruscant zog. Er drehte sich um, als er sie hereinkommen hörte, und lächelte ernst.
»Meister Yoda. Mir fehlen die Worte, um meiner grenzenlosen Erleichterung Ausdruck darüber zu verleihen, dass Ihr das Massaker auf Geonosis überlebt habt. Es wäre mir noch nicht einmal im Traum eingefallen, dass die Separatisten wegen solch geringfügiger Unstimmigkeiten mit der Republik zu solch extremen, herzzerreißenden Maßnahmen greifen könnten.«
»Überrascht auch ich bin, Oberster Kanzler«, erwiderte Yoda. »Nicht vorauszusehen war diese Entwicklung.«
Palpatine kehrte zu seinem Stuhl zurück. »Nicht vorauszusehen, ja«, murmelte er, während Mas Amedda seinen Platz zur Rechten von Palpatine einnahm. »Und auch von den Jedi nicht. Das bereitet Euch bestimmt auch Sorge.« Er beugte sich vor, und auf seinem Gesicht lag ein gespannter Ausdruck. »Meister Yoda, ehe wir im Einzelnen darüber sprechen, was auf Geonosis vorgefallen ist, muss ich eins wissen: Wie geht es meinem jungen Freund Anakin? Ich war sehr in Sorge, als ich hörte, dass er verletzt worden ist.«
»Verletzt, ja, Oberster Kanzler«, sagte Yoda. »Sterben aber wird er nicht.«
Palpatine setzte sich wieder auf und fuhr sich mit leicht bebender Hand übers Gesicht. »Wahrhaftig! Die Macht schützt ihn.« Die Stimme versagte ihm, und er zitterte. »Es tut mir leid. Ihr müsst mir meinen Gefühlsausbruch verzeihen. Anakin bedeutet mir sehr viel. Ich kenne ihn, seit er ein kleiner Junge war, habe ihn aufwachsen und zu einem wunderbaren jungen Mann werden sehen, der so tapfer, so stark ist und dem Jedi-Orden so viel Ehre macht – und deshalb liegt mir sein Wohlergehen so am Herzen. Ich hoffe …« Er stockte. »Ich hoffe, Ihr betrachtet meine Sorge um ihn – meine Zuneigung – nicht als Einmischung, Meister Yoda. Denn natürlich liegt mir nichts ferner, als Anakins Fortkommen als Jedi im Wege zu stehen.«
Yoda sah zu Boden, während er mit beiden Händen seinen Gimerstock umklammerte. Es war nicht leicht, etwas darauf zu erwidern. Ja, ihm bereitete Palpatines Zuneigung zu dem Jungen Sorge. Wie gut gemeint, wie ehrlich und von Herzen kommend sie auch sein mochte, so war das Verhältnis des Obersten Kanzlers zu Obi-Wans Schüler doch problematisch. Alle Schwierigkeiten, die Skywalker hatte, beruhten auf seinem Bedürfnis nach emotionalen Bindungen. Seine Freundschaft mit Palpatine machte alles nur noch komplizierter. Aber der Mann war nun einmal der Oberste Kanzler. Und er meinte es gut.
Manchmal musste Politik vorgehen.
»Einmischung, Oberster Kanzler? Nein«, sagte er. »Euer Interesse der junge Skywalker schätzt.«
»So wie ich ihn schätze, Meister Yoda«, sagte Palpatine. »Ich frage mich …« Palpatine legte eine taktvolle Pause ein. »Dürfte ich wohl erfahren, was für Verletzungen er davongetragen hat?«
Yoda warf einen Blick auf Bail Organa, der bisher noch nicht einmal begrüßt worden war. Ob es ihn wohl störte? Sollte es der Fall sein, so war er ein Meister darin, seine Gefühle zu verbergen.
Ein guter Mann er ist. Loyal und diskret. Trotzdem Jedi-Angelegenheiten ich vor ihm würde lieber nicht besprechen. Aber die Antwort Palpatine zu verweigern, ich kann auch nicht.
Er tippte mit den Fingern auf seinen Gimerstock und nickte dann. »Seinen rechten Arm der junge Skywalker hat verloren. Bei einem Lichtschwert-Duell er wurde abgetrennt.«
»Bei einem Duell?«, wiederholte Palpatine ungläubig. »Mit wem? Wer könnte denn so unbesonnen sein, bei Anakin sein Lichtschwert zu ziehen? Wer in der ganzen Galaxie besitzt denn überhaupt das Geschick und die Erfahrung, um einen Jedi mit seinen Fähigkeiten zu schlagen?«
Und wieder war da dieser unangenehm stechende Schmerz, den Bedauern und das Gefühl versagt zu haben hervorriefen. Yoda zwang sich, Palpatines entsetzten Blick unerschütterlich zu erwidern. »Count Dooku es war, Kanzler. Wahr sind die ersten Berichte, die wir von Meister Kenobi erhielten. Zu einem Feind der Republik Count Dooku ist geworden.«
Palpatine drehte sich zu Mas Amedda um, der die Hände vor Entsetzen erhoben hatte. Dann schaute er wieder zurück. Seine Lippen waren aufeinandergepresst, und seine Augen schimmerten vor Kummer. »Meister Yoda, ich weiß kaum, was ich sagen soll. Count Dooku hat den Jedi-Orden verraten. Er hat uns alle verraten. Ich verstehe das nicht. Wie hat er etwas so Böses tun können?«
Yoda runzelte die Stirn. Über die Sith würde er vor Bail Organa ganz gewiss nicht reden. »Der Traum von Macht Dooku verführt hat. Eine schreckliche Tragödie das ist.«
Palpatine stieß einen schmerzerfüllten Seufzer aus. »Erzählt mir nun auch den Rest, Meister Yoda. Ich weiß zwar, dass es mir das Herz brechen wird, aber ich muss hören, was sich auf Geonosis zugetragen hat.«
Das war eine Geschichte, die schnell erzählt war und ohne Ausschmückungen oder Emotionen vorgetragen wurde. Als Yoda fertig war, stand Palpatine wieder auf, um durch das Fenster aus Transparistahl nach draußen in den wimmelnden Himmel von Coruscant zu schauen. Die Hände hatte er hinter dem Rücken verschränkt, und das Kinn war auf die in Samt und Brokat gehüllte Brust gesunken.
»Wisst Ihr was, mein Freund«, meinte er schließlich und brach damit das drückende Schweigen. »Es gibt Momente, da zweifele ich daran, dass ich die Kraft habe weiterzumachen.«
»Sagt so etwas nie!«, rief Mas Amedda. »Ohne Eure Führung könnte die Republik nicht überleben!«
»Vielleicht stimmte das früher einmal«, gestand Palpatine ein. »Aber wenn ich als Oberster Kanzler so schrecklich versage, dass die verblendeten, dummen Separatisten dazu ermutigt werden, uns so einen Schlag zu versetzen …«
»Oberster Kanzler, Ihr seid Euch selbst gegenüber zu hart«, warf Bail Organa schnell ein. »Wenn hier einer die Schuld trägt, dann dieser verräterische Count Dooku und die Anführer der verschiedenen Gilden und Verbände, die ihn unterstützen und Ereignisse und schwächere, einfältigere Systeme zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Sie sind diejenigen, die die Republik im Stich gelassen haben, nicht Ihr. Das Blut, das auf Geonosis vergossen wurde, klebt an ihren Händen, nicht an Euren. Von Anbeginn dieses Streits habt Ihr Euch bemüht, eine friedliche Lösung zu finden.«
»Und ich habe versagt!«, erwiderte Palpatine und wirbelte herum. »Wer weiß besser als ich, Bail, wie wichtig es ist, dass die Gewalt ein Ende hat? Ich – ein Mann, dessen Heimatplanet angegriffen wurde und der hilflos mit ansehen musste, wie ein unfähiger Oberster Kanzler und ein hinhaltender Senat zuließen, dass die Menschen, die sie geschworen hatten zu beschützen, aufgrund der Gier der Handelsföderation starben. Zehn Jahre sind seit dieser schrecklichen Zeit vergangen, aber haben sich die Umstände geändert? Nein, das haben sie nicht! Zwar stehe ich nun als Oberster Kanzler der Republik vor Euch, aber ich bin immer noch hilflos. Wir stehen der größten Bedrohung in unserer Geschichte gegenüber. Bürger der Republik sterben, Jedi sterben, weil ich nicht rechtzeitig gehandelt habe, um diese Tragödie zu verhindern.«
»Das stimmt nicht«, erwiderte Organa. »Die einzige Person, die die Macht gehabt hätte, die Tragödie zu verhindern, war Dooku. Doch er entschied sich stattdessen, eine Gräueltat zu begehen. Euch trifft keine Schuld, Oberster Kanzler. Wir schulden Euch Dankbarkeit dafür, dass Ihr den Mut hattet, den schweren, aber notwendigen Schritt zu tun, die Klonarmee in Auftrag zu geben. Ohne diese Armee wären Meister Yoda und seine Jedi bis auf den letzten Mann abgeschlachtet worden. Und was würde dann aus der Republik werden?«
Langsam ließ Palpatine sich auf seinen Stuhl sinken. »Ich muss gestehen, Ihr überrascht mich, Bail. Unter Berücksichtigung Eurer engen Beziehung zu Senatorin Amidala war ich mir gar nicht sicher, ob Ihr mit meiner Entscheidung einverstanden wart.«
Organa wirkte betroffen. »Es stimmt, dass ich die Senatorin von Naboo bewundere und ihr großen Respekt entgegenbringe«, meinte er. »Seit ich mit ihr zusammen im Loyalisten-Komitee tätig war, habe ich ihre einzigartigen Qualitäten zu schätzen gelernt. Aber ich war immer der Meinung, dass die Republik verteidigt werden muss – trotz der sehr realen Gefahr, die das mit sich bringt.«
»Und ich weiß Eure nicht erlahmende Unterstützung sehr zu schätzen«, erwiderte Palpatine. Ein bedrücktes, leichtes Lächeln lag auf seinem Gesicht. »Insbesondere da ich Euch bitten muss, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Senator Organa, ich habe das Gefühl, dass das Loyalisten-Komitee seinen Zweck erfüllt hat. Wir brauchen jetzt ein neues Komitee, eines, das über alle Angelegenheiten wacht, die die Sicherheit der Republik betreffen. Ihr solltet diesem Komitee als Vorsitzender angehören sowie drei oder vier Senatoren, denen Ihr absolut vertraut. Werdet Ihr Euch darum kümmern? Werdet Ihr die Aufgabe übernehmen?«
Organa nickte. »Natürlich, Oberster Kanzler. Ich fühle mich geehrt, dass Ihr mich fragt.«
»Hervorragend«, sagte Palpatine mit ernster Miene. »Und Meister Yoda, sobald Ihr Euch um die Jedi-Angelegenheiten gekümmert habt, müssen wir – Ihr, Eure Gefährten aus dem Hohen Rat und ich – ein formelles Kriegskomitee einberufen, um so eine schnelle und endgültige Lösung für diese unangenehme Situation zu finden. Zum Wohle der Republik müssen wir aus diesem Konflikt als Sieger hervorgehen.«
Yoda runzelte die Stirn. Die Jedi sollten noch tiefer in Regierungsangelegenheiten hineingezogen werden? Das war das Letzte, was er wollte. Aber Palpatine hatte in einer Sache recht. »Mit Euch übereinstimme ich, Oberster Kanzler. Schnell beendet werden muss dieser Krieg und angestrebt werden Frieden.«
»Dann will ich Euch nicht länger aufhalten«, sagte Palpatine und erhob sich. »Ich danke Euch, dass Ihr so umgehend zu mir gekommen seid, da ich doch weiß, dass Ihr es gewiss vorziehen würdet, bei Euren verwundeten Jedi zu sein. Bitte, sagt Anakin, wenn Ihr ihn seht, dass ich in meinen Gedanken bei ihm bin.«
»Natürlich, Oberster Kanzler«, erwiderte Yoda. »Und mich zu Euch zu rufen, zögert nicht, wenn von Nutzen ich sein kann.«
Palpatine lächelte. »Zweifelt nicht einen Moment daran, Meister Yoda. Glaubt mir, wenn ich sage, dass Ihr und die Jedi von meinen Plänen nie weit entfernt seid.«
Die Audienz beim Obersten Kanzler war beendet, und Yoda und Bail Organa verließen Palpatines Büro. Yoda dachte an den langen Marsch zur Raumstation und unterdrückte einen Seufzer, während er bedauerte, dass er seinen mit Repulsorlift-Antrieb versehenen Schwebestuhl nicht dabeihatte.
»Ich reise jetzt auch ab«, sagte Organa. »Kann ich Euch zum Jedi-Tempel zurückbringen, Meister Yoda?«
»Ein freundliches Angebot das ist«, erwiderte Yoda mit einem Nicken. »Annehmen ich es. Viel zu tun dort habe ich. Zeit vergeuden ich nicht will.«
Und leider stand ganz oben auf seiner Liste ein Gespräch mit Obi-Wan Kenobi, das bestimmt nicht einfach werden würde.
Kaum war er in den Hallen des Heilens im Tempel eingetroffen, wurde er auch schon aufgefordert, sich mit Meisterin Vokara Che in ihren Privatgemächern zu treffen.
»Meister Yoda«, empfing ihn die hochgeschätzte Twi’lek und lächelte ihn freundlich mit wachsamem, zurückhaltendem Blick an. »Es ist eine große Erleichterung zu sehen, dass Ihr unversehrt seid. Ich habe gehört, Ihr habt Euch mit Dooku duelliert. Es ist lange her, dass Ihr Euer Lichtschwert im Kampf gezogen habt.«
Er zuckte leicht mit einer Schulter. Er war erschöpft, doch das würde vorbeigehen. »Unversehrt ich bin, Vokara Che. Sorgen Ihr braucht Euch nicht zu machen. Von unseren verletzten Jedi erzählt mir. Wie geht es ihnen?«
»Die meisten sind geheilt oder gerade im Heilungsprozess. Anakin war am schwersten betroffen. Wir haben ihn in eine tiefen Heiltrance versetzt, um dem Schock seiner Verletzung entgegenzuwirken, während letzte Feinheiten an seiner Armprothese vorgenommen wurden. Leider war es durch die Schwere des durch das Lichtschwert verursachten Schadens an seinem Unterarm nicht möglich, die Gliedmaße wieder anzubringen. Doch ich gehe davon aus, dass er sich wieder vollständig erholen wird. Obwohl er anfangs bestimmt Gewöhnungsprobleme haben wird.«
Eine Armprothese. Yoda spürte, dass er plötzlich sehr niedergeschlagen war, obwohl er schon damit gerechnet hatte, dies zu hören. Wie stark ein Jedi mit der Macht verbunden war, wurde von der Menge der Midi-Chlorianer in seinem Blut bestimmt. Es war bekannt, dass der Verlust einer Gliedmaße Einfluss auf die Macht eines Jedi hatte. Anakin Skywalker hatte zwar mehr Midi-Chlorianer als je ein Jedi zuvor, aber trotzdem …
»Zu ihm gehen, ich werde jetzt«, sagte er bedrückt. »Und zu Obi-Wan auch.«
Vokara Che runzelte die Stirn, und ihre Lekku zuckten leicht. »Ja. Natürlich. Meister Yoda … Was Obi-Wan betrifft …«
»Nichts zu sagen Ihr braucht, Vokara Che. An Skywalkers Verletzung er gibt sich die Schuld.«
Sie beiden kannten Obi-Wan seit früher Kindheit. Sie nickte mit wehmütiger Miene. »Haben wir etwas anderes bei ihm erwartet?«
Hatten sie nicht, dachte Yoda. Kein anderer Jedi hätte die beängstigende Aufgabe übernommen, Anakin Skywalker so ernsthaft auszubilden wie Obi-Wan Kenobi. Mit der Bürde eines Versprechens belastet, das er einem Sterbendem gegeben hatte, dem Wissen, dass er ein Kind der Prophezeiung ausbildete, der ständigen Furcht, er könnte einen Fehler machen und Qui-Gon enttäuschen, verging kein Tag, an dem Obi-Wan nicht einen Weg fand, sich Anakins Fehler und Misserfolge zu eigen zu machen.
Mit einem Seufzer glitt Yoda von seinem Stuhl. »Mit Obi-Wan sprechen ich werde.«
Vokara Che lächelte erleichtert und stand auf. »Gut.« Dann verblasste das Lächeln. »Doch da ist noch eine Sache …« Sie räusperte sich. »Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr es wisst, aber Senatorin Amidala hat Obi-Wan und seinen Schüler hierherbegleitet. Wir haben sie natürlich behandelt, aber vorher kam es zu einer gewissen … Unstimmigkeit. Sie machte sich große Sorgen um Anakin. Bestand darauf, ihn zu sehen. Es kam zu einem hitzigen Disput, als ich es ihr verweigerte. Möglicherweise wird sie eine offizielle Beschwerde einreichen. Es tut mir leid.«
Yoda spürte, wie er noch niedergeschlagener wurde. Senatorin Amidala. Noch ein Problem, noch ein Geheimnis, noch ein Teilchen, das zum Puzzle Anakin Skywalker gehörte.
Es war ein Kraftakt, sich von Sorgen und Gedanken frei zu machen. »Sorgt Euch nicht, Vokara Che. Jetzt zu dem jungen Skywalker bringt mich bitte. Dann mit Meister Kenobi ich werde sprechen.«
Die immer schwächer werdenden Schmerzen seiner Lichtschwertwunden waren nunmehr nur noch eine Erinnerung, und Obi-Wan schritt in seinem beengten Heilzimmer auf und ab, während er die schwer errungene Disziplin verfluchte, die ihn daran hinderte, zum nächsten Heiler zu stürzen, um diesen dazu aufzufordern, ihm sofort zu zeigen, wo Anakins Zimmer lag.
»Meister Kenobi«, sagte eine vertraute, strenge Stimme. Yoda. Er drehte sich um.
»Euer Padawan schläft«, sagte Yoda, der in der offenen Tür stand. »Schmerzen er hat jetzt keine mehr. Setzt Euch, damit wir können reden.«
Yoda nicht zu gehorchen, war undenkbar. Obi-Wan ließ sich im Schneidersitz auf dem Boden nieder und legte die Hände im Schoß zusammen.
»Vergebt mir, Meister«, murmelte er. »Ich habe nicht die volle Kontrolle über meine Gefühle.«
»Nötig habe ich es, dass Ihr mir das sagt?«, fragte Yoda. »Ich glaube, das ich nicht habe.«
Der Verweis war zwar scharf, doch es schwang ein gewisser trockener Humor darin mit. Obi-Wan riskierte seinen Blick und stellte fest, dass in Yodas Miene nicht nur Missbilligung lag. Eine gewisse Milde war in seinen strahlenden Augen zu erkennen.
»Vergebt mir«, sagte er noch einmal. »Ich wollte nicht respektlos erscheinen.«
»Hm«, machte Yoda, und wieder pochte er mit seinem Gimerstock auf den Boden. »Dass Ihr geheilt seid, freut mich zu sehen, Meister Kenobi, denn zu Euren Pflichten Ihr müsst zurückkehren. Viel es gibt zu tun, wenn Krieg droht.«
Obwohl es ihm vielleicht noch einen viel härteren Tadel einbringen mochte, musste Obi-Wan das Wort ergreifen. »Meister Yoda, mein Platz ist hier bei Anakin. Meinetwegen wurde er verwundet.«
»Wegen Dooku er wurde verwundet«, entgegnete Yoda. »Und weil ungehorsam er Euch war. Kein Kind Anakin Skywalker ist mehr. Ein Mann er ist jetzt, und wie ein Mann er muss handeln. Seine Fehler er muss akzeptieren und sie wiedergutmachen.«
»Ich glaube, Anakin hat sie wiedergutgemacht, Meister Yoda. Er wurde verstümmelt. Er wäre fast gestorben.«
»Und Euer Fehler es war nicht!«
Es hätte etwas an der Sache ändern sollen, Meister Yoda das sagen zu hören. Es hätte ihn die drückende Last aus Trauer und Schuld ein bisschen leichter werden lassen sollen. Doch das tat es nicht. Nichts schaffte das. Nichts konnte etwas daran ändern.
Anakin ist mein Padawan. Es ist meine Pflicht, ihn zu beschützen.
»Vor ihm selbst Ihr könnt ihn nicht beschützen, Obi-Wan«, sagte Yoda sanft. »Vor Euch selbst schützen hätte Qui-Gon gekonnt, wenn Fehler Ihr macht, als sein Schüler Ihr wart?«
Es war so lange her, und er dachte so selten daran. »Lernen auch wird Euer Schüler. Eine Aufgabe ich habe für Euch, Obi-Wan. Erledigt sie ist, Ihr könnt zurückkehren hierher.«
Obi-Wan nickte. »Danke, Meister.«
Doch statt die Aufgabe nun im Einzelnen zu erklären, begann Yoda im kleinen Raum auf und ab zu gehen, wobei das Pochen seines Gimerstocks in der Stille laut zu hören war. »Ihr wisst, Obi-Wan, warum zögerte ich, dass Euer Schüler Skywalker wurde?«
Wusste er es? Er war sich nicht sicher. Und nachdem er und Qui-Gon sich beim Rat durchgesetzt hatten und Anakin sein Padawan geworden war, hatten Yodas Vorbehalte keine Rolle mehr gespielt.
»Äh … nein, Meister«, antwortete er vorsichtig.
Yoda bedachte ihn mit einem kurzen skeptischen Blick. »Hm. Dann Euch ich werde sagen. Zögerte ich, weil er den gleichen Makel aufweist wie Ihr, Obi-Wan. Die Neigung zu Bindung.«
Was? »Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz.«
Yoda stieß ein Schnauben aus. »Doch, Ihr versteht. Euer Versprechen Qui-Gon Jinn gegenüber, dass Anakin Ihr ausbildet, von Bindung es rührte her. Große Zuneigung Ihr empfandet für ihn. Große Zuneigung für Anakin Skywalker Ihr empfindet. Tief Eure Gefühle sind, Obi-Wan. Ganz Herr über Eure Gefühle Ihr nicht seid. Über seine Gefühle der junge Skywalker ist auch nicht Herr. Den Verdacht ich habe, dass Ihr mit ihm in Bezug auf Bindung nicht immer streng gewesen seid.«
Das stimmte. Er war es nicht gewesen. Weil Anakin nicht wie andere Padawane war. Anakin erinnerte sich an seine Mutter. Mehr noch – er war mit ihr verbunden. Ihr Band war in frühester Zeit geknüpft worden und nicht leicht zu zerreißen. Aber der Hohe Rat hatte dies gewusst, als er zugestimmt hatte, dass Obi-Wan ihn ausbildete, und so schien es ihm eigentlich unfair, ihn dafür zu kritisieren. Genauso unfair, wie ihm dabei nicht ein bisschen Spielraum einzuräumen. Zumindest in einem Punkt hatte Yoda recht: Er verstand etwas von Bindungen.
»Wegen der Bindung zu seiner Mutter«, fuhr Yoda mit ernster Miene fort, »nach Tatooine der junge Skywalker ging und Eurem direkten Befehl sich damit widersetzte.«
Obi-Wan starrte ihn an. »Ich … wir … Er hat mir nicht gesagt, warum er Naboo verließ. Es war keine Zeit darüber zu sprechen. Auf Geonosis ging alles zu schnell.«
»Etwas zugestoßen ist Shmi Skywalker, ich fürchte«, sagte Yoda leise.
»Was?«
»In der Macht ich spürte den jungen Skywalker. Großer Schmerz. Große Wut. Eine schreckliche Tragödie.«
O nein. »Er hat mir nichts davon erzählt, Meister Yoda. Er hätte es mir bestimmt erzählt, wenn seiner Mutter etwas widerfahren wäre.«
Er hätte es mir doch erzählt? Oder hätte ich es nicht gespürt?
Doch er war so wütend auf Anakin gewesen, so enttäuscht und niedergeschlagen. Von dem eklatanten Ungehorsam des Jungen. Dass er sich hatte gefangen nehmen lassen. Dass er Padmé mit hineingezogen hatte. Und so war er abgelenkt gewesen, seine Sinne von seinen Gefühlen beeinträchtigt, als sie einander in der Arena von Geonosis gesehen hatten.
Wieder einmal von Bindungen geschwächt.
»Hm«, meinte Yoda, der immer noch auf und ab ging. Dann blieb er stehen, und er sah Obi-Wan unter halb gesenkten Lidern an. Sein Mund war in einer Weise verzogen, die jeden sensiblen Jedi wachsam sein ließ. Er stieß mit dem Gimerstock einmal kräftig auf den Boden auf. »Senatorin Amidala. Um die Gefühle Eures Padawan für sie Ihr wusstet?«
Obi-Wan ließ seinen Blick auf seine Hände sinken, die immer noch ineinanderliegend auf seinem Schoß ruhten. »Ich … weiß, dass er sie als kleiner Junge sehr bewunderte. Als wir den Auftrag bekamen, sie zu beschützen, merkte ich, dass er seine Bewunderung für sie nicht vergessen hatte.« Er schaute auf. »Meister, ich ermahnte ihn, dass der Weg, den er gewählt hat, alles verbietet, was über ein herzliches Verhältnis zwischen den beiden hinausgeht.«
Yodas Augen wurden noch kleiner. »Eure Mahnung, Obi-Wan, er beachtete nicht.«
Obi-Wan spürte, wie sein Herz pochte. Yoda wusste Bescheid. Über die furchtbare Auseinandersetzung mit Anakin auf dem Kanonenboot, als sie Dooku verfolgt hatten und ihrem Schicksal entgegengeflogen waren. Über Anakins heftiges Beharren darauf, die Rettung Padmés über die Pflicht zu stellen. Yoda wusste Bescheid.
»Während Anakin schläft, Ihr werdet zu Senatorin Amidala gehen«, fuhr Yoda fort. »Beendet werden muss seine Beziehung zu ihr, ehe daraus noch mehr Schwierigkeiten erwachsen. Mehr als alle anderen Ihr wisst das, Obi-Wan.«
Siri. Alter Schmerz, der ihn plötzlich durchzuckte und rasch verdrängt wurde. Ein anderes Leben. Ein anderer Obi-Wan. Yoda hatte recht. Anakins Bindung zu Padmé durfte nicht weiterhin bestehen. Sie hatte sich bereits als gefährliche Ablenkung erwiesen.
Ich habe den Verlust überlebt. Anakin wird es auch überleben.
Das einzige Problem an der Sache war nur …
Wie sie zu Anakin gerannt war, der in der Arena so schwer verletzt worden war. Die Zärtlichkeit in ihren Augen, ihre Berührung. Die wilde Entschlossenheit, mit der sie ihn auf dem Flug nach Coruscant beschützt hatte. Wie sie ihren eigenen Schmerz ignoriert hatte, um seinen Schmerz zu lindern. Und wie sie hier im Tempel darum gekämpft hatte, ihn zu sehen.
»Meister Yoda, ich fürchte, das Ganze ist nicht so einfach«, äußerte er vorsichtig. »Ich glaube, Anakins Gefühle werden erwidert. Wahrscheinlich wird mir Senatorin Amidala die Einmischung in ihre Privatangelegenheiten übel nehmen.«
»Privatangelegenheiten?« Yodas Ohren hoben sich, während seine Augen auf einmal ganz groß wurden. »Privat nichts ist, wenn es dabei um einen Jedi geht. Unwichtig sind ihre Gefühle, Obi-Wan. Diese Beziehung Ihr werdet beenden.«
Obi-Wan nickte. »Ja, Meister«, sagte er und war wieder ganz der vollkommen beherrschte und ruhige Jedi. Doch unter der Oberfläche gärte der Zweifel.
»Geht jetzt, Obi-Wan«, sagte Yoda. »Zu warten nichts bringt.«
»Ja, Meister«, sagte er wieder.
Denn letztendlich hatte er gar keine andere Wahl.
Drei
Obwohl es noch früher Abend war, lag Padmé in ihrem abgedunkelten Zimmer und suchte seliges Vergessen im Schlaf. Leider weigerte der Schlaf sich aber hartnäckig sich einzustellen.
Ich sagte Anakin, dass ich ihn liebe, weil ich dachte, wir würden sterben. Aber wir haben überlebt – und jetzt gibt es kein Zurück. Mein Herz gehört ihm. Wir gehören zueinander bis ans Ende des Lebens.
Unruhig wälzte sie sich unter den dünnen Laken und quälte sich mit der Erinnerung daran, wie sie in den geheimen Hangar auf Geonosis gelaufen war, wo er den Kampf gegen Dooku verloren hatte und so furchtbar verstümmelt worden war. Sie wand sich, wenn sie nur daran dachte, wie sein abgetrennter Arm im Schmutz gelegen hatte. Sie litt bei der Vorstellung, dass ihm solch eine schreckliche Verletzung so kurz nach der brutalen Ermordung seiner Mutter zugefügt worden war und was sich dann ereignet hatte.
Und weil sie nicht allein gewesen waren, sondern auch Obi-Wan und der wirklich hervorragende Yoda, hatte sie ihn nicht küssen oder um ihn weinen können. Mehr als eine Umarmung war ihr nicht erlaubt gewesen. Yodas Klonkrieger hatten sie zur Seite treten lassen, damit sie ihn hochnehmen, ins Kanonenboot tragen und später an Bord des Raumschiffes helfen konnten, das sie nach Hause brachte.
Das war der schlimmste Schmerz von allen gewesen.
Es läutete an ihrer geschlossenen Tür. Was? Mit einem ärgerlichen Seufzer zog sie sich einen Hausmantel über und öffnete die Tür. »Dreipeo, ich hatte doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will.«
»Oh, Miss Padmé, bitte vergebt mir«, sagte der aufgeregte Droide. »Ich habe versucht, ihn zum Weggehen zu bewegen, aber er beharrt darauf, ist fast schon grob, gar nicht wie er selbst und …«
»Von wem sprichst du? Wer ist da?«
»Na, Meister Kenobi«, erwiderte C-3PO. »Und er sagt, er würde erst wieder gehen, wenn er mit Euch gesprochen hat.«
Irgendetwas musste passiert sein. Anakin. »Sag ihm, dass ich gleich komme«, trug sie dem Droiden mit trockenem Mund auf. »Biete ihm etwas an. Ich brauche nicht lange.«
Kaum hatte sich die Tür hinter dem Droiden geschlossen, schlüpfte sie aus ihrem Nachtgewand und zog ein schlichtes, aber elegantes blaues Kleid an. Kleidung war wie Rüstzeug. Wenn er ihr schlechte Nachrichten überbrachte … Wenn Anakin … Sie wollte ihm nicht mit dem kleinsten Nachteil auf ihrer Seite gegenübertreten.
Aber Anakin ist nicht tot. Wäre er tot, würde ich es wissen.
Obi-Wan wartete im Wohnzimmer auf sie. Seine gepflegte Kleidung bestand aus einer frischen Jedi-Tunika und Beinkleidern. Er stand fest auf beiden Beinen, und sein Gesicht war nicht mehr bleich und verzerrt vor Schmerzen. Heiler hatten sich um die Lichtschwertwunden gekümmert, die ihn hilfloser gemacht hatten, als sie je für möglich gehalten hätte.
»Obi-Wan«, begrüßte sie ihn. »Seid Ihr hier, um mich zum Tempel zu begleiten? Darf ich Anakin jetzt sehen?«
Die Hände vor dem Körper locker ineinandergelegt, neigte er kurz den Kopf. »Nein, Senatorin Amidala. Ich fürchte, das ist nicht möglich.«
Senatorin. Nicht Padmé. Und sein ganzes Auftreten steife Förmlichkeit.
»Ich verstehe«, sagte sie und war dabei auf der Hut. »Hätte in dem Fall angesichts der vergangenen Ereignisse Euer Botengang nicht warten können? Ich bin müde. Ich muss mich ausruhen.«
»Ich bin mir dessen bewusst, Senatorin«, erwiderte er. »Und es tut mir leid, dass ich Euch störe. Aber nein, die Sache kann nicht warten.«
Ach ja? Nun, das hatte er nicht zu entscheiden, oder? Dies war ihr Zuhause. Hier herrschten ihre Regeln. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Habt Ihr Anakin gesehen?«
Falls er sich ärgerte, zeigte er es zumindest nicht. »Er ruht sich aus. Es gibt nichts, worüber Ihr Euch Sorgen machen müsstet.«
Er war so gelassen. So völlig gleichgültig. Jeder hätte angenommen, dass er nur von irgendeinem Bekannten sprach. Doch sie wusste es besser.
C-3PO kehrte mit Karlini-Tee zurück. Obi-Wan schüttelte den Kopf. »Nein, danke.«
Sie nahm einen Becher, aber wohl eher, um sich abzulenken, als dass sie Appetit darauf hatte. Dann entließ sie den Droiden, den Anakin gebaut hatte, mit einem Nicken. »Das ist alles. Ich rufe dich, wenn ich dich wieder brauche.«
Als sich die Tür hinter 3PO geschlossen hatte, drehte sie sich wieder zu Obi-Wan um. »Warum seid Ihr hier?«
Er zögerte erst, dann seufzte er und ließ von seiner unangebrachten Zurückhaltung ab. »Weil wir miteinander reden müssen, Padmé.«
Sie spürte, wie ihr Herz anfing zu pochen. »Ich verstehe. Nun, wenn wir miteinander reden wollen, sollten wir es uns bequem machen.« Sie deutete auf das Sofa und die Sessel. »Bitte, setzt Euch.«
Wieder zögerte er, um dann jedoch zu nicken. »Danke«, sagte er und ließ sich in einen Sessel sinken.
Sie setzte sich ihm gegenüber auf das Sofa und musterte ihn über den Rand ihres Bechers hinweg. Den Rücken hielt er gerade, doch die Schultern waren etwas nach vorn geneigt, als würde er mit Schwierigkeiten rechnen, vielleicht mit einem Angriff. Und überraschenderweise schienen ihm plötzlich die Worte zu fehlen.
Na gut. Dann werde ich eben den ersten Schritt tun.
Sie stellte ihren Becher auf dem kleinen Tischchen ab, das neben ihr stand. »Obwohl Ihr Euch Sorgen um Anakin macht – und ich weiß, dass Ihr das tut, also gebt hier nicht den stoischen Jedi, seid Ihr im Moment wahrscheinlich nicht sonderlich zufrieden mit ihm, kann ich mir vorstellen. Aber Ihr solltet eins wissen, Obi-Wan – er widersetzte sich seinen Befehlen nicht leichtfertig.«
Überrascht sah er sie an. Dann verzog er das Gesicht. »Auf welchen Moment bezieht Ihr Euch? Als er von Naboo nach Tatooine aufbrach oder von Tatooine nach Geonosis?«
»Beide Male. Obi-Wan, egal, was Ihr auch denken mögt – er nimmt es sehr ernst, ein Jedi zu sein. Das ist das Einzige, wovon er redet. Dass er ein Jedi ist und Euch nicht enttäuschen will. Er …«
Doch Obi-Wan hörte ihr nicht zu. Sein Blick, der in die Ferne ging, hatte sich umwölkt, und seine Miene war grimmig. Und dann schaute er sie wieder an. »Was ist mit Anakins Mutter passiert, Padmé?«
Die Frage versetzte ihr einen Schock. Ihr war nicht klar gewesen, dass er wusste, dass irgendetwas nicht stimmte. »Was passiert ist? Sie ist gestorben.«
Und das versetzte ihm einen Schock. Gut.
»Was meint Ihr damit ›Sie ist gestorben‹?«, fragte er und klang erschüttert. »Wie? Und wo war Anakin? Was …«
Sie hielt eine Hand hoch, um der Flut seiner Fragen Einhalt zu gebieten. Es stand ihr nicht zu, mit diesem Mann über Shmi Skywalkers Tod zu sprechen. Weder über ihren Tod – noch darüber, was hinterher mit den Sandleuten geschehen war.
»Es tut mir leid. Wenn Ihr mehr wissen wollt, müsst Ihr Anakin fragen.«
Es war Obi-Wan anzumerken, dass ihm diese Antwort nicht gefiel, aber er war schlau genug, nicht weiter zu drängen. »Ich kann ihm verzeihen, dass er nach Tatooine ging, wenn … wenn seine Entscheidung vom Schicksal seiner Mutter beeinflusst wurde«, sagte er. »Doch nach Geonosis zu fliegen, war vorsätzlicher Ungehorsam. Er …«
»Nein, Obi-Wan. Das war meine Entscheidung, nicht seine.«
»Eure?«
»Ja. Anakin wollte Euch vor den Separatisten retten, und er wollte Meister Windu gehorchen. Da nun aber offensichtlich nicht beides gleichzeitig möglich war, traf ich die Entscheidung für ihn. Und zwar die, die er gern getroffen hätte, aber vor der er aufgrund der Konsequenzen Angst hatte. Denn wofür er sich auch entschieden hätte, es wäre immer falsch gewesen.«
Obi-Wan sah sie mit gerunzelter Stirn an. »Den direkten Befehl vom Hohen Rat der Jedi zu befolgen, ist nie falsch, Senatorin. Einem Befehl nicht zu gehorchen, das ist der Fehler.«
»Qui-Gon hat sich ziemlich häufig über den Rat hinweggesetzt«, entgegnete sie. »Das erzählte er mir auf Tatooine. Er sagte, es wäre die größte Dummheit, sich statt auf das eigene Urteil auf das eines anderen zu verlassen, wenn man eine Sache selber am besten entscheiden kann.« Sie griff wieder nach ihrem Becher und nahm einen kleinen Schluck von ihrem Tee. »Es würde mich sehr überraschen, wenn er Euch nicht den gleichen Rat gegeben hätte, Obi-Wan.«
Sein Blick wurde leer, und seine Gesichtszüge erstarrten. »Ich bin nicht hergekommen, um über Qui-Gon Jinn zu sprechen.«
Ihr lief ein Schauer über den Rücken, denn seine Stimme klang ganz kalt. Das war der Obi-Wan, der Anakin zum Schweigen, ja, fast schon zum Weinen bringen konnte. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Er hat kein Recht, mich zu tadeln.
Sie setzte ihren Becher wieder ab. »Schön. Dann lasst uns über etwas anderes reden. Wenn Ihr in der Arena gestorben wärt, weil er nicht zu Eurer Hilfe herbeigeeilt war, hätte ihn das völlig vernichtet. Glaubt Ihr ernsthaft, dass ich daneben stehen und es einfach zulassen würde?«
»Es geht hier nicht um das, was Ihr getan habt, Padmé. Der kritische Punkt ist doch, dass Anakin es gar nicht hätte geschehen lassen dürfen. Er ist ein Jedi. Es wird von ihm verlangt, dass er Pflicht über persönliche Gefühle stellt.«
»Und das tat er auch! Er war bereit zu tun, was Meister Windu ihm aufgetragen hatte. Ich war diejenige, die beschloss, Euch zu retten. Und als mein mir zugewiesener Leibwächter blieb Anakin gar keine andere Wahl, als notgedrungen mitzukommen.«
Das brachte ihr einen Blick ein, in dem ein Anflug von Verbitterung lag. »Sehr einfallsreich von Euch, Senatorin«, meinte Obi-Wan. »Qui-Gon wäre stolz gewesen.«
Sie beugte sich vor und versuchte zu ihm durchzudringen, versuchte, dieses selbstbeherrschte Jedi-Gebaren, das nichts durchließ, zu überwinden. »Anakin bewundert Euch so sehr, Obi-Wan. Er muss wissen, dass Ihr ihm vertraut.«
Er nickte. »Das weiß er.«
»Wirklich?« Sie setzte sich wieder auf. »Na, ich bin mir nicht sicher.«
»Ihr glaubt mir nicht? Warum nicht?«
»Weil er mehr Selbstvertrauen hätte, würde er glauben, dass Ihr ihm vertraut.«
»Mehr Selbstvertrauen?«, wiederholte Obi-Wan ungläubig. »Padmé, Anakins Problem ist nicht sein Mangel an Selbstvertrauen. Eher das Gegenteil. Sein übersteigertes Selbstvertrauen hat ihn ins Unglück gestürzt. Hätte er meinen Befehl nicht missachtet, sich nicht allein in einen Kampf mit Dooku gestürzt, würde er jetzt nicht bewusstlos im Tempel liegen und darauf warten, dass man seine Armprothese fertig stellt!«
»Aha«, sagte sie mit wild pochendem Herzen. »Ihr gebt also Anakin die Schuld daran, was passiert ist.«
Obi-Wan stand auf und wandte sich leicht von ihr ab. »Ich bin nicht hergekommen, um noch einmal die Ereignisse von Geonosis aufzuwärmen. Das ist eine Jedi-Angelegenheit, nicht Eure.«
»Dann kommt endlich auf den Punkt oder kehrt in den Tempel zurück, Obi-Wan«, erwiderte sie. »Ich habe Euch nicht hergebeten. Und ich habe Euch nur aus reiner Höflichkeit gestattet zu bleiben.«
Langsam drehte er sich wieder zu ihr um. Sein Gesicht war bleich, und seine klaren blauen Augen waren von den widerstreitenden Gefühlen, die in ihm tobten, ganz dunkel. »Der Punkt ist der, dass Ihr Euch nicht mehr als eine herzliche Beziehung zwischen Euch und Anakin erhoffen könnt, Senatorin. Er hat sich dem Jedi-Orden verpflichtet. Sein Leben ist bei uns. Von etwas anderem zu träumen, wäre dumm.«
Sie spürte, wie es in ihr vor Wut zu brodeln begann und sich der Zorn wie ein Hitzeschleier in der Wüste Tatooines über sie legte. »Ich weiß nicht, wovon Ihr überhaupt redet.«
»Haltet mich nicht für dumm, Padmé!«, fuhr er sie an. »Natürlich wisst Ihr das. Er hegt zärtliche Gefühle für Euch. Starke Gefühle, die sein Urteilsvermögen beeinträchtigen und dafür sorgen, dass er dem Orden gegenüber ungehorsam ist. Wollt Ihr etwa leugnen, dass Ihr ähnlich für ihn empfindet?«
»Meine Gefühle gehen nur mich etwas an!«
»Nicht, wenn es dabei um einen Jedi geht!«
Schwer atmend funkelten sie einander an. Wenn sie seinen Schmerz sehen konnte, dann konnte er dasselbe bei ihr bestimmt auch erkennen.
»Deshalb seid Ihr hergekommen?«, wisperte sie. »Um mir zu sagen, dass ich Anakin vergessen muss?«
»Ich bin hergekommen, weil man es mir aufgetragen hat«, antwortete Obi-Wan nach einer Weile. »Und weil ich versuche, ihn zu beschützen. Und Euch, obwohl Ihr mir das wahrscheinlich nicht glauben werdet. Aber, Padmé …« Er ließ sich wieder in den Sessel sinken und legte die Fingerspitzen auf ihr Knie. »Es stimmt. Ihr müsst wissen, dass es euch beiden nur das Herz brechen wird, wenn ihr weiter auf diesem Wege bleibt. Wenn Ihr Anakin liebt, dann müsst Ihr ihn gehen lassen. Er kann Euch nicht lieben und gleichzeitig ein Jedi sein. Und er wurde dafür geboren, ein Jedi zu sein. Ihn erwartet ein größeres Schicksal, als Ihr oder ich uns auch nur vorstellen können. Wenn er nicht frei ist, um seiner Bestimmung zu folgen, werden sehr viele vielleicht einen furchtbaren Preis dafür bezahlen. Wollt Ihr das?«
Sie blinzelte und drängte die aufsteigenden Tränen zurück. »Und liebt Ihr ihn so wenig, dass Ihr ihn zu einem Leben in Einsamkeit verdammen würdet – und das alles im Namen irgendeiner Prophezeiung, von der kein Einziger aus Eurem kostbaren Jedi-Rat mit Bestimmtheit sagen kann, dass sie wahr ist?«
Obi-Wan stand wieder auf und bewegte sich dieses Mal in Richtung Tür. »Wenn ich ihn nicht … lieben würde«, sagte er mit stockender Stimme, während er ihr den Rücken zuwandte, »wäre ich jetzt nicht hier.«
Sie sprang auf. »Dann glaube ich, dass Ihr und ich etwas anderes unter Liebe verstehen. Ich würde nie etwas tun, was Anakin schadet. Könnt Ihr dasselbe von Euch sagen, Obi-Wan?«
Er wirbelte mit blitzenden Augen zu ihr herum. »So etwas zu sagen, wäre kindisch und dumm!«
»Obi-Wan, ich mache mir Sorgen um ihn. Versteht Ihr das denn nicht?«
Er atmete tief ein und mühsam wieder aus, um sich wieder zu fassen. »Padmé, Ihr irrt, wenn Ihr denkt, ich wüsste nicht, was ich verlange. Ich weiß es. Das Leben eines Jedi ist einsam. Es verlangt uns die größten Opfer ab. Die Bedürfnisse von Fremden stehen an erster Stelle, und unsere kommen erst zum Schluss. Doch wie viel Leid würde es wohl geben, wenn die Jedi ihren Aufgaben nicht mehr nachkämen? Wollt Ihr das? Meint Ihr, dass Anakin das will?«
Er will den Jedi dienen, und er will lieben und geliebt werden. Ich weigere mich hinzunehmen, dass er gezwungen wird, sich zwischen beidem zu entscheiden.
»Ich kann nicht über Euch bestimmen«, fuhr Obi-Wan fort. »Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Aber ich fordere Euch auf – ich bitte Euch –, diese eine Sache zu tun. Verlasst Coruscant. Kehrt nach Naboo zurück. Gebt Anakin die Zeit, die er braucht, um sich von seiner Verletzung zu erholen – und erkennt, was Ihr und ich bereits wissen: dass die einzige Lösung in dieser unseligen Situation ist, wenn ihr getrennte Wege geht.«
Sie drängte die aufsteigenden Tränen zurück. Ihr sagt, Ihr würdet verstehen, Obi-Wan, aber das tut Ihr nicht. In allen wichtigen Belangen kennt Ihr Anakin überhaupt nicht. Aber ich. Ich kenne ihn. Ich habe gesehen, wie er wirklich ist. Alles. Mit meiner Liebe kann ich ihn retten.
Aber das konnte sie Obi-Wan nicht sagen. Er würde es nie glauben. Und jetzt, da er wusste, dass sie und Anakin einander liebten, würde er auch nie ein Auge zudrücken. Also musste sie ihn glauben machen, dass er sie davon überzeugt hatte, Anakin zu verlassen, wäre das einzig Richtige. Es machte sie traurig, dass es nötig war, zu so einer List zu greifen. Sie mochte Obi-Wan sehr. Und sie wusste, dass er Anakin liebte – auf die farblose, beherrschte Art, wie sie Jedi zu eigen war. Doch Anakins Liebe war wie die glühende Hitze einer Supernova. Beim Versuch, diese zu beherrschen, würden die Jedi ihn vernichten.
Ich würde eher sterben, als das geschehen zu lassen.
Sie hob den Blick. »Glaubt Ihr wirklich, dass ich ihm mit meiner Liebe nur schade?«
»Ja, Padmé«, erwiderte er und musste sich räuspern. »Das tue ich.«
Es war nicht schwer, die Tränen wieder in ihre Augen steigen zu lassen. Der schlichte Ernst in seiner Stimme tat ihr weh, und damit hatte sie nicht gerechnet. »Aha.«