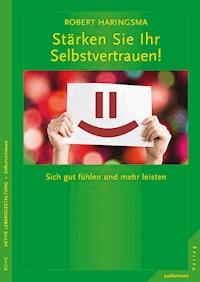
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Menschen mit einem optimalen Selbstvertrauen können besser mit Kritik umgehen, weil sie die Kritik auf ihr Handeln und nicht auf ihre Person beziehen. Sie nehmen deutlicher Stellung, weil sie wissen, was ihnen wichtig ist, und sie haben eine objektivere Perspektive auf ihre eigene Leistung. Aber wie viel Selbstvertrauen ist eigentlich optimal? Wann schätzen wir unsere Kompetenzen richtig ein, und wann unter- oder sogar überschätzen wir uns? Robert Haringsma unterscheidet zwei Säulen, auf denen sich gutes Selbstvertrauen gründet: 1. die Überzeugung, unabhängig von Status oder Leistung als Mensch etwas wert zu sein (Würde), und 2.eine gute Kenntnis der eigenen persönlichen Werte, nach denen sich unser Handeln ausrichtet (Authentizität). Schritt für Schritt stellt der Autor fundierte Strategien vor, an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten und dabei nachhaltig Wirkung zu erzielen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Robert HaringsmaStärken Sie Ihr Selbstvertrauen!Sich gut fühlen und mehr leisten
Über dieses Buch
Das Selbstvertrauen beeinflusst unser Leben auf vielfältige Weise. Menschen mit starkem Selbstvertrauen leiden in der Regel weniger unter psychischen Problemen und fühlen sich unter anderen Menschen wohler. Mangelndes Selbstvertrauen hingegen kann unser Gefühlsleben und Verhalten negativ beeinflussen, es kann uns unsicher und traurig machen. Robert Haringsma hat sich als Stotterer schon früh mit dem Thema Selbstvertrauen auseinandergesetzt, zunächst aus privater, dann aus beruflicher Motivation heraus. In seinem Buch thematisiert er unter anderem
die Quellen des Selbstvertrauens, die häufigsten Fehler, wenn es um die Stärkung des Selbstvertrauens geht (und wie man sie vermeidet), wie man mit Perfektionismus und Versagensangst umgeht, wie man voller Selbstvertrauen sein kann, ohne arrogant oder eingebildet zu wirken.Beispiele und alltagspraktische Aufgaben helfen dabei, das vermittelte Wissen zu verinnerlichen und im Alltag langfristig umzusetzen.
Robert Haringsma ist Begründer des Amsterdamer Instituts für Positive Psychologie, wo er Selbstvertrauenstrainings durchführt und Coachings anbietet.
Copyright © der deutschen Ausgabe: Junfermann Verlag, Paderborn 2015
Copyright © der Originalausgabe: Uitgeverij Lannoo nv, 2012
Die Originalausgabe ist 2012 unter dem Titel Vergroot je zelfvertrouwen bei Lannoo erschienen, http://www.lannoo.com.
Übersetzung: Bärbel Jänicke
Coverfoto: © gustavofrazao – fotolia
Covergestaltung / Reihenentwurf: Christian Tschepp
Satz & Digitalisierung: JUNFERMANN Druck & Service, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsdatum dieser eBook-Ausgabe: 2015
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-419-2
ISBN dieses E-Books: 978-3-95571-433-8 (EPUB), 978-3-95571-434-5 (MOBI), 978-395571-435-2 (PDF).
Einleitung
Ziel dieses Buches
Selbstvertrauen beeinflusst unser Leben auf vielfältige Weise. Mangelndes Selbstvertrauen kann alle möglichen unangenehmen Folgen für unser Gefühlsleben und Verhalten haben. Es sorgt dafür, dass wir uns nicht im besten Licht zeigen, und es kann uns unsicher und traurig machen. Menschen mit starkem Selbstvertrauen sind dagegen glücklicher und leiden weniger unter psychischen Problemen. Sie zeigen mehr Initiative und fühlen sich unter Menschen wohler. Selbstvertrauen ist, kurz gesagt, ein Mittel zur Erreichung eines Ziels. Wir brauchen es, um uns wohlzufühlen und unser Leben gut und sinnvoll zu gestalten.
Wenn Sie dieses Buch in die Hand genommen haben, haben Sie womöglich selbst wenig Selbstvertrauen. Vielleicht suchen Sie aber auch nach einer Möglichkeit, jemandem in ihrem Umfeld dabei zu helfen, seinen Perfektionismus, seine mangelnde Selbstachtung oder seine Versagensangst zu überwinden. Oder Sie sind ein Elternteil oder ein Erzieher und suchen nach einem verantwortungsbewussten Weg, das Selbstvertrauen von Kindern zu stärken. Wie immer Ihre Frage lauten mag, Sie sind sicherlich auf der Suche nach einer klaren und gut begründeten Antwort, die Sie direkt in die Praxis umsetzen können.
Dieses Buch ist daher ausdrücklich als Selbsthilfe-Buch konzipiert. Ich habe es geschrieben, um Sie beim Aufbau Ihres eigenen Selbstvertrauens oder des Selbstvertrauens anderer zu unterstützen. Im ersten Kapitel gehe ich darauf ein, was genau Selbstvertrauen ist.
Danach schildere ich eine Reihe praktischer Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Dabei kommt unter anderem Folgendes zur Sprache:
Praktische Aufgaben. Wissen ist wichtig, aber es bringt nicht viel, wenn man es nicht praktisch umsetzt.
Was sind die häufigsten Fehler, wenn es um die Stärkung des Selbstvertrauens geht (und wie können Sie sie vermeiden)?
Wie geht man mit Perfektionismus und Versagensangst um?
Welche Quellen des Selbstvertrauens gibt es?
Wie kann man voller Selbstvertrauen sein, ohne arrogant oder eingebildet zu wirken?
Im letzen Kapitel des Buches werden diese ganzen Informationen in einem Stufenplan zusammengefasst, mit dem Sie nach dem Lesen dieses Buches Ihr Selbstvertrauen weiter stärken können. Für jeden Bereich Ihres Selbstvertrauens erhalten Sie spezielle Aufgaben. So verfügen Sie über ein übersichtliches Handbuch, mit dem Sie sofort in die Praxis einsteigen können.
Ich verspreche Ihnen nicht, dass Sie mithilfe dieses Buches all Ihre Träume erfüllen und ein unerschütterliches, felsenfestes Selbstvertrauen aufbauen werden, das niemals ins Wanken gerät. Solche Versprechungen werden Ihnen nur von selbst ernannten „Gurus“ aufgetischt, im ungünstigsten Fall tragen sie gerade zu einer Schwächung des Selbstvertrauens bei. Denn letztlich wird man sich immer eingestehen müssen, dass man die versprochene Perfektion nie erreicht, und sich dafür dann noch die Schuld geben. Das will ich Ihnen nicht antun.
Ich möchte daher gleich vorab sagen, dass die persönliche Entwicklung ein Prozess ist, der langsam verläuft und sich fast nie unserer Vorstellung von Perfektion fügt. Es ist durchaus möglich, das eigene Selbstvertrauen zu stärken, doch dazu gibt es kein Wundermittel. Die Arbeit an sich selbst erfordert Zeit, Achtsamkeit und Engagement. Dieses Buch kann Ihnen auf Ihrer Tour ein guter Reiseführer sein, aber Sie selbst werden es letztlich sein, der den ersten Schritt gehen und die Disziplin aufbringen muss weiterzugehen. Die Lektüre dieses Buches ist ein erster Schritt auf Ihrer Reise, die Übungen zu nutzen füllt die restliche Wegstrecke Ihrer Reise aus.
Hintergrund
In meiner Praxis arbeite ich als Trainer täglich mit Menschen, die sich mehr Selbstvertrauen wünschen. In Gruppen oder Einzelgesprächen habe ich unterschiedlichste Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren begleitet, von Studierenden bis zu Führungskräften. Sie melden sich unter anderem in meinen Kursen an, weil sie sich unter Menschen oder in ihrer Partnerschaft nicht wohlfühlen. Ihr geringes Selbstvertrauen macht sich auch oft in professionellen Zusammenhängen bemerkbar, zum Beispiel häufig in der Vorstellung, nicht genug zu leisten. Manche von ihnen geraten in die Nähe eines Burn-outs, weil sie sich ständig dazu gedrängt fühlen, ein perfektes Ergebnis zu liefern.
Diese Rolle als Trainer war für mich nicht immer selbstverständlich. Denn früher habe ich selbst mit einem Mangel an Selbstvertrauen gerungen. Ich stottere schon mein ganzes Leben, und das hat sich lange sehr negativ auf mein Selbstvertrauen ausgewirkt. Ich versuchte immer, mein Gestammel zu kompensieren, indem ich mich auf anderen Gebieten hervortat. Zum Beispiel indem ich mehr Bücher las als andere und bessere Noten erzielte. Ich war ständig darum bemüht, besser zu sein als die anderen. Meinem Selbstvertrauen half das aber wenig. Solange meine Leistung gut war, fühlte ich mich ziemlich wohl. Aber es bestand immer die Gefahr, letztlich doch noch zu versagen und damit zu offenbaren, dass ich „nicht gut genug war“. Dieser Druck hatte zur Folge, dass mich eine ständige Unruhe begleitete. Und wenn ich wirklich einmal hinter der Leistung der anderen zurückblieb, fühlte ich mich erst recht mies.
Es hat mich viel Zeit gekostet zu erkennen, wie ich ein stabiles und starkes Selbstvertrauen entwickeln konnte. Zum ersten Mal entdeckte ich die Möglichkeiten einer solchen persönlichen Entwicklung, nachdem ich mir in der örtlichen Bibliothek ein Buch von Anthony Robbins ausgeliehen hatte. Robbins ist einer der bekanntesten „Selbsthilfegurus“. Er hat zahlreiche Bücher über persönliche Entwicklung und Erfolg verfasst. Ich fand die Themen, die in seinem Buch besprochen wurden, sehr interessant, erkannte aber auch, dass viele Dinge so nicht funktionierten. Ich studierte Psychologie, um herauszufinden, was die Wissenschaft zum Thema persönliche Entwicklung zu sagen hatte. Doch schon bald musste ich erkennen, dass die Psychologie an diesem Thema nur wenig Interesse hatte. Während meines Studiums habe ich eine Menge Nützliches über den Aufbau einer Studie, die Möglichkeit, bei Klienten Veränderungen zu bewirken, und die Persönlichkeit und deren Entwicklung gelernt. Dabei ging es jedoch vor allem um die Heilung von Kranken und weniger um die Entwicklung von gesunden Menschen.
Meine Abschlussarbeit habe ich schließlich über die Wirkung von Selbsthilferatgebern geschrieben. In den Büchern von Dr. Anthony Robbins, Wayne Dyer und anderen Selbsthilfegurus geht es um das Streben nach einem besseren Leben und die Suche nach Glück. Doch oft lässt die Qualität ihrer Ratschläge einiges zu wünschen übrig. Freilich muss man den Autoren zugutehalten, dass sie Fragen zu Glück, Normen und Werten, zu Liebe und Sinnsuche zumindest thematisieren. Im Schlussteil meiner Abschlussarbeit habe ich daher die Frage aufgeworfen, warum die wissenschaftliche Psychologie diesen Themen so wenig Aufmerksamkeit schenkt.
Der Zweitgutachter meiner Arbeit sagte mir, dass man sich in der sogenannten Positiven Psychologie durchaus wissenschaftlich mit diesen Themen auseinandersetze. Diese ziemlich neue Richtung innerhalb der Psychologie konzentriere sich auf die Frage, was ein glückliches Leben sei und wie man es verwirklichen könne. In den Medien wird sie auch als „Glückswissenschaft“ bezeichnet. Die erforscht beispielsweise Themen wie Weisheit, Glück, positives Denken, Selbstdisziplin und soziale Fähigkeiten. Diese eine Anmerkung zu meiner Arbeit hat weitgehend darüber entschieden, womit ich mich in den Jahren danach beschäftigen sollte.
Der erste Schritt, zu dem ich mich entschieden hatte, bestand darin, selbst etwas zur Forschung innerhalb der Positiven Psychologie beitragen zu wollen. Das gestaltete sich damals noch ziemlich schwierig. Schon während meines Studiums hatte ich ja erfahren müssen, dass man vier Jahre studieren konnte, ohne je etwas über positive Psychologie zu hören. Und bei der Suche nach einer Alma Mater für meine Promotion zeigte sich, warum. Die meisten Universitäten standen der Erforschung dieser Themen äußerst reserviert gegenüber. Nur die Freie Universität Amsterdam wollte diesen Themen eine Chance einräumen. So habe ich 2009 mit meiner Promotion zur Wirksamkeit von Selbstvertrauens-Trainings begonnen. Ich habe die internationale Literatur auf diesem Gebiet aufgearbeitet und schließlich wirksame Prinzipien zur Entwicklung eines starken Selbstvertrauens gefunden. Die Zeit, in der ich mich dieser Untersuchung widmete, hatte viele positive Konsequenzen.
Zunächst einmal bewirkte sie, dass mein persönliches Selbstvertrauen enorm gestärkt wurde. Ich habe eingesehen, dass ich nicht mit meinem Stottern gleichzusetzen bin, sondern auch andere Charaktereigenschaften habe, die mich zu einem wertvollen Menschen machen. Außerdem habe ich entdeckt, dass der Versuch, sein Selbstvertrauen auf die eigenen Leistungen und Erfolge aufzubauen, ein Spiel ist, das man niemals gewinnen kann. Das Selbstwertgefühl kann nur stabil sein, wenn es aus einem selbst kommt und nicht zu sehr auf dem Urteil anderer beruht. Diese Einsicht hat mir viel innere Ruhe verliehen und dazu geführt, dass ich eine Menge nebensächlicher Dinge, über die ich mir immer große Sorgen gemacht hatte, leichter relativieren konnte.
Als ich nicht mehr versuchte, meinen Selbstwert durch Leistung zu steigern, gelang mir lustigerweise auf einmal manches viel besser. Ich gründete das Institut für Positive Psychologie und, wie Sie sehen, habe ich die Möglichkeit erhalten, ein Buch dazu zu schreiben. Für mich persönlich ist es allerdings am erstaunlichsten, dass ich trotz meines Stotterns inzwischen vielfach von Universitäten und Unternehmen als Referent angefragt werde. Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, wünsche ich mir, ich hätte dieses Wissen über Selbstvertrauen schon früher gehabt. Das hätte mir einiges an Kopfzerbrechen erspart und hätte mich in meinem Leben glücklicher und zufriedener gemacht. Um zu verhindern, dass andere ebenfalls unnötig mit einem Mangel an Selbstvertrauen ringen, habe ich begonnen, Trainings und Coachings zu geben und Bücher und Artikel zu diesem Thema zu schreiben.
Vor allem jedoch haben mir meine Studien ermöglicht, meine persönliche Erfahrung für viele andere Menschen zu verallgemeinern. Denn meine persönliche Erfahrung allein sagt per se noch nicht viel darüber aus, wie Selbstvertrauen bei anderen Menschen funktioniert. Menschen, die sich immerzu als „Erfahrungsexperten“ anpreisen, ähneln eher Friseuren, die jedem ihrer Kunden den Haarschnitt verpassen, der ihnen selbst gut steht. Um zu verhindern, dass ich selbst in diese Falle tappe, habe ich mich auf eine große Zahl psychologischer Untersuchungen gestützt, Untersuchungen, die von Laborexperimenten bis zu Beobachtungen in Klassenzimmern reichen. Und um diese Ergebnisse zu überprüfen, habe ich schließlich selbst eine Studie mit etwa hundert Testpersonen durchgeführt. Ich habe sie ein Training durchlaufen lassen und eruiert, ob ihr Selbstvertrauen dadurch tatsächlich gestärkt wurde. Auf diese Weise wollte ich kontrollieren, ob meine Art zu arbeiten bei ihnen Wirkung zeigte.
Dabei war es interessant zu sehen, wie Menschen diese Theorie auffassen und in ihrem eigenen Leben anwenden. Manche Teilnehmer fanden nun endlich den Mut, gewisse Karriereschritte zu unternehmen, andere wiederum wagten es, sich einem schwierigen Gespräch mit ihrem Partner oder ihrem Vorgesetzten zu stellen. Ich machte jedoch vor allem die Erfahrung, dass sich die Teilnehmer nach dem Training entspannter fühlten und sich weniger Sorgen um ihren Selbstwert machten. So bekam die Theorie in der Praxis für mich plötzlich ein menschliches Antlitz. Das vermittelte mir Einsichten in das Phänomen des Selbstvertrauens, die viel weiter reichten als meine eigene Erfahrung.
Das Institut für Positive Psychologie
Ich möchte mich dafür stark machen, die Positive Psychologie auch in den Universitäten einzuführen. Außerdem setze ich mich dafür ein, das Wissen dieses Fachgebiets einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei spielt die Website des Instituts für Positive Psychologie (http://www.ivpp.nl) eine wichtige Rolle. Dort veröffentliche ich Artikel über alle möglichen Themen der Positiven Psychologie.
Wenn Sie Fragen zu meinem Buch haben oder darüber diskutieren möchten, lade ich Sie herzlich ein, die Seite des IVPP zu besuchen. Dort können Sie sich kostenlos als Mitglied einschreiben und erhalten anschließend direkten Zugang zum Mitgliederforum. Unter [email protected] können Sie mir auch persönlich mailen. Ich würde mich freuen, etwas über Ihre Erfahrungen zur Anwendbarkeit des Buches in der alltäglichen Praxis zu hören.
Nun bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Erfolg mit den Übungen zu wünschen!
Robert Haringsma
TEIL I: OPTIMALES SELBSTVERTRAUEN
1. Was ist optimales Selbstvertrauen?
Ein Buch über Selbstvertrauen kann nur mit der Frage beginnen: Was ist Selbstvertrauen? Obwohl wir alle wissen, wie sich Selbstvertrauen (und der Mangel an Selbstvertrauen) anfühlt, ist es gar nicht so leicht, genau zu erklären, was es ist. Ich möchte das in einer kurzen historischen Schilderung des wissenschaftlichen Denkens zum Phänomen Selbstvertrauen erläutern. Dabei wird deutlich werden, dass noch in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts Selbstvertrauen sowohl als Ursache wie auch als Lösung aller psychischen Probleme angesehen wurde. Spätere Forschung hat dann allerdings dazu geführt, dass der Begriff Selbstvertrauen einen schlechten Ruf bekam. Zum Schluss werde ich auf die Methode eingehen, die ich in diesem Buch verwende.
Worin liegt das Problem?
„Ein Mangel an Selbstvertrauen führt zu schlechten schulischen Leistungen.“ 1980 hielten amerikanische Psychologen die Belege für diese Behauptung für so stark, dass man sie als bewiesene Tatsache betrachten könne.[1]i Man rief umfangreiche Programme ins Leben, um das Selbstvertrauen von Schülern zu stärken, Programme, in denen man den Kindern beibrachte, positiv über sich zu denken. So wurde beispielsweise eine „Magic Box“ von Hand zu Hand gereicht, die die Antwort auf die Frage enthalten sollte, wer die bemerkenswerteste Person der Welt sei. Wenn die Schüler in die Schachtel schauten, entdeckten sie ihr eigenes Spiegelbild. Die Antwort lautete also für jeden Schüler „ich selbst“.[2]
Mir scheint es schon an sich nicht vernünftig zu sein, Kinder dazu zu erziehen, sich selbst ganz fantastisch zu finden. Leider gingen die Schulen aber noch weiter. Negative Beurteilungen wurden für das Selbstvertrauen des Kindes als schädlich erachtet. Daher verzichtete man auf Tests bei den Kindern. Waren sie einmal unumgänglich, wurde stark davon abgeraten, ein negatives Feedback („Das war nicht ausreichend“) zu geben. Es ist natürlich klar, dass auch Studenten, die in der Schule gelernt hatten, dass sie „die bemerkenswerteste Person der Welt“ sind, entsprechend behandelt werden wollten. Sie hatten jedoch wenige Kompetenzen, die eine solche Vorzugsbehandlung gerechtfertigt hätten. Als diese Kinder ihren Platz in der Gesellschaft suchten, zeigten sich die Grenzen dieser Selbstvertrauensprogramme dann in aller Deutlichkeit. An ihrem ersten Arbeitsplatz sahen sie sich nämlich mit der harten Realität konfrontiert. Hier wurden sie nach ihrer Leistung bewertet, und das oft auf ziemlich unmissverständliche Art und Weise, was nicht selten zu Konflikten mit ihren Arbeitgebern führte. Diese hatten häufig den Eindruck, dass ihre neuen Mitarbeiter verwöhnt seien, wenig Rückgrat zeigten und außerdem zu wenig leisteten. So verbreitete sich in der Gesellschaft schon bald die Ansicht, dass Selbstvertrauen alles andere als ein Wundermittel war.
Diese intuitive Auffassung wurde zunehmend durch eine ganze Reihe von Studien gestützt. Roy Baumeister, der zunächst selbst über das Phänomen Selbstvertrauen geforscht hatte, wurde bald zu einem seiner schärfsten Kritiker. In einem großen Übersichtsartikel, in dem er die Ergebnisse unzähliger Beiträge zu diesem Thema zusammenfasste, kam er zu dem Schluss, dass sich Menschen mit einem großen Selbstvertrauen zwar besser fühlten, es aber keinerlei Hinweise darauf gäbe, dass sie auch bessere Leistungen erbrachten.[3] Ein starkes Selbstvertrauen sei weder in der Schule noch im Arbeitsleben ein sicheres Indiz für Erfolg. Menschen mit einem starken Selbstvertrauen blickten zwar positiv in die Zukunft und entwickelten eher Initiative als Menschen mit geringem Selbstvertrauen. Ihr starkes Selbstvertrauen sorge jedoch nicht dafür, dass sie in der Schule oder am Arbeitsplatz mehr leisteten. Auch als Führungskräfte bewährten sie sich nicht besser als andere. Außerdem seien Menschen mit geringem Selbstvertrauen nicht gewalttätiger als andere, und das Risiko, dass sie rauchten, tranken oder Drogen nahmen, sei nicht überdurchschnittlich hoch. Offenbar waren die Auswirkungen sowohl eines zu großen als auch eines zu geringen Selbstvertrauens stark übertrieben eingeschätzt worden. Es hatte den Anschein, als habe unser Selbstvertrauen wenig mit unserer Leistung zu tun.
Baumeister schlug vor, zur Stärkung unseres Selbstvertrauens am besten am Ausbau unserer Kompetenzen zu arbeiten. Wenn Menschen mehr leisten, steigere sich das Selbstvertrauen von selbst. Die Studien von Jennifer Crocker und Lora Park[4] belegten jedoch das Gegenteil. Sie untersuchten Menschen, die ihr Selbstvertrauen auf ihre Erfolge und ihre Leistung stützten. Ihre Testpersonen hatten also, ohne Baumeisters Rat zu kennen, dessen Strategie schon angewandt. Diese Studie zeigte allerdings, dass bessere Leistungen nicht eine Stärkung des Selbstvertrauens bewirkten. Ja mehr noch, Selbstvertrauen, das auf Leistung basierte, erwies sich sogar als besonders fragil. Solange jemand genug leistete, war sein Selbstwertgefühl hoch. Doch sobald im Leben einmal etwas schiefging, schwand dieses Gefühl rasend schnell dahin. So schnell, dass sich Depressionen und eine Vielzahl anderer Probleme einstellen konnten.
Selbstvertrauen war jahrelang eines der wichtigsten Themen der Psychologie gewesen. Nun schien dieses Phänomen plötzlich mit allen möglichen Nachteilen behaftet zu sein. Entschied man sich dafür, sein Selbstvertrauen auf die eigene Leistung zu stützen, führte das zu einem unglücklichen Leben und einem geringen Selbstwertgefühl. Versuchte man stattdessen, sein Selbstvertrauen durch ein positives Selbstbild zu stärken, wurden die eigenen Leistungen davon beeinträchtigt. Wofür man sich auch entschied, es brachte immer negative Folgen mit sich. Viele Wissenschaftler hielten es für klug, sich überhaupt nicht um ein starkes Selbstvertrauen zu bemühen.
Die Lösung: Selbstwert und Kompetenz
Zum Glück sollte es nicht lange dauern, bis Wissenschaftler eine neue Theorie zum Selbstvertrauen formulierten. Der erste Schritt zur Lösung war die Erkenntnis, Selbstvertrauen nicht nur als ein rein psychisches Phänomen zu betrachten. Diese neue Einsicht konnte einen Teil der Konfusion zwischen den Wissenschaftlern auflösen. Baumeisters Thema war das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Je mehr man sich in eine Aufgabe einübt, desto mehr wird das Vertrauen, diese Aufgabe ordentlich erledigen zu können, wachsen. Crocker und Park thematisierten jedoch eine andere Art des Selbstvertrauens. Sie sprachen vom Gefühl, etwas wert zu sein, vom Selbstwert einer Person. Aufgrund dessen entstand eine neue Theorie, nach der sich Selbstvertrauen aus einer Kombination aus Kompetenz und Selbstwert ergab.[5] Diese Theorie wird auch als Zweifaktorenansatz bezeichnet.
Kompetenz ist ein Begriff, der auf die Beherrschung einer bestimmten Tätigkeit wie Lesen, Schreiben oder Bergsteigen verweist. Die allgemeine Regel in Sachen Kompetenz lautet: Je besser man etwas kann, desto mehr Selbstvertrauen wird man in diesem Bereich haben. Ich vermute einmal, wenn ich Sie bitten würde, ein Handy zu bauen, würden sich Ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet wohl als ziemlich gering herausstellen. Wenn ich Sie jedoch bitte, sich die Zähne zu putzen, wird Ihre Kompetenz in diesem Bereich bestimmt sehr groß sein. Mit Kompetenz meine ich hier also einfach nur den Grad Ihres Könnens. Dass Selbstvertrauen damit in einem engen Zusammenhang steht, wird niemanden überraschen. Wenn man sich schon jahrelang einer bestimmten Aufgabe gewidmet hat, wird das Selbstvertrauen in diesem Bereich ziemlich groß sein. Manchmal vielleicht sogar so groß, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, ob man die nötigen Kompetenzen dazu hat oder nicht. Die meisten Niederländer steigen zum Beispiel nicht mit dem Gedanken aufs Fahrrad: „Wenn das mal gut geht!“ Ihr Vertrauen in diese Kompetenz ist optimal und das Fahrradfahren funktioniert bei ihnen vollkommen automatisch.
Abbildung 1.1
Man kann sich eine Kompetenz als eine Eigenschaft vorstellen, die man, wie in Abbildung 1.1 gezeigt, auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten kann. Besitzt man viele Kompetenzen, bei denen man auf eine hohe Punktzahl kommt, wird das eigene Selbstvertrauen oft sehr hoch sein. Gibt es viele Kompetenzen mit einer geringen Punktzahl, wird das Selbstvertrauen in der Regel gering sein.
Werthaftigkeit stellt einen anderen wichtigen Bereich des Selbstvertrauens dar. Wir sagen dann auch, jemand habe „ein positives Selbstbild“ oder er besitze „Selbstwert“. Jemand mit wenig Selbstwertgefühl beschreibt sich selbst etwa folgendermaßen: „Ich bin eigentlich nichts Besonderes. Es gibt niemanden, dem viel an mir liegt, und ich habe keine herausragenden Eigenschaften oder speziellen Talente. Mein Beitrag zu dieser Welt ist eigentlich nur negativ. Ich enttäusche viele Menschen und verursache nur eine Menge Probleme.“ Jemand mit viel Selbstwertbewusstsein spricht positiv über sich. Er wird vielleicht so etwas sagen wie: „Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Umgebung eine wichtige Rolle spiele. Ich habe enge Bindungen zu anderen und fühle mich von ihnen geschätzt. Alles in allem habe ich das Gefühl, dass ich auf andere Menschen und auf meine Umgebung einen positiven Einfluss habe.“ Man kann sich vorstellen, dass dieser Mensch sich um einiges wohler fühlt als jener mit geringem Selbstwertgefühl. Selbstwert kann man sich ebenfalls als eine Eigenschaft vorstellen, die man auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten kann, wie in Abbildung 1.2.
Abbildung 1.2
Grundlage des Selbstwertes bildet die Überzeugung, dass man etwas wert ist, dass man etwas darstellt, dass man das Recht hat, da zu sein. In der Psychologie gibt es verschiedene Begriffe für dieses Gefühl wie zum Beispiel Selbstwert, Selbstliebe und Selbstachtung. Das Selbstwertgefühl nimmt zu, wenn es auf dem Boden eigener Normen und Werte gründet. Und kennt man erst einmal seine eigenen Werte, ist es natürlich auch wichtig, danach zu handeln.
Ein stabiles und großes Selbstvertrauen beruht auf einer Kombination von Kompetenz und Selbstwert. Um gut zu verstehen, warum gerade diese Kombination so wichtig ist, beschreibe ich zunächst die Probleme, die entstehen können, wenn man sein Selbstvertrauen entweder nur auf Kompetenz oder nur auf Selbstwert stützt.
Selbstwert ohne Kompetenz
Selbstvertrauen, das vornehmlich auf Selbstwert beruht und in viel geringerem Maße auf Kompetenz, liegt im folgenden Schema im rechten unteren Bereich.
Abbildung 1.3
Ein solches Selbstvertrauen wirkt sich in zweierlei Hinsicht negativ aus: Diese Menschen werden arrogant und bleiben hinter ihrem eigenen Leistungsvermögen zurück. Arroganz zeigt sich in der Überschätzung der eigenen Bedeutung. Man geht nicht mehr davon aus, ebenso viel wert zu sein wie andere, sondern ist der Überzeugung, mehr wert zu sein. Aus dieser Vorstellung, etwas Besonderes zu sein, kann, wie bei den zuvor beschriebenen amerikanischen Schülern, leicht die Vorstellung erwachsen, bestimmte Privilegien zu verdienen. Man geht dann einfach davon aus, das Recht auf eine Sonderbehandlung zu haben. Das eigene Umfeld hat dafür begreiflicherweise oft wenig Verständnis, sodass Menschen mit einer solchen Einstellung im Allgemeinen nicht als sympathisch empfunden werden.
Der Fall, dass jemand hinter seinem eigenen Leistungsvermögen zurückbleibt, ergibt sich vor allem, wenn der eigene Selbstwert als Ausrede dafür gebraucht wird, nichts leisten zu müssen. Ich beobachte bei manchen meiner Klienten, dass sie von ihrer aktuellen Arbeit gelangweilt sind und ihre Potenziale eigentlich nicht ausschöpfen können. Oft merke ich, dass sie viel mehr aus sich herausholen möchten, sich das aber nicht wirklich trauen. Das hat meistens weniger mit ihrem Selbstwertbewusstsein zu tun, denn das ist groß, sondern mit ihren Kompetenzen. Sie fragen sich: Bin ich den Anforderungen einer neuen Stelle gewachsen? Ist das Risiko nicht zu groß, dass ich entlassen werde, wenn meine Leistung nicht gut genug ist? Sie befürchten, dass ihre Kompetenzen nicht ausreichen, um neue Herausforderungen bewältigen zu können. Sie haben nicht etwa Angst zu scheitern und damit ihrem Ego zu schaden, es geht ihnen allein um die praktischen Konsequenzen ihrer eventuell zu schwachen Leistung. Sie konfrontieren sich jedoch nicht mit ihrer Angst, sondern gehen ihr aus dem Weg, indem sie sich sagen, dass sie „gut sind, so wie sie sind“.
Verstehen Sie mich nicht falsch, moralisch gesehen ist, was mich angeht, nichts dagegen zu sagen, wenig zu leisten. Unter psychologischem Gesichtspunkt gibt es jedoch genügend Belege für die Ansicht, dass man glücklicher wird, wenn man gefordert wird und sich entwickeln kann. Man wird sich, mit anderen Worten, wohler fühlen, wenn man gute Leistung bringt. Da ich davon überzeugt bin, dass Selbstvertrauen von einiger Bedeutung für ein glücklicheres Leben ist, ist es problematisch, wenn ein großes Selbstwertgefühl dazu führt, dass man hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurückbleibt. Das trägt sicherlich nicht zu einem glücklicheren Leben bei.
Kompetenz ohne Selbstwert
Baumeister verwirft ein Selbstvertrauen, das sich nicht auf Kompetenz stützt. Seiner Ansicht nach bringt ein Übermaß an Selbstwertgefühl, kombiniert mit einem Mangel an Kompetenz, arrogante und verwöhnte Menschen hervor. In seinem neusten Buch über Selbstdisziplin behauptet er glattweg, dass die gängigen Theorien zum Selbstvertrauen die amerikanische Jugend verdorben hätten.[6] Selbstdisziplin müsse an dessen Stelle treten. Hätte Baumeister allerdings Crocker und Park besser zugehört (oder etwas mehr Therapieerfahrung gehabt), hätte er wissen können, dass der Versuch, sein Selbstvertrauen auf die eigenen Kompetenzen zu stützen, auch zu ziemlich gravierenden Problemen führen kann.
Bei Menschen, die ihre Kompetenzen gut entwickelt haben, wirkt es manchmal so, als hätten sie viel Selbstvertrauen. Sie strahlen Autorität aus und nötigen anderen durch ihr entschiedenes und resolutes Auftreten Respekt ab. Diese Ausstrahlung muss jedoch nicht unbedingt widerspiegeln, was sich in ihrem Innern abspielt. Denn gerade sie können tief in ihrem Innern sehr unsicher sein. In unserem Schema findet man diese Gruppe im linken oberen Bereich (siehe Abbildung 1.4). Das spezifische „Leiden“, das zu diesem Segment gehört, bezeichnet man auch als „Perfektionismus“.
Abbildung 1.4
Menschen, die in Bezug auf ihre Kompetenzen eine hohe, in Bezug auf ihren Selbstwert hingegen eine geringe Punktzahl erreichen, stützen ihr Selbstvertrauen vor allem auf ihre Leistung. Sie gehen also davon aus, dass sie mehr Selbstvertrauen gewinnen können, wenn sie erfolgreicher werden. Dadurch wird ihr Selbstvertrauen jedoch sehr fragil. Rückschläge und Erfolge wechseln sich im Leben ebenso ab wie Kritik und Anerkennung. Wenn sie ihr Selbstvertrauen von der Leistung und der Anerkennung anderer abhängig machen, wird es also manchmal stark und manchmal schwach sein.[7] Sie beschreiben ihr Selbstvertrauen oft als eine Art Achterbahn. Wenn sie erfolgreich sind, fühlen sie sich fantastisch, und wenn sie keinen Erfolg haben, fühlen sie sich fürchterlich.
Perfektionisten sind ein Extrembeispiel dieser Kategorie. Sie möchten nicht nur eine gute, sondern eine perfekte Leistung abliefern. Perfektion gehört jedoch in aller Regel nicht zu den menschlichen Möglichkeiten. Daher sind Perfektionisten mit ihren Leistungen ständig unzufrieden und unsicher in Bezug auf ihr Können. Sie arbeiten oft (zu) hart, um ihren eigenen Maßstäben gerecht zu werden, sie sind burn-out- und depressionsgefährdet. Ganz im Gegensatz zu dem, was man vielleicht auf den ersten Blick hin erwarten würde, führt Perfektionismus nicht zu besseren Leistungen. Im Abschnitt über Selbstwert gehe ich genauer auf dieses erstaunliche Ergebnis ein.
Versteht man unter Selbstvertrauen eine Kombination aus Selbstwert und Kompetenz, lassen sich die Resultate der Studien von Baumeister und Crocker / Park gut einordnen. Baumeisters Untersuchungsergebnisse verweisen auf die Risiken eines Selbstwertgefühls ohne Kompetenzen. Crockers und Parks Resultate belegen die negativen Folgen von Kompetenzen ohne Selbstwertgefühl. Haben wir auf diese Weise ein klares Bild von den Ursachen erhalten, die Selbstvertrauensprobleme hervorrufen können, liegt auch die Lösung für sie auf der Hand. Selbstvertrauen kann nur stabil und stark sein, wenn sich Selbstwert und Kompetenzen im Gleichgewicht befinden. Wir nennen diesen Zustand das optimale Selbstvertrauen.
Ein Gleichgewicht zwischen Kompetenz und Selbstwert
Optimales Selbstvertrauen ist eine stabile Kombination aus Kompetenz und Selbstwert. Unser Selbstwertgefühl bietet eine Grundlage dafür, an unseren Kompetenzen arbeiten zu können. Und unser Ringen mit immer wieder neuen Herausforderungen sorgt dafür, dass wir uns in unserem Selbstwert nicht überschätzen. Optimales Selbstvertrauen ermöglicht es uns, zuversichtlich im Leben zu stehen, ohne ständig nach Belegen dafür suchen zu müssen, dass wir ganz besonders und außergewöhnlich sind.
Professor Chris Mruk, dessen Selbstvertrauenstrainings ich 2010 erforscht habe, arbeitet schon seit Jahren wissenschaftlich zum Thema Selbstvertrauen. Er ist Autor des Buches Self-Esteem-Research, Theory and Practice. Toward a Positive Psychology of Self-Esteem.[8] Er hat den Namen „optimales Selbstvertrauen“ gewählt, weil es sich bei einem starken Selbstvertrauen um ein „Optimum“ handelt. Ein Optimum, das sich aus einem hohen Selbstwert und großer Kompetenz zusammensetzt.
Abbildung 1.5





























