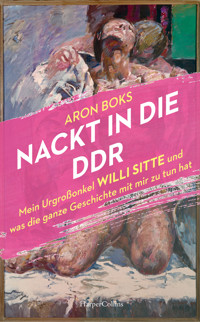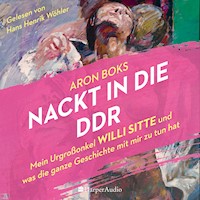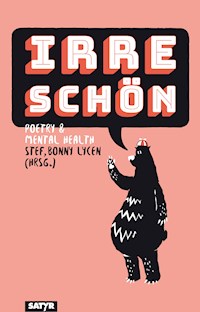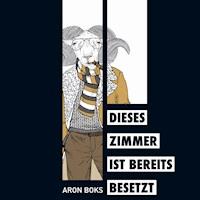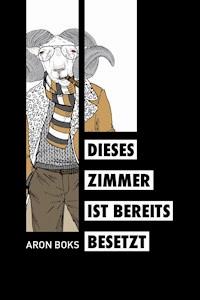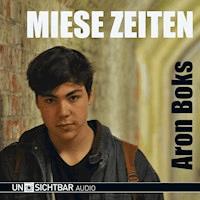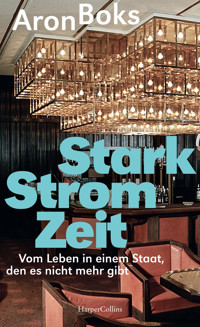
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was bleibt, wenn das Licht der Zukunft erlischt? Eine ungewöhnliche DDR-Geschichte über Konsum und Design
In einer alten DDR-Zeitschrift entdeckt Aron Boks eine Lampe – entworfen von seinem Großvater. Mit einem eigenen Leuchten- und Dekorationsbetrieb gehörten seine Großeltern zu den wenigen Selbständigen in der DDR. Für den privaten Verkauf entwarfen sie Lampen mit Stoffschirmen, Troddeln und Bommeln. Gleichzeitig erhielten sie staatliche Aufträge für Hotels und Ferienheime, in denen mit ihren futuristisch anmutenden Glasmodulen der Sozialismus erstrahlte.
Nach der Wende verschwinden die Leuchten – und mit ihnen die Geschichte dahinter. Aron Boks begibt sich auf Spurensuche und erzählt dabei eine persönliche, ungewöhnliche Geschichte der DDR. Es geht um Konsum und Design, Erinnern und die Frage, wie Gegenstände weiterleuchten, lange nachdem das System, das sie hervorgebracht hat, untergegangen ist.
»Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, auf dieses Foto in der DDR-Zeitschrift zu gucken, die noch von den Leuchten und den Ideen meines Großvaters vor der Wende erzählt. Ich wollte endlich etwas haben, das ich anfassen, das ich greifen und benutzen kann. Ich wollte nicht akzeptieren, dass mir ein Teil meiner Geschichte durch das Ausmisten der Geschichte anderer versperrt bleibt.«
»Ähnlich wie Lukas Rietzschel in seinen Romanen beeindruckt Aron Boks durch seinen offenen und vorurteilsfreien Blick auf die jüngere Geschichte.«
Tino Dallmann, MDR Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Wieviel DDR steckt in uns?
1995 wirft Rolf Bültemann sein letztes Stück DDR-Karriere auf den Müll. Einen Haufen Lampen, die damals nichts und heute richtig viel wert wären. Das war kurz vor Aron Boks' Geburt. Und kurz nach der Wende. Rolf Bültemann war sein Großvater.
Was hat es mit den Lampen auf sich, von denen Aron Boks' Großmutter bis heute erzählt?
Um das zu verstehen, reist Aron Boks zurück in die Geschichte. Dabei folgt er seinen Großeltern ins VEB Elektromotorenwerk in Wernigerode, einem Großbetrieb mit fast 3000 Beschäftigten, der nach der Wende in seiner damaligen Form verschwindet und vielen bis in die Gegenwart fehlt.
Aron Boks, der die DDR selbst nie erlebt hat, will wissen, was dieser Staatsbetrieb für Spuren hinterlassen hat. Und was es für Menschen bedeutet, wenn sie etwas suchen, das es nicht mehr gibt. Hautnah führt er uns dabei die Drastik der Wendezeit vor Augen. Denn während der Traum seiner Großeltern zerbirst, beginnt für seine Eltern die Zeit ihres Lebens …
Zum Autor
Aron Boks wurde 1997 in Wernigerode geboren und lebt als Autor, Slam Poet und Moderator in Berlin-Charlottenburg. 2019 erhielt er den Klopstock-Förderpreis für Neue Literatur. Seit 2021 schreibt er vor allem für die taz und die taz.FUTURZWEI-Kolumne »Stimme meiner Generation«. 2023 erschien sein Buch »Nackt in die DDR«, in dem er sich auf die Lebensspuren seines Urgroßonkels, dem Künstler und Funktionär Willi Sitte begibt. Das Buch fand großes Medienecho. Aron Boks selbst hat die DDR nie erlebt. Die Recherche und Arbeit am Buch bedeuteten für ihn auch den Zugang in die verstärkte Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Geschichte und ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Neben seiner Schreibtätigkeit moderiert Boks zu diesem Thema Literatur- und Gesprächsveranstaltungen mit Nachwendekindern aus Ost- und Westdeutschland.
Aron Boks
Starkstromzeit
Vom Leben in einem Staat, den es nicht mehr gibt
HarperCollins
Originalausgabe
© 2025 by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 ∙ 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von ullstein bild
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN9783749907496
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte des Urhebers und des Verlags bleiben davon unberührt.
»denn nichts anderes ist Schreiben als: Beispiele anbieten.«
– Christa Wolf, »Nachdenken über Christa T.«, 1968
1. New York City, 45 Green Street, April 2025
Ich glaube, ich habe ein Klingeln erwartet. Oder irgendetwas anderes, das mehr an einen Antiquitätenladen erinnert. Auf dem roten Schild über dem Eingang steht Artemide, und der Laden wirkt so ziemlich wie das Gegenteil von antiquiert: ein helles Designerlampengeschäft in SoHo, einer der angesagtesten Gegenden Manhattans.
Die Verkäuferin ist keine gebückte grauhaarige Frau, die unter einem Berg alter Uhren und vergilbter Büchern hervorlugt, sondern eine Mittvierzigerin mit orangebraunem Pagenschnitt und enganliegendem Kleid, die zur Begrüßung professionell lächelt. Ich sehe aber kaum zu ihr hin, sondern zu der schwarzen Lampe, die auf einem beleuchteten weißen Podest steht. »Das ist sie«, rufe ich aufgeregt und deute mit ausgestrecktem Zeigefinger darauf.
»Kann ich helfen?«
»Mein Großvater hat diese Lampe gebaut!«, sage ich. »In the DDR!«
Die Verkäuferin zieht die Augenbrauen zusammen, macht eine ausladende Handbewegung und offenbart ihren englisch-italienischen Akzent: »DDR?«
»Like in the GDR.«
Ich zeige ihr das Schwarzweißfoto eines Schreibtischs auf meinem Handy und zoome auf die schwarze Lampe im Industrial Look mit Pendel, es ist das gleiche Modell, das vor uns auf dem Podest steht. »Mein Großvater hat diese Lampe gebaut!«
»Ahhh!«
Ich drehe mich um. Meine Großmutter inspiziert das Preisschild einer kleinen Lampe im Eingangsbereich, und meine Mutter mustert den rotfunkelnden Kopf einer Stehleuchte daneben. Ich wende mich wieder zur Verkäuferin und deute aufs Podest.
»Jedenfalls, ich würde diese Lampe gern kaufen.«
»Sie kostet fünfhundertfünfundsiebzig Dollar.«
»Ich zahle mit Karte.«
»Sehr gut«, sagt sie. »Sie bekommen die Lampe aus einem unserer Lager geliefert. So in drei oder vier …«
»Nein, nein«, unterbreche ich sie. »Ich muss sie sofort mitnehmen.«
Die Verkäuferin entschuldigt sich, lächelt mir mitleidig zu und setzt sich an ihren Arbeitsplatz im hinteren Bereich des Raumes. Ich sehe wieder zu meiner Mutter und meiner Großmutter, die jetzt gemeinsam durch den aktuellen Produktkatalog blättern, während ich die ganze Zeit an die DDR denke.
»Also es gibt noch eine Leuchte, die ein Kunde bestellt, aber nicht abgeholt hat«, sagt die Verkäuferin hinter ihrem Computer. »Wenn Sie wollen …«
»Ja, ja! Die nehme ich«, sage ich und zeige ihr noch einmal das Foto. »Sehen Sie? Das ist wirklich die Lampe, die mein Opa gebaut hat!«
Die Verkäuferin gibt mir zwanzig Prozent Rabatt.
2. Bonn, Rathausgasse 22–24, Januar 1988
»Ihr kommt aus der Zone?«, fragt der Ladenbesitzer mit einem seltsamen Dialekt und einer Mischung aus Irritation und Bewunderung.
»Aus der DDR!«, antwortet Barbara höflich, während ihr Blick aufgeregt durch den funkelnden Laden wandert und sich auf die schwarze Lampe mit dem Pendel und dem Reflektor richtet, die Rolf ein- und ausschaltet. Der Ladenbesitzer sieht ihnen irritiert dabei zu. Er hat selten Kunden, die nur zufällig in sein Einrichtungshaus mitten im Bonner Zentrum stolpern und dann fast ausschließlich über die Funktionsweise von Leuchten sprechen wollen. Und vor allem kommen die dafür nicht extra aus der DDR. Aber die beiden hier suchen nach Inspiration.
»Schwachstrom«, sagt Rolf mehr zu sich selbst, während er wieder auf den Schalter der Leuchte drückt. DDR, denkt der Verkäufer – das ist viel weiter weg als Frankreich oder Belgien. DDR, das ist »der schwarze Kanal« und grauer Alltag mit Mischbeton. Jedenfalls kein Land, in dem sich Leute für italienische Designerleuchten, Transformatoren und Halogen interessieren. Bonn, denkt Barbara und sieht in das liebevoll eingerichtete Schaufenster, in dem die schlichten roten und schwarzen Stehleuchten wie höfliche Kellner mit Speisekarten stehen, die sie und Rolf auf ihrem gestrigen Streifzug durch Köln umworben hatten. Gestern waren sie auch im Kaufhof in der Nähe des Doms, zusammen mit ihrem Cousin und seiner Frau, die in der Nähe von Bonn leben.
Der offizielle Grund ihrer Westreise lautet »G81« – so der Vermerk der Stasi. Bedeutet: der 81. Geburtstag von Barbaras Tante und die Erwartungshaltung, etwas Zeit mit der Familie zu verbringen.
»Ich weiß ja noch, wie es bei euch drüben ausgesehen hat. Kinder, nee«, hat Christel, die Frau des Cousins und gebürtige Harzerin, immer wieder gesagt und an ihre letzte DDR-Reise erinnert. »Wie man einfach nüscht zu fressen bekommt.« Während die anderen routiniert durch die Gänge von Kaufhof spazierten, blieben Rolf und Barbara überall stehen. Mit dem gleichen Glitzern in den Augen wie die Kinder, die sich draußen an den Schaufenstern mit den Steiff-Stofftieren die Nasen plattdrückten. Barbara kaufte dann Haarspangen für ihre Töchter, ohne auf den Preis zu schauen, was ihr erst bewusstwurde, als Christel sich auch darüber empörte: »Nein, wie man für so ein bisschen Klimperkram so viel Geld ausgeben kann!«
Als sie tags darauf das Geschäft in Bonn verlassen, eilt ihnen der Besitzer hinterher. »Moment«, ruft er, und als die beiden sich umdrehen, überreicht er ihnen den knallgelben Katalog, auf dem in schwarzer Schrift Artemide steht. Er sei eigentlich unverkäuflich. Sie würden die sonst niemals an Kunden geben, hatte ein Mitarbeiter vorhin noch gesagt.
»Ein Geschenk für Sie und Ihre Zukunft«, sagt der Besitzer bewegt und schaut erst Rolf, dann Barbara in die Augen. »Nur passen Sie gut darauf auf, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Barbara trägt den Katalog schützend unter ihrer Jacke wie ein Lebewesen, bis sie im Haus ihrer Verwandten angekommen sind. Sie sieht noch einmal auf den Namen: Artemide. So sehen also Westleuchten aus, denkt sie, und daran, noch nie etwas von dieser Firma gehört zu haben, genau wie vermutlich auch die Vopos an der Grenze nicht. Barbara versteckt alles unter einem Berg Klamotten und drei Packungen Milka Schokolade. Falls der Herr bei der Kontrolle Süßes mag.
Ein paar Tage später sind meine Großeltern wieder mit ihrem Leuchtenbau- und Dekorationsglas-Betrieb beschäftigt. Während Barbara morgens Glasgefäße herstellt und am Nachmittag bereits die Aufträge für das Jahr 1990 entgegennimmt, studiert Rolf die Maße der schwarzen Leuchte, die es ihm aus dem Bonner Geschäft besonders angetan hat. Sie trägt den Namen Tizio. Der in Mailand lebende Münchner Industriedesigner Richard Sapper entwirft sie 1972 aus einem Problem heraus. Er findet einfach keine Arbeitsleuchte, die seinen Ansprüchen gerecht wird. Das liegt weniger an materiellen Schwierigkeiten, da Richard Sapper zu dieser Zeit als einer der erfolgreichsten Produktdesigner der Welt gilt. Was ihn an handelsüblichen Leuchten stört, ist vor allem, dass sie das Licht diffus verteilen und einen dabei blenden, anstatt es präzise auf die gewünschte Fläche zu richten. Außerdem brauchen die meist so viel Verkabelung und Raum, was für unordentliche Menschen wie ihn zum Verhängnis wird. Also entwirft Sapper eine Lampe, die sich durch ein angebrachtes Gegengewicht mühelos der Umgebung anpasst, einen präzisen Reflektor besitzt und deren breiter Schwenkarm über jedes Chaos hinwegreicht und durch den »Schwachstrom«, also Niederspannung, fließt.
Die Leuchte gewinnt 1979 den Compasso d’Oro, den renommiertesten Designpreis der Welt, und wird wenig später zu einer der populärsten Designleuchten der Welt. Rolf weiß das zu diesem Zeitpunkt nicht und kennt auch nicht die Sorgen des italienischen Artemide-Gründers Ernesto Gismondi. »Sie wird überall gekauft – und kopiert. Auf der halben Welt mussten wir gegen Plagiatoren vorgehen. Tizio wurde kopiert in Taiwan, Brasilien, in der Türkei – einfach überall.« 1
So auch im Juni 1988 in der Deutschen Demokratischen Republik.
Rolf ist von Tizio fasziniert. Licht auf Draht. Eine Lampe, die ohne große Verkabelung, »ohne Schnickschnack«, wie er sagt, auskommt. Er findet, dass sich diese Lampe mit ihrem minimalistischen Design perfekt für seine Tochter eignet, die in diesem Jahr auf die Erweiterte Oberschule (EOS) wechseln soll, um dort ihr Abitur zu machen. Rolf ist kein Mann der großen Ratschläge oder emotionalen Gespräche. Er arbeitet mit den Händen. Also steckt er das, was er übers Leben gelernt hat, in dieses neue Modell. Eine Lampe, die sich nicht beeindrucken lässt vom Schein der Konkurrenz, die sich den Verhältnissen anpasst, zielorientiert ist – vor allem ohne Effekthascherei. Die Materialien dafür sind schwer zu bekommen, besonders der Transformator, der Netzspannung in Kleinspannung umwandelt und unerlässlich für die Lampe ist. Also greift er auf die Hilfe seiner ehemaligen Arbeitskollegen im VEB Elektromotorenwerke Wernigerode zurück, die so etwas unbemerkt aus dem Betrieb mitgehen lassen können.
Im Sommer noch vor dem neuen Schuljahr ist die Leuchte fertig. Kurz darauf wird sie von Barbara fotografiert, die den Film beim Fotografen entwickeln lässt. Sie findet sie so schön, dass sie damit bei einem Preisausschreiben der »Kultur im Heim« teilnehmen will. Das Magazin für Wohnraumgestaltung in der DDR.
»Barbara, glaubst du echt, dass wir das machen können?«
»Warum nicht?«, fragt sie und bringt das Kuvert mit den Fotos und das Anschreiben, das sie in Rolfs Namen verfasst hat, zur Post.
Im Oktober 1988 erhalten sie eine Antwort:
»Wir senden Ihnen die Farbfotos mit bestem Dank zurück und sind in der Redaktion sehr wohl der Meinung, daß Sie sich am Leuchtenbauwettbewerb beteiligen sollten. Es ist völlig unwesentlich; ob Autodidakt oder studierter Formgestalter etc.«
Die Redakteurin ist etwas übermütig, denn die Ausschreibungsregeln lassen doch nur studierte Formgestalter zu – eine Bezeichnung, die vor allem seit den 1970ern für Produktdesigner in der DDR geläufig ist und mit einem gesellschaftlichen Auftrag einhergeht. Allerdings ist die Redaktion von der neuartigen sozialistischen Handarbeit meiner Großeltern so beeindruckt, dass sie bei den beiden vorbeikommen wollen, um in einer der nächsten Ausgaben den Betrieb »Bültemann Leuchtenbau & Dekorationsglas« vorzustellen.
»Nachdem er zunächst vor allem großflächige farbige Lichtgestaltungselemente für gesellschaftliche Bedarfsträger ausgeführt hat, befaßt er sich jetzt intensiv mit der Herstellung von Leuchten für den individuellen Bedarf. Dabei liegt ihm die Entwicklung unkonventioneller Leuchtenmodelle besonders am Herzen.« 2
Der Text mit der Überschrift »Zeitgemäßes Licht« erscheint in der Ausgabe Juli/August 1989. »Bei Einzelanfertigungen berücksichtigt er [Rolf Bültemann] die Wünsche der Kunden weitestgehend«, heißt es zum Ende. »Sein eigentliches Ziel aber sind Kleinserien 3 .«
3. Wernigerode, Zwölfmorgental 7, 1984
Als mein Großvater kurz vor Weihnachten 2019 stirbt, sind er und meine Großmutter seit über 50 Jahren ein Paar. Sie lernen sich im Oktober 1969 kennen. An einem Wochenende, an dem in Wernigerode die Balkone und Schaufenster mit DDR-Flaggen für den 20. Geburtstag der Republik geschmückt werden, in Berlin der neue Fernsehturm eingeweiht wird und mein Großvater meine Großmutter am Einlass einer Party vorbeischmuggelt, um mit ihr zu tanzen.
An diesem Abend wissen die beiden, dass sie zusammenbleiben wollen und merken doch bald, dass sie in vielen Dingen grundverschieden sind: Barbara streitet gern, Rolf flieht lieber. Er ist Einzelkind, sie ist das Jüngste von vier Geschwistern. Sie kommt aus einer Kommunistenfamilie, seine besteht aus alten Sozialdemokraten und einem Opa, der ihm zur Jugendweihe in den 1960ern ein Silberbesteck mit Hakenkreuzen schenkt, »ein Familienerbstück!«. In seiner Familie gibt es viele gelernte Kaufleute, in Barbaras interessiert man sich für Kunst. Allerdings ähneln sie sich von Anfang an, wenn sie sich von ihren Zukunftsträumen erzählen: Rolf sagt dann, dass er schon als Kind am liebsten Dinge gezeichnet hat, die es noch nicht gibt, und Barbara, dass sie ihr Leben und das von anderen vor allem mit schönen Dingen umgeben will.
Anfang der 1980er-Jahre beginnen sie gemeinsam Kunsthandwerk aus Glas herzustellen. Rolf ist zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und entwirft die meisten ihrer Leuchten. Meine Großmutter zählt laut dem Gewerbeamt als »helfende Ehefrau«. Sie ist vier Jahre jünger als Rolf und übernimmt im Geschäft die kleineren Handwerksarbeiten, Kostenplanungen und Telefongespräche, bei denen sie die Adresse ihres Unternehmens wie einen Märchennamen durchgibt: Zwölfmorgental. Hier steht ihr Wohnhaus, aber auch ihre Garage und ihr Geschäft.
Bevor Barbara einen Beruf lernte, hatte sie keine Vorstellung für das große Ganze, das ihr stets nahegelegt wurde, sehen zu lernen. Stattdessen richtet sich ihr Blick als Mädchen immer auf die kleinen Freuden des Alltags. Sie weiß noch, wie sie mit dem Kopf in den Wolken im letzten Sommer nach der zehnten und letzten Klasse der Polytechnischen Oberschule (POS) neben einem Freund ihrer Schwester, einem Offizier namens Schicki, lief und auf seinen unromantischen Monolog zum Thema Lichtverschmutzung in den Nachthimmel zeigte. »Aber siehst du nicht, wie die Sterne leuchten?« Und sie weiß, wie heiß es war und wie sie barfuß in Pfützen gesprungen ist und versucht hat, den grummeligen Offizier zum Lachen zu bringen. »Guck mal Schicki, meine Füße werden ganz dreckig.« Da hatte er sie von oben bis unten gemustert. »Ja Bärbel, genau wie dein Charakter.«
Das hatte gesessen. Das große Ganze hat sie zwar immer noch nicht gesehen, aber versucht etwas Sinnvolles in einer Anstellung als Mitarbeiterin in der Abteilung Kultur im Rat des Kreises, einer Art Kreisrat im Herrschaftsapparat der SED, zu finden.
Etwa 1971 tritt sie begeistert in die Partei ein, liest Marx, Feuerbach, Lenin und wird durch einen Kaderplan der Partei zum Fernstudium 4 der Kulturwissenschaften in Meißen delegiert, um perspektivisch als Funktionärin im Bereich Kultur zu arbeiten. Parallel arbeitet sie im Rat des Kreises in einer reinen Frauenabteilung mit einem Mann an der Spitze. Mit diesem versteht sich Barbara vom ersten Tag an richtig gut, weil der ihre aufgeweckte und interessierte Art mag. Den Blick für das Besondere und ihre jugendliche Naivität. So sehr, dass er sie eines Tages bittet, ihre Gehaltsabrechnungen persönlich von seinem Schoß abzuholen und ihm zum Dank einen Kuss zu geben. Sie gibt ihm eine Ohrfeige, und kurz darauf ist ihr Chef nicht mehr da. Er wird in die SED-Bezirksleitung nach Magdeburg befördert.
Rolf hat vorher bei einem Elektriker im Privatbetrieb gelernt und wollte wie Barbara per Fernstudium studieren. Das geht allerdings nur per Delegation von Volkseigenen Betrieben und in Rolfs Fall über den VEB Elektromotorenwerk Wernigerode. Dort arbeiten über 3000 Menschen. Das Elmo, wie das Werk auch genannt wird, hat ein Veranstaltungshaus mit Kantine, eine Kampfgruppe 5 , eine Betriebskrippe und Kitas, Freizeitzirkel mit Laientheater oder Singclubs, Parteigruppe und Massenorganisationen und vieles mehr – eine Art kleine DDR zwischen den Werkstoren und wie alle Volkseigenen Betriebe der DDR als »soziale Heimat« der Menschen gedacht.
1980 arbeiten über 80 Prozent der Werktätigen der DDR in solchen Betrieben. Außerdem finanziert das Elmo Sportplätze, Wohnungen und Feste in der Stadt. »Mutter Elmo« nennen die ehemaligen Arbeiter den Betrieb bis heute und erinnern sich dabei an ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Vielleicht war dieses auch der Grund, wieso Rolf – der seit Februar 1971 dort als Elektriker und später als Ingenieur für elektrische Anlagen tätig ist – nach anfänglichem Unbehagen stellvertretender Abteilungsleiter werden will. Dass er dafür in die Partei eintreten soll, ist ihm klar. Man will ausgebildete »Kader«. Doch bei wachsender Verantwortung stößt er auf eine ziemlich späte Erkenntnis: Er fürchtet sich vor der Sache, die ausgerechnet das Lebenselixier eines Elektromotorenwerkes ist: Starkstrom. Als Privatelektriker ging es um Leitungen und Steckdosen, nicht um diese Industrieanlagen, durch die 1000 Volt-Strom schießt und die so sorgfältig gesichert werden müssen, da eine Nachlässigkeit reicht, sein eigenes Leben oder das der Kollegen aufs Spiel zu setzen. Immer wieder muss er in Bereitschaft ausrücken, auf Anschlag sein, Anlagen warten und aufpassen, dass nichts passiert. Der Druck wird nicht unbedingt weniger, wenn sein Chef neuerdings immer euphorischer von seinen Karrierechancen spricht. »Rolf, wenn ich in Rente bin, dann kannst du das hier alles übernehmen. Dann hast du das Sagen!«
Eines Nachts wacht Barbara auf und sieht, wie Rolf schlafend, dafür aber mit weit aufgerissenen Augen auf dem Ehebett steht und sie anfährt: »Hilf mir und gib mir einen Hammer!« Doch Barbara hat eine bessere Idee: Die beiden brauchen einen Neuanfang.
Nach dem Machtantritt des Ersten Sekretärs des ZK der SED Erich Honecker und einer großangelegten Verstaatlichungswelle im Jahr 1972 werden in der gesamten DDR alle verbliebenen privaten oder halbstaatlichen Betriebe und mittelständische Unternehmen von Parteibeschlüssen gelenkt. Alles soll einheitlich, kontrolliert und zentral gesteuert ablaufen. Trotzdem gibt es nach 1972 weiterhin Selbstständige. Sie machen etwas mehr als zwei Prozent der Bevölkerung aus. Zudem verbleiben im Handwerk, Kleinhandel und in der Gastronomie weiterhin Privatunternehmen, zu denen etwa 85000 Handwerksunternehmen und 40000 Unternehmen in Gastronomie und Einzelhandel zählen. Im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten ist der Privatsektor in der DDR ab den 1980er-Jahren sogar deutlich vielfältiger und – gemessen an Beschäftigtenzahlen und wirtschaftlicher Leistung – größer als etwa in Polen oder Ungarn. Dabei stehen deren Regierungen Privatisierungen und gesellschaftlichen Liberalisierungen unter sowjetischem Einfluss weitaus aufgeschlossener gegenüber als die SED. Die Partei versucht eigentlich, Eigeninitiativen aus Schutz der eigenen Herrschaft zu unterbinden. Als sich aber bereits Anfang der 1970er-Jahre Engpässe im Bau von Prestigeprojekten wie etwa dem Wohnungsbauprogramm abzeichnen, beschließt der Ministerrat mehrere Fördermaßnahmen wie etwa bessere Materialversorgung und Steuererleichterung, um die Zahl der Selbstständigen nicht sinken zu lassen. 6 Als mein Großvater seinen Antrag auf die Genehmigung eines Gewerbes stellt, übertrifft die Anzahl der Menschen, die ebenfalls einen solchen Antrag stellen, die der zu vergebenden Genehmigungen.
Die Witze der DDR-Bürger kommentieren die Lebensrealität: »Die vier Hauptfeinde beim Aufbau des Sozialismus? Frühling, Sommer, Herbst und Winter«, gleichzeitig genießen die Elektriker, Maurer, Klempner, Dachdecker und Friseure ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Und auch wenn die Partei mit Blick auf Privatbetriebe oft argwöhnisch bleibt, zählen meine Großeltern zum Zeitpunkt als sie ihren Betrieb führen zu den privilegiertesten Personen der DDR. 7 Die Privatbetriebe werden vom Staat vor allem deswegen geduldet, weil sie zu denen gehören, die die Lücken und Fehlkalkulationen in der viel zu eng gestrickten, aber nun einmal nicht änderbaren Planwirtschaft ausgleichen können.
1984 machen sich meine Großeltern mit ihrem Kleinstbetrieb »Bültemann Leuchtenbau & Dekorationsglas« selbstständig. Aus ihrer Garage heraus verkaufen sie selbsthergestellte Wohnraumleuchten und dekorative Glasgefäße. Monat für Monat fertigt Barbara über 100 Glasvasen für einen Dresdner Gartenbaubetrieb an, dessen Fahrer verlässlich jeden Monat in den Harz fährt, bis der Betrieb ihm das aufgrund von Benzinengpässen untersagt. Der Großbetrieb hatte seine Konsumgüterproduktion bei ihnen ausgelagert. Die Warenproduktion jedes Großbetriebs muss zu diesem Zeitpunkt auch aus Konsumgütern bestehen. Der Beschluss kommt aus der Führungsetage der SED unter Honecker. Ein Großteil der Bevölkerung, so die Analyse Honeckers, ist unzufrieden und will nicht weiter für eine irgendwann zu realisierende Utopie arbeiten, sondern bitte jetzt