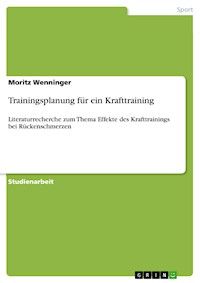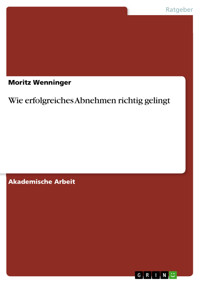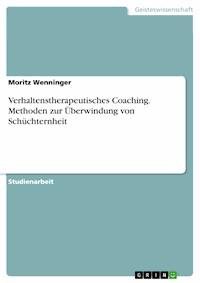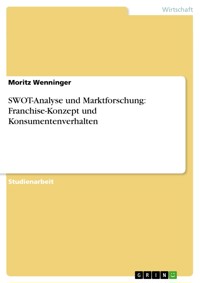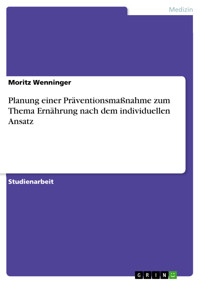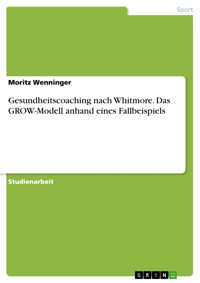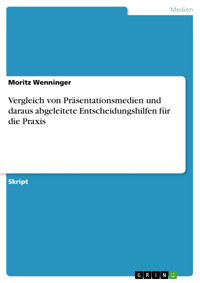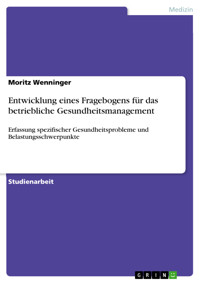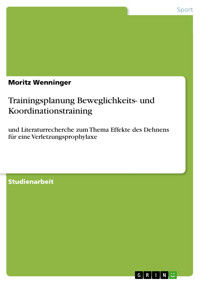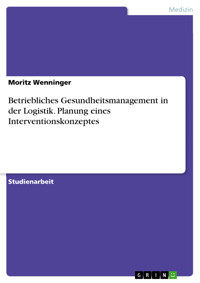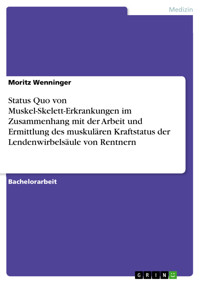
Status Quo von Muskel-Skelett-Erkrankungen im Zusammenhang mit der Arbeit und Ermittlung des muskulären Kraftstatus der Lendenwirbelsäule von Rentnern E-Book
Moritz Wenninger
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Gesundheit - Sonstiges, Note: 1,3, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: „Muskuloskelettale Erkrankungen sind weltweit die führende Ursache von chronischen Schmerzen, körperlichen Funktionseinschränkungen und Verlust an Lebensqualität“ (RKI, 2013). Da die meisten Erkrankungen mit zunehmendem Alter auftreten, geht die WHO aufgrund der demografischen Entwicklung davon aus, dass die Anzahl der Betroffenen hinsichtlich Knochen- und Gelenkerkrankungen in den kommenden 20 Jahren zunehmen wird (ebd). Betrachtet man die Gesundheitsberichte der Krankenkassen, so zeigt sich seit Jahren unverändert, dass Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) aufgrund langer Ausfallzeiten (AU Tage) einen sehr hohen Anteil an den Krankenständen aufweisen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beziffert den Verlust an Arbeitsproduktivität (Ausfall an Bruttowertschöpfung, volkswirtschaftliche Betrachtung) auf Grund der Fehlzeiten jährlich auf 78 Mrd. Euro. Da Muskel-Skelett-Erkrankungen einen hohen Anteil des Fehlzeitengeschehens ausmachen, wird erkennbar, welche Bedeutung dieser Bereich für Unternehmen hat. Auffallend ist, dass sowohl Frauen als auch Männer Rückenschmerzen als häufigste körperliche Beschwerde nennen (Zok, 2010, S. 77). Diese sind in Deutschland eine Gesundheitsstörung von herausragender epidemiologischer, medizinischer und gesundheitsökonomischer Bedeutung. „So sind Rückenleiden ein besonders häufiger Grund für die Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems, Arbeitsunfähigkeit und Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung“ (Raspe, 2012, S. 7). Da Rückenschmerzen die zweithäufigste Einzeldiagnose an AU Tagen und AU Fällen sind (Meyer, Mpairaktari & Glushanok, 2013, S. 293) und diese mit steigendem Alter immer häufiger beklagt werden (Zok, 2010, S. 79), lässt sich unter dem Aspekt des demografischen Wandels und der damit verbundenen Alterung der Erwerbstätigen (Esslinger & Singer, 2010, S. 101), erahnen, welch immense Bedeutung insgesamt der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen beigemessen werden sollte. Goebel et. al (2005, S. 388 ff.) haben festgestellt, dass die Kräftigung der Lendenwirbelsäule (LWS) signifikant lumbale Rückenschmerzen reduzieren kann. Daraus resultiert die Fragestellung, inwieweit der Kraftstatus der Lendenwirbelsäule im Zusammenhang mit dem Erleiden von Rückenschmerzen steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung und Problemstellung
2 Zielsetzung
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
3.1 Belastungen und Erkrankungen im Zusammenhang mit der Arbeit
3.1.1 Psychische Störungen und Belastungen
3.1.2 Körperliche Erkrankungen und Belastungen
3.2 Aktueller Forschungsstand Muskel-Skelett Erkrankungen im Zusammenhang mit der Arbeit in Deutschland
3.2.1 Klassifikation
3.2.2 Epidemiologie
3.2.3 Ursachen
3.2.4 Folgen
3.2.5 Prävention
3.3 Arbeitsschutz
3.3.1 Definition
3.3.2 Abgrenzung
3.3.3 Inhalt und Ablauf
3.4 Betriebliche Gesundheitsförderung
3.4.1 Definition
3.4.2 Abgrenzung
3.4.3 Inhalt und Ablauf
3.5 Betriebliches Gesundheitsmanagement
3.5.1 Definition
3.5.2 Abgrenzung
3.5.3 Inhalt und Ablauf
3.6 Die isometrische Kraftmessung zur Leistungsdiagnostik im Gesundheits- und Freizeitsport
3.6.1 Verbreitung isometrischer Kraftmessungen im Gesundheits- und Freizeitsport
3.6.2 Zweck und Interpretation von isometrischen Kraftmessungen
3.6.3 Die Rückenanalyse bei Kieser Training
4 Methodik
4.1 Untersuchungsobjekte
4.2 Untersuchungsdurchführung
4.3 Datenauswertung
4.4 Geräte und Hilfsmittel
4.5 Statistik
5 Ergebnisse
5.1 Ergebnisdarstellung der Fragebögen und Rückenanalysen der Männer
5.2 Ergebnisdarstellung der Fragebögen und Rückenanalysen der Frauen
6 Diskussion
6.1 Interpretation der Ergebnisse der Fragebögen
6.2 Interpretation der Ergebnisse der Rückenanalysen
6.3 Bezug auf den gegenwärtigen Kenntnisstand
6.4 Methodendiskussion
6.5 Schlussfolgerung und Ausblick
7 Zusammenfassung
8 Literaturverzeichnis
9 Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis
9.1 Tabellenverzeichnis
9.2 Abbildungsverzeichnis
9.3 Abkürzungsverzeichnis
Anhang
1 Einleitung und Problemstellung
„Muskuloskelettale Erkrankungen sind weltweit die führende Ursache von chronischen Schmerzen, körperlichen Funktionseinschränkungen und Verlust an Lebensqualität“ (RKI, 2013). Da die meisten Erkrankungen mit zunehmendem Alter auftreten, geht die WHO aufgrund der demografischen Entwicklung davon aus, dass die Anzahl der Betroffenen hinsichtlich Knochen- und Gelenkerkrankungen in den kommenden 20 Jahren zunehmen wird (ebd).
Betrachtet man die Gesundheitsberichte der Krankenkassen, so zeigt sich seit Jahren unverändert, dass Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) aufgrund langer Ausfallzeiten (AU Tage) einen sehr hohen Anteil an den Krankenständen aufweisen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) beziffert den Verlust an Arbeitsproduktivität (Ausfall an Bruttowertschöpfung, volkswirtschaftliche Betrachtung) auf Grund der Fehlzeiten jährlich auf 78 Mrd. Euro. Da Muskel-Skelett-Erkrankungen einen hohen Anteil des Fehlzeitengeschehens ausmachen, wird erkennbar, welche Bedeutung dieser Bereich für Unternehmen hat.
Auffallend ist, dass sowohl Frauen als auch Männer Rückenschmerzen als häufigste körperliche Beschwerde nennen (Zok, 2010, S. 77). Diese sind in Deutschland eine Gesundheitsstörung von herausragender epidemiologischer, medizinischer und gesundheitsökonomischer Bedeutung. „So sind Rückenleiden ein besonders häufiger Grund für die Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems, Arbeitsunfähigkeit und Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung“ (Raspe, 2012, S. 7). Da Rückenschmerzen die zweithäufigste Einzeldiagnose an AU Tagen und AU Fällen sind (Meyer, Mpairaktari & Glushanok, 2013, S. 293) und diese mit steigendem Alter immer häufiger beklagt werden (Zok, 2010, S. 79), lässt sich unter dem Aspekt des demografischen Wandels und der damit verbundenen Alterung der Erwerbstätigen (Esslinger & Singer, 2010, S. 101), erahnen, welch immense Bedeutung insgesamt der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen beigemessen werden sollte.
2 Zielsetzung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen Status Quo von Muskel-Skelett-Erkrankung im Zusammenhang mit der Arbeit (Berufstätigkeit) aufzuzeigen.
Damit verbunden soll der Kraftstatus der Lendenwirbelsäule bei der Berufsgruppe der Rentner, mittels Rückenanalyse bei Kieser Training, erhoben und analysiert werden.
In diesem Kontext beleuchtet die Bachelor-Thesis allgemein Belastungen und Erkrankungen im Zusammenhang mit der Arbeit, die als potentielle Risikofaktoren für die Entstehung von Muskel-Skelett-Erkrankung angesehen werden können, um so Empfehlungen und Maßnahmen für die Prävention dieser geben zu können.
Im theoretischen Teil der Arbeit werden weiterhin die für die Prävention relevanten Begriffe Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement definiert, abgegrenzt und inhaltlich erläutert.
Die Zweckmäßigkeit der Analysemethode der isometrischen Kraftmessung wird dargelegt und dementsprechend die Rückenanalyse (RA) bei Kieser Training als Erhebungsmittel herangezogen und charakterisiert.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
3.1 Belastungen und Erkrankungen im Zusammenhang mit der Arbeit
3.1.1 Psychische Störungen und Belastungen
„Immer mehr Menschen haben mit einem immer schnelleren Wandel von Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen zu kämpfen. Sie können das Gleichgewicht zwischen Belastungs- und Bewältigungspotentialen nicht mehr aufrechterhalten und werden krank“ (Kickbusch, 2005, S. 15, zitiert nach Keupp & Dill, 2010, S. 43).
Psychische und Verhaltensstörungen werden nach dem internationalen ICD-10-Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen klassifiziert. ICD steht dabei für International Classification of Diseases. Dabei werden elf Diagnosegruppen unterschieden, die an der ersten Stelle mit dem Buchstaben F kodiert werden und durch die zwei folgenden Ziffern eine spezifische Diagnose zugeordnet bekommen (Bamberg, Ducki & Metz, 2011, S. 67). Folgend eine Übersicht davon:
Abb. 1: Übersicht psychischer Störungen nach dem ICD-10-Klassifikationssystem (Bamberg, Ducki & Metz, 2011, S. 67)
Nach der 10. Revision wird auch nicht mehr von psychischen Erkrankungen, sondern von Störungen gesprochen, da dies in Fachkreisen als die neutrale Bezeichnung gilt. Dementsprechend wird im Folgenden die Bezeichnung psychische Störung benutzt (Kamp & Pickshaus, 2011, S. 70).
Seit 2001 haben die Krankheitstage aufgrund psychischer Störungen um nahezu 67 % zugenommen. Auch die durchschnittliche Falldauer psychischer Störungen ist mit 24,9 Tagen je Fall mehr als doppelt so lang, als der Durchschnitt mit 11,8 Tagen je Fall im Jahr 2012. Datenbasis der Erkenntnis und der nachfolgenden Grafik bilden die 11 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitglieder in Deutschland (Meyer, Mpairaktari & Glushanok, 2013, S. 263).
Abb. 2: Tage der Arbeitsunfähigkeit der AOK-Mitglieder nach Krankheitsarten in den Jahren 2002-2012 (Meyer, Mpairaktari & Glushanok, 2013, S. 291)
Die Grafik spiegelt die oben getroffene Aussage exakt wieder, so stellt das Jahr 2001 die 100 % Ausgangsmarke dar, wobei sich im Laufe der Jahre bis 2012 die AU Tage aufgrund von psychischen Störungen um knapp 67 % erhöht haben.
Dieser enorme Anstieg schlägt sich neben dem Ausfall der Arbeitsleistung auch in den damit verbundenen Behandlungskosten von psychischen Störungen nieder, die im Jahre 2008 etwa 28,6 Milliarden Euro betrugen und ebenfalls kontinuierlich seit 2002 angestiegen sind (statista, 2014). Anzumerken ist hier, dass es sich nur um die direkten Behandlungskosten handelt, die der zweijährigen Kostenrechnung des Statistischen Bundesamtes entstammen. Dabei führt das Statistische Bundesamt keine eigene Erhebung durch, sondern greift auf bereits vorhandene Daten innerhalb und außerhalb der amtlichen Statistik zurück und führt diese in geeigneter Weise zusammen. Dadurch entsteht eine zeitliche Verzögerung, so wurden die Daten des Jahres 2008 erst im Jahre 2010 ermittelt. Bei dieser Krankheitskostenrechnung werden ausschließlich laufende Gesundheitsausgaben einzelnen Krankheiten zugeordnet, d. h. dass Investitionen wegen ihres Vorleistungscharakters und der damit verbundenen Zuordnungsproblematik unberücksichtigt bleiben (Böhm & Cordes, 2010, S. 51).
Ebenfalls unberücksichtigt bleiben die indirekten Kosten, wie Kosten des Arbeitsausfalles, Krankengeldzahlungen der Krankenkassen, Kosten krankheitsbedingter Frühverrentungen und Einnahmeverluste sowie Zusatzausgaben der Rentenversicherung (Bödeker & Friedrichs, 2011, S. 2).
Eine in den Jahren 1979 bis 1981 durchgeführte Untersuchung zum Thema Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit konnte belegen, dass psychische Störungen häufiger auftreten, wenn „die zeitliche Struktur der Arbeit als restriktiv erfahren wird, bei konfliktreichen kollegialen und hierarchischen Beziehungen, einem hohen Grad an Monotonie und geringer Autonomie“ (Seibel & Lühring, 1982, S. 19). Treten solche psychischen Belastungen am Arbeitsplatz also länger auf, können psychische Störungen die Folge sein.
Auch die in den Jahren von 2004 bis 2009 durchgeführten Befragungen von 28.223 Mitarbeitern aus 147 Betrieben verschiedener Wirtschaftsbranchen nennen ähnliche psychische Belastungen am Arbeitsplatz:
Abb. 3: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz (modifiziert nach Zok, 2010, S. 59)