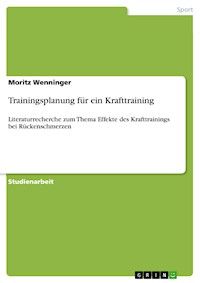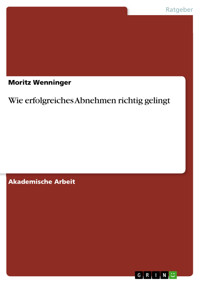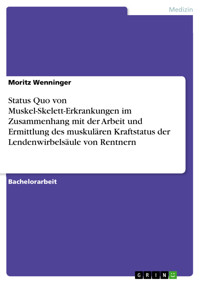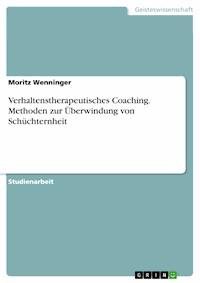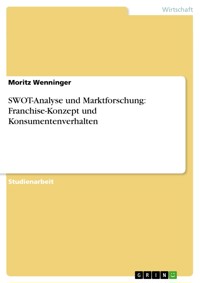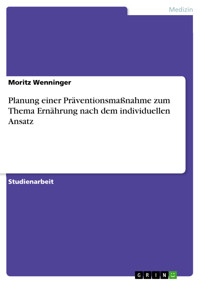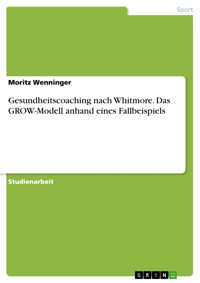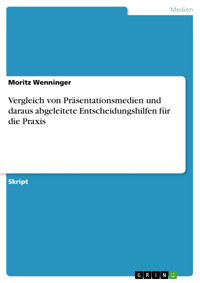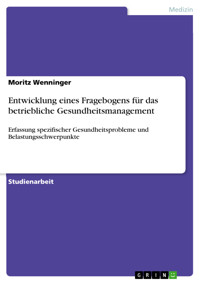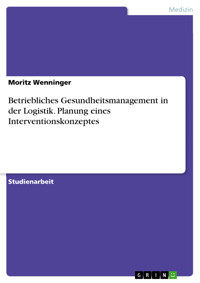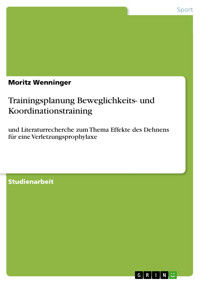
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Sport - Bewegungs- und Trainingslehre, Note: 1,2, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Herr B. ist bis auf sein Krafttraining zwei Mal die Woche jeweils 40 Minuten an geführten Maschinen, körperlich nicht sonderlich gefordert. Gerade sein Beruf als Bürokaufmann ist von einer sitzenden Tätigkeit geprägt. So beklagt er neben häufig auftretenden Nackenverspannungen eine gebeugte Sitzhaltung, auf die ihn seine Frau immer am Esstisch hinweist. Er ist 36 Jahre alt und wiegt bei einer Körpergröße von 180 cm 78 kg. Sein Blut - druck liegt im normalen Bereich (vgl. STEHBECK, 2009, S. 11). Als er vor drei Jahren Vater geworden ist, hat er das Fußballspielen aus zeitlichen Gründen aufgegeben, was er zuvor sieben Jahre lang 2 – 3 Mal je Woche für je - weils 90 Minuten betrieben hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Personendaten
2 Beweglichkeitstestung (vgl. REIß / ALBERS, 2012, S. 36ff.)
2.1 Testung der Brustmuskulatur (M. pectoralis major):
2.2 Testung der Hüftbeugemuskulatur (speziell M. iliopsoas):
2.3 Testung der Kniestreckmuskulatur (speziell M. rectus femoris):
2.4 Testung der Kniebeugemuskulatur (Mm. ischiocrurales):
2.5 Testung der Wadenmuskulatur (Mm. triceps surae)
3 Trainingsplanung Beweglichkeitstraining
4. Trainingsplanung Koordinationstraining
5 Literaturrecherche - Effekte des Dehnens im Hinblick auf eine Verletzungsprophylaxe
5.1 Studie 1: POPE / HERBERT / KIRWAN / GRAHAM
5.2 Studie 2: HARTIG / HENDERSON
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1. Personendaten
Zu Beginn dieser Trainingsplanung für das Beweglichkeits- und Koordinationstraining steht die Diagnose, um einen detaillierten Überblick über die zu trainierende Person zu bekommen.
Tab. 1: allgemeine und biometrische Daten
Herr B. ist bis auf sein Krafttraining zwei Mal die Woche jeweils 40 Minuten an geführten Maschinen, körperlich nicht sonderlich gefordert. Gerade sein Beruf als Bürokaufmann ist von einer sitzenden Tätigkeit geprägt. So beklagt er neben häufig auftretenden Nackenverspannungen eine gebeugte Sitzhaltung, auf die ihn seine Frau immer am Esstisch hinweist.
Er ist 36 Jahre alt und wiegt bei einer Körpergröße von 180 cm 78 kg. Sein Blutdruck liegt im normalen Bereich (vgl. STEHBECK, 2009, S. 11).
Als er vor drei Jahren Vater geworden ist, hat er das Fußballspielen aus zeitlichen Gründen aufgegeben, was er zuvor sieben Jahre lang 2-3 Mal je Woche fürjeweils 90 Minuten betrieben hatte.
Als Trainingsmotive nennt Herr B. die Reduktion seiner Nackenverspannungen und den Wunsch, eine aufrechte Sitzhaltung wahren zu können, sowie seine Koordination zu verbessern.
2 Beweglichkeitstestung (vgl. REIß / ALBERS, 2012, S. 36ff.)
Unter diesem Punkt soll mit Herrn B. ein manueller Beweglichkeitstest, in Anlehnung an Janda, durchgeführt werden. Hierbei werden folgende Muskelgruppen überprüft: Brustmuskulatur (M. pectoralis major), Hüftbeugemuskulatur (speziell M. iliopsoas), Kniestreckmuskulatur (speziell M. rectus femoris), Kniebeugemuskulatur (Mm. ischiocrurales), Wadenmuskulatur (Mm. triceps surae).
Zu erwähnen ist, dass diese Art der Testung keine vollständig objektiven Ergebnisse liefern kann, da die Erfahrung des Testleiters in erheblichem Maße mit eine Rolle spielt. Für eine optimale Durchführung sollte neben einer ausreichend breiten und langen, festen Untersuchungsbank, ein ruhiger, wohl temperierter Raum ohne Ablenkung zur Verfügung stehen. Weiterhin ist genug Zeit vorhanden um Herrn B. Zweck und Ablauf der Muskelfunktionsüberprüfung verständlich zu erläutern (vgl. JANDA, 2000, S. 8).
2.1 Testung der Brustmuskulatur (M. pectoralis major):
Herr B. begibt sich in Rückenlage auf die waagrecht stehende Liege, so dass die Liege mit dem Schultergelenk des zu testenden Armes abschließt.
Zur Beckenfixierung sind die Beine angewinkelt und die Füße bleiben in Kontakt zur Auflagefläche. Der Testleiter fixiert den Thorax durch leichten Zug mit der Hand in diagonaler Richtung von der zu testenden Seite weg. Der getestete Arm ist im Schultergelenk abduziert und nach außen rotiert sowie im Ellenbogengelenk in einem Beugewinkel von 90°.
Als Messbereich gilt die Position des Oberarmes zur Horizontalen.
Während der Testdurchführung achtet der Testleiter darauf, dass das Becken nicht abhebt und die LWS komplett in Kontakt zur Liege steht. Hilfreich ist hierbei die Anweisung, den Bauch leicht anzuspannen. Beide Arme werden getestet.
Erreicht der Oberarm die Horizontale, oder kann sogar durch leichten Druck seitens des Testleiters darunter bewegt werden, ist das Ergebnis positiv zu bewerten. Ein neutrales Ergebnis wird erzielt, wenn der Oberarm die Horizontale nicht erreicht, durch leichten Druck seitens des Testers aber schon.
Ein negatives Ergebnis liegt vor, wenn der Oberarm die Horizontale überhaupt nicht erreicht.
2.2 Testung der Hüftbeugemuskulatur (speziell M. iliopsoas):
Herr B. begibt sich in Rückenlage auf die Liege, wobei das Gesäß mit dem unteren Rand der Liege abschließt, so dass die Beine Überhängen.