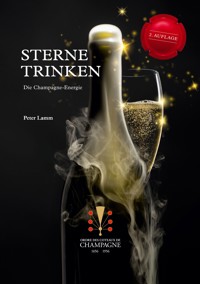
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sterne trinken Die Champagne-Energie Entdecken Sie persönlich, was den Champagne seit Jahrhunderten so unwiderstehlich macht: - Wie man ihn allein, zu zweit oder im Rahmen besonderer Anlässe perfekt genießt. - Wie man ihn verkostet und seine besonderen Qualitäten erkennt. - Wie man den Überblick über die insgesamt 11.000 Sorten gewinnt und behält. - Wie man ihn kultiviert und mit Speisen richtig kombiniert. - Wie man die besten Gläser findet und was man beim qualitätsbewussten Einkaufen, Lagern und Servieren beachten muss. Dieses Buch ist ein Kompendium für alle, die schon immer geahnt haben, dass dem Champagner und seiner Geschichte ein ganz besonderer Zauber innewohnt, und die nun das -Warum- erforschen wollen. Der Autor Ing. Peter Lamm ist ein Genießer guten Essens und Trinkens, der im Champagne ein ganzes Universum für das Vertiefen seiner Kennerschaft findet. Er ist Chambellan und Sénéchal im Ordre des Côteaux de Champagne Autriche und setzt mit diesem zweiten Buch fort, was er schon in seinem ersten sehr erfolgreich vermittelt hat: Inspirierende (Lebens-)Energie ist überall dort zu finden, wo die Freude am Entdecken und Genießen und der Spaß an der Begegnung mit Gleichgesinnten in eine Galaxie des Besonderen führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETER LAMM
Sterne trinken:
Die Champagne-Energie
EDITION ORDRE DES COTEAUX DE CHAMPAGNE
www.champagner-bollinger.de
„Ich trinke Champagne,
wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich alleine bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen.
Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken.
Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe.“
MADAME LILY BOLLINGER
Genuss ist die schönste Form, die Energiespeicher von Körper, Geist und Seele immer wieder neu zu füllen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
mein gesamtes (Berufs-)Leben lang habe ich mit und an der Energie gearbeitet: als Führungskraft, Innovator und Spezialist für den Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten. Deshalb trägt mein erstes Buch auch den programmatischen Titel „Meine Energie“.
Und es war gerade der Umgang mit den hochkomplexen Systemen von Fortschritt und Nachhaltigkeit, der mich zu den Quellen einer guten Energiebilanz für uns Menschen geführt hat: Zu den Fragen der Motivation, der Selbstwirksamkeit, des Durchhaltevermögens und zu jener natürlichen Intelligenz, die aus einer zunehmenden Unterscheidungsfähigkeit erwächst.
Essen und Trinken bewusst genießen zu lernen, gehört für mich zur Entwicklung und Verfeinerung unseres Lebens. Denn Essen und Trinken sind nicht nur Energiespender im körperlichen Sinn, sondern auch Träger unserer Kultur. Sie führen uns zu einer Lebensqualität, in der sich Individualität mit Entscheidungssicherheit und unbeschwerte Freude mit Erkenntnisgewinn und Erfahrung verbinden. Dafür möchte ich mich einsetzen.
Deshalb bin ich in unserer Bruder- und Schwesternschaft Ordre des Coteaux de Champagne aktiv und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben … für alle, die im Besonderen Herausforderung, Bereicherung und neue Perspektiven finden wollen.Der Champagne gilt völlig zu Recht als „der König der Weine“. Er verkörpert aber auch eine Philosophie und viele Grundsätze, die auch zu Perlen für unsere persönliche Lebensgestaltung werden können:
Die konsequente Ausrichtung auf Qualität.
Das Nützen, Schaffen und Akzeptieren von klaren Rahmenbedingungen.
Achtsamkeit und Handwerkskunst in allem, was wir tun.
Und nicht zuletzt eine klare Identität.
Champagne ist für mich der beste und lebendige Beweis dafür, dass letztlich nicht Größe und Volumen gewinnen werden, sondern Alleinstellung im Anspruch, Kreativität und das verbindend Gemeinsame.
Der Benediktinermönch und einer der Urväter des heutigen Champagne, Dom Pierre Pérignon, hat bei der Begegnung mit dem „Schaumwein“ seinen Brüdern zugerufen: „Brüder, kommt schnell, ich trinke Sterne!“.
Und genau diese Einladung gebe ich heute gern an Sie weiter, liebe Leserin und lieber Leser. Holen Sie sich diese Sterne!
Haut le Pomponne!
PETER LAMM
Autor, Dignitaire Ambassadeur, Ambassade d’Autriche
Wie ein Astronom die Daten, Bahnen und Ursprünge der Sterne erforschen und dokumentieren. Wie ein Sterndeuter die Geschichten und Mythen erzählen, die das Ganze prickelnd und genießbar machen. Und dem Ganzen noch eine gute Dosage persönliche Begeisterung beifügen – das ist die Cuvée, mit der Peter und ich die Leser(innen) dieses Buches dazu animieren wollen, Sterne zu trinken.
Peter Lamm und mich verbindet eine langjährige Freundschaft, und wir haben schon einmal ein erfolgreiches Buch miteinander gemacht: „Meine Energie“ ist die Verbindung seiner persönlichen Lebensgeschichte mit seinem Erkenntnisgewinn im richtigen Umgang mit den Energiequellen innerhalb und außerhalb unseres Planeten.
Bislang hatte ich mich noch sehr wenig mit dem Thema Champagne beschäftigt, aber schon nach den ersten Recherchen, Gesprächen und Erfahrungen war mir klar: Der Champagne, seine Herkunft, seine Qualitäten und sein richtiges Wahrnehmen und Genießen ergeben eine tolle Geschichte für Körper, Geist, Herz und Seele.
Peter und ich haben dieses Buch in leicht verständlicher Sprache geschrieben und erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder tiefschürfende Expertise. Es soll sie, liebe Leserin und lieber Leser, einfach begeistern wie ein Sternenhimmel, der uns immer wieder bewundernd staunen lässt.
Mit dem Ordre des Coteaux de Champagne steht zudem ein kraftvolles Raumschiff voller Freundinnen und Freunde bereit, mit dem wir uns gemeinsam auf eine „interstellare Reise“ begeben und jede Menge Spaß und Genuss dabei haben können.
Wie und wann Sie diese galaktische Expedition zu Ihrem persönlichen Lieblingsstern führen wird, ist offen.
Douglas Adams hat sein weltberühmtes Buch Per Anhalter durch die Galaxis vor allem einem Grundsatz gewidmet: Don’t panic. Er soll auch für uns gelten. Einfach loslegen. Auf zu den Sternen!
HARALD JESCHKE
Co-Autor von Sterne trinken.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Autor PETER LAMM
Co-Autor HARALD JESCHKE
Wie der Champagne zu den Sternen kam
Geweiht – Gekrönt – Geliebt – Gefeiert
Die Koordinaten der Entstehung
Terroir – Trauben – Methode – Garantien
Der Aufbruch in die Galaxis
Körper – Geist – Herz – Seel
e
Das Funkeln der Sterne
Wahrnehmen – Kultivieren – Genießen – Kaufen
Das Magnetfeld des Ordre des Coteaux de Champagne
Geschichte – Begegnungen – Insignien – Mitgliedschaft
Das Planetarium der Daten
Glossarium – Quellen und Mitwirkende
Die Sternstunden des Wissens
Quiz – Lösungen – Nachwort – Notizen
Alle nicht namentlich näher bezeichneten Aufnahmen stammen vom Autor. Sollten trotz sorgfältiger Recherchen unsererseits Rechte Dritter an Bildern Grafiken, Texten oder dergleichen bestehen, bitte ich um Kontaktaufnahme.
Wie der Champagne zu den Sternen kam
Bedeutung kann man nicht erfinden — Champagne-Laune wird zur Erlebnismarke für viele — Champ ist Kult — Gelegenheit, Anlass und Ereignis — Vom Luxus zur Kennerschaft: Der Unterschied, der den Unterschied macht — Champagne und Persönlichkeiten — Von den Mühen der Ebene zu den Sternen des Genießens: Strenge Rahmen und Bedingungen fördern Ideen und sichern Qualitäten.
VON ANFANG AN GEWEIHTER WEIN
Als der fränkische König aus der Dynastie der Merowinger, Chlodwig I., nach seiner siegreichen Schlacht von Zülpich zum katholischen Glauben konvertierte, war das eine Weichenstellung von historischer Tragweite. Chlodwig I. wird in der Folge nämlich Begründer des Frankenreiches und macht Paris zur Hauptstadt. Und es ist Saint Rémin, der Bischof von Reims, der den „berühmten Krieger“ um das Jahr 500 in die Glaubensgemeinschaft der Katholiken aufnimmt. Mit diesem Akt hat der Bischof aber viel mehr aus der Taufe gehoben als „nur“ den mächtigsten Herrscher und Heerführer seiner Zeit: Saint Rémin hat die Geografie der Champagne mit einer enormen politischen und historischen Bedeutung verbunden und diesem Weinbaugebiet eine neue Entwicklungsrichtung gegeben. Saint Rémin lebte inmitten von Weinbergen in der Nähe von Epernay und hatte sich – wie alle Geistlichen dieser Zeit – intensiv um den regionalen Weinbau gekümmert. Als nun dieser erste französische König Chlodwig I. an einem Abend um Weihnachten 496 gekrönt wurde, genossen die Weine der Champagne nun auch die Weihen seines hoffähigen Status.
VOM LAUF DER GESCHICHTE GEKRÖNT
Die Stadt Reims war schon damals das Herz der Region Champagne. Sie avancierte in der Folge für fast 1.000 Jahre (829-1825) zur Krönungsmetropole Frankreichs. In den opulenten Feiern rund um die Krönungen flossen die Weine der Champagne in Strömen; und sie wurden wegen ihres Geschmacks und ihrer Feinheit sehr schnell zum Sinnbild und zur Verkörperung des Elitären, Festlichen und Außergewöhnlichen. Man war in der Region sehr stolz auf die Champagneweine und bot sie deshalb auch Monarchen an, die in die Gegend kamen. Die „Mundpropaganda“ kam ins Rollen: Francois I. bekam mehrere Fässer und auch Maria Stuart; in wenigen Jahren hatten die Weine prominente „Evangelisten“ und angesehene Meinungsbildner und Förderer von Rang gefunden. Ludwig XIV. allein soll zu seiner Krönung hundert Pinten (ca. 55 Liter) Champagnewein geschenkt bekommen haben.
Seit dem XII. Jahrhundert war das Ansehen dieser Weine ständig weiter gewachsen, und „die Großen dieser Welt“ wählten sie als Krönung ihrer Feste.
Champagne zu kredenzen, war nicht nur Ausdruck von Kennerschaft und Qualitätsbewusstsein, sondern auch ein markantes Kennzeichen der Bedeutung und der Festlichkeit des Ereignisses.
Selbst die französischen Revolutionäre fanden Geschmack an ihnen und wählten ausschließlich Winzer aus der Champagne zu den „offiziellen Exklusivlieferanten“ ihres Festes der „Fédération“ am 14. Juli 1790 auf dem Champ des Mars.
Als der Wiener Kongreß vom September 1814 bis Juni 1815 tagte, ist die Allgegenwart der Champagne in aller Munde. Er wird zum ersten Bindeglied zwischen den Teilnehmern: „Der Geist prickelte wie der Wein aus der Champagne.“
www.occ-autriche.at
GEWEIHT, GEKRÖNT, GELIEBT, GEFEIERT
In den kommenden Jahren wurden das Aushandeln und Besiegeln wichtiger Verträge immer öfter von Champagne begleitet … und bisweilen auch behutsam „moderiert“. In dieser Zeit ist er wohl zum Sinnbild für die Bedeutung und die Wichtigkeit historischer Augenblicke und großer (politischer) Richtungsentscheidungen geworden. Der Champagne ist Gast bei großen königlichen Hochzeiten. Auf der Weltausstellung in Paris 1889 wurde ein 1.600 Hektoliter großes Eichenfass von Mercier ausgestellt, das heute in der Eingangshalle des Champagnehauses Mercier in Épernay steht. Und auch auf der Weltausstellung in Brüssel war die Champagne mehrfach präsent.
GLÜCK BESIEGELN UND DER ZAUBER DER ERSTEN MALE
Champagneweine und das Taufritual sind (seit Chlodwig I.) in den Herzen der Menschen untrennbar miteinander verbunden. Dass man in der Champagne bis heute die Lippen der Kinder bei der Taufe mit Champagne benetzt, weist eindrucksvoll auf die tiefe und höchst emotionale Bedeutung dieser Verbindung hin. Ob bei Schiffstaufen, Jungfernfahrten und -flügen, bei der Vereinigung der französischen und englischen Teilstrecken des Tunnels durch den Ärmelkanal, bei Pionierleistungen der Luft- und Raumfahrt oder zur Feier sportlicher Höhepunkte:
Champagne ist nicht nur ein Begleiter großer Ereignisse, sondern macht sie erst dazu.
Heute haben nicht nur „die Reichen und die Schönen“ ihren Lieblingschampagne, sondern auch immer mehr „Menschen wie du und ich“. Die Vielfalt des Angebotes, viele Flaschengrößen und eine gut gestaffelte Preisskala machen es möglich: Immerhin gibt es ja an die 11.000 Variationen von Champagne. Der Champagne verdankt vieler seiner Talente und seine schöpferische Wandlungsfähigkeit den Menschen, ihrer Kreativität, ihrer Erfahrung und der Feinfühligkeit ihrer Sinne: Vor allem aber dem geschulten Geruchsgedächtnis des Kellermeisters. Wichtig zu wissen: Geschmack- und Geruchsinn sind untrennbar miteinander verbunden.
Die Kunst, verschiedene Trauben und dann verschiedene Weine und sogar verschiedene Jahrgänge miteinander zu vermählen, wurde ab dem Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt. Diese „Verkostung“ ist der Fähigkeit eines Malers vergleichbar, verschiedene Farben zu einem erwünschten Ton zu vermischen. Der Kellermeister (chef de cave) kreiert Jahr für Jahr eine einzigartige Harmonie, die dem Stil des Champagnehauses, dem des Produzenten und auch dem der Marke entsprechen muss. Er „macht“ Marke, hält sie am Leben und sorgt für die Kontinuität ihrer Bedeutung und Marktstellung.
Voltaire in einer Satire Jahr 1736aus dem
Jeder Champagne ist eine eigene Kreation … und ist vielleicht schon deshalb „ein Bruder im Geist“ für die Seelen von Künstlern und Philosophen: „Von diesem frischen Weine ist der prickelnde Schaum ein glänzendes Ebenbild von uns Franzosen.“
Champagneweine lösen die Zunge, inspirieren zu Tönen und Rhythmen und lassen Wörter aufs Papier tropfen.
Der Autor Alexandre Dumas, zum Beispiel, gab an, immer ein Glas Champagne neben seinem Tintenfass zu haben und seiner Feder eine prickelnde Inspiration zu wünschen. Und als Richard Wagner den Misserfolg seines Thannhäuser in Paris verkraften musste, versöhnte er sich mit Frankreich nur dank dieses Weines, „der ihm ganz allein den Lebensmut zurückgibt.“
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben viele Maler Motive mit Champagne in ihre Bildkompositionen einbezogen. Aber auch die Stars und Starlets der damals aufkommenden Filmära machen ihre Liebe deutlich. Und (nicht nur) Hollywood bekräftigt sie bei jeder passenden Gelegenheit bis heute.
„Ich liebe Champagne, weil er den Eindruck vermittelt, dass es Sonntag ist und dass die besseren Tage sehr nahe sind“, sagte beispielsweise Marlene Dietrich. Und Marylin Monroe soll sogar in Champagne gebadet haben …
DIE BLÄSCHEN DES CHAMPAGNE: WAHRE PERLEN FÜRS GEMÜT
Was dem einen spaßig, faszinierend oder gar einzigartig vorkommt, ist für den anderen ein zentrales Identitätsmerkmal des Champagne und Ausdruck einer bestimmten und exakt definierten Qualität: Es geht um die magischen Bläschen, die sich minutenlang formen und verformen, die aufsteigen, tanzen, herumwirbeln und langsam wieder verschwinden. Perlen, die einfach magisch wirken und zauberhafte Symbole voller Grazie, Spiritualität und Überschwänglichkeit bilden. Sie sind so einladend anders und so anregend, dass man mit ihnen am liebsten spielen würde. Ein Vergnügen für alle Sinne.
Kaum vorstellbar, dass diese Bläschen noch zu Lebzeiten des Champagne-Pioniers Dom Pérignon (1638 bis 1715) ausgemerzt werden sollten. Glücklicherweise waren damals die Erkenntnisse der Gärungstechnik noch nicht so weit gediehen, als dass man ihr Auftauchen und ihre Entwicklung hätte kontrollieren oder stoppen können. Die Bläschen sind geblieben.
Im Laufe der Jahrhunderte haben die Hersteller von Champagne gelernt, die Bläschenbildung zu steuern und die Flaschengärung zu beherrschen. Heute weiß man: Die – völlig natürlichen – Bläschen entstehen durch das langsame Wirken hochwertiger und fein dosierter Gärungshelfer in den Flaschen, die in der Kühle der Kreidekeller liegen.
Dass dabei in ihnen hoher Druck entsteht, hat lange Zeit zu geborstenen Flaschen geführt und die Champagneweine als „Propfensprenger“ oder „Teufelsweine“ diskreditiert.
Ab dem Ende des 17.Jahrhunderts hat man auch diese Probleme – auch dank der Erkenntnisse von Louis Pasteur (1822-1895) – in den Griff bekommen und sogar eigene dickwandige und speziell geformte Glasflaschen entwickelt, die dem Druck im Inneren der Flasche standhalten.
SCHWERES GLAS FÜR DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS
Die Freidenker des 18. Jahrhunderts waren von der Leichtigkeit und der Verträglichkeit der Champagneweine entzückt, und vor allem die Damen genossen den „Springkorken-Wein“ bei kleinen Soupers im Palais Royal. Beim Maskenball von Paris im Jahr 1739 wurden nicht weniger als 1.800 Flaschen Champagne getrunken. Und Casanova erzählt in seinen Memoiren von der wichtigen Rolle, die die der Champagne bei seinen Verführungskünsten gespielt haben soll.
Abenteuerlustige Champagne-Hersteller bereisten „die ganze Welt“, um ihr Produkt bekannt, beliebt und begehrt zu machen. Die Ersten, die „ihren Champagne“ als absolutes „must“ gefordert haben, waren die Adeligen am englischen Hof. Und natürlich auch jene jungen Leute in auffälliger Kleidung, die Kirchen und Jahrmärkte unsicher machten, um aufzufallen … die Dandys.
Der russische Zar Alexander I. ließ Champagne aus Frankreich anlässlich der Militärparaden ebenso auffahren, wie man in Kalifornien und New York sang, tanzte und die Gläser im Rhythmus neuer Speisefolgen klingen ließ. Der Champagne hatte sich endgültig etabliert und sich den Ruf erworben, der ideale Wein für fröhliche und niveauvolle Veranstaltungen zu sein.
Als am Ende des 16. Jahrhunderts Verkehrsmittel wie die Eisenbahn neue Transportmöglichkeiten erschlossen, ist der „Champ“, wie ihn die Fans damals zu nennen pflegten, buchstäblich überall präsent, gefragt und verfügbar. Er ist gleich nach dem Ende des Krieges von 1870 populär geworden, und Feydeau, Offenbach und Strauss geben ihm in ihren musikalischen Werken Bühne und Auftritt. Das Champagne-Lied in der Fledermaus von Johann Strauss ist ebenso berühmt wie die Aufforderung, im dritten Akt von Verdis La Traviata das Glas Champagne zu erheben.
Während der Wilden Zwanziger Jahre gibt es auch bei den verrücktesten Events und Partys immer nur eine Bedingung fürs Mitmachen: Es musste Champagne geboten werden! Man sah und bestellte ihn überall, und neben den Attraktionen mit Elefanten, Pferden und Artisten sprudelt immer ein Brunnen mit dem „ König der Weine“.
CHAMPAGNE IST WIEDERGEWONNENE FREIHEIT
Als General Eisenhower im Jahr 1945 sein Hauptquartier in Reims einrichtet, ist es nur selbstverständlich, dass man die Befreiung Frankreichs mit Champagne feiert.
Man weiß und will es immer wieder erleben und bestätigt sehen: Champagneweine führen Menschen zusammen und garantieren ein fröhliches und unbeschwertes Zusammensein. Und was will man mehr in diesem 20. Jahrhundert des Wiederaufbaus, des Wandels und der Umbrüche? So fließt der Champagne bei der Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution, bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1998 und bei den Festlichkeiten um die Jahrtausendwende.
Der Genuss ist Programm: Unbeschwerte Entspannung und ein Start und Aufstieg aus den Mühen der Ebene zu den Sternen einer neuen Kennerschaft.
www.champagne.de
ZUSAMMEN- FASSUNG
DIE WICHTIGSTEN DATEN
DER GESCHICHTE DES CHAMPAGNE
www.champagne.de
OHNE CHAMPAGNE KANN ICH NICHT LEBEN, BEI EINEM SIEG VERDIENE ICH IHN, BEI EINER NIEDERLAGE BRAUCHE ICH IHN.
WINSTON CHURCHILL
01 Die Koordinaten der Entstehung
Einen Champagne erfolgreich zu produzieren, braucht heute viererlei Kompetenzen: Nachhaltigkeit, önologisches Wissen, handwerkliches Können und industriell-perfektionierte Kompetenz für Finish, Logistik und Marketing. Es beginnt beim optimalen Zusammenspiel von BODEN, KLIMA und MIKROKLIMA des ANBAUGEBIETES (Terroir) und geht über die Qualität der TRAUBEN und eine gesicherte Methode der Verarbeitung bis hin zu einer klaren und verständlichen Auszeichnung auf dem Etikett.
An diesen Koordinaten muss man sich orientieren und mit ihrer Hilfe auch die Position von Rebsorte und Geschmack genau verorten können. Das ist der Anspruch. Daran orientiert sich auch der Inhalt dieses Hauptkapitels.
In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:
Terroir: Boden, Klima, Anbaugebiete, Crus
Untergrund, Gesteinsauf bau
Die Arbeit am Weinberg
Die Weinlese von Hand
1. DAS TERROIR
Der Name Champagne (le champagne) bezeichnet das Wein- und Ackerland (lat. campus, das Feld) entlang des Marnetals ca. 150 km östlich von Paris und es umfasst mit 34.000 Hektar nur ca. 3 % der Weinbaufläche Frankreichs.
Wegen der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit ist diese Fläche stark gegliedert: 67,7 % der Ertragsfläche entfallen auf das Departement Marne, der Rest verteilt sich auf die Departements Aube (22,5 %), Aisne (9,3 %), Haute-Marne (0,2 %) und Seine-et-Marne (0,2 %).
AOC – Appellation d’ ContrôléeOrigine
Die Grenzen der AOC Champagne – AOC steht für Appellation d’ Origine Contrôlée – wurden im Jahr 1927 gesetzlich festgelegt. Sie gelten bis heute und wurden auf Basis der Weinbaugeschichte, aufgrund von Flurstrukturen und auf Basis bestehender Parzellen fixiert. Außerdem waren ab diesem Zeitpunkt nur mehr drei Rebsorten zugelassen:
Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay.
Zudem wurden Vorschriften für eine umfassende Qualitätssicherung in Kraft gesetzt:
Beschränkungen der Erträge pro Hektar und beim Keltern.
Der Einsatz bestimmter Rebschnitt-Methoden.
Vorgaben für das Anlegen von Weingärten in Bezug auf Höhe, Zwischenraum und Dichte der Rebstöcke.
Weinlese ausschließlich von Hand.
DIE CHAMPAGNE UMFASST VIER WEINBAUREGIONEN, IN DENEN JEWEILS EINE REBSORTE DOMINIERT:
99,7 % der Anbaufläche sind jenen drei Rebsorten gewidmet, die klimatisch gut angepasst sind. Sie und nur sie sind die Grundweine, die für das Herstellen von Champagne verwendet werden dürfen.
www.champagne.de
Die vier Regionen und Rebsorten
Region > Pinot Noir > Pinot Meunier > Chardonnay
www.champagne.de
DIE CHAMPAGNE IM STERNZEICHEN DER TERROIRS: EINE TRILOGIE VON KLIMA, BODEN UND UNTERGRUND
Terroirs beschreiben nicht nur geografisch abgegrenzte Gebiete, sondern stehen für einen äußerst komplexen Zusammenhang. Die Besonderheiten des Champagne-Anbaugebietes sind ja die eigentliche Ursache für die Einzigartigkeit der Weine und der legendären Cuvées, die sich daraus komponieren lassen.
Die Wirksamkeit des Zusammenspiels von Klima, Boden und Untergrund fällt zwar innerhalb des gesamten Weinbaugebietes sehr unterschiedlich aus; das raue Klima wird aber durch zwei geografische Merkmale ausgeglichen. Und dafür geben die Weinberge ihr Bestes:
D er Kreidegrund ermöglicht eine natürliche Drainage und Klimatisierung des Bodens.
Die hügelige Landschaft begünstigt eine maximale Sonneneinstrahlung.
„Die Kreidestücke im Boden reflektieren das Licht auf die Weinblätter. Unter einem ästhetischen Blickwinkel ist das ein verblüffendes Phänomen: es dämpft die Farben, mildert die Konturen und verleiht der Landschaft ein verschwommenes, unscharfes Aussehen, das an ein impressionistisches Gemälde erinnert.“
Patrick Forbes,
Champagne-Autor
www.champagne.de
Vier kleine Gebiete für ganz große Weine
Die Montagne de Reims, wo sich die Weinberge an den Hängen zwischen dem Plateau und den Tälern der Ardre und der Vesle im regionalen Naturschutzgebiet entlangschlängeln.
Das Marnetal, in dem die Weinhänge zu beiden Seiten der Marne aufsteigen und sie ihre Windungen von AŸ bis in die Aisne und sie über Châteaux-Thierry hinaus begleiten.
Die Côte des Blancs, deren Weinberge dem Verlauf der Felswand folgen, die von Norden nach Süden das Herz der Champagne, Epernay, mit den Hängen von Sézannais verbinden.
Die Côte des Bar und Montagne de Reims mit ihren sanft abfallenden Hängen zwischen Seine und Aube im Süden der Champagne. Eine friedliche Landschaft voll Harmonie.
Zusammenhang macht Sinn und Qualität
Rebsorte, Klima und die Bodenbeschaffenheit sind die bestimmenden Größen der Weinqualität. Das ist in der Champagne nicht anders als in allen anderen Weinbaugebieten der Welt. Anders ist hingegen die Achtsamkeit und die Akribie, mit denen in der Champagne das Zusammenspiel dieser Qualitätsfaktoren verfolgt werden. Zwar lässt das von ozeanischen Einflüssen geprägte Klima (10,5 °C Jahresdurchschnittstemperatur, ca. 700 mm Niederschlag und etwa 1.700 Stunden mittlere Sonnenscheindauer pro Jahr) die Trauben optimal reifen, aber die Böden sind sehr unterschiedlich:
Die 90 bis 300 Meter hohen Weinberge bestehen im Departement Marne überwiegend aus Belemnit-Kreide, das aus dem Mesozoikum stammt. Dieser Kreidegrund wurde aus versteinerten Tintenfischen gebildet, die vor 250 bis 65 Millionen Jahren gelebt haben. Der Kreidegrund kann unter einer dünnen Humusschicht bis zu 300 Meter dick sein.
Westlich von Reims herrscht kalkhaltiger Sand vor.
I m Departement Aube wächst der Wein auf kalkhaltigen Böden, die mit Lehm durchmischt sind.
Im Departement Aisne dominieren Mergelböden aus Kalk und Ton.
www.champagne.de
GRAND CRUS ODER PREMIER CRU: DIE LAGE ENTSCHEIDET
In der AOC Champagne werden in 319 Dörfern und Gemeinden (sogenannten Crus) Reben für die Herstellung von Champagne angebaut. Weil sie sich hinsichtlich Bodenbeschaffenheit, Mikroklima und anderer Qualitätskriterien unterscheiden, werden sie auf einer Skala von 80 bis 100 bewertet. Bei dieser Bewertung ist aber auch die angebaute Rebsorte von Bedeutung: nur Pinot Noir und Chardonnay können Grand Cru-Status erhalten. Premier Crus müssen zwischen 90 und 99 Punkte erreichen, um diesen Titel führen zu dürfen.
Grand Crus erhalten die höchste Bewertung
Zurzeit dürfen sich nur 17 Dörfer und Gemeinden mit etwa 10 % der Rebfläche diesem exklusiven Kreis zurechnen. Sie liegen alle im Departement Marne.
Premier Crus dürfen sich 42 Gemeinden nennen. Sie umfassen 15 % der gesamten Rebfläche.
Die Einstufung als Grand Cru oder Premier Cru ist nicht nur „Ehrensache“, sondern hat auch große wirtschaftliche Bedeutung für die Winzer. Der vom CIVC (Comité Interprofessionell du Vin du Champagne) festgesetzte Preis wird für Grand Cru zu 100 % bezahlt, für alle anderen Crus je nach ihrer Bewertung auf der Skala von 80 bis 100. Es steht dem Weinbauern aber frei, ihre Preise mit ihren Abnehmern direkt zu verhandeln.
Die Höhenf lüge des Außerordentlichen
Ein Champagne darf nur dann als Grand Cru oder Premier Cru bezeichnet werden, wenn alle Trauben aus Gemeinden der jeweiligen Bewertungsklasse stammen. Es können aber auch Trauben aus verschiedenen Gemeinden gleicher Bewertungsklasse sein.
Grand Cru und Premier Cru Champagne werden aus den besten Trauben hergestellt, die die Rebstöcke der Champagne zu bieten haben. Dabei ist ein Grand Cru etwas höher angesiedelt als ein Premier Cru. Stammt der Grundwein einer Champagne aus Grand-Cru bzw. Premier-Cru-Gemeinden, so darf das jeweils auf dem Etikett vermerkt werden.
Viele Spitzen-Cuvées der großen Champagnehäuser werden ausschließlich aus Grand-Cru-Lagen gewonnen.
Das Champagne-Konzept der Terroirs, in dem das komplexe Zusammenspiel von Boden, Klima und Mikroklima beachtet und gesteuert wird, ist eine permanente önologische und ökologische Herausforderung. Es ist immer ein Spiel mit vielen Unbekannten. Es ist und bleibt aber auch der beste Garant für Vielfalt und gleichbleibend hohe Weinqualität. Der Kreidegrund ist das große „Geheimnis“ …
Kreidegrund
Für die Rebstöcke ist Kreide ein idealer Wasser-und Wärmespeicher, und ihre Wurzeln reichen bis zu 10 Meter in den Kreidegrund hinein. Kreide speichert Feuchtigkeit (ohne stehende Nässe zu bilden) und gibt die Tageswärme in der Nacht an die Rebstöcke ab. Außerdem liefert der Kreideboden Mineralstoffe und Spurenelemente, die zum Geschmack des Champagne beitragen.
www.occ-autriche.at
Wie gut Kreide als „natürliche Klimaanlage“ funktioniert, beweisen auch die über 200 Kilometer langen und in einer Tiefe von 10 bis 40 Metern liegenden Lagerstollen der Champagnehäuser. In ihnen herrscht eine konstante Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100 % und eine gleichmäßige Kellertemperatur von 12 °C. Und weil Kreide Feuchtigkeit absorbiert, kommt es auch zu keiner Kondensation. Ideale Bedingungen. Der Ursprung der Kreidekeller (les crayères) geht auf die gallo-römische Zeit zurück. Für den Aufbau von Reims, damals Durocortorum, wurde unterirdisch Kreide abgebaut. Ab der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts wurden die Stollen erweitert und als Weinkeller genützt. Viele Champagnehäuser stehen auf einem unterirdischen Netz von Kellergängen.
DIE ARBEIT AM WEINBERG: EINE JÄHRLICHE HERAUSFORDERUNG BIBLISCHER DIMENSION
Die wichtigsten Faktoren, die den Ertrag eines Weinberges beeinflussen, sind Pflanzdichte und Rebschnitt.





























