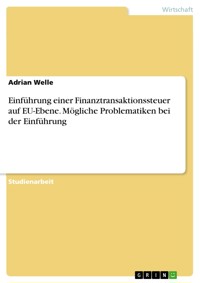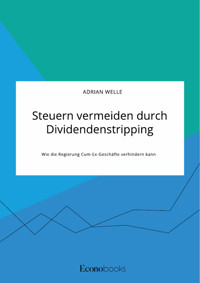
Steuern vermeiden durch Dividendenstripping. Wie die Regierung Cum-Ex-Geschäfte verhindern kann E-Book
Adrian Welle
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EconoBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 2018 wurde mit den sogenannten „Cum-Ex-Geschäften“ einer der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte offenbar: Jahrelang haben sich reiche Menschen ihre einmal gezahlte Steuer gleich mehrfach zurückerstatten lassen – und das auf Kosten der Steuerzahler. Die Rede ist hier von Dividendenstripping. Wie genau funktioniert Dividendenstripping? Handelt es sich bei diesen Verfahren um legale Steuervermeidungsmodelle oder um illegale Steuerumgehungspraktiken? Und wie kann der Gesetzgeber aktuell und zukünftig Praktiken wie die der „Cum-Ex-Geschäfte“ verhindern? Der Autor Adrian Welle beleuchtet die verschiedenen Modelle des Dividendenstrippings und erläutert wie diese Aktionären dabei helfen, Steuern zu sparen. Welle wirft einen kritischen Blick auf die Gesetzeslage in Deutschland und leitet Gegenmaßnahmen zur Vermeidung von Dividendenstripping ab. Aus dem Inhalt: - Steuerzahler; - Dividende; - Steuerstrafrecht; - Dividendenstichtag; - Steuerumgehung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Gang der Arbeit
2 Grundlegendes
2.1 Definition einer Aktie und deren Dividende
2.1.1 Aktien als Beteiligung an einem Unternehmen
2.1.2 Verwahrung von Aktien
2.1.3 Veräußerbarkeit/Handel von Aktien über die Börse und außerbörslich
2.1.4 Ausschüttung einer Dividende als Gewinnbeteiligung des Unternehmens
2.2 Besteuerung von Dividenden
2.3 Definition und Abgrenzung von Steuervermeidung, Steuerumgehung und Steuerhinterziehung
2.3.1 Steuervermeidung
2.3.2 Steuerumgehung
2.3.3 Steuerhinterziehung
3 Definition und Ablauf des Dividendenstrippings
3.1 Begriffserklärung
3.2 Varianten des Dividendenstrippings
3.2.1 Cum-Cum-Geschäfte
3.2.2 Cum-Ex-Geschäfte
4 Steuerrechtliche Würdigung
4.1 Zurechnungsproblematik
4.1.1 Zurechnungsproblematik bei Cum-Cum-Geschäften
4.1.2 Zurechnungsproblematik bei Cum-Ex-Geschäften
4.2 Missbrauchsverdacht
4.2.1 Missbrauchsverdacht bei Cum-Cum-Geschäften
4.2.2 Missbrauchsverdacht bei Cum-Ex-Geschäften
4.3 Zwischenergebnis
5 Reaktionen des Gesetzgebers
5.1 Zur Verhinderung der Cum-Geschäfte
5.2 Zur Verhinderung der Cum-Cum-Geschäfte
5.3 Zur Untersuchung der genutzten Modelle
6 Mögliche Maßnahmen zur zukünftigen Verhinderung ähnlicher Modelle
6.1 Einführung einer Anzeigepflicht für Steuergestaltungen
6.2 Einheitliche Besteuerung
7 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Urteilsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
sog. sogenannt
u. und
o. oder
ggf. gegebenenfalls
Vgl. Vergleich
o.V. ohne Verfasser
S. Seite
BT-Drucksache Bundestags-Drucksache
ca. circa
AG Aktiengesellschaft
bspw. beispielsweise
d.h. das heißt
AktG Aktiengesetz
DepG Depotgesetz
u.a. unter anderem
KWG Kreditwesengesetz
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
bzw. beziehungsweise
CCP Central Counterparty, Zentraler Kontrahent
JHV Jahreshauptversammlung
i.d.R. in der Regel
EStG Einkommensteuergesetz
Abs. Absatz (in Verbindung mit Gesetzesnormen)
S. Satz (in Verbindung mit Gesetzesnormen)
u.U. unter Umständen
AO Abgabenordnung
i.e.S. im eigentlichen Sinne
z.B. zum Beispiel
OTC Over-The-Counter
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
OGAW-IV Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Nr. Nummer (in Verbindung mit Gesetzesnormen)
Mrd. Milliarden
o.g. oben genannt
LK Leerkäufer
LV Leerverkäufer
bzgl. bezüglich
i.V.m. in Verbindung mit
i.S.d./v. im Sinne des/von
BFH Bundesfinanzhof
BMF Bundesministerium der Finanzen
FG Finanzgericht
EuGH Europäischer Gerichtshof
n.h.M. nach herrschender Meinung
BdB Bundesverband deutscher Banken
FGO Finanzgerichtsordnung
InvStRefG Investmentsteuerreformgesetz
PUAG Untersuchungsausschussgesetz
UA Untersuchungsausschuss
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
o.Ä. oder Ähnliches
1 Einleitung
1.1 Fragestellung
Am 18. Oktober 2018 veröffentlichte das Recherchezentrum Correctiv[1] unter dem Titel „The Cum-Ex-Files“ seine Recherchen über die Nutzung spezieller Wertpapiergeschäfte zur (möglicherweise illegalen) steuerlichen Gestaltung.[2] Bereits vor der Veröffentlichung gab es Medienberichte zu den Vorgängen, nach der Veröffentlichung war das mediale Echo in Deutschland dann sehr groß. So sprach unter anderem die Tagesschau in einem Beitrag vom 18. Oktober 2018 vom „Angriff auf Europas Steuerzahler“[3], die FAZ von „jahrelangen Steuerausfällen in Milliardenhöhe durch dubiose Aktiengeschäfte“[4] und Die Zeit sah gar den „größten Steuerraub in der deutschen Geschichte“[5] aufgedeckt. Doch worum ging es bei den öffentlich gewordenen Praktiken genau? Sog. „Cum-Ex-Geschäfte“ beschreiben (stark zusammengefasst) den Handel mit Aktien kurz vor und nach dem sog. Dividendenstichtag einer Aktiengesellschaft und daraus resultierenden Steuerzahlungen, welche ggf. zu Unrecht mehrfach vom Finanzamt erstattet wurden.[6] Das Urteil in den Medien war dahingehend zu deuten, dass durch das illegale Handeln einiger Banken und Finanzmarktteilnehmer[7] dem Finanzamt, und damit auch dem Steuerzahler, ein immenser Schaden entstanden sei. Die Vorgänge zu den Cum-Ex-Geschäften an sich waren jedoch schon vor Veröffentlichung der „Cum-Ex-Files“ bekannt. So befasste sich unter anderem ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss zwischen 2016 und 2017 mit „Gestaltungsmodellen zu sog. Cum-Ex-Geschäften“.[8]
Neben den Cum-Ex-Geschäften rückten auch die sog. „Cum-Cum-Geschäfte“ in den medialen Fokus[9], die das Ziel haben, Steuererstattungen für Nicht-Erstattungsberechtige nutzbar zu machen. Diese beiden Subvarianten werden in der vorliegenden Arbeit unter dem Oberbegriff „Dividendenstripping“ zusammengefasst.
Zielsetzung dieser Arbeit ist es, dem Leser die genutzten Modelle zu erläutern und verständlich zu machen, auch anhand grundlegender Informationen zu Aktien, Dividenden und deren Besteuerung. Nachdem die Analyse der genutzten Modelle abgeschlossen ist, stellt sich die Frage, wie die Vorgänge steuerrechtlich zu bewerten sind. Handelt es sich wirklich um einen massenhaft genutzten Steuerbetrug, wurde eine Gesetzeslücke ausgenutzt oder waren die Praktiken ganz legal? Zudem stellt sich die Frage, ob diese oder ähnliche Gestaltungen durch gesetzgeberische Maßnahmen (aktuell und in Zukunft) zu verhindern sind.
1.2 Gang der Arbeit
Diese Arbeit soll beim Leser in einem ersten Schritt die Grundlagen zum Verständnis der genutzten Modelle schaffen. Dazu wird in Kapitel 2 grundsätzlich erklärt, was eine Aktie überhaupt ist, wie diese Aktien gehandelt und verwahrt werden. Der für diese Arbeit zentrale Begriff der Dividende soll genauer erläutert und danach die Besteuerung dieser Dividenden aufgezeigt werden. Für die spätere Bewertung der genutzten Modelle ist es zudem notwendig, dass in diesem Kapitel eine Abgrenzung der Begriffe Steuervermeidung, Steuerumgehung und Steuerhinterziehung stattfindet.
In Kapitel 3 wird dann spezifisch auf die häufig genutzten Varianten des Dividendenstrippings eingegangen. Nach einer allgemeinen Definition des Begriffs werden die Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte in ihren einzelnen Schritten näher erläutert und in ihrer komplexen Zielsetzung analysiert.
Eine steuerrechtliche Würdigung der Modelle soll dann in Kapitel 4 folgen. Hierzu sollen sowohl die Cum-Ex- als auch die Cum-Cum-Geschäfte getrennt voneinander anhand ausgesuchter Expertenmeinungen und ergangener Rechtsprechung untersucht werden.
Im Anschluss an die steuerrechtliche Würdigung soll in Kapitel 5 genauer beleuchtet werden, ob der Gesetzgeber auf die möglicherweise problematischen Modelle aufmerksam geworden ist und ob dementsprechend Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Wenn ja, sollen diese Maßnahmen bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden.
Aufbauend auf dieses Kapitel sollen in Kapitel 6 mögliche neue Gegenmaßnahmen formuliert werden und überprüft werden, ob diese Maßnahmen ggf. wirksamer als die bisher getroffenen Maßnahmen seien könnten.
Diese Arbeit abschließend soll in Kapitel 7 ein Fazit gezogen werden, in dem die gewonnen Erkenntnisse dem Leser verdichtet aufgeführt werden sollen und die Eingangsfragen bzgl. der Legalität bzw. Verhinderung solcher Modelle noch einmal aufgegriffen werden.
2 Grundlegendes
2.1 Definition einer Aktie und deren Dividende
2.1.1 Aktien als Beteiligung an einem Unternehmen
In Deutschland firmieren ca. 15.000 Unternehmen als Aktiengesellschaft (kurz: AG)[10], bei denen durch die Ausgabe von Aktien das (Mit-)Eigentum auf viele Aktionäre verteilt ist.
Als Anteilseigner hat der Aktionär bestimmte Rechte gegenüber der Aktiengesellschaft, die sich in die Mitgliedschaftsrechte (bspw. Teilnahme/Stimmrecht an der Jahreshauptversammlung) und die Vermögensrechte (bspw. Anspruch auf Gewinnbeteiligung/Liquidationserlös) aufteilen, von denen die wohl wichtigsten das Stimmrecht, das Recht auf Liquidationserlös und das Recht auf Gewinnbeteiligung (Dividendenanspruch) sind.[11]
Das Stimmrecht[12] beschreibt das Recht der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung der AG an Beschlüssen mitzuwirken und über diese auch abzustimmen.[13]
Das Recht auf Liquidationserlös ergibt sich daraus, dass der Aktionär als Anteilseigner des Unternehmens auch das unternehmerische Risiko mitträgt, d.h. er im Falle der Insolvenz bzw. Liquidation mithaften muss, allerdings begrenzt auf die Höhe seiner Einlage in Höhe seines Aktienbestands.[14] Im Rahmen der Liquidation wird das Vermögen des Unternehmens veräußert Verbindlichkeiten bedient, ein verbleibender Überschuss wird als Liquidationserlös an die Aktionäre verteilt. [15]
Der Dividendenanspruch ist für die vorliegende Arbeit sicherlich das bedeutsamste Merkmal einer Aktie und wird in 2.1.4 näher erläutert.
2.1.2 Verwahrung von Aktien
Wie bereits beschrieben erfolgt bei einer AG die Verbriefung des Miteigentums über die ausgegebenen Aktien. Historisch gesehen haben AGs und Aktien eine Vergangenheit, die bis in die Tage der Industrialisierung zurückreichen.[16] Zu dieser Zeit war es üblich, dass die einzelnen Aktien in Form von Urkunden ausgestellt wurden (sog. „Effekten“[17]) und an die Aktionäre ausgegeben wurden. In der heutigen Zeit ist die physische Auslieferung von Effekten an den Aktionär eher selten geworden. Grund dafür ist, wie in vielen Bereichen, der technische Fortschritt und die zunehmende Digitalisierung. Auch kann lt. § 10 Abs. 5 AktG die AG in ihrer Satzung verfügen, dass die einzelnen Aktionäre keinen Anspruch auf Verbriefung ihrer individuellen Anteile haben bzw. diesen Anspruch einschränken.
Heutzutage wird häufig eine sog. „Sammelurkunde“ ausgestellt, die die Rechte der einzelnen Aktionäre sammelverbrieft.[18] Die häufigste Form der Sammelurkunde ist die sog. „Globalurkunde“, bei der die Aktionäre nach §§ 9a Abs. 2, 6 Abs. 1 S. 1 DepG Miteigentum an ihr erlangen. Die Verwahrung dieser Globalurkunde erfolgt bei einer Wertpapiersammelbank[19], in Deutschland ist dies die Clearstream International S.A. (kurz: Clearstream). Die einzelnen Aktionäre wiederum unterhalten keine direkte Geschäftsverbindung zu Clearstream sondern haben bei ihrer jeweiligen Hausbank ein Depotkonto, der Depotbank.[20][21] Clearstream teilt somit die jeweiligen Rechte zuerst an die Depotbanken auf, die dann spezifisch die einzelnen Rechte an der Globalurkunde in die jeweiligen Aktionärsdepots verbuchen.[22]
Neben der Verwahrung hat die Depotbank auch noch andere Aufgaben zu leisten, u.a. den Aktionären Steuerbescheinigungen über gezahlte Kapitalertragsteuer (bspw. auf Dividenden) zur Vorlage beim Finanzamt auszustellen. [23][24]
2.1.3 Veräußerbarkeit/Handel von Aktien über die Börse und außerbörslich
Warum wird in Aktien investiert? Grundsätzlich lassen sich auf diese Frage viele verschiedene Antworten geben. Man kann als Aktionär, wie bereits beschrieben über die Geschicke des Unternehmens (im begrenzten Maße[25]) mitentscheiden.[26] Ökonomisch profitiert der Aktionär von seinem Recht auf eine Gewinnausschüttung bzw. Dividende, welches für ihn einen laufenden Ertrag darstellt.[27] Zum anderen können bei Aktien Kursgewinne[28] durch die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage entstehen, die beim Verkauf der entsprechenden Aktie realisiert werden können.[29]
Ein Ort, an dem Angebot und Nachfrage nach Aktien zusammengeführt ist die Börse.[30] Die Börse ermöglicht es, dass Kauf- und Verkaufsaufträge für Aktien an einem zentralen Ort gebündelt zusammengeführt werden.[31] Damit ein Wertpapier an einer Börse handelbar ist, muss seine Fungibilität bzw. Vertretbarkeit gegeben sein[32], durch die häufige Ausgabe von sog. „Inhaberaktien“ [33] ist die Fungibilität von Aktien in Deutschland in hohem Maße erfüllt, denn diese verbriefen alle die selben Rechte und Pflichten. [34]
Früher wurden Geschäft zwischen Käufern und Verkäufern auf dem Börsenparkett von Maklern[35] zusammen geführt bzw. vermittelt.[36] Mittlerweile wurde diese Art des Handels durch elektronische, computergestützte Systeme abgelöst, bei denen ein sog. „Zentraler Kontrahent“ (kurz: CCP) eine wichtige Funktion übernimmt. Aktionäre geben ihre jeweiligen Orders[37] hier direkt in das Handelssystem der jeweiligen Börse ein, bspw. über das Internet. Die Verkaufsabwicklung an der Börse verläuft grundsätzlich anonym, der CCP übernimmt (vereinfacht gesagt) eine Mittlerfunktion zwischen den Parteien, indem er sowohl mit dem Käufer als auch dem Verkäufer im ersten Schritt eine Vertragsbeziehung eingeht und als Vertragspartner bekannt ist um dann im zweiten Schritt das eigentlich gewünschte Geschäft durchzuführen.[38]
Eine Börsentransaktion wie der Kauf/Verkauf einer Aktie ist ein sehr technischer Vorgang, der sich in vier Schritten vollzieht: Der Order (schuldrechtliches Geschäft), dem Matching (Transaktionsabgleich), dem Clearing (Verrechnung der einzelnen Geschäfte) und dem Settlement (dingliches Erfüllungsgeschäft)[39]